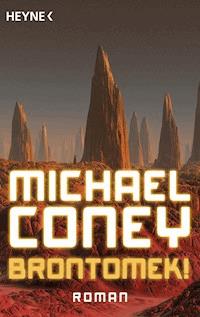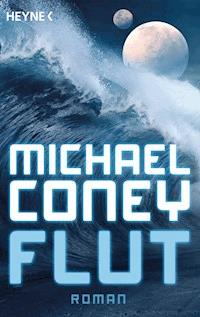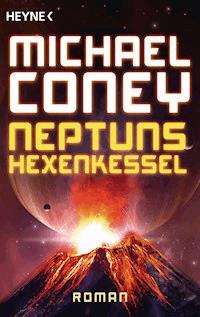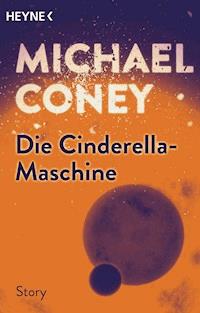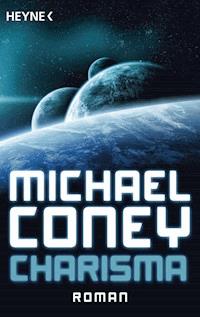
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Doppelgänger
Eine geheime Forschungsstation in Cornwall entdeckt, dass es eine ganze Reihe von parallelen Welten gibt. In jeder dieser Welten agieren dieselben Menschen in nahezu identischen Situationen. Nur die individuellen Handlungen unterscheiden sich, und deren Ergebnisse müssen in den anderen Welten nachgeholt werden. John Maine verliebt sich in eine wunderschöne Frau, doch sie stirbt bei einem Unfall. Um sie in einer der Parallelwelten wiederzufinden, meldet er sich freiwillig für das Experiment – und findet heraus, dass auch er in der Parallelwelt bereits tot ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
MICHAEL CONEY
CHARISMA
Roman
Das Buch
Eine geheime Forschungsstation in Cornwall entdeckt, dass es eine ganze Reihe von parallelen Welten gibt. In jeder dieser Welten agieren dieselben Menschen in nahezu identischen Situationen. Nur die individuellen Handlungen unterscheiden sich, und deren Ergebnisse müssen in den anderen Welten nachgeholt werden. John Maine verliebt sich in die wunderschöne Susanna, doch sie stirbt bei einem Unfall. Um sie in einer der Parallelwelten wiederzufinden, meldet er sich freiwillig für das Experiment – und findet heraus, dass auch er in der Parallelwelt bereits tot ist …
Der Autor
Titel der Originalausgabe
CHARISMA
Aus dem Englischen von Hans Maeter
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1975 by Michael Coney
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Für Jane und Lady Margaret -
und Keith Roberts,
der Gottes Land ebenfalls liebt …
Und für Daphne,
die Pallahaxi Browneyes ist
1
Ich ließ die anderen in der Kabine sitzen und trat durch die breite Tür auf das überdachte Achterdeck. Das Boot glitt ruhig über das leicht bewegte Wasser hinweg; wir fuhren parallel zu den etwa eine Viertelmeile entfernten Klippen. Die flachen Wellen rollten diagonal zu unserem Kurs und klatschten aufgischtend gegen die zerklüfteten, schwarzen Felsen. Ich hörte wieder das laute Lachen Mellors’ aus der Kabine; das Sopran-Kichern, von dem es begleitet wurde, stammte von seiner Frau.
Copwright steuerte die Hilfskontrollen in der Kabine; in diesen Gewässern konnte nicht viel passieren – doch würde ich ihn ablösen, wenn wir die Zufahrt von Falcombe erreichten. Ich warf einen Blick durch das Fenster und sah ihn bequem in seinem Sessel sitzen; er beteiligte sich an der Konversation und blickte nur gelegentlich auf den Radarschirm oder durch die Frontscheibe. Ich habe noch nie einem Mann getraut, der Gin trinkt. Er hatte mir den Rücken zugewandt; neben ihm saß Jean Longhurst mit einem Martini in der Hand.
Ihnen gegenüber saßen Mellors und seine Frau. Mellors erzählte irgendeine Anekdote; ich konnte nicht verstehen, was er sagte, doch schien die Geschichte zumindest ihn zu amüsieren. Immer wieder gestikulierte er mit seinem Glas, und einmal sah ich ihn ein paar Tropfen des Drinks auf das Kleid seiner Frau verschütten. Dorinda Mellors blickte ihren Mann strafend an und tupfte die Flecken mit einem Taschentuch ab, während er, der nichts davon bemerkt hatte, weitersprach.
Pablo stand etwas abseits und beobachtete sie – bei der Gruppe, doch nicht Teil von ihr. Er war wie ich in der eigenartigen Situation, die Mellors weitaus besser zu kennen als Alan Copwright oder Jean Longhurst, fühlte sich in ihrer Gesellschaft jedoch nicht wohl, weil ihre Beziehungen rein geschäftlich waren. Ich fragte mich, warum die Mellors so flüchtige Bekannte mitgenommen hatten; Alan und Jean lebten erst seit kurzer Zeit in Falcombe und hatten die Mellors gestern kennengelernt, an der Bar des Falcombe Hotels.
Ich wandte mich um und sah das Wasser rasch unter dem Rumpf der Hausyacht fortgleiten. Auf einem Tisch neben mir lag die Angelschnur mit ihrem Haken; einem Impuls folgend warf ich sie über Bord und beobachtete, wie die Leine sich straffte, als der kleine, torpedoförmige Haken seine Position etwa zwanzig Fuß hinter dem Heck und vier Fuß unter der Wasseroberfläche einnahm. Ich hörte ein Geräusch hinter mir; Pablo kam heraus und trat neben mich an die Reling.
»Alles in Ordnung da drin?«, fragte ich.
»Der Alte scheint ganz glücklich zu sein. Ich glaube, er hat ein Auge auf Jean geworfen.«
»Jesus!«
»Schon in Ordnung. Er macht das sehr unauffällig. Ich glaube nicht, dass Dorinda etwas gemerkt hat.«
Zur Zeit wollten weder Pablo noch ich, dass irgendetwas geschah, das Mellors von dem derzeitigen Geschäft ablenkte. Die nächsten Tage waren entscheidend.
Bis vor vier Monaten hatte ich bei Pablo als Verkäufer gearbeitet; er hat eine kleine Bootswerft bei Wixmouth. Im vergangenen Juni hatte ich gerüchteweise gehört, dass Wallace Mellors, ein reicher Hotelier in Falcombe, interessiert wäre, eine Flotte von Hausyachten zu kaufen, als Ergänzung zu seinen verschiedenen anderen Unternehmen in der Gegend. Soweit ich die Situation überblickte, bestanden keinerlei Schwierigkeiten für den Betrieb der Boote, da Mellors den Stadtrat – genauer gesagt, die ganze Stadt – in der Tasche hatte. Es ging lediglich darum, den Mann davon zu überzeugen, dass die Sache sich für ihn lohnen würde. Ich war sicher, dass mir das gelingen würde. Ich hatte früher Hotels geleitet, Hausyachten auf Charter-Basis geführt und sehr überzeugende Artikel für Yacht-Magazine geschrieben; deshalb glaubte ich genau der richtige Mann zu sein, um Mellors Wellenlänge zu finden.
Pablo betreibt seine Werft auf einer bescheidenen Basis. Er hat etwa ein Dutzend Mitarbeiter und stellt Standard-Fiberglasrümpfe her, in die er eine Hover-Turbine installiert und eine Kabine nach den Wünschen des Kunden. Der fertige Artikel ist geräumig genug, um darauf leben und bei fast jedem Wetter mit fünfzig Meilen fahren zu können. Ein Abschluss wie dieser – es ging dabei um etwa zwölf Boote – würde Pablo Arbeit für den ganzen Winter geben und einen schönen Profit.
Also hatte ich Mellors aufgesucht und wohnte auf seine Rechnung im Falcombe Hotel, das ihm gehörte. Wir schienen vom ersten Tag an blendend miteinander auszukommen, und als ich meine Erfahrungen in der Hotelbranche erwähnte, wurde er sehr interessiert. Er hatte gerade seinen Manager gefeuert und suchte einen Ersatz. Und nicht nur das, er brauchte auch jemand, der sich um die Hausyachten kümmerte, wenn sie geliefert wurden – inzwischen hatte ich ihn davon überzeugen können, dass es sich lohnte, die Sache ernsthaft zu überdenken.
Kurz gesagt: Ich stieg bei Pablo aus und trat dem Mellors-Imperium bei. Alle Gewissensbisse, die ich gehabt haben mag, wurden mehr als aufgewogen von meiner Freude, den Bootsvertrag an Land gezogen und Pablo zu einem fetten Profit verholfen zu haben. Pablo nahm die Sache philosophisch auf und war bereit, mir trotz meines Ausscheidens die übliche Provision zu zahlen, da ich die Verkaufsverhandlungen vor meiner Kündigung begonnen hatte. Er trug mir nichts nach. Also schienen alle glücklich und zufrieden zu sein.
Doch die Zeit verging, und die Verhandlungen zogen sich in die Länge, und Pablo und ich wurden zunehmend unruhiger. Mellors schien nicht bereit, irgendetwas schriftlich festzulegen. Um endlich zu einem Abschluss zu kommen – Mellors hatte auf baldige Lieferung gedrängt – brachte Pablo elf Boote, die eigentlich für andere Kunden bestimmt waren, nach Falcombe und verankerte sie direkt unter Mellors’ Nase hinter dem Falcombe Hotel. Sie alle (deutete Pablo damit an, ohne es auszusprechen) können mit einem Federstrich dir gehören. Doch inzwischen war es September geworden und die Touristen-Saison vorüber; also lag es logischerweise in Mellors Interesse, den Kauf bis zum nächsten Frühjahr aufzuschieben.
Währenddessen wohnte ich an Bord einer der Yachten, arbeitete Anzeigentexte aus und traf die grundlegenden Vorbereitungen für das Verchartern der Boote in der kommenden Saison, führte das Falcombe Hotel und erhielt dafür keine andere Vergütung als freies Essen und Trinken. Meine einzigen Einkünfte stammten aus gelegentlichen Beiträgen für Yacht-Zeitschriften. Aber Mellors hatte mir für den Beginn der nächsten Saison ein hohes Gehalt versprochen, neben einer Beteiligung an den Profiten von der Vercharterung der Hausyachten.
Also durfte ich es mir mit ihm nicht verderben, sonst war die Arbeit der letzten Monate nur Zeitverschwendung gewesen.
»Wovon sprechen sie dort drinnen?«, fragte ich.
»Der alte Mann ist gerade damit fertig geworden, von sich selbst zu erzählen. Das heißt« – ein Unterton von Bitterkeit trat in Pablos Stimme – »er ist damit fertig geworden, ihnen zu erzählen, wie er ins Charterboot-Geschäft eingestiegen ist und nun elf Hausyachten besitzt. Jetzt versucht er, von den anderen etwas über die Forschungsstation herauszubringen.«
»Damit wird er nicht weit kommen. Die Leute von der Station sind ziemlich schweigsam.«
»Copwright hatte ein paar Drinks.«
»Aus welchem Grund sollte Mellors sich für die Station interessieren? Da gibt es doch keine Gelegenheit, Geschäfte zu machen, oder?«
»Ich habe den Eindruck, dass die Station auf einem Grundstück errichtet worden ist, das ihm gehört und der Pachtvertrag einige Unklarheiten enthält. Er deutete an, dass er die Pacht jederzeit erhöhen könne, und auf jeden beliebigen Betrag.«
»Was hat denn das mit Copwright und Jean zu tun?«, fragte ich. »Die sind doch nur Angestellte. So etwas sollte Mellors mit dem Boss ausmachen, diesem … wie heißt er noch?«
»Stratton, glaube ich.«
»Oh …« Ein silbriges Aufblitzen unter der Wasseroberfläche ließ mich aufblicken. Ich nahm die Fischpistole vom Tisch und drückte auf einen Knopf. Ein Stromstoß fuhr durch die Angelschnur. Eine Makrele schnellte silbern glänzend aus dem Wasser.
Ich hob die Pistole und drückte ab. Der Rückstoß der Waffe riss meine Hand ein wenig nach oben. Die Makrele zuckte mitten im Sprung zusammen und fiel ins Wasser; anstatt zu versinken wurde sie an der Oberfläche mitgeschleppt und schlug das Wasser zu schäumender Gischt. Ich schaltete die automatische Rolle ein, und der Fisch wurde herangezogen. Ich schwang ihn über die Reling, und er fiel zappelnd an Deck.
Pablo bückte sich und löste behutsam den winzigen, mit Widerhaken bewehrten Bolzen aus der Flanke des Fisches, dann zog ich die dünne Nylonschnur und den daran befestigten Bolzen in die Pistolenmündung zurück. Pablo hob den Deckel vom Eimer und warf die Makrele hinein, wo ihr kräftiges Zappeln bei den anderen Fischen reflexhafte Zuckungen auslöste. Er legte den Deckel wieder auf und grinste mich an.
»Das war ein verdammt guter Schuss. Ich wusste gar nicht, dass du dich in Gegenwart von Frauen unsicher fühlst.«
»Ich auch nicht.« Pablos rasche Themenwechsel überraschten mich gelegentlich noch immer, obwohl ich ihn seit Jahren kannte.
»Die Pistole ist natürlich ein Ersatz. Nein, keine Einwände. Ich weiß es.« In seinen müden Augen lag ein Schimmer von Mitgefühl, als er mich anblickte. Ich wusste, was jetzt kommen würde: eine Kostprobe seiner hausgemachten Philosophie. »Ich habe dasselbe Problem«, sagte er. »Und in letzter Zeit hat es sich noch verschlimmert. Ich bekam einen Minderwertigkeitskomplex dazu. Ich konnte keinem Mädchen mehr ins Gesicht sehen. Also habe ich mir eine Kamera gekauft, eine Minolta. F 1.4-Linse, automatische Dies und Jenes, ein Traum von Perfektion. Aber war ich nun zufrieden?«
»Nun?«
»Nein. Das Ding hat meine Sehnsucht nach Virilität nicht erfüllen können. Jedes Kind konnte damit umgehen – oder, noch schlimmer, eine Frau. Es sah weibisch aus – besonders, wenn ich das Objektiv herausnahm und ein rundes Loch an der Stelle zurückblieb, wo sonst das F 1.4 saß.«
Er seufzte und starrte eine Weile auf das Wasser. Gedämpftes Lachen drang aus der Kabine: die Party lief gut. Die Klippen glitten vorüber. Weit hinter uns sah ich das dreieckige Segel einer Yacht, die gegen den Wind auf Falcombe zukreuzte.
Pablo fuhr fort: »Aber diese austauschbaren Objekte sind eine wunderbare Sache. Ich ging zum Geschäft zurück und kaufte mir ein 300er Teleobjektiv – ein langes Rohr – und montierte es anstelle des anderen ins Kameragehäuse. Dann hängte ich mir den Apparat um den Hals, so dass er auf meinem Bauch hing und das Teleobjektiv nach vorn ragte. So schlenderte ich die Uferpromenade von Wixmouth entlang und beäugte die Mädchen.«
»Hat es etwas genützt?«
»Nein«, sagte er traurig. »Sie hielten mich nur für einen Strandfotografen.«
Dick Orchard trat zu uns an die Reling. Ich hatte völlig vergessen, dass er an Bord war. Er besaß diese gewisse ruhige Zurückhaltung, die im rauen Lebenskampf nicht immer zum Vorteil gereicht. Er war klein, grauhaarig und alt und besaß ein Kapitänspatent. Pablo hatte ihn angeheuert, um die Hausyachten von Wixmouth nach Falcombe zu bringen und er war noch eine Weile geblieben, um sich zu versichern, dass es keine seemännischen oder technischen Schwierigkeiten gab.
Er hob den Deckel vom Eimer und musterte die Fische. Dann nahm er mir schweigend die Fischpistole aus der Hand und betrachtete sie. Er warf mir einen scheuen Blick zu, als er zu reden begann.
»Es wäre vielleicht gut, wenn Sie oder ich jetzt das Ruder übernehmen würden, John.« Er deutete mit einem bezeichnenden Kopfnicken auf das Kabinenfenster. Mellors und seine Frau waren jetzt auf den Beinen; Jean Longhurst stand gerade auf. Copwright saß noch immer am Ruder, doch seine Aufmerksamkeit wurde von anderen Dingen abgelenkt, und er war offensichtlich nicht in der Lage, die Yacht zu steuern. Er starrte mit müden, verträumten Augen Jean an.
»Geh nach vorn, Dick«, schlug Pablo vor. »Wenn du am Hauptruder bist, sage ich den anderen Bescheid.« Er öffnete die Tür, und ich sah ihn mit Copwright sprechen, der grinsend aufstand und sich bemühte, wach und alert zu wirken. Alle drängten jetzt zur Tür, und kurz darauf stand die ganze Besatzung, mit Ausnahme Dicks, auf dem Achterdeck und blickten in das aufgewirbelte Wasser, das hinter uns zurückblieb. Ein paar Möwen, die auf Fische hofften, stießen ihre traurigen Schreie aus und schossen herab.
»Natürlich«, sagte Mellors in seinem aggressiven Tonfall, »läuft die Maschine jetzt stark gedrosselt.« Sein Arm lag locker um Jean Longhursts Taille. Dorinda Mellors stand neben mir und sah teilnahmslos auf die See. Ich blickte die Reling entlang auf ihre Gesichter: Dorinda, Wallace Mellors, Jean, Alan Copwright, Pablo. Es mochte an der späten Stunde liegen – da ist etwas im langsamen Übergang zum Zwielicht, das die Phantasie anregt –, doch glaubte ich eine Atmosphäre unterdrückter Gewalttätigkeit in der Gesamtheit dieser Gesichter erkennen zu können. Jeder für sich gesehen waren sie ganz normale Menschen, die auf See hinausblickten, doch zusammen … ich weiß nicht. Ein plötzlicher Windstoß blies einen Gischtnebel über uns, und die Stimmung war verflogen. Ich hatte mir das nur eingebildet. Und außerdem spürt man immer eine Atmosphäre unterdrückter Gewalttätigkeit, wenn Mellors dabei ist.
Wallace Mellors ist um die fünfzig, muskulös, schwarzhaarig, laut, voreingenommen und sehr erfolgreich. Er besitzt einen rauen Charme und die Fähigkeit, ein Image von unkomplizierter, geradliniger Ehrlichkeit zu projizieren, das, wie ich manchmal zu erkennen glaubte, das Geheimnis seines Erfolges ist. Ich mochte ihn und spürte, dass auch er mich mochte – doch als ich ihn dann besser kennenlernte, bekam ich immer stärkere Zweifel an seiner Vertrauenswürdigkeit. Vor ein paar Tagen hatte ich an der Bar mit seiner Frau gesprochen, und irgendwie waren wir auf das Thema meiner Anstellung gekommen. Sie fragte: »Haben Sie schon irgendetwas schriftlich, John?«, und aus der Art, wie sie das sagte, erkannte ich, dass sie mich warnen wollte, wenn auch sehr vorsichtig …
»Die Yacht macht mehr als fünfzig Meilen, mit voller Kraft. Was sagen Sie dazu, Alan?«
Es war eine von Mellors unbeantwortbaren Fragen, mit denen er Menschen in die Defensive drängte. Copwright blickte ihn ruhig an, wenn auch seine Augen etwas verschwommen wirkten. Copwright trug eine Stahlbrille und einen Bart, der auf der Unterseite des Kinns spross; das Kinn selbst war glatt rasiert. Das gab ihm das Aussehen einer intelligenten Ziege. »Verdammt gut, Wal«, antwortete er.
»Aber ihr Wissenschaftler rechnet sicher mit Lichtgeschwindigkeit, wie, Jean?«
»Manchmal.« Wenn Alan Copwright Ähnlichkeit mit einer Ziege aufwies, hatte Jean Longhurst das Aussehen eines Pferdes – oder zumindest eines Mädchens, das Pferde reitet, was manchmal so ziemlich dasselbe ist.
»Nun haben Sie sich nicht so, Jean. Wir alle wissen doch, was in der Station los ist. Wozu also diese Geheimnistuerei? Temporal-Forschung, habe ich einmal sagen hören. Was ist das? Für mich klingt es wie Zeitreisen.« Er lachte kurz auf, beinahe verächtlich, und der Blick, den er Copwright zuwarf, war prüfend. »Genau wie H. G. Wells es beschrieben hat. Haben Sie Wells gelesen, Alan?«
Alan seufzte fast unhörbar. Seine Augen waren klarer geworden, die Seebrise, die auf dem Achterdeck wehte, hatte ihn ernüchtert. »Mein Gott, ja. Natürlich habe ich Wells gelesen. Der Mann hatte eine bewundernswerte Vorstellungskraft, für seine Zeit. The War of the Worlds. The First Man on the Moon. Das war erstklassig. Damals. Heute kommt es einem allerdings ein wenig holperig vor.«
»Die Zeitmaschine …«, murmelte Mellors fast unhörbar. »Das wäre eine Idee …«
»Die können Sie vergessen, Wal.« Copwright amüsierte sich über die durchsichtigen Versuche des Mannes, ihn auszuhorchen. »Zeitreisen sind unmöglich. Und die Gründe dafür kennen Sie genau so gut wie ich. Es gäbe zu viele Paradoxa, wie den eigenen Großvater zu töten. Und warum sind denn keine Zeitreisenden aus der Zukunft bei uns, und so weiter. Sie müssen den Tatsachen ins Auge sehen, Wal: Die Zukunft ist noch ungeschehen, und die Vergangenheit ist tot und vorbei. Also kann es Zeitreisen nicht geben.«
»Es wäre sehr viel Geld wert, nur ein kleines Stück, sagen wir einen Tag oder zwei Tage, in die Zukunft treten zu können. Überlegen Sie doch einmal, wie man all seine Unternehmungen danach ausrichten könnte.« Ich sah Mellors an, dass seine Gedanken weit weg waren, und in seinen Augen lag ein Ausdruck von Gier.
»Sie können sich doch wirklich nicht beklagen, Mr. Mellors«, lachte Jean und trat einen Schritt von ihm fort, so dass sein Arm von ihrer Taille glitt. Sie trat an die Backbord-Reling und blickte zum Ufer. Wir hatten eine Bucht erreicht, die Starfish Bay genannt wurde und wo man durch einen breiten Spalt zwischen den Uferklippen einen weiten Blick auf das Land hat, auf Felder, Wiesen, Moor und Heide, bis zu den waldbestandenen Hügelketten in der Ferne. Zwei riesige Bäume standen in der Senke direkt am Ufer der kleinen Bucht. Ein paar Wolken schwebten über uns, doch zum größten Teil zeigte der Himmel das fahle Blau des frühen Abends. Tief über dem Horizont hing die Schwärze eines aufziehenden Unwetters, aber es würde einige Stunden dauern, bis es uns erreichte.
»Ich möchte Ihnen etwas sagen, Wal, um Ihnen unnötige Gedanken zu ersparen«, sagte Copwright plötzlich. »Es stimmt, dass wir auf der Forschungsstation die Möglichkeiten von Zeitreisen untersucht haben. Das fällt zufällig in unsere Arbeitssphäre – als Angelegenheit akademischen Interesses, nicht als Aufgabe, für die öffentliche Gelder verschwendet werden. Wir haben uns kurz damit beschäftigt, einen Weg zu finden, der um die Paradoxa herumführt. Und festgestellt, dass es so einen Weg nicht gibt. Also war das Thema für uns gestorben. Es ist erledigt.« Aus der Art, wie er das sagte, erkannte ich, dass seiner Ansicht nach Mellors es ebenfalls fallen lassen sollte.
»Ein Jammer …« Mellors zog ein Newspocket-Gerät aus der Tasche und verfolgte automatisch die Durchgabe der Marktpreise. Selbst auf See, mit dem mysteriösen Abendlicht auf dem Wasser und den Schreien der Möwen aus ihren Nestern in den Uferklippen war es ihm unmöglich, den Rest der Welt zu vergessen. Er war immer Geschäftsmann. Ich vermute, dass dies eins der Geheimnisse seines Erfolges war, fragte mich jedoch gleichzeitig, ob es das wert war. Der kleine Bildschirm des Taschengeräts glühte bläulich im Zwielicht, die Ziffern flackerten. Er schaltete es aus und steckte es in die Tasche, einen zufriedenen Ausdruck auf seinem Gesicht. Offensichtlich war sein Imperium nicht zusammengebrochen.
Er deutete auf die Starfish Bay. »Sehen Sie sich das an«, sagte er zu mir gewandt, aber – wie es seine Gewohnheit war – alle Anwesenden mit einschließend. »Hübsche, kleine Bucht. Ruhig und abgeschlossen. Es kommt kaum mal jemand her. Keine Straßen, müssen Sie wissen, nur ein Sandweg aus dem Landesinneren. Aber am besten erreicht man sie, wenn man von Falcombe aus über die Klippen steigt.« Sein Gesicht wirkte ruhig, beinahe traurig, als er uns eine weitere Facette seines Charakters vorführte: Mellors, der romantische Träumer. »Als Junge bin ich oft hier herausgekommen und geschwommen. Das Wasser ist tief und sauber; auf mehrere Meilen gibt es keine Zuleitung von Abwässern. Der Ausblick von den Klippen ist phantastisch … Niemand wird hier jemals bauen. Das Land ist öffentlicher Besitz. Geschützt. Als Gebiet hervorragender Naturschönheit.«
Jean Longhurst stand vor mir, als ich auf die Bucht hinausblickte. Die Knöchel ihrer Hände traten weiß hervor, so hart umklammerte sie die Reling. Aus dem Augenwinkel heraus sah ich, wie Copwright erstarrte.
»Neulich war ich zufällig im Büro des Stadtrates«, fuhr Mellors grüblerisch fort. »Vielleicht wollte ich die Kopie meines Pachtvertrages mit der Forschungsstation einsehen … Sie wissen doch, dass die Station auf meinem Land errichtet wurde, nicht wahr, Alan? Aber natürlich, das habe ich Ihnen ja schon früher gesagt. Auf jeden Fall, stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich feststellte, dass die Falcombe Forschungsstation irgendwelche Rechte auf Land an der Starfish Bay erworben hatte. Und sehr seltsame Rechte … Weil es Landbesitz der Öffentlichkeit ist, verstehen Sie. Es gehört nicht irgendeinem Menschen, sondern uns allen, würde ich sagen. Sind Sie nicht auch der Ansicht, John?«
Jetzt versuchte er, mich in irgendeine private Angelegenheit zu verwickeln. Ich schwieg.
Er fuhr fort. »Es sieht so aus, als ob die Station kürzlich ausschließliche Rechte auf einen Teil dieses öffentlichen Grundbesitzes erworben habe. So wie ich die Dinge sehe, können sie diesen Teil vielleicht sogar einzäunen, wenn ihnen danach ist. Wissen Sie zufällig etwas darüber, Alan?«
Wir haben Alans Antwort nicht gehört, weil in diesem Augenblick etwas geschah, das so unheimlich, so phantastisch war, dass ich im ersten Moment an meinem Verstand zweifelte. Doch als ich umherblickte, erkannte ich, dass die anderen es auch sahen …
Die Wolken waren über uns hinweggezogen. Die schwarze Sturmfront stand noch immer am Horizont, schien aber nicht nähergekommen zu sein. Der Himmel über uns war fast wolkenlos: nebelfeine Zirren wurden von der sinkenden Sonne gelbrot getönt. Ich sah grasende Kühe auf den Weiden, und etwas weiter entfernt stieg Rauch aus dem Schornstein einer Kate senkrecht zum Himmel empor.
Doch die beiden hohen Bäume an der Starfish Bay schienen von einem Hurrikan gepackt worden zu sein; sie wurden hin und her geschüttelt, verstreuten Blätter nach allen Seiten und glänzten vor Nässe, während um sie herum die Luft still und unbewegt war …
Ich hörte einen Ausruf von Copwright, der rasch unterdrückt wurde. Jean wandte den Kopf zu ihm, und sie schienen sich etwas mit Blicken zu sagen; die Augen des pferdegesichtigen Mädchens glänzten, und ihre Lippen öffneten sich vor Erregung. Mellors runzelte die Stirn. Pablo suchte meinen Blick. In seinen Augen stand Verwirrung – und Angst, wie ich glaubte.
Dann starrten wir alle über das Wasser der Bucht auf die beiden Bäume, die schwankten und tanzten, als ob sie von einer riesigen Faust geschüttelt würden.
2
Es dunkelte, als wir das letzte Stück der engen Flussmündung hinauffuhren, die den Hafen von Falcombe mit der See verbindet. Das Wasser war goldgesprenkelt von den Reflexen der Lichter der zahlreichen Hotels, die auf dem Hang des Hügels standen, der sich rechts von uns erhob; das andere Flussufer lag dunkel, bis auf die Lichtpunkte einiger, weniger Fenster. Dick steuerte einen langsamen Zickzack-Kurs um die aus dem Wasser ragenden Felsen herum, die in dieser Gegend reichlich verstreut sind. Er stand am Rad in der Bugkabine; wir anderen saßen im großen Salon und tranken. Niemand sprach viel.
Wenig später verbreiterte sich der Fluss zum Hafen hin, und Dick nahm Kurs auf den Pier; um diese Jahreszeit waren die meisten Boote an Land gebracht worden, und es gab viel Platz. Wir fuhren an einer Reihe von Hausyachten vorbei, die unterhalb des Falcombe Hotels Bug an Heck verankert waren. Es war Ebbe und ein breiter Streifen ockerfarbenen Schlamms glänzte zwischen uns und dem Ufer. Vage weiße Schatten schossen durch die Luft: Möwen auf einer letzten Jagd nach Futter, bevor sie sich für die Nacht zurückzogen. Die Turbine heulte lauter, als Dick die Hubkraft verstärkte, dann glitt die Hausyacht über den Schlamm hinweg und senkte sich etwa acht Fuß von der Steinwand des Piers entfernt zu Boden. Dick trat an Deck und warf den Buganker aus; Pablo sicherte auf die gleiche Art das Heck. Bis Mitternacht würden fünf Fuß Wasser unter dem Boot sein.
Pablo brachte eine Planke aus, befestigte sie an Deck, tief auf ihr zum Pier und machte das andere Ende an einem Poller fest. Ich sah, wie Dorinda Mellors einen misstrauischen Blick auf das schmale Brett warf, doch Pablo hatte keine Lust, die Hausyacht gegen die alten Steine des Piers reiben und beschädigen zu lassen; deshalb die unorthodoxe Ankerprozedur.
Ich glaube, wir waren alle ein wenig angetrunken, als wir vorsichtig über den dunklen Pier gingen und versuchten, den verschiedenen Fußangeln auszuweichen -Hummerreusen und herumliegenden Fischnetzen. Wenig später erreichten wir Falcombes Hauptstraße; um diese Jahreszeit waren die schmalen Gehsteige fast menschenleer. Ein paar wenige Schaufenster waren erleuchtet; Katzen hockten in dunklen Hauseingängen. Ein Stück weiter begann die Straße anzusteigen und führte an den Waterman’s Arms vorbei zum Falcombe Hotel.
Aus irgendeinem Grund waren Mellors und ich ein Stück hinter den anderen zurückgeblieben. Er umspannte meinen Arm. »John«, sagte er leise, »es könnte sich lohnen, morgen einen Blick auf die Starfish Bay zu werfen. Warum machen Sie nicht einen kleinen Spaziergang über die Klippen?«
Alan und Jean waren ein paar Schritte voraus und unterhielten sich lebhaft mit Dorinda Mellors und Pablo. Ein Stück vor ihnen schritt Dick, allein und schweigend. Aus den Waterman’s Arms drangen gedämpftes Stimmengewirr und Lachen.
Der Alkohol hatte mich mutig gemacht. »Ich sehe nicht ein, wozu das gut sein sollte.«
»Muss es zu etwas gut sein? Es interessiert mich, das ist alles. Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich feststelle, ein ziemlich gewichtiger Mann in dieser Gegend zu sein, stimmt’s? Ich bin der Meinung, dass ich gegenüber den Menschen hier eine gewisse Verantwortung habe.«
»So?«
»Und es gefällt mir nicht, dass die Bürokratie sie überrollt. So etwas ist wie die Schmalseite eines Keils. Als nächstes werden sie vielleicht die Wege sperren und Betreten-verboten-Schilder aufstellen und anderen Blödsinn machen, wenn sie es nicht schon getan haben. Albright sagte mir, dass es zu einem Ausbruch von Myxomatose gekommen sei; überall tote Kaninchen, die stinken und verwesen und die Touristen vergraulen. Es würde mich nicht überraschen, wenn auch das irgendwie mit der Station zusammenhinge.«
Das war mir wirklich zu viel. »Kommen Sie, Wal. Albright hat eine Farm dort oben. Wahrscheinlich hat er die Krankheitserreger selbst verbreitet. Zuzutrauen wäre es ihm.«
Wir traten durch den opulenten Eingang des Falcombe Hotels; Carter, der Portier, lächelte und nickte respektvoll. Mellors und seine Frau grüßten ihn betont herzlich; sie legten immer großen Wert darauf, die Mitarbeiter höflich zu behandeln. Ich blickte Carter kühl an, als wir an ihm vorbeigingen. Ich hatte ihn im Verdacht, an den Lebensmitteldiebstählen aus der Küche beteiligt zu sein; seit einiger Zeit hatte ich Fehlbestände festgestellt, und das Zeug musste an ihm vorbei hinausgeschafft werden – wenn man es nicht mit Booten abtransportierte.
Mellors griff wieder nach meinem Arm, als wir uns der Bar näherten. »Sehen Sie sich morgen ein wenig bei der Starfish Bay um, ja, John? Ich würde das als einen persönlichen Gefallen betrachten.«
Ich wusste, was das bedeutete.
Für eine Weile beschäftigte ich mich in meinem winzigen Büro. Es war noch früh am Abend, doch spürte ich schon diese Taubheit um die Wangen, die, wie ich aus Erfahrung wusste, das erste Anzeichen für heranreifende Besoffenheit ist. Das Hotel war etwa zur Hälfte gefüllt – recht gut für diese Jahrszeit. Alles schien glatt zu laufen: Die Köche bereiteten das Dinner vor, die Kellner schliefen in ihren Zimmern, die Rezeptionistin beschwichtigte einen schwierigen Gast, und der Buchhalter stellte die Tagesabrechnung zusammen – abzüglich seines stillen Anteils, überlegte ich düster. Ich warf einen Blick auf die Belegungsliste, fand ein freies Zimmer, nahm den Schlüssel und ging hinauf um mich zu duschen.
Nach dem Dinner kehrte ich zu den anderen zurück und entdeckte sie in der Cocktail Lounge bei Kaffee und Likören. Ich zog mir einen Stuhl heran und setzte mich. Sie waren inzwischen so weit fortgeschritten, dass sie meine Ankunft nicht bemerkten. Ich fühlte mich ein wenig fehl am Platz, da die Konversation zusammenhanglos geworden war. Alan war in eine tiefe Diskussion mit Jean verstrickt, Mellors und seine Frau trugen ein neues Gefecht ihres ehelangen Krieges aus und knurrten einander mit giftigen Untertönen an, während Dick und Pablo über Boote sprachen. Sie wirkten noch verhältnismäßig nüchtern, gestikulierten jedoch ziemlich wild. Ich schob die Kaffeekanne beiseite und wandte meine Aufmerksamkeit Alan und Jean zu.
»Hör zu«, sagte Alan undeutlich. »Ich habe in letzter Zeit keine Gelegenheit gefunden, mit Susanna zu sprechen. Das habe ich dir doch schon gesagt.«
Etwas betroffen, in eine private Unterhaltung eingedrungen zu sein, war ich dennoch neugierig. Jeans Gesicht zeigte einen Ausdruck pferdehafter Besorgnis. »Also wissen wir nicht, was, zum Teufel, vor sich geht«, sagte sie. »Manchmal bezweifle ich, ob Stratton es weiß. Hast du jemals daran gedacht, dass unsere Experimente parallelisiert werden könnten?«
Das klang interessant und ich rückte unauffällig etwas näher. Sie schienen meine Anwesenheit nicht zu bemerken. »Willst du damit sagen«, fragte Alan, »dass eine Art …« – er zögerte und verzog nachdenklich sein ziegenähnliches Gesicht – »… Kollision eintreten könnte?«
Auch Jean war sehr nachdenklich. »Zusammentreffen wäre wohl eine treffendere Bezeichnung – obwohl nur Gott wissen mag, was das bedeuten kann. Aber diese Bäume … sie waren direkt im Fokalpunkt.«
Ich hätte liebend gern mehr gehört, doch an diesem Punkt unterbrach Mellors das Gespräch, indem er einen fleischigen Arm um Jeans Taille legte. »Was ist denn mit Ihnen beiden? Sie können sich doch nicht von den anderen absondern. Dies soll schließlich eine Party sein, nicht wahr?«
Als Mellors sich mit Jean zu befassen begann, wandte Pablo sich mir zu. »Muss mit dir reden«, sagte er abrupt.
»Bitte.«
Er blickte umher. »Nicht hier. In der Toilette.«
»In Ordnung.« Ich stand auf. »Entschuldigen Sie uns einen Augenblick.«
Wir standen über die Handwaschbecken gebeugt. Pablo schwankte leicht. Er umklammerte meinen Arm. »Ich will dir einen guten Rat geben.«
Dies ist nun eine Gesprächseröffnung, die mir überhaupt nicht gefällt. In meinem ganzen Leben ist mir nie ein Rat gegeben worden – wenn er als solcher etikettiert worden war –, der sich nicht als absolut wertlos und häufig auch als beleidigend herausgestellt hatte. »Schieß los«, sagte sie resigniert.
»Nimm dich vor diesem Bastard Mellors in Acht.«
»Das tue ich immer«, antwortete ich mit gespielter Selbstsicherheit, spürte jedoch gleichzeitig einen Druck in der Magengegend.
»Der will dich aufs Kreuz legen. Vielleicht mich auch.« Pablo starrte durch das Fenster der Herrentoilette, in dem eine der Milchglasscheiben zu meinem ständigen Ärger durch eine aus klarem Glas ersetzt worden war. Jedes Mal, wenn die Hotelinspektoren vorbeikommen, kriege ich Kommentare darüber zu hören; anscheinend zieht eine kleine Scheibe Klarglas im Fenster einer Herrentoilette Perverse an wie ein Licht die Motten; das jedenfalls scheinen sie anzunehmen. Ich kann ihre Gedankengänge nicht nachvollziehen. Falls ein Perverser sich schon erregt, wenn er durch das kleine Fenster hereinlinst, um wieviel größer müsste dann sein Genuss sein, wenn er den Waschraum tatsächlich betritt, sein Inneres mit allen Sinnen in sich aufnimmt: den Geruch von Deodorant, das Rauschen von Wasser, der Anblick der in keuschem Weiß gekachelten Wände, der blanken Chromarmaturen. Das alles habe ich ihnen gesagt, doch sie sahen mich nur recht seltsam an.
Ich blickte jetzt auch aus dem Fenster; hinter der kleinen Fläche mit den Mülltonnen konnte ich den mit Flutlicht beleuchteten Rasen am Flussufer sehen; die Tische und Stühle wirkten verlassen, einige waren umgekippt. Ich machte mir eine gedankliche Notiz, das morgen früh in Ordnung zu bringen. Im Augenblick sah es so aus, als ob alle Menschen vor einer unmittelbar bevorstehenden Sturmflut geflohen wären. Jenseits des Rasens, kaum erkennbar auf dem dunklen Wasser, sah ich eine Kette weißer Rechtecke: Pablos Hausyachten.
»Warum glaubst du, dass er uns aufs Kreuz legen will?«, fragte ich.
»Hat er schon irgendetwas unterschrieben? Natürlich nicht, dieser hintertriebene Bastard. Ich hätte diese verdammten Boote anderweitig verkaufen können, weißt du das? Ich hatte feste Kunden dafür. Aber weil du mich überzeugt hast, dass Mellors ernsthaft zum Abschluss kommen will, habe ich sie vertröstet. Ich habe ihnen etwas von Produktionsschwierigkeiten erzählt, dass ich die Boote erst in sechs Monaten liefern könnte. Dadurch habe ich das Vertrauen der Kunden verloren. Und Zinsen für das investierte Kapital.«
»Das wissen wir doch längst. Ich tue alles, um die Sache hinzukriegen.«
»Dann werde ich dir etwas sagen, was du noch nicht weißt.« Pablo wandte sich um und blickte mir ins Gesicht; seine Augen waren verquollen von Alkohol und Sorge. »Er versucht, dich auszubooten. Weißt du, was er mir beim Dinner vorgeschlagen hat? Er wolle mit mir direkt abschließen. Deine Provision ist zehn Prozent, nicht? Er bot mir Barzahlung bei fünf Prozent Rabatt auf den ganzen Betrag – direkt von ihm an mich. Das würde den Zwischenhändler ausschließen. Dich.«
»Du hättest dabei fünf Prozent gespart, Pablo«, sagte ich langsam.
»Genau wie er.« Pablo lächelte bitter. »Aber sowas ist nicht meine Art, John. Wir kennen uns eine ganze Weile. Wir haben unsere Abmachung getroffen lange bevor wir Mellors kannten, und für mich ist ein Vertrag ein Vertrag. Du bekommst deine zehn Prozent, oder es wird nichts aus dem Geschäft. Einverstanden?«
Dazu gab es nicht viel zu sagen. Ich murmelte meinen Dank, und wir gingen zu den anderen zurück. In meinem Magen saß eine kalte Wut, doch als ich Mellors Zustand sah, wusste ich, dass dies nicht der richtige Moment für eine Auseinandersetzung war. Er würde nicht einmal wissen, wovon die Rede war – oder so tun, als ob er es nicht wüsste. Ich setzte mich.
Mellors blickte mich kurz an, anscheinend ohne mich zu erkennen. Dann wandte er sich Jean zu. »Noch einen Drink. Und Sie auch, Alan. Kellner!« Köpfe wandten sich in unsere Richtung, als er nach der Bedienung schrie.
»Ich hole die Drinks«, sagte ich, als ich sah, dass der Kellner beschäftigt war. »Was wollen Sie?«
Mellors grinste breit. »Da sehen Sie einen tüchtigen Manager, Jean. Ein heller Junge. Hat eine großartige Zukunft. Und in der nächsten Saison nehme ich ihn als Partner in unser kleines Hausyacht-Charter-Geschäft auf. Stimmt’s John?«
Ich murmelte irgendeine Zustimmung und ging, um die Drinks zu holen. Später nutzte ich die erste sich bietende Gelegenheit, um mich zu entschuldigen und ging. Ich beauftragte die Rezeptionistin und den Buchhalter, das Hotel um Mitternacht abzuschließen, holte den Mantel aus meinem Büro und ging zur Tür, dankbar, nicht im Hotel wohnen zu müssen.
Ich erwachte gegen zwei Uhr nachts durch seltsame Geräusche. Das Boot schaukelte ziemlich heftig, selbst in dem geschützten Hafen von Falcombe, also nahm ich an, dass der drohende Sturm schließlich über uns hereingebrochen war …
Für den Unerfahrenen ist allein die Vorstellung, an Bord eines kleinen Schiffs zu schlafen, romantisch. Ein Glas Bier in der Stille des abendlichen Zwielichts, die tanzenden Reflexe von Lichtern anderer Boote auf dem ruhigen Wasser; dann in die gemütliche Kabine auf einen letzten Scotch und eine Zigarette. Später in der Koje, die Decke bis unters Kinn heraufgezogen, stellt man sich vor, dass das Wasser, nur wenige Zoll entfernt, gegen den schützenden, schossgleichen Bootsrumpf plätschert. Und dann traumloser, gesunder Schlaf.
Die Wirklichkeit sieht natürlich völlig anders aus. Zugegeben, alles verläuft problemlos, bis der Seemann in seiner Koje liegt. Erst dann, wenn er am meisten verwundbar ist, hört er die Geräusche. Das langanhaltende, dumpfe Dröhnen, begleitet von dem metallischen Pochen.
Das sagt ihm, dass der Anker über Grund schleift.
Er fährt hoch, knallt mit dem Kopf gegen die Bodenbretter der oberen Koje und versucht, durch das winzige Bullauge etwas zu erkennen. Vor zwei Stunden hatte er einen umgebauten Fischkutter und eine Reihe kleiner Dinghis gesehen, die rotblaue Flanke eines Seenotrettungsbootes und den Leuchtturm am Ende des Piers.
Jetzt sieht er nichts, außer Wasser natürlich, düster und kalt und drohend in dem erratischen Licht des Mondes, über den ein immer mehr auffrischender Sturm zerrissene Wolkenfetzen jagt.
Er ist mit der Ebbe meerwärts abgetrieben worden. Als seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, kann er das Ufer erkennen, schwarz und drohend, und die gischtenden Brecher, die gegen den Fels branden und sehr bald sein zerbrechliches Gefährt zu Kleinholz zertrümmern werden. Es scheint, als ob er in diese Richtung getrieben werden würde; und ein paar Sekunden angstvoller Beobachtung bestätigen das. Der riesige, dunkle Schatten des Ufers kommt immer näher.