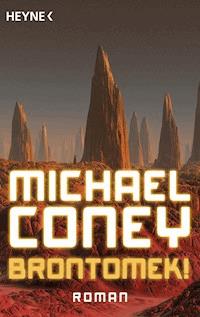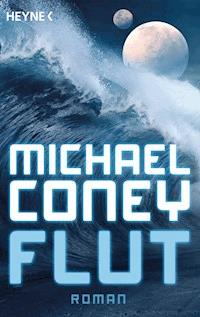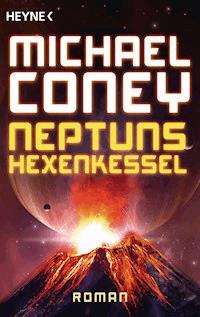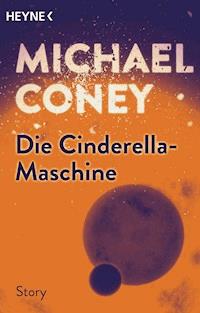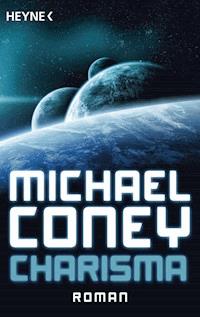2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein viel zu langer Winter
Der junge Drove verbringt jedes Jahr den Sommer mit seinen Eltern in Pallahaxi, einem kleinen Ort am Meer. Er trifft alte Freunde wieder, darunter auch das Mädchen Braunauge, in das er sich verliebt hat. Ihr Leben ist geprägt von den seltsamen Gezeiten, in denen das Meer zähflüssig wird. Was anfangs noch nach einem ganz gewöhnlichen Sommerurlaub auf dem Planeten der Stilk aussieht, wird jedoch jäh gestört, denn es droht eine Klimakatastrophe kosmischen Ausmaßes: Der Riesenplanet Rax, der auf einer exzentrischen Bahn um dieselbe Sonne wie der Planet der Stilk kreist, droht den kleineren Planeten aus seiner Umlaufbahn zu reißen und ihn auf eine Bahn zu lenken, die ihn weiter von der Sonne entfernt als gewöhnlich. Der Sommer geht – und ein langer Winter steht bevor …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
MICHAEL CONEY
DER SOMMERGEHT
Roman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Das Buch
Der junge Drove verbringt jedes Jahr den Sommer mit seinen Eltern in Pallahaxi, einem kleinen Ort am Meer. Er trifft alte Freunde wieder, darunter auch das Mädchen Braunauge, in das er sich verliebt hat. Ihr Leben ist geprägt von den seltsamen Gezeiten, in denen das Meer zähflüssig wird. Was anfangs noch nach einem ganz gewöhnlichen Sommerurlaub auf dem Planeten der Stilk aussieht, wird jedoch jäh gestört, denn es droht eine Klimakatastrophe kosmischen Ausmaßes: Der Riesenplanet Rax, der auf einer exzentrischen Bahn um dieselbe Sonne wie der Planet der Stilk kreist, droht den kleineren Planeten aus seiner Umlaufbahn zu reißen und ihn auf eine Bahn zu lenken, die ihn weiter von der Sonne entfernt als gewöhnlich. Der Sommer geht – und ein langer Winter steht bevor …
Der Autor
Michael Coney wurde 1932 in Birmingham geboren und besuchte die King Edward’s School. Er wurde zunächst Buchhalter, übte dann eine Reihe unterschiedlicher Berufe aus: Unter anderem betrieb er ein Pub in Devon, später leitete er ein Hotel auf der Karibikinsel Antigua. Anfang der Siebzigerjahre siedelte er mit seiner Familie nach Kanada über und wurde Feuerwächter der Columbia Forestry Commission. Seit 1966 schrieb er Science Fiction, mit seinen grandiosen Schilderungen außerirdischer Welten wurde er schnell zu einem der zentralen Autoren der Siebziger und Achtziger. Die beiden »Pallahaxi«-Romane gelten als seine bedeutendsten Werke. Michael Coney starb 2005 an Krebs.
www.diezukunft.de
Titel der englischen Originalausgabe:
HELLO SUMMER, GOODBYE
Deutsche Übersetzung von Bernhard Kempen
Copyright © 2007 by The Estate of Michael Coney
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe byWilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covergestaltung: Das Illustrat, München
Satz: Schaber Datentechnik, Wels
ISBN: 978-3-641-17347-0
1
ICH DENKE OFT AN DEN TAG in Alika zurück, als mein Vater, meine Mutter und ich hin und her flitzten und auf der Veranda einen Haufen mit Sachen zusammentrugen, die für unseren Urlaub in Pallahaxi gedacht waren. Obwohl ich gerade erst in die Pubertät eingetreten war, wusste ich bereits genug über Erwachsene, um ihnen während dieses alljährlichen Ereignisses möglichst aus dem Weg zu gehen, denn aus irgendwelchen Gründen kam es dabei immer wieder zu Paniksituationen. Meine Mutter hetzte mit hektischen Bewegungen und starrem Blick herum und fragte ständig, wo sich bestimmte Dinge befanden, um sich im nächsten Moment selber die Antwort zu geben. Mein Vater stapfte würdevoll die Kellertreppe herauf und hinunter und schleppte kanisterweise Destill für seinen kostbarsten Besitz heran, den Motorwagen mit eigenem Antrieb. Immer wenn der Blick meiner Eltern auf mich fiel, sah ich keine Liebe in ihren Augen.
Also ging ich ihnen aus dem Weg, während ich dennoch darauf achtete, dass meine eigenen Sachen nicht vergessen wurden. Ein kleiner Teil des unsortierten Haufens enthielt bereits meinen Schleuderball, mein Ringeln-Spielbrett, mein Miniaturmodell eines Grume-Skimmers und mein Fischernetz. Während eines verstohlenen Besuchs am Motorwagen hatte ich den Käfig mit meinen Tratten hinter den Rücksitz geschoben. In diesem Moment kam Vater mit einem weiteren Kanister aus dem Haus und blickte mich finster an.
»Wenn du dich nützlich machen willst, könntest du den Tank füllen.« Er stellte den Kanister neben dem Wagen ab und reichte mir einen Messingtrichter. »Aber verschütte nichts. Das Zeug ist heutzutage ziemlich kostbar.«
Damit spielte er auf die Verknappung an, die eine Folge des Krieges war. Ich hatte den Eindruck, dass er kaum auf irgendetwas anderes anspielte. Während er zum Haus zurückging, schraubte ich den Deckel ab und sog schnuppernd den berauschenden Duft des Destills ein. Das Zeug hatte mich schon immer fasziniert. Es wollte einfach nicht in meinen jungen Kopf hinein, dass eine Flüssigkeit – insbesondere eine, die so große Ähnlichkeit mit Wasser hatte – tatsächlich brennen konnte. Auf den Vorschlag eines Freundes hatte ich einmal versucht, es zu trinken. Dieser Freund hatte mir auch erzählt, dass Destill eine ähnliche Grundlage wie Bier, Wein und all die anderen aufregenden und verbotenen Getränke hatte, die in Tavernen ausgeschenkt wurden.
Also hatte ich mich eines Nachts in den Keller geschlichen und einen heißen Ziegelstein an mich gedrückt, um die Furcht zu vertreiben. Dann hatte ich einen Kanister geöffnet und davon getrunken. Wenn ich danach ging, wie das Destill in meinem Mund und meiner Kehle brannte, wunderte es mich gar nicht, dass sich damit ein Dampfmotor antreiben ließ. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass es den Leuten Spaß machte, das Zeug zu trinken. Mir wurde schwindlig und übel, und ich musste mich eine ganze Weile stöhnend an der Hauswand abstützen, während die Kälte mir das Rückgrat hinaufkroch. Dass ich zitterte, hatte mindestens genauso viel mit meiner Angst wie mit meiner Übelkeit zu tun. Es war Winter, und der kalte Planet Rax beobachtete mich wie ein böses Auge. In Alika können die eisigen Nächte des Winters sehr grausam sein.
Aber mit Pallahaxi hatte ich schon immer Sommer und Wärme verbunden, und dorthin wollten wir an jenem Tag fahren. Ich steckte die Tülle des Trichters in den Tank des Motorwagens und neigte den Kanister, worauf das Destill heraussprudelte. Von der anderen Straßenseite sahen mir drei kleine Mädchen zu. Ihre schmutzigen Münder standen vor Ehrfurcht und Neid angesichts des wunderbaren Fahrzeugs offen. Schwungvoll stellte ich den leeren Kanister ab und hob den nächsten an. Ein Mädchen warf einen Stein, der gegen den glänzenden Lack schlug, dann rannten sie alle schreiend die Straße entlang davon.
Hinter den Häusern auf der anderen Straßenseite erhoben sich die hohen Turmspitzen des Parlamentsgebäudes, wo der Regent den Vorsitz über das Repräsentantenhaus hatte. Dort arbeitete mein Vater in einem schmuddeligen kleinen Büro als Sekretär des Ministers für Öffentlichkeitsarbeit. Mein Vater war ein Parl, und der Motorwagen war ein Statuszeichen seines Amtes. Deshalb hatten die Kinder so wütend reagiert. Dafür hatte ich durchaus Verständnis, aber ich fand es verfehlt, die Wut am Wagen auszulassen und nicht an meinem Vater.
Ich drehte mich zu unserem Haus um. Es war ein großer Bau aus dem gelblichen Gestein der Umgebung. Meine Mutter huschte hinter einem Fenster vorbei, während sie panisch nach etwas Unerfindlichem suchte. Im Garten schnappten ein paar Blumen nach flüchtigen Insekten, und ich erinnere mich gut daran, dass ich mich fragte, warum der Garten in diesem Jahr so vernachlässigt wirkte. Überall war Spreizkraut, das prächtig gedieh und auch die letzten Blauschoten mit smaragdgrünen Garotten erwürgte. Es hatte etwas Erbarmungsloses, wie sich das Unkraut sichtbar ausbreitete, und plötzlich erschauderte ich, als ich mir vorstellte, dass es nach unserer Rückkehr aus dem Urlaub das Haus überwuchert haben würde. Dann würde es nachts durch die Täfelung kriechen und uns im Schlaf strangulieren.
»Druv!«
Mein Vater ragte vor mir auf und hielt mir einen weiteren Kanister hin. Als ich schuldbewusst zu ihm aufblickte, zuckte er die Achseln, wobei sein Gesicht einen seltsamen Ausdruck zeigte. »Schon gut, Druv.« Auch er betrachtete das Haus. »Ich übernehme das. Du kannst gehen und deine Sachen holen.«
In meinem Zimmer schaute ich mich schnell um. Ich war schon immer der Ansicht gewesen, dass ich nur wenige Dinge nach Pallahaxi mitnehmen musste. Schließlich war es eine andere Welt, wo man ganz andere Sachen machen konnte. Ich hörte, wie Mutter im Nebenzimmer kramte.
Auf dem Fenstersims stand der Glaskrug, in dem sich mein Eiskobold befand. Ich hatte ihn schon fast vergessen. Nun sah ich ihn mir genau an und bildete mir ein, ich könnte einen feinen Kristallfilm auf der Oberfläche der zähen Flüssigkeit sehen. Ich suchte, bis ich einen Stock gefunden hatte, und tippte damit vorsichtig den Eiskobold an. Keine Reaktion.
Während des vergangenen Winters, als die Sonne geschrumpft in die Ferne des Himmels geflohen und Rax bei Nacht als furchterregender kalter Stein sichtbar gewesen war, waren alle Kinder der Umgebung ganz verrückt auf Eiskobolde gewesen. Wie bei vielen solchen Wellen der Begeisterung war nicht ganz klar, wie es angefangen hatte, aber plötzlich hatte jeder einen Glaskrug voll gesättigter Salzlösung und schüttete jeden Tag etwas mehr von den seltsamen Kristallen hinein, die aus der Sumpfebene an der Küste stammten, wo die Eisteufel wohnten.
»Ich hoffe doch sehr, dass du dieses furchtbare Ding nicht mitnehmen willst«, rief Mutter entsetzt, als ich mit dem Kobold aus meinem Zimmer kam.
»Ich kann ihn jetzt unmöglich zurücklassen. Er ist fast so weit.« Als ich Mutters ängstlichen Tonfall bemerkte, erklärte ich ihr die Angelegenheit etwas genauer. »Ich habe ihn ungefähr zur gleichen Zeit angesetzt wie Joelo aus unserer Nachbarschaft, und sein Kobold ist vor zwei Tagen lebendig geworden, und dabei hätte er fast einen Finger verloren. Schau mal!« Ich schwenkte das Glas unter ihrer Nase, worauf sie zurückwich.
»Verdammt! Nimm das verfrorene Ding weg!«, schrie sie, und ich starrte sie voller Erstaunen an. Ich hatte meine Mutter noch nie zuvor fluchen gehört. Ich bemerkte, dass mein Vater sich näherte, und stellte den Kobold schnell auf einen Tisch in der Nähe. Dann wandte ich mich ab und beschäftigte mich mit einem Kleiderhaufen in der Ecke.
»Was ist hier los? Weswegen hast du geschrien, Fayet?«
»Ach … ach nichts. Druv hat mich für einen Moment erschreckt, das ist alles. Es hat wirklich nichts zu bedeuten, Burt.«
Ich spürte Vaters Hand auf meiner Schulter und drehte mich widerstrebend zu ihm um. Seine kalten Augen starrten genau in meine. »Ich möchte eins klarstellen, Druv. Wenn du nach Pallahaxi mitkommen willst, musst du dich benehmen, verstanden? Ich habe schon zu viele andere Sachen im Kopf und kann mich nicht auch noch um dich kümmern. Geh und bring deine Sachen zum Wagen.«
Ich hatte es schon immer als ungerecht empfunden, dass mein Vater in der Lage war, mir einfach so seinen Willen aufzuzwingen. In der Pubertät ist man auf dem Höhepunkt seiner Intelligenz, und ab da geht es bergab. So war es auch mit meinem Vater geschehen, sagte ich mir verbittert, während ich den Motorwagen belud. Der eingebildete alte Narr wusste genau, dass er mir intellektuell nicht gewachsen war, und deshalb verlegte er sich auf die Taktik der Gewaltandrohung. Aber das bedeutete letztlich, dass ich unsere kleine Auseinandersetzung gewonnen hatte.
Das Problem war nur, dass mein Vater sich dieser Tatsache gar nicht bewusst war. Er lief ständig zwischen verschiedenen Zimmern und der Veranda hin und her und beachtete mich nicht weiter, während ich mich bemühte, Schritt zu halten. Jedoch erfolglos, denn der Stapel von Kisten wurde immer größer. Es verschaffte mir eine gewisse Befriedigung, seinen Kram grob in den Gepäckraum des Wagens fallen zu lassen, wohingegen ich meine Sachen sorgfältig auf den freien Sitz stellte. Zwischendurch fragte ich mich, warum es mir gefiel, meiner Mutter von Zeit zu Zeit einen Schrecken einzujagen, und kam zu dem Schluss, dass ich sie vermutlich unbewusst für ihre Dummheit bestrafen wollte. Ihr Aberglaube war für sie eine Waffe, die sie bei einem Streit wie eine Keule der unwiderleglichen Tatsachen einsetzte.
Wir alle fürchten uns vor der Kälte. Diese Furcht ist völlig natürlich und hat sich zweifellos entwickelt, um uns vor der Nacht und dem Winter und dem zu warnen, was die Kälte einem antun kann. Doch Mutters Angst vor der Kälte ist unvernünftig und höchstwahrscheinlich vererbt. Wenn ich sie darauf anspreche, schürzt sie die Lippen und sagt: »Es wäre mir wirklich lieber, wenn du mich niemals danach fragen würdest, Druv.« In gewisser Weise ist diese kleine Bekundung vollkommen, was den Inhalt, die Betonung und Mutters verletzten, geheimnisvollen Gesichtsausdruck betrifft. Es ist die reinste Theatralik.
Damit meint sie, dass man ihre Schwester weggesperrt hat. Das ist eine ganz einfache Sache, die vielen Leuten passiert, aber Mutter ist es gelungen, die Angelegenheit mit Tragik und Dramatik zu überfrachten. Niemand hat wegen der Sache mit Tante Zu mehr gelitten als ich, trotzdem war ich in der Lage, den damaligen Schrecken größtenteils zu vergessen und alles von der humorvollen Seite zu sehen.
Ich hatte immer gedacht, dass Tante Zu etwas für meinen Vater übrighatte. Jedenfalls konnte sie ihn überreden, ihr seinen Motorwagen zu borgen – was eine außergewöhnliche Leistung war, mehr als alles, was meine Mutter je erreicht hatte. Tante Zu, die unverheiratet war, wollte mit mir vor ein paar entfernten Verwandten angeben. Mit ihrer einspännigen Lox-Kutsche wäre es eine sehr lange Fahrt gewesen, also borgte sie sich einfach den Motorwagen. Es war Winter.
Wir hatten den Rückweg etwa zur Hälfte hinter uns gebracht, als uns in einer völlig unbewohnten Gegend das Destill ausging. Der Motorwagen kam stockend und zischend zum Stehen.
»Ach du liebe Güte«, sagte Tante Zu bedauernd. »Jetzt müssen wir laufen, Druv. Ich hoffe, deine kleinen Beine sind schon kräftig genug dazu.« Ich erinnere mich noch genau an die Worte, die sie sagte.
Also marschierten wir los. Ich wusste, dass wir es niemals vor Anbruch der Dunkelheit bis nach Hause schaffen würden, und ich wusste, dass mit der Dunkelheit die Kälte kam und dass wir nicht die richtige Kleidung trugen. Ich war intelligent genug – obwohl sie ständig so herablassend zu mir sprach –, um die Möglichkeiten gegeneinander abzuwägen und einzusehen, dass sie Recht hatte. Wir konnten nicht beim Motorwagen bleiben. Obwohl Vater eine hohe Position in der staatlichen Verwaltung hatte, konnte nicht einmal er sich ein geschlossenes Fahrzeug leisten, wie es der Regent benutzte.
»Ach du liebe Güte«, sagte Tante Zu etwas später noch einmal, als die Sonne unterging und Rax’ düstere Scheibe am Horizont glitzerte. »Es wird kalt.«
Wir kamen an einer Gruppe äsender Lorin vorbei, die in den Ästen hockten, während sie geräuschvoll kauten. Ich weiß noch, wie ich überlegt habe, ob ich mich, wenn es richtig kalt wurde – schrecklich kalt –, an einen von ihnen ankuscheln könnte, um mich in seinem langhaarigen Pelz zu wärmen. Lorin sind harmlose, freundliche Geschöpfe, und in der Umgebung von Alika werden sie hauptsächlich als Begleiter für die Lox genutzt. An kalten Tagen sind die Lox manchmal vor Angst träge und halb gelähmt, doch die Anwesenheit von Lorin hat einen beruhigenden Einfluss auf sie. Manche Leute sagen, es wäre etwas Ähnliches wie Telepathie. An jenem Abend blickte ich sehnsüchtig zu den Lorin hinüber und beneidete sie um ihr seidiges Fell und ihr entspanntes, friedfertiges Naturell. Obwohl ich noch jung war, wusste ich, worum es im Leben ging, und auf jeden Fall wusste ich genug, um ein klein wenig Angst vor Tante Zu zu haben …
Rax war über die Bäume emporgestiegen und reflektierte sein falsches Licht, das keine Wärme hatte. »Ich wünschte, ich hätte daran gedacht, meinen Pelzmantel mitzunehmen«, murmelte Tante Zu.
»Wir könnten uns an die Lorin ankuscheln«, schlug ich nervös vor.
»Wie kommst du nur auf die Idee, ich könnte geneigt sein, mich einem solchen Tier zu nähern?«, gab Tante Zu zurück. Ihre Furcht nährte ihre schlechte Laune. »Glaubst du, ich wäre nicht besser als ein Lox?«
»Entschuldigung.«
»Warum läufst du so schnell? In diesem Mantel muss dir ziemlich warm geworden sein. Meine Kleidung ist recht dünn.«
Ich hätte genauso große Angst haben müssen wie sie, denn wir waren noch sehr weit von zu Hause entfernt, und trotz meines Mantels biss die Kälte wie scharfe Zähne in meine Haut. Ich steckte die Hände in die Taschen und hastete weiter, ohne zu sprechen. Als Kind dachte ich primitiver, und im Hinterkopf hatte ich immer noch die Idee mit den Lorin. Wenn mir nichts mehr helfen konnte – einschließlich Tante Zu –, würden sich die Tiere um mich kümmern.
Sie taten es immer …
»Gib mir deinen Schal, damit ich ihn mir um die Hände wickeln kann, Druv. Ich habe keine Taschen.«
Ich blieb stehen und zog mir den Wollschal vom Hals. Ich reichte ihn Tante Zu und sagte immer noch kein Wort. Ich wollte ihr keinen Anlass geben, an dem sich ihre Angst entfachen konnte. Als wir die Kuppe eines Hügels erreichten, konnte ich in weiter Ferne Lichter sehen. Aber sie waren viel zu weit entfernt. Der Winterwind pfiff um meine nackten Beine, und das Blut floss eisig kalt meinem Herzen entgegen. Ich hörte, wie Tante Zu vor sich hinmurmelte.
»Phu … Phu«, betete sie zum Sonnengott. »Phu, mir ist kalt. Wärme mich, wärme mich … hilf mir!«
Neben der Straße verliefen niedrige Hecken, die aus dornigen, empfindungslosen Pflanzen bestanden. Die Lorin wussten um unsere Furcht, sie spürten sie mit ihrer Eigenart und blieben in unserer Nähe. Ihre zottigen Köpfe waren blassblaue Flecken im Raxlicht, während sie uns neugierig beobachteten und darauf warteten, dass die Kälte den Lack der Zivilisation von unseren zitternden Körpern platzen ließ.
»Du musst mir deinen Mantel geben, Druv. Ich bin älter als du, und ich vertrage die Kälte nicht so gut.«
»Bitte lass uns zu den Lorin gehen, Tante Zu.«
»Druv, ich habe es dir schon einmal gesagt! Ich werde mich auf gar keinen Fall in die Nähe dieser abscheulichen Wilden begeben. Gib mir deinen Mantel, du ungehorsamer kleiner Junge!« Ihre Hände bearbeiteten mich wie Krallen.
»Lass mich los!« Ich wehrte mich, aber sie war viel größer, zäher und kräftiger als ich. Sie stand hinter mir und zerrte am Mantel, und ich spürte die Hartnäckigkeit ihrer Furcht.
»Davon werde ich deinem Vater erzählen, du kleines Miststück. Er wird schon wissen, was er mit dir zu tun hat. Jetzt gib mir … endlich … diesen … Mantel!« Sie unterstrich ihre Worte jeweils mit einem heftigen Ruck, und plötzlich stand ich in meiner Unterwäsche da und spürte, wie meine Körperwärme verdampfte. Tante Zu plapperte weiter vor sich hin, als sie sich die Ärmel des Mantels um die Schultern knotete. Ich sah das Licht von Rax in ihren Augen aufblitzen, und sie musterte mich heimtückisch. »Jetzt gib mir auch noch deine Hose, und dann werde ich deinem Vater nichts sagen, Druv.«
Ich rannte los, aber ich hörte, dass sie dicht hinter mir war. Ihr Atem ging keuchend, und gleichzeitig schrie sie mich an. Dann schlug plötzlich die eisige Härte der Straße gegen mich, und Tante Zu war auf mir, zerrte an meiner Kleidung und stieß ein wirres, kreischendes Geplapper aus. Meine Furcht hatte mich in einen traumartigen Zustand abdriften lassen, und bald war mir kaum noch bewusst, dass ich nackt war, hörte kaum noch ihre Schritte, die sich von mir entfernten. Während ich dalag, bemerkte ich, dass die Lorin mich aufhoben, und benommen wurde mir der Grund für die Wärme in meinem Geist klar. Dann trugen sie mich fort, umarmten mich und trösteten mich mit Gemurmel, das ich nur halb verstand.
Als ich einschlief, verblasste in meinem Kopf das Bild von Tante Zu, wie sie schreiend die Straße im Raxlicht entlangtaumelte.
Am nächsten Tag hatten die Lorin mich nach Hause gebracht. In der Wärme der Sonne Phu lieferten sie mich nackt auf unserer Türschwelle ab. Dann zogen sie sich zurück, um sich ihren eigenen Angelegenheiten zu widmen. Als ich wieder zu mir kam, sah ich noch ein paar von ihnen. Einer hockte auf einem Lox und versuchte das Tier zwischen den Deichseln eines Jauchekarrens anzustacheln, sich in Bewegung zu setzen. Ein anderer kauerte auf einem Acker und düngte die Pflanzen. Ein dritter baumelte an den Ästen eines Obo-Baums und mampfte Winternüsse. Ich öffnete die Tür und ging ins Haus. An jenem Tag badete meine Mutter mich mehrmals. Sie sagte, dass ich stank. Erst sehr viel später erfuhr ich, dass man Tante Zu weggesperrt hatte.
Später erinnerte ich mich an den Jauchekarren, ein Gefährt, das man nur selten zu Gesicht bekommt, und ich fragte meine Mutter, warum wir den Dünger nicht auf die Felder brachten, sondern ihn in die städtische Grube schütteten. Ich erwähnte die Tatsache, dass wir die Lorin dazu anregten, sich auf unseren Äckern zu erleichtern.
»Was sollen diese widerlichen Fragen!«, tadelte sie mich. »Du weißt ganz genau, dass das eine völlig andere Sache ist. Außerdem wäre es mir lieber gewesen, wenn du dich von den Lorin ferngehalten hättest.«
Zurück zum Tag unserer Abreise nach Pallahaxi. Schließlich hatten wir alle unsere Sachen auf den Motorwagen geladen, der nun verlockend nach Destill roch. Mein Vater legte stets großen Wert darauf, den Tank nach einer Fahrt wieder zu leeren, nachdem er ihn eines Morgens leer vorgefunden hatte und den Verdacht hegte, die Lorin hätten den Inhalt ausgetrunken. Das Fahrzeug wird nur selten benutzt. Die meiste Zeit steht es draußen vor dem Haus und verkündet mittels der Erto-Flagge an der Seite stumm die hohe gesellschaftliche Stellung meines Vaters.
Ich kehrte noch einmal ins Haus zurück, weil ich mich von meinem Zimmer verabschieden wollte, doch dann lauerte meine Mutter mir auf. Sie bestrich Brot mit Winternusscreme, und eine Tasse mit Cochasaft stand auf dem Tisch.
»Druv, ich möchte, dass du noch etwas isst, bevor wir fahren. In letzter Zeit hast du nicht viel gegessen.«
»Mutter«, sagte ich geduldig. »Ich habe keinen Hunger. Wir haben sowieso nie die Sachen da, die ich mag.«
Das nahm sie als Kritik an ihrer Fähigkeit, einen Haushalt zu führen. »Wie kann man von mir erwarten, dass ich mit dem wenigen Geld, das ich bekomme, alle Mäuler stopfe? Und dann diese Rationierungen! Du hast keine Ahnung, was los ist. In den Läden gibt es nichts zu kaufen, gar nichts. Vielleicht solltest du irgendwann selber einkaufen gehen, junger Mann, statt den ganzen Urlaub lang Trübsal zu blasen. Dann wüsstest du, wie es ist.«
»Ich habe doch nur gesagt, dass ich keinen Hunger habe, Mutter.«
»Essen ist Treibstoff für den Körper, Druv.« Vater stand in der Tür. »Genauso wie Destill den Motorwagen antreibt. Ohne Nahrung wird dein Körper den Betrieb einstellen. Dir wird kalt, und schließlich stirbst du. In meiner hohen Position können wir uns mit Lebensmitteln eindecken, auf die andere, die weniger Glück haben als wir, verzichten müssen. Mach dir bewusst, wie gut wir es haben.«
So schaffte es mein Vater immer wieder, mich mit wenigen knappen Worten wahnsinnig vor Wut zu machen, während er mir jegliche Möglichkeit der Gegenwehr verweigerte. Ich fragte mich, ob ihm überhaupt bewusst war, was er tat. Er musste doch begreifen, wie sehr es mir missfiel, wenn er simple Tatsachen vortrug, die mir längst bekannt waren, wenn ich mir während des Urlaubs oberlehrerhafte Vergleiche zwischen Körpern und Maschinen anhören musste. Und wenn er mir sagte, wie gut ich es hatte, konnte ich das erst recht nicht ausstehen. Ich kochte leise vor Wut, während wir eine Mahlzeit aus gebratenem Fisch und Trockenobst zu uns nahmen.
Meine Mutter hatte mir die ganze Zeit skeptische Blicke zugeworfen, und ich glaubte, dass sie wusste, wie es in mir aussah. Ich hätte es besser wissen müssen. Nach dem letzten Seitenblick – der beinahe etwas Gerissenes hatte – wandte sie sich an meinen Vater.
»Ob wir diesen Sommer wohl dieses kleine Mädchen wiedersehen? Wie war noch gleich ihr Name, Burt?«
Vater antwortete geistesabwesend. »Die Tochter des Leiters der Fischfabrik, Konch? Sie hieß Goldlippe oder etwas in der Art. Ein anständiges Mädchen, wirklich ein anständiges Mädchen.«
»Nein, Burt. Ein kleines Mädchen. Druv und sie waren so gute Freunde. Schade nur, dass ihr Vater ein Tavernenwirt ist.«
»Aha? Dann erinnere ich mich wohl doch nicht an sie.«
Ich murmelte etwas und verließ eilig den Tisch, bevor Mutter ihr eigentliches Vorhaben in die Tat umsetzen konnte. Sie wollte mich zweifellos nach dem Namen des Mädchens fragen und aufmerksam mein Gesicht beobachten, wenn ich antwortete. Ich stürmte die Treppe hinauf zu meinem Zimmer.
Das Mädchen war nicht klein gewesen. Sie war nur ein wenig kleiner als ich und fast im gleichen Alter, und ihr Name – den ich niemals vergessen werde, solange ich lebe, – war Pallahaxi-Braunauge.
Ich stand am Fenster meines Zimmers und beobachtete eine Gruppe Kinder, die rund um den öffentlichen Radiator auf der anderen Straßenseite spielten, und dabei dachte ich an Braunauge. Ich überlegte, was sie wohl den ganzen Winter lang in ihrer Zauberstadt Pallahaxi gemacht hatte – und ob sie irgendwann auch einmal an mich gedacht hatte. Ich fragte mich, ob sie sich an mich erinnerte, wenn wir uns wiedersahen. Die Tage der Kinderzeit vergehen langsam, und in einem ganzen Jahr passiert sehr viel. Außerdem hatten Braunauge und ich uns trotz der Bemerkung meiner Mutter nur flüchtig kennengelernt. Erst in den letzten Tagen des Urlaubs waren wir dazugekommen, miteinander zu sprechen. So schüchtern können Kinder in diesem Alter manchmal sein.
Aber seitdem war kein Tag vergangen, an dem ich ihr Gesicht nicht vor meinem geistigen Auge gesehen hatte, die süßen Grübchen in ihren Wangen, wenn sie lächelte – was sie oft getan hatte –, das schimmernde Braun ihrer großen Augen, wenn sie traurig war –, was sie einmal war, als wir uns voneinander verabschiedet hatten, während meine Eltern mit einer Mischung aus Nachsicht und Erleichterung zugesehen hatten. Sie war die Tochter eines Tavernenwirts, und sie wohnte in einem Haus, in dem die Leute tranken. Ich wusste, wie froh meine Eltern gewesen waren, dass der Urlaub vorbei war.
Das Letzte, was ich aus meinem Zimmer mitnahm, war ein kleiner grüner Armreif. Braunauge hatte ihn eines Tages verloren, und ich hatte ihn aufgehoben, aber ohne ihn ihr wiederzugeben. Ich wollte ihr den Reif als Begrüßungsgeschenk geben, weil ich mich immer noch zu schüchtern fühlte, um einfach auf sie zuzugehen. Ich steckte das Schmuckstück in meine Hosentasche und ging wieder nach unten zu meinen Eltern, die zum Aufbruch bereit waren.
Als ich durch die Küche ging, bemerkte ich einen Glaskrug, der leer war. Ich hob ihn auf, untersuchte ihn und schnupperte daran.
Mutter hatte meinen Eiskobold weggeschüttet.
2
DIE LETZTEN VORBEREITUNGEN wurden schweigend ausgeführt. Vater entzündete feierlich die Brenner, während ich immer noch darunter litt, wie heimtückisch mein Eiskobold entsorgt worden war. Ich beobachtete die Angelegenheit aus der nötigen Distanz und hoffte insgeheim, dass ihm das Ding um die Ohren flog. Es kam zum üblichen gedämpften Fuff, als sich das verdunstete Destill entzündete. Kurz darauf stieg Dampf von den Stangen und Zylindern auf, und das Zischen im Kessel verkündete, dass der Motorwagen fahrbereit war. Wir stiegen ein: Vater und Mutter nebeneinander auf den vorderen Sitzen und ich hinter ihnen neben dem Kessel. Die angenehme Wärme linderte meine Wut, denn es war nahezu unmöglich, sich auf dem Rücksitz eines Motorwagens für längere Zeit schlecht zu fühlen. Bald fuhren wir durch die Nebenstraßen von Alika, wo uns die Leute schweigend beobachteten. Niemand winkte, wie sie es in den Vorjahren getan hatten.
»Verfrorene Parls!«, rief ein kleines Mädchen ohne Arme.
Wir kamen am letzten öffentlichen Radiator vorbei, einem kleinen Heizgerät aus senkrechten Röhren, von denen eine feine Dampfwolke aufstieg, die offenbar aus einem Leck austrat. Dann waren wir auf dem unbesiedelten Land. Vater und Mutter unterhielten sich, aber ich konnte nicht verstehen, was sie sagten, weil die Kolben genau hinter mir zischten und stampften. Ich beugte mich vor.
»War es hier, wo man Tante Zu gefunden hat?«, brüllte ich.
Natürlich wusste ich, dass man sie hier gefunden hatte. Die Leute haben darüber geredet. Anscheinend hatte man einen Suchtrupp losgeschickt, ein paar tapfere Seelen, die sich mit dicken Pelzen und warmen Ziegelsteinen gewappnet hatten und deren Bäuche zweifellos mit Destill gefüllt waren, wie ich mir gut vorstellen konnte. Tante Zu hatte man nur hundert Schritt von der Sicherheit des öffentlichen Radiators entfernt gefunden. Sie hatte einen Anemonenbaum umarmt und versucht, den glatten Stamm hinaufzuklettern, um auf der Suche nach Wärme in die fragwürdige Zuflucht seines Bauches zu kriechen. Es heißt, sie hätte pausenlos geschrien und die Finger so tief in das zähe Fleisch des Baumes gegraben, dass man es mit Stöcken aufhebeln musste. Sie war nackt gewesen, hatte mein Informant mir erschaudernd anvertraut. Zu diesem Zeitpunkt zirkulierte die Geschichte bereits an der Schule. Der Baum hatte ihr die Kleidung vom Rücken gerissen und verzehrt, aber Tante Zu war zu schwer gewesen, um von ihm emporgehoben zu werden, und zu schwach, um selbst hinaufklettern zu können.
»Es wäre mir lieber, wenn du deine Tante nicht erwähnen würdest, Druv«, sagte Mutter. »Es gibt Dinge, an die man sich nicht ständig erinnern sollte. Schaut mal, welch hübscher Anblick!«
Hügel wellten sich vor uns wie langsame Meereswogen, wenn die Grume ihren Höhepunkt erreicht hatte. Stellenweise waren Äcker zu sehen, auf denen Wurzelgemüse angebaut wurde, aber größtenteils war das Land eine freie Fläche, auf der in der ständigen Sonne des frühen Sommers friedlich Lox grasten. Nach dem langen Winter sah alles frisch und grün aus, und noch strömten die Bäche und Flüsse. Später würden sie unter der Hitze austrocknen. In der Nähe zog eine Gruppe von vier Lox einen schweren Pflug durch den Boden. Zwischen ihnen gingen aufrecht zwei Lorin, um gelegentlich ihre glatten Flanken zu tätscheln und sie zweifellos mental zu ermutigen. Auf dem Pflug hockte ein Farmer auf einem wackligen Sitz und stieß bedeutungslose Farmerrufe aus. Wie auch viele andere Leute, die ihr Leben unter der Sonne Phu verbrachten, war er mutiert. In seinem Fall konnte er sich eines weiteren Arms auf der rechten Körperseite rühmen. In der Hand schwang er eine Peitsche.
Wir kamen an vereinzelten kleinen Dörfern vorbei und nahmen von Zeit zu Zeit an winzigen Hütten Wasser auf, wo uns die Farmerfrauen misstrauisch aus niedrigen Türrahmen beäugten, hinter denen sich undeutlich Kinder tummelten. Hier waren die Mutationen häufiger, und Vater beglückwünschte einen Mann zu seiner vielfingrigen Hand.
Der Mann setzte die Arbeit an der Pumpe fort und ließ in rhythmischen Stößen Wasser hervorsprudeln. »Ich schätze, Phu hat es gut mit mir gemeint«, keuchte er. »Das Leben auf diesem Land ist hart. Ein Mann braucht jede Hilfe, die er bekommen kann.« Seine Finger tanzten über die Maschinen des Motorwagens, überprüften hier einen Stift und zogen dort eine Schraube fest. Er steckte einen alten Ledertrichter in den Wassertank und neigte vorsichtig den Eimer.
»Ich vermute, auch in dieser Gegend herrscht Knappheit an vielem, wegen des Krieges …«, sagte Vater mit überraschender Zurückhaltung. Hier auf dem primitiven Land war er ausnahmsweise nicht in seinem Element. Durch die offene Tür der Hütte erhaschte ich einen kurzen Blick auf einen Lorin, der tatsächlich auf einem Stuhl saß, wie es schien.
»Welcher Krieg?«, fragte der Mann.
Ich dachte sehr lange über diese Frage nach, während wir unsere Reise durch das Ödland der Äquatorialregion fortsetzten und die Sonne ihre Kreise immer näher am Horizont zog. Unterwegs verlor ich das Gefühl für die Zeit, weil im ständigen Sonnenlicht des frühen Sommers ein Standardtag auf den nächsten folgte. Nur meine regelmäßige Müdigkeit erinnerte mich daran, dass die Zeit weiterhin verging. Das Einzige, was existierte, schienen die Wüste zu sein, eine gelegentliche Wühltratte, der Sitz unter mir und das Schnaufen des Dampfmotors.
Dann gab es eine Unterbrechung der Eintönigkeit, als wir auf einen Fischlaster stießen, der am Straßenrand liegengeblieben war. Davor hockten niedergeschlagen zwei Männer. Wie es für sie typisch war, saßen ein paar Lorin um das Fahrzeug herum, nachdem sie mitten in der leeren Wüste materialisiert waren, und imitierten sinnlos die verzweifelte Haltung der Männer.
Mein Vater murmelte meiner Mutter etwas zu, und für mich bestand kein Zweifel, dass er überlegte, einfach vorbeizufahren. Doch dann bremste er im letzten Moment und kam mehrere Schritt hinter dem Laster zum Stehen. Es stank furchtbar nach Fisch.
»Ich kann Sie bis Bexton mitnehmen«, rief er über die Schulter den Männern zu, die bereits herbeigelaufen kamen. »Dort können Sie jemanden benachrichtigen. Leider müssen Sie auf dem Treibstofftank Platz nehmen, weil es drinnen zu eng ist.«
Die Männer bedankten sich brummend, kletterten hinter mir auf den Motorwagen, und schon setzten wir uns wieder in Bewegung. »Hallo, Junge«, rief einer von ihnen mir durch das Labyrinth der glänzenden Stangen zu.
»Was ist mit dem Laster passiert?«, brüllte ich zurück. Es gefiel mir nicht, dass sie in meine Privatsphäre eingedrungen waren, und ich dachte mir, dass sich der Mann vielleicht über meine Frage ärgerte.
Er grinste bedauernd und stieg über das Trittbrett nach vorn, wo er sich einfach neben mich setzte und mich zwang, näher an den Kessel heranzurücken. Ich starrte geradeaus, weil ich mich über mich selbst ärgerte, ihn zu einem Gespräch eingeladen zu haben. Ausnahmsweise hatten meine Eltern Recht behalten. Es lohnte sich nicht, Vertretern dieser Klasse freundlich entgegenzutreten.
»Das verfrorene Ding ist verstopft«, erklärte er auf seine bodenständige Art. »Weil’s kein Destill gibt.« Er blickte zu den Kanistern auf dem Tank. »Außer für ein paar Verfrorene, die Glück haben. Wir haben den Laster umbauen lassen, damit er auf Holz fährt. Also muss man ein verfrorenes großes Feuer unter dem Kessel machen und darf nicht vergessen, ständig Holzscheite nachzulegen. Das haben wir alles völlig richtig gemacht, aber in der Fischfabrik haben sie Mist gebaut. Man hat vergessen, uns Bürsten mitzugeben, mit denen wir die Röhren ausputzen können. Sind schließlich sehr lange und dünne Röhren. Und jetzt sind alle mit verfrorenem Ruß verstopft, und der verfrorene Laster fährt nicht mehr.«
»Es besteht kein Grund, dass Sie pausenlos fluchen.«
»Ein eingebildeter kleiner Verfrorener, was? Dein Vater ist bestimmt irgend so ein Parl, darauf wette ich. Kann gar nicht anders sein, wenn er einen solchen Motorwagen hat.« Sein Blick wanderte immer wieder zu den Kanistern hinüber, und seine Gegenwart wurde allmählich unerträglich, bedrohlich. Meine Eltern saßen vorn, ohne etwas zu bemerken, und diskutierten über Rationierungen.
»Vater hat einen bedeutenden Posten«, sagte ich mit Entschiedenheit, um meine Angst zu überspielen. Der Wortlaut war nicht meiner, ich wiederholte nur, was ich bei vielen Gelegenheiten von meiner Mutter gehört hatte. Zum ersten Mal kam mir in den Sinn, dass ich gar nicht genau wusste, was die Worte wirklich bedeuteten. Ich stellte mir mehrere Bergspitzen vor, von winterlichem Schnee bedeckt. Vater saß auf dem höchsten Gipfel, während seine Untergebenen auf den niedrigeren hockten. Die Allgemeinheit kauerte sich in den Tälern zusammen, voller Ehrfurcht vor der Erhabenheit der Berge.
»Davon bin ich überzeugt, mein Junge. Sitzt bestimmt jeden Tag am selben Schreibtisch – außer einmal im Jahr, wenn er mit euch allen in Urlaub fährt, an die Küste, um die Grume zu beobachten, und ihr wohnt bestimmt in einem Hotel, das Seeblick heißt.«
»Wenn Sie es unbedingt wissen wollen: Mein Vater besitzt ein Ferienhaus in Pallahaxi.«
»Das kann ich mir vorstellen.« Er lächelte mich mit schwarzen Zähnen an, während seine Augen kalt blieben. »Jetzt würde ich dich gerne was fragen. Was glaubst du, was ich den ganzen Tag lang mache?«
ENDE DER LESEPROBE