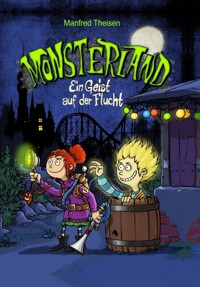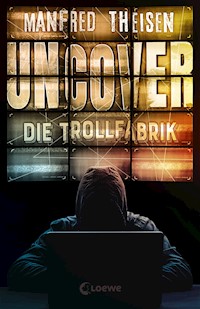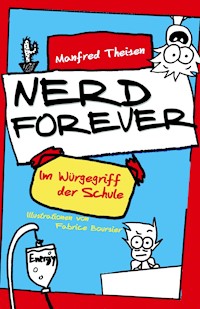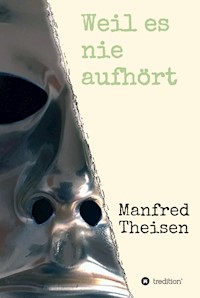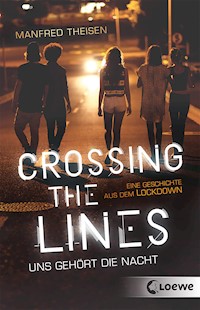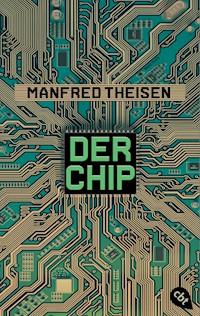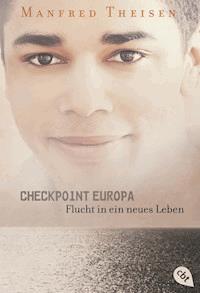
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Basil ist aus Syrien nach Deutschland geflohen. Und versucht, hier Fuß zu fassen. Aber er hat nicht nur seine Eltern im Krieg verloren, sondern auch seine große Liebe Sahra. Er und sie wurden auf der Flucht getrennt. So macht er sich auf die Suche nach ihr. Mit von der Partie ist der Journalist Tobias, der sich an ihn heftet, um einen Roman zu schreiben. Basil merkt jedoch bald, dass die Suche ein Wagnis ist, denn die Gespenster der Vergangenheit sitzen ihm im Nacken …
Über das Schicksal eines Jugendlichen, der mehr erlebt hat, als viele andere in einem Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© Isabelle Grubert
DER AUTOR
Der Autor und Politologe Manfred Theisen arbeitete als Zeitungsredakteur und forschte im Nahen Osten. Seine Lesereisen und Recherchen führten ihn in die arabischen Staaten. Heute lebt er mit seiner Familie in Köln.
Weitere lieferbare Bücher bei cbt:
Amok (30175)
Täglich die Angst (30363)
Weil es nie aufhört (30902)
Checkpoint Jerusalem (31107)
MANFRED THEISEN
CHECKPOINT EUROPA
Flucht in ein neues Leben
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Originalausgabe Juni 2016
© 2016 by cbt Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christina Neiske
Umschlaggestaltung: init | Kommunikationsdesign, Bad Oeynhausen, unter Verwendung mehrerer Motive von Thinkstock (LuminaStock, Design Pics)
he ∙ Herstellung: wei
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-16833-9V001www.cbt-buecher.de
Ich vermisse dich!
Ich tippe die Zeilen in mein Handy und schaue darauf. Dann warte ich in der Kälte, obwohl ich weiß, dass Sahra nie antwortet. Ihre Nummer ist tot. Es erscheint nur ein Häkchen. Sie hat meine Nachricht nicht gesehen. Das Display verdunkelt sich. So gehe ich weiter die nächtliche Allee entlang in diesem Park in Köln. Es ist Winter und die Luft ist eisig. Wie Sahra wohl heute aussieht? Über ein Jahr ist bereits vergangen, seit wir uns auf der Flucht aus den Augen verloren haben. Seither habe ich nichts mehr von ihr gehört. Jetzt bin ich siebzehn, genau wie sie. Ich mag deine Haut, hellbraun und zart ist sie, hat Sahra gesagt und mich geküsst. Nun weiß ich nicht einmal, ob sie noch lebt.
Wenn Schnee fällt, ist alles sauber und rein in Deutschland, als gäbe es keine Vergangenheit, kein Gestern und keinen Krieg. Das ist schön. Sicherheit ist ein gutes Gefühl. Alles hier gibt mir Sicherheit. Ich mag dieses Land und die Stadt. Ich gehe allein durch den Park, wie ein Fuchs, der in der Dunkelheit sein Revier durchstreift. In Syrien habe ich nie einen Fuchs gesehen. Ich weiß nicht einmal, ob es dort Füchse gibt.
Die Menschen hier haben Jahreszeiten: Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst. Seit über einem Jahr bin ich schon in Deutschland. Meine Flucht hat zwei Jahre gedauert – über die Türkei nach Griechenland, hinüber nach Italien, dann nach Frankreich und schließlich über Paris hierher.
Das Wort Jahre ist der Plural von Jahr. Im Deutschen gibt es acht verschiedene Pluralendungen wie das Jahr – die Jahre,das Haus – die Häuser oder die Maus und die Mäuser. Oder heißt es die Mäuse? Ich weiß es nicht, obwohl ich jeden Tag in eine deutsche Schule gehe, deutsch lese, lerne und mit meinem Freund Tobias deutsch spreche. Er ist ein Journalist und schreibt meine Geschichte auf, meine Flucht von Syrien hierher, meine Reise durch die Tage und die Nächte. Das Buch soll dick wie ein Roman werden. Tobias sagt, er bewundere meine Wissbegier. Er kenne so viele übersättigte Jugendliche in Deutschland, die sich für nichts interessieren. Ich hingegen würde alles aufsaugen wie ein Schwamm. Vielleicht sagt er es auch nur, um mir zu gefallen. Dabei gefällt mir das gar nicht, denn ich möchte genauso sein wie die anderen.
Ich träume sogar in Deutsch. Die Sprache ist kompliziert, hat aber ihre Ordnung, genau wie dieser Park, in dem alles im rechten Winkel angelegt ist. Weiße Schwäne schwimmen tagsüber auf dem rechteckigen Weiher, und selbst die Sträucher sind zu Würfeln geschnitten, als ob sie nicht gewachsen wären, sondern aus einer Sträucher- und Bäumefabrik stammten. Die Deutschen formen ihr Land und zählen alles. Sogar die Vogelarten, die aussterben. Ordnung ist ihre Religion. Es ist eine gute Religion, denn ohne Ordnung herrscht nur Chaos. Die Menschen hier haben alles durchdacht und organisiert.
Das mag ich!
Genau wie die deutschen Mädchen.
Aber die sind so weit weg – weiter als Sahra es je sein kann. Selbst wenn sie nicht mehr leben würde, wäre sie mir näher als irgendein deutsches Mädchen. In der Schule sitzt Mia Thielen neben mir; sie legt immer ihr rotes Haar zur Seite, wenn sie mit mir redet. Sie ist hübsch, ihre Haut ist ganz hell und sie hat Sommersprossen um die Nase. Doch für sie bin ich immer noch ein Flüchtling mit einem Aufenthaltstitel. Ich helfe ihr in Mathematik und sie lächelt mich aus grünen Augen an. Näher als ein Lächeln komme ich nicht an sie heran. Ich gehöre einfach nicht hierher und nicht zu ihr, sondern zu Sahra. Irgendwann werde ich sie finden und zu mir holen.
Keiner aus meiner Klasse hat mich bislang im Heim besucht. Sie wissen nicht, wie ich lebe. Dabei hat die Schule sogar zum Spenden für Flüchtlinge aufgerufen. Im Fernsehen zeigen sie Bilder von Flüchtlingen, Tag für Tag kommen mehr und mehr. Syrien ist unterwegs, der Libanon ist unterwegs und auch der Irak. Libyen, Algerien und Marokko. Erst hat sich das Geld auf der Welt bewegt, dann die Waren und nun sind es die Menschen. In der U-Bahn habe ich ein Graffiti gelesen:
Wir Deutschen haben die Waffen geschickt!
Jetzt kommen die Menschen!
Die Deutschen haben die neuen Flüchtlinge mit offenen Armen in München und Berlin empfangen, in Köln und Dortmund. Als ich im Saarland die Grenze von Frankreich nach Deutschland überquert habe, stand niemand am Bahnhof, um mich zu begrüßen.
Wieder schaue ich auf das schwarze Display. Keine Antwort von Sahra. Ich vermisse sie. Ich werde sie suchen, das habe ich mir geschworen. Und ich werde sie finden! Auch wenn es ihr Grab ist.
Das Licht der Laternen hier im Park ist weiß wie der Schnee. Im Herbst raschelt der Boden bei jedem Schritt, jetzt verschluckt der Schnee die Schritte und zeigt meine Spur, die Spur des Fuchses. Ich liebe den Schnee. Er ist rein wie ein weißes Blatt Papier. Ich schreibe Sahras Namen ordentlich mit einem Stock und frage mich, ob ich verrückt geworden bin, weil ich hier unter der Laterne ihren Namen in arabischen Buchstaben in den Schnee schreibe. In Syrien war ich der Beste in Englisch. Jetzt will ich der Beste in Deutsch sein. Ich habe schon auf der Reise Deutsch gelernt mit dem Vokabeltrainer vom Goethe-Institut auf dem Handy.
Das Rauschen der Autobahn, die direkt in die Kölner City führt, dringt zu mir herüber. Diese Straße schläft nie. Ich verlasse den Park über die Brücke, unter mir braust der Verkehr. Die Reifen der Fahrzeuge mahlen den Schnee zu Matsch. Ich liebe Autos, aber sie zerschneiden alles mit ihren Straßen. Abertausende kleine Asphaltadern haben die Stadt fest im Griff. Ich habe gelesen, dass in Köln die Menschen so dicht beieinander leben, als ob man die gesamte Menschheit auf dem australischen Kontinent zusammenstellen würde. Ich hätte gern ein Fahrrad, doch ich habe nie gelernt, das Gleichgewicht zu halten. Mein Vater wollte immer, dass ich etwas lerne, und ich will lernen. Manchmal frage ich mich jedoch, was es nutzt, wenn man viel weiß, aber ein Araber ist. Im Netz war ein Artikel über Hochbegabte: Die Deutschen denken bei Hochbegabten immer an Menschen mit weißer Haut, an US-Amerikaner, Franzosen, Engländer, vielleicht noch an Japaner und Chinesen, aber nie an einen Schwarzen aus dem Kongo, einen Somali, ein Mädchen aus Eritrea. Hochbegabung ist hellhäutig. Das scheint ein Gesetz zu sein.
Vor einem halben Jahr sollte ich ein Praktikum machen. Ich habe mich in einer Autowerkstatt, einem Supermarkt und in einem Lampengeschäft beworben, aber egal wo, sie wollten mich nicht. Mein Deutsch ist sehr gut, sagt meine Lehrerin, aber in den Betrieben wollen sie mich nicht, obwohl ich im Fernsehen oft höre, dass wir Syrer gerne genommen werden. Jetzt habe ich ein anderes Ziel: Ich werde Fremdsprachenkorrespondent. Auf dem Amt meinten sie, dass in den nächsten Jahren mehr Menschen in der Industrie gesucht werden, die arabisch sprechen und auch noch gutes Englisch. Ich sei sprachbegabt, auch mein Französisch könne sich sehen lassen, und ich solle mich ruhig mal bei der Herbrandt-Stiftung bewerben. Diese vergebe schon länger Stipendien für Migranten und habe sich nun auf Flüchtlinge spezialisiert. Man dürfe nur noch nicht länger als fünf Jahre in Deutschland sein. Daher könne ich mich problemlos bewerben. Ich glaube trotzdem nicht, dass es funktioniert. Nichts, was mit Arbeit zu tun hat, funktioniert.
Ich laufe durch die engen Straßen des Wohnviertels auf der anderen Seite der Brücke. Die Jogger haben längst ihre Runden gedreht und stehen unter den Duschen. Ein Mädchen ist noch draußen. Sie kommt mir in einem Mantel mit weißem Pelzkragen entgegen und schaut auf ihre Schuhe. Schon von Weitem ist sie hübsch wie eine Reklame. Sie hat so rotes Haar wie Mia. Als sie den Kopf hebt, traue ich mich nicht, sie weiter anzusehen, und blicke nach unten. Vor einer Woche wurde ein Mädchen im Park vergewaltigt. Keiner aus meiner Klasse glaubt, dass es ein Flüchtling gewesen ist. Warum betonen sie es so? Dann ist das Mädchen blicklos an mir vorbei. Ich sehe ihr kurz nach, betrachte ihre Spuren im Schnee.
Als ich nach meiner Ankunft in Deutschland noch in der Flüchtlingsunterkunft in Lebach im Saarland untergebracht war, haben die Mädchen die Straßenseite gewechselt, wenn jemand wie ich auf sie zukam. Sie hatten Angst vor uns. Köln ist eine große Stadt. Hier leben zu viele Leute, um vor jedem Angst zu haben. Aber in Lebach war das so. Ich lebte dort nur, weil die Behörden glaubten, ich sei schon achtzehn Jahre alt und kein Jugendlicher mehr. Zwei Jungen aus unserem Haus haben jeden Tag Mädchen angesprochen. Jasser und Wakur, zwei Kurden aus dem Irak. Sie sind zum Kaufland gegangen und haben dort die Mädchen gefragt, wie sie zu dieser oder jener Straße kommen könnten. Dann haben sie gefragt, wie die Körperteile heißen. Bein oder Knie oder so. Und dann haben sie ihren Google-Übersetzer eingeschaltet, Ich liebe dich auf Arabisch eingegeben und der Übersetzer hat auf Deutsch »Ich liebe dich« zu den Mädchen gesagt. Doch keines der Mädchen hat ihnen auf Deutsch die gleichen Worte gesagt. Jasser und Wakur wollten, dass ich mit ihnen komme und Mädchen anmache. Aber ich wollte das nicht. Ich schäme mich. Jetzt habe ich im Fernsehen Bilder von Lebach gesehen. Tausende von Flüchtlingen sind im Lager untergebracht. Ich will nicht wissen, wie viele Personen sich nun dort ein Zimmer teilen müssen. Eigentlich hätte ich von Lebach gar nicht nach Köln gedurft, aber ich bin hier. Und keiner fragt mehr warum.
Vor unserem Heim bleibe ich stehen. Es ist ein zweistöckiges Haus mit flachem Dach. Unsere Betreuerin heißt Nina: kräftige Beine, kräftige Arme, ein Körper wie ein Viereck. Sie ist eine nette Frau mit einem freundlichen runden Gesicht und einem Ring in der Nase. Warum sie ihn trägt, weiß ich nicht. Ich frage so etwas nicht. Am Fenster sehe ich Yasin auf und ab gehen. Er wird nächste Woche achtzehn und trägt als Einziger von uns einen Vollbart. Ein Mann muss einen Bart tragen, sagt er. Das sei eine religiöse Pflicht. Er belehrt uns ständig. Als ob wir den Koran nicht kennen würden.
Ich will nicht ins Heim, nicht in unsere Küche, wo Yasin jetzt ist, wo sich alle treffen und sagen, sie seien Freunde. Das ist eine Lüge! Yasin glaubt, dass ich in meinem Herzen noch ein Muslim sei. Ich hätte keine christliche Taufe empfangen, daher sei ich gemäß der Hadith ein Muslim. Schließlich ist in den Augen der Muslime jedes Neugeborene, egal, welchen Glauben seine Eltern besitzen, automatisch ein Muslim, bis die Eltern das Kind zu einem Christen, einem Juden oder was auch immer taufen. Er sagt dies, obwohl ich jetzt ein Kreuz unter dem Hemd trage. Kurz vor Weihnachten habe ich mir das Christensymbol in einem Geschäft am Kölner Dom gekauft. Es ist so groß wie mein Handteller und aus Olivenholz. Ich glaube nicht an Gott, aber ein solches Kreuz beruhigt. Mir ist trotz des Schnees nicht kalt hier draußen. Die Daunenjacke schützt mich wie den Wal das Fett. Und die Mütze ist warm.
Ich lasse mich einfach rechts neben dem Hauseingang rücklings in den Schnee fallen. Es ist ein gutes Gefühl, auf dem Rücken zu liegen und in den Himmel hinein zu denken. Die Schneeflocken schweben auf mein Gesicht wie hinabrieselnde Sterne. Eine Schneeflocke fällt mir direkt ins Auge. Es brennt. Ich schließe die Augen, konzentriere mich auf meinen Atem, spüre die Kälte, die langsam in meine Jacke dringt, und höre die Geräusche von früher, denke an Sahra, an unsere Überfahrt als blinde Passagiere vom griechischen Hafen Patras ins italienische Ancona. Schließe meine Augen fester und erinnere mich, wie wir uns auf dem Parkdeck einer Fähre in einer Nische verborgen hatten und darauf warteten, dass die Leute endlich ihre Autos verließen. Khalil war bei uns. Ich hatte Sahra und ihn in Athen kennengelernt. Sie lebten damals im gleichen Lager und wir teilten uns eine Suppe. Er ist Palästinenser und aufbrausend wie ein wilder Stier.
Nachdem die Autos geparkt waren, öffneten sich die Türen der Wagen. Heraus stiegen Erwachsene und Kinder mit Taschen und Rucksäcken, laut diskutierend, nur wenige Meter vor uns stritten sich Bruder und Schwester wie Feinde, Kinder sprangen zwischen den Wagen umher, schrien, endlich frei, endlich raus aus der Zelle. Die meisten Passagiere waren Touristen, die von Griechenland zurück nach Italien, Österreich, in die Schweiz, nach Frankreich oder Deutschland wollten. Der ganze Bauch des Schiffes war ein einziges lautes Gewimmel und Geschrei. Bunt und aufgeregt. Eine Sirene ertönte. Die Menschen zwängten sich zwischen den Wagen hindurch zu den Türen, hinter denen die Treppen und Aufzüge liegen mussten, die sie hinauf auf die oberen Decks der Fähre brachten. Kurz darauf wurden die Türen wieder lautstark verriegelt. Plötzlich war es ruhig hier unten. Nur die Schritte der Arbeiter und Wachleute waren noch zu hören. Wir mussten aufpassen, dass sie uns nicht entdeckten. Gebeugt schlich ich mich mit Khalil und Sahra durch die Reihen der Autos. Khalil und Sahra probierten rechts die Türen, ich zog links an den Griffen.
»Der hier ist offen«, zischte uns Khalil zu.
Er stieg vorn in den Toyota, Sahra kletterte flink auf die Rückbank. Ich öffnete vorsichtig die gegenüberliegende Hintertür. Auf meiner Seite war ein verkrümelter Kindersitz befestigt. Nachdem ich ihn abmontiert und nach vorne geworfen hatte, setzte ich mich, machte mich klein und zog den Kopf ein. Khalil hockte vorne geduckt auf dem Beifahrersitz, aber es gelang ihm nicht, sich zu verstecken – er ist ein Kerl wie ein Baum, viel kleiner kann er sich gar nicht machen. Sahra hätte schon eher ins Handschuhfach gepasst, so zierlich ist sie. Um uns herum standen die Wagen dicht an dicht. Ob sie während der Überfahrt nach Italien die ganze Zeit die Beleuchtung auf dem Parkdeck brennen lassen würden?
Ich war so wach, dass ich den Geruch des Wagens riechen konnte. Draußen hatte es nach Meer, Öl und Abgasen gestunken, hier stank es nach Kunststoff und Plastik. Unter meinem Po pikste etwas: Es war ein Spielzeugauto, ein Porsche Cayenne. Eine Red-Bull-Dose stand in der Mittelkonsole. Sahra und ich versuchten uns flach hinzulegen, damit wir von außen nicht so leicht entdeckt werden konnten, falls ein Wachmann an den Wagen vorbeigehen würde. Meine Beine hatte ich eng an den Körper gezogen wie zum Schlafen und mit den Füßen stieß ich an die Tür.
Das Schiff ruckte an.
Ob es abgelegt hatte? Verließen wir gerade den Hafen? Es krachte draußen. Metall stieß auf Metall, rieb sich laut. Ich wollte endlich raus aus Griechenland! Es war eine furchtbare Zeit gewesen. Ich hatte wie ein Hund auf der Straße gelebt; nur die baptistischen Christen in Athen waren nett zu mir gewesen. Deshalb bin ich heute kein Muslim mehr, sondern Christ. Obwohl ich nicht verstehe, warum die Christen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Gott kann doch gar keinen Sohn haben! Das ist unlogisch. Er hat Adam erschaffen und Eva aus seiner Rippe. Aber warum hat Maria Jesus geboren? Warum brauchte Gott eine Frau? Ich verstehe das nicht! Keiner kann es verstehen. Dennoch glaube ich, es ist besser für mich, ein Christ zu sein. Die Christen in Europa haben Angst vor den Muslimen. Das Kreuz beruhigt sie.
Khalil versuchte sich vorn vor dem Sitz zusammenzukauern, aber es gelang ihm nicht. Er schaute über die Red-Bull-Dose zu mir wie eine zu kräftige Schildkröte aus einem zu kleinen Panzer. Dann kämmte er sich das Haar mit den Fingern zur Seite. Ihm fehlt das vordere Glied seines rechten Zeigefingers. Angeblich hatte er den Finger als Kind in eine Coladose gesteckt und nicht wieder rausgekriegt. Der Finger hatte geblutet und sich heftig entzündet. Weil ihn niemand ordentlich behandeln konnte, eiterte er und musste schließlich amputiert werden. Khalil stammt aus der Stadt Burj el-Barajneh. Das ist eigentlich gar keine Stadt, sondern ein Flüchtlingslager, wo die Menschen dicht wie Fische in einem Netz leben, wo sich die Stromleitungen wie Spinnfäden von Haus zu Haus ziehen und den Menschen im Sommer die Luft zum Atmen nehmen. Wenn Khalil über Burj el-Barajneh redete, dann sprach er über seine Familie, die noch dort lebt, und in jedem Wort wohnte sein Hass gegen die Juden.
Denn früher war der Ort ein Flüchtlingslager jener Palästinenser, die aus Israel vertrieben worden waren. Sie lebten in Zelten vom Roten Kreuz, bis die Menschen sich irgendwann Häuser gebaut haben. Aus Tausenden wurden Zehntausende Bewohner. Auf die flachen Häuser setzten sie Stockwerke, eines nach dem anderen. Und ab und an bricht einfach eines dieser Häuser unter der erdrückenden Last der Stockwerke zusammen und begräbt seine Bewohner. Burj el-Barajneh ist nicht für die Ewigkeit gebaut, doch nun leben schon Generationen dort, und Khalil wurde da geboren. Nur ein Vogel kann sich an einem solchen Ort frei fühlen. Menschen haben Füße und Wurzeln, die sie festhalten. Sie sind gefangen bis zu ihrem Tod in diesem Grab der Lebenden. Und sie dürfen nie mehr zurück in ihre Heimat Palästina, weil es heute Israel ist.
Ich blickte zu Khalil, und er bedeutete mir mit der Hand, dass ich mich noch mehr ducken sollte. Ich legte den Kopf ganz auf den Sitz, fühlte Sahras Wärme oben an meiner Schläfe, wir lagen Kopf an Kopf. Noch heute, hier im Schnee vor dem Heim liegend, spüre ich ihre Nähe. Die Vergangenheit ist gut, wenn ich an Sahra denke. Ich starrte damals wie gebannt auf die Plastikflasche Vittel, die hinter dem Vordersitz des Toyotas klemmte. Vermutlich hatte der kleine Junge, der eben im Kindersitz gesessen hatte, sie leer genuckelt, es war nur noch eine winzige Pfütze darin. Ich hatte Durst, meine Zunge klebte schon am Gaumen fest. Warum hatten wir eben nicht noch etwas getrunken? Warum hatten wir kein Wasser mitgenommen? Es war eine Dummheit. Wir wussten, es würde eine lange Überfahrt von Patras nach Ancona, aber dass wir auf der Reise fast verdursten sollten, ahnten Khalil und Sahra in diesem Moment vermutlich genau so wenig wie ich. Auf der Vittelflasche erkannte ich das Wort Wasser.
»Das ist Deutsch!«, sagte ich laut. »Wir sind in einem Auto von Deutschen!«
»Sei still!«, zischte mir Khalil zu. »Wie verrückt bist du eigentlich?«
Er sprach ein härteres Arabisch als ich. Ich mag das nicht. Es klingt, als ob er die Worte wie ein wilder Hund bellt. Khalils Augen sind schwarz und voller Hass auf die USA, auf die Juden und auf jeden, der etwas gegen Palästina sagt oder etwas Gutes über die USA. Ich hörte Sahras Atem. Khalil wollte damals schon unbedingt nach Paris; ich zu meinem Onkel nach Deutschland und Sahra nur weg – nach Schweden, Norwegen oder Deutschland. Irgendwohin, wo kein Krieg ist.
Ich glaube, sie wollte mit mir kommen, weil sie mich damals schon mochte. Sie ist so zart, verletzlich wie ein Blatt, und sie kommt auch aus Syrien, aus der Nähe meiner Heimatstadt Homs, aber von einem kleinen Dorf auf dem Land, wo die Zeit stets langsamer lief. Sie hat ihre Eltern auf der Flucht von der Türkei nach Griechenland verloren. Die griechische Küstenwache hatte mit einem langen Stock ein Loch in das Schlauchboot gestochen, sodass es untergegangen ist. Ich konnte es kaum glauben, als sie davon erzählt hat, doch ihre Augen sagen immer die Wahrheit. Warum sollte sie lügen?
Seit dem Tod ihrer Eltern war sie ein einsamer Mensch gewesen. Doch jetzt hatte sie ja mich! Ich lag mit ihr in diesem Toyota und schwor alles zu tun, damit ihr nichts Böses geschieht. Ich hatte ein Kribbeln im Bauch. Ihre Augen sind dunkel wie ihr Haar. Ich sah ihr Gesicht vor mir, obwohl wir uns nicht sehen konnten. Aber ihre Nase, ihre Augen, die beiden Fältchen um die Mundwinkel, wenn sie lächelt, das alles werde ich niemals vergessen, egal, was noch geschieht. Ob ich im Schnee vor unserem Heim oder neben ihr auf der Rückbank des Toyotas liege, Sahra ist immer bei mir. Die Erinnerungen und die Bilder von ihr sind einfach da, wie der Schnee, der auf mein Gesicht fällt.
Draußen schepperte etwas. Wieder stieß Metall auf Metall. Vielleicht hatte das Schiff jetzt erst abgelegt? Ich wusste es nicht. Eine solche Fähre ist so riesig, dass sie fast schon eine Insel ist. In einem Prospekt, der am Hafen aushing, hatte ich gesehen, dass es in den oberen Stockwerken der Fähre einen Supermarkt gab, wo man Parfüm und Spielzeug und sogar Computer und Kleidung kaufen konnte. Und oben an Deck wurden Bier und Cocktails serviert.
Die meisten Flüchtlinge hatten in Patras versucht, auf einen der Laster zu steigen und so auf die Fähre und auf das Parkdeck zu gelangen. Sie reißen an einer roten Ampel hinten die Türen der Laster auf und klettern in den Laderaum. Ein zweiter schließt sofort die Tür von außen. Das geht blitzschnell, damit der Fahrer nichts bemerkt. Am besten können es die Afghanen. Sie sind klein und flink. Sie klettern auch unter die Laster und halten sich dort fest. Sie sind ohnehin anders als wir: ruhiger, gelassener und extrem tapfer. Ich frage mich, warum sie so vieles klaglos erdulden.
Ich habe nur ein einziges Mal einen Afghanen weinen sehen – als Adil vom Tod seiner Familie gehört hatte. Ich hatte Adil in Istanbul auf der Straße kennengelernt. Wir sprachen Englisch. Adil hatte eine tiefe Narbe auf der Nase. Sein Vater war von den Taliban erschossen worden, seine Mutter mit ihm in den Iran geflohen, wo sie bald gestorben war, und er arbeitete in Teheran bei einem Kerl, der Tische machte. Kleine Teetische. Adil schweißte die Gestelle der Tische zusammen. Und zahlte der Polizei seine Abgaben. Doch eines Tages kamen zwei Kerle auf einem Motorrad und hielten neben ihm an. Sie fragten ihn, ob er Afghane sei. Dann schlugen sie ihn nieder und wollten Geld für ihre Mütter. Das Benzin sei so teuer. Als Adil grinste, schlugen sie ihn wieder und wieder, als suchten sie in seinem Blut nach Münzen. Adil erzählte schlimme Geschichten über die Iraner. Ich weiß nicht, ob sie stimmen. Ist das afghanische Leid wirklich so unendlich? Adil sagte: Frag einen Iraner, was er von einem Afghanen hält, und er wird dich fragen, was du von Tieren hältst. Die Iraner mögen es nicht, wenn wir Afghanen durch ihr Land nach Europa reisen. Schließlich könnten wir dort etwas lernen und zurück nach Afghanistan kommen und unser Land aufbauen. Die Iraner wollen das nicht, sie wollen die Afghanen kleinhalten, denn sonst vergessen sie womöglich, dass die Iraner ihre Herren sind.
Khalil, Sahra und ich sind in Patras nicht auf einen Laster gesprungen, um auf die Fähre zu kommen. Stattdessen sind wir über den Zaun am Hafen geklettert, wo die Touristen in ihren Wagen auf die Abfertigung warteten. Gerade als wir die Fähre betraten, entdeckte uns ein Wachmann. Khalil schlug ihn kurzerhand mit einem Stein nieder, der ihm dann aus der Hand glitt. Keine Ahnung, woher er diesen Stein hatte. Der Mann war groß und mächtig, so groß und mächtig wie Khalil. Trotzdem fiel er um wie ein leerer Eimer. Das Blut floss aus seinem Kopf über den Metallboden des Decks. Der Wind des Meeres war sanft und warm, und Khalils Gesicht war ohne jede Regung, als habe er den Schmerz des Wachmanns nicht mitempfunden, als sei ihm alles egal.
Als ich Khalil dann im Toyota liegend fragte: »Meinst du, der Wachmann, den du niedergeschlagen hast, ist tot?«, fauchte er nur zurück: »Sei endlich still und bleib unten mit dem Kopf!«
Ich sah nur noch die Red-Bull-Dose, nicht mehr Khalils Gesicht dahinter, denn er machte sich noch kleiner und zog den Kopf ein.
Ich redete trotzdem weiter, weil Reden beruhigt: »Die finden ihn bestimmt nicht so schnell. Die haben alle Hände voll zu tun, wenn die Fähre ablegt.«
»Jetzt halt endlich die Fresse«, zischte Khalil über die Konsole hinweg. Er starrte mich an, als wollte er mich mit seinen Augen beißen. Er ist aufbrausend. Man darf ihn nie in die Enge treiben. Khalil will keinen Kompromiss, er will sein Recht.
Aber es stimmte: Ich sollte besser still sein! Schließlich wollte ich genau so wenig ins Gefängnis wie er. Wenn ich jetzt von den Wachen erwischt worden wäre, hätten sie mich der Polizei ausgeliefert, und die hätte mich geschlagen. Da war ich mir sicher. Die Griechen wollen uns nicht, sie wollen nicht einmal, dass wir uns registrieren. Ich hatte in Athen vier Tage für Papiere angestanden, dann nicht mehr. Es war sinnlos. Nur eine Handvoll von uns wurde am Tag registriert, die Übrigen mussten am nächsten Tag wiederkommen und wieder und wieder, bis sie aufgaben oder weiter nach Westeuropa zogen.
Ich schloss die Augen und hörte Sahras Atem. Sie hatte kein Wort gesagt, aber sie lebte. Sie hat ein ruhiges Wesen. Nichts ist schlimm, solange ich mit ihr zusammen sein kann und ihren Atem höre.
»Was machst du denn hier, Basil?«, unterbricht eine laute Stimme meine Gedanken.
Es ist Tobias.
Ich spüre die Kälte auf meiner Haut, höre die Autobahn in der Ferne. Abrollgeräusche, die einen Teppich über die Nacht legen. In Köln-Ehrenfeld hat sich das Leben in die Häuser zurückgezogen. Die Realität dringt langsam wieder in meinen Verstand. Ich bin nicht auf der Fähre, liege nicht auf dem Rücksitz des Toyotas, sondern hier vor der Tür unseres Heims, habe das alles nur gedacht.
Und höre Tobias’ Stimme: »Also, sag. Warum liegst du im Schnee?«
Ich öffne die Augen. Tobias’ Gesicht ist rundlich und freundlich wie der Mond. Er trägt seine Motorradlederjacke, obwohl er gar nicht mehr Motorrad fährt. Auf der Jacke ist ein Tiger zu sehen und japanische Schriftzeichen. Was sie wohl bedeuten? Er reicht mir die Hand. Sie ist nicht behaart, im Gegensatz zu meinen Fingern. Das ist nicht der einzige Unterschied zwischen uns, Tobias hat auch einen kleinen Bauch und dünne Beine. Er nimmt mich in den Arm. Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn er das tut. Deutsche nehmen sich in den Arm, wenn sie sich mögen. Er mag mich also.
Wir sehen uns fast jeden Tag, seit wir uns vor gut drei Monaten zufällig kennengelernt haben. Ich war nachmittags im Mediamarkt und suchte nach preiswerten In-Ear-Kopfhörern, genau wie er. Er hatte seine kleine Tochter Zeta dabei, die mich angesprochen hat. Tobias hat Kind und Frau und gehört zu dieser Stadt, er wohnt mit seiner Freundin Jessi und der kleinen Tochter Zeta in einem Reihenhaus. Das Haus haben sie geerbt. Das Dach muss erneuert werden und die Gehwegplatten zum Eingang sind krumm und schief. Zu Weihnachten sollte ich Tobias besuchen, aber ich wollte nicht. Schließlich ist es ein Familienfest bei den Christen. Im kommenden Jahr werde ich mitfeiern, denn wir sind jetzt Freunde, und Tobias meint, dass ich zu seiner Familie gehöre.
»Hast du an Sahra gedacht?«, fragt Tobias.
Ich entgegne mit einem Lächeln: »Du hast ein Auto. Wir könnten zu ihr nach Nizza fahren.«
»Du weißt doch gar nicht, ob sie wirklich dort ist.«
»Irgendwo muss ich mit der Suche beginnen. In Paris ist sie nie angekommen, nachdem wir uns aus den Augen verloren hatten.«
»Und geschrieben hat sie dir auch nicht.«
Das stimmt. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Aber wenn ich an sie denke, dann kribbelt es immer noch in meinem Bauch. Lächelnd sage ich: »Lass uns einfach nach ihr suchen.« Und das meine ich ernst.
Er geht nicht auf meine Bitte ein, sondern schaut auf meinen Abdruck im Schnee. »Früher habe ich mich auch manchmal so in den Schnee gelegt und einen Schneeengel gemacht.« Er schaut mich an wie ein Kind mit Dreitagebart. »Dazu legt man sich auf den Rücken und wedelt mit den Armen.«
Mein Abdruck sieht nicht aus wie der eines Engels, eher wie ein lang gestrecktes Ei ohne Flügel.
»Schneeengel«, sage ich leise. Mir gefällt das Wort. Engel haben Flügel. Und dann fällt mir ein Sprichwort ein: »Kinder sind die Flügel des Menschen.« Tobias schaut mich groß an und sagt, dass ihm kalt wird. Im Wagen sei ihm so warm gewesen und nun diese Kälte. Jetzt erst fällt mir sein Auto auf, das direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite parkt. Ich habe eben gar nicht gehört, wie er nur wenige Meter von mir entfernt eingeparkt hat. Es ist ein roter Golf, der an den Radkästen rostet und dessen Türgummis porös sind.
Ich öffne die Haustür zum Wohnheim. Es ist ruhig im Flur. Hinter den Türen von Fesseha und Tarik ist Musik zu hören, doch ich schließe die Tür neben der Küche auf. Das ist mein Zimmer. Tobias schlüpft hastig aus den Schuhen, kippt den Klapptisch an der Wand herunter, holt seinen Laptop aus dem Rucksack, setzt sich auf den Klappstuhl und schreibt noch in Lederjacke: Kinder sind die Flügel des Menschen. Dann sagt er: »Das ist wirklich ein guter Satz, Basil. Ich könnte ihn hundert Mal schreiben und ihn mir ins Zimmer hängen.«
»Willst du Tee?«, frage ich.
Er will immer Tee: schwarz, stark und mit Biohonig. Er und seine Frau Jessi haben mir das Glas geschenkt, genau wie die breite Tasse, aus der er gleich trinken wird.
Tobias notiert alles, was ich sage, jedes meiner Worte ist ihm wichtig. Vermutlich schreibt er gerade auf, dass ich auf meinem Bett sitze, hinter mir eine Deutschlandkarte an der Wand hängt, daneben ein Bild von meiner Heimatstadt Homs, dass am Kopfende zwei Hanteln auf dem Boden ruhen, dass das Bett unordentlich ist, dass ich aufstehe und den Wasserkocher anstelle, dass ich zwei Tassen aus der Küche hole, dass ich in jede Tasse einen Beutel Earl Grey lege und dass ich Tobias und mir einen Tee zubereite. Er kennt meine Gedanken, schmiedet sie zu Worten und Sätzen und schreibt sie nieder. Er ist der einzige Mensch, dem ich alles erzählen kann. Ich vertraue ihm wie sonst niemandem.
»Ich habe heute nicht viel Zeit«, erklärt er. »Jessi will, dass ich mich mehr um Zeta kümmere. Aber wann soll ich das tun? Ich habe schon zweiunddreißig Bewerbungen geschrieben.« Die Zeitung hat ihm vor einem halben Jahr gekündigt, seither sucht er Arbeit. Tobias hat seinen eigenen Blog im Netz, aber damit kann er kein Geld verdienen. Das sagt er jedenfalls.
Ich sage: »Wenn du meine Geschichte verkaufst, werden wir beide reich.«
»Ganz sicher«, stimmt er mir schmunzelnd zu. Dabei reibt er sich übers Kinn. Ich weiß nicht, ob er wirklich daran glaubt, mit meiner Geschichte Geld verdienen zu können. »Lass uns einfach anfangen. Du hast mir gestern von Syrien erzählt, von eurer Wohnung in Homs und von deiner Mutter. Was ist mit ihr passiert, als die Truppen von Präsident Assad die Stadt angegriffen haben?«
Ich erkläre ihm, dass er Assad bitte nicht Präsident, sondern höchstens Diktator nennen soll. »Es gibt kein größeres Schwein in Syrien. Der IS hat nicht so viele Menschen umgebracht wie Assad.«
»Warum hat dein Vater dich eigentlich Basil genannt? Es ist doch der Vorname von Assads totem Bruder.«
Ich weiß es nicht. Wenn er nicht von Assads Soldaten erschossen worden wäre, hätte ich ihn dies sicherlich noch gefragt. So aber vermute ich: »Vielleicht weil Basil mutig und tapfer heißt?«
Tobias sagt: »Vielleicht. Aber jetzt erzähl weiter.«
Er senkt den Kopf, blickt starr auf die Tastatur und seine Finger. Ich soll sie mit meinen Worten bewegen. Doch das tue ich nicht. Stattdessen nehme ich die Teebeutel aus den Tassen und reiche ihm seinen Tee.
»Trink erst mal.«
Er nippt kurz. Wieder lauern seine Finger auf meine Worte.
»Okay«, sage ich und erzähle, dass ich meine Mutter vor mir sehe. In ihrer ganzen Leibesfülle. Mein Kopf ist heute noch übervoll von ihrem Lächeln, ihren kleinen lustigen Augen. Tobias’ Finger hacken auf die Tastatur, folgen jedem meiner Atemzüge. Meine Mutter saß auf dem Kissen und sah selbst aus wie ein Kissen. Ihre Schultern, ihr Hals, ihre Brust, ihr Bauch, auch ihr Gesicht war so rund wie ein Kissen. Riesig war sie und voller Liebe, als wollte sie die Welt bemuttern. Eines Tages würde sie die Wohnung nicht mehr verlassen können, sie würde nicht mehr durch den Rahmen passen. Ich fragte mich, warum sie immer noch dicker wurde. Es gab keine Süßigkeiten mehr in Homs, kein Kanafeh, kein Mabruma, selbst der Grießpudding war aus, und trotzdem wuchs der Umfang meiner Mutter. Als ich das sage, bekomme ich ein schlechtes Gefühl und frage Tobias, ob er es bitte streichen könne.
Ich will nicht so über meine Mutter reden.
»Keine Angst, Basil. Ich mache sie schlanker«, erklärt er. Seine Augen funkeln dabei. Findet er das lustig?
»Lass das!« Ich werde lauter.
»Du hast doch so über sie geredet.«
»Streich es bitte.«
Ich stehe neben ihm, schaue auf den Laptop und nippe am Tee. Tobias löscht die Zeilen. Doch das gefällt mir auch nicht. Ich weiß nicht, was ich über meine Mutter sagen soll, ohne dass es mir ein schlechtes Gewissen macht. Die Wahrheit? Sie war dick. Das ist die Wahrheit. Ich bitte ihn erneut: »Kannst du es wieder zurückholen, was ich gerade gesagt habe?«
»Warum?«
»Weil es die Wahrheit ist. Meine Mutter hat das ganze Elend in sich hineingefressen, all die Stunden, die sie um meinen Vater getrauert hat. Sie war dick, weil sie dick sein wollte. Sie brauchte diese Schutzschicht aus Fett wie ein Wal, der in das kalte Meer taucht.«
»Du redest von ihr, als würde sie noch leben.«