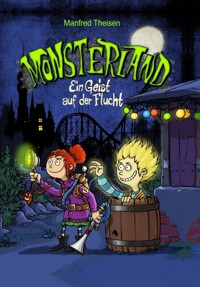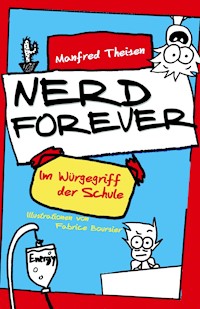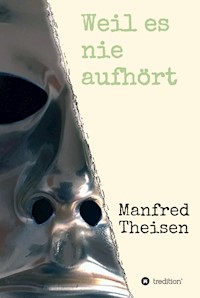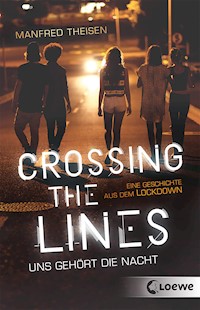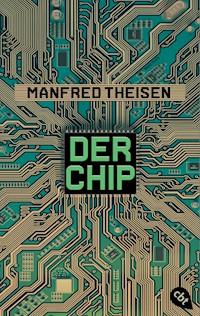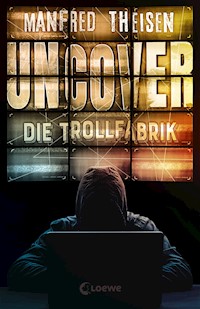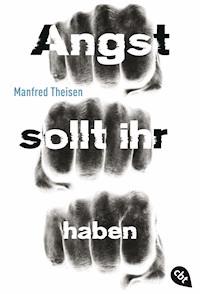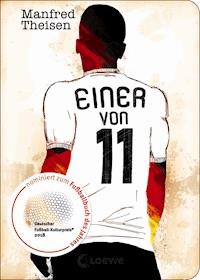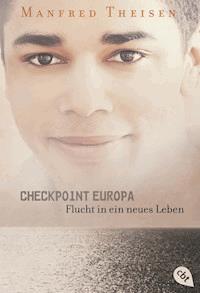Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Marlon, neuer Pate von Ehrenfeld
- Sprache: Deutsch
Einmal New York und zurück. Im Handgepäck hat Marlon - der Pate von Ehrenfeld - ein Kreuz aus Holz. Und in dem Kreuz ist das »sanctum praeputium«, die heilige Vorhaut Jesu. Doch kaum hat Marlon das verschrumpelte Stück, wollen es alle. Auch die italienische Mafia und der Kölner Kardinal persönlich. Es geht brutal zu, schließlich handelt es sich um eine 2.000 Jahre alte, verschollen geglaubte Reliquie. Als dann noch ein Killer ausbricht und Marlons Oma beginnt mitzumischen, ist das Chaos perfekt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Theisen
Der Pate von Ehrenfeld und der Kardinal in der Wanne
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Superbass (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haus-scholzen-07-03-03.jpg), »Haus-scholzen-07-03-03«, Farbe, Kontrast, Auschnitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
ISBN 978-3-8392-7864-2
Widmung
Für Jevgenia
1 Der lebende Tod ist ausgebrochen
»Du bleibst ruhig, ganz ruhig.«
Kommissar Markus Brandt lag wach. Er redete mit sich selbst, oder besser: Er versuchte, sich selbst zu beruhigen, was ihm schwerfiel. Über ihm tanzten die Schatten an der Decke. »Wenn sie kommt, bleibst du einfach liegen. Du wirst nicht meckern, nicht schreien, nur liegen bleiben.«
Seine Tochter Charlotte war noch nicht daheim, obwohl sie versprochen hatte, spätestens um Mitternacht von der Party nach Hause zu kommen. Gleich war es 3 Uhr. Um 1.13 Uhr hatte sie geschrieben: »Nina will noch nicht nach Hause, aber ich will lieber mit Nina nach Hause fahren. Ist sonst zu gefährlich. Okay?«Er hatte darauf ein »Okay« geantwortet.Um 1.52 Uhr hatte sie geschrieben: »Nina ist weg. Weiß nicht, wann sie gegangen ist. Nehme den Bus um 2.28 Uhr.«Er hatte ihr ein Daumenhoch geschickt, und sie hatte nachgefragt: »Soll ich den Bus nehmen?«Woraufhin er mit schlechtem Gewissen geschrieben hatte: »Ja, nimm den Bus.«Im Klartext hieß das: Charlotte würde erst um circa 3.30 Uhr daheim sein. Das war viel zu spät für ein 16-jähriges Mädchen allein in Köln. Davon war er überzeugt, vor allem, weil das 16-jährige Mädchen seine einzige Tochter war. Er hätte sie am liebsten von der Party abgeholt, doch das ging nicht, denn Charlotte zögerte stets das Nachhausekommen so lange hinaus, dass er am Ende im Auto saß und Taxi spielte.
Sein Diensthandy klingelte. Teamleader Simon Wörner. Bis vor Kurzem war Brandt noch bei der Mordkommission gewesen, nun sorgte er sich in einer eigens geschaffenen Stelle um die Kölner Bandenkriminalität im Auftrag des Bundeskriminalamtes. Das Gute am Jobwechsel war: Endlich musste er nicht mehr mit Kommissar Rolf Gemüth zusammenarbeiten, den er für hochgradig verfilzt hielt. Das Negative: Das organisierte Verbrechen war ein Quell ständiger Morde, verdeckt oder offen. Feierabend gab es selten. Wörner erklärte, ein Anrufer habe mitgeteilt, dass Karl Kühnert sich in einem der Bungalows an der Rochusstraße direkt gegenüber der JVA befinde.
»In welchem Bungalow?«
»Wissen wir nicht.«
»Wie?«
»Ja, was soll ich sagen? Der Anrufer hat aufgelegt, ehe er mit der Hausnummer rausgerückt ist.«
»Merkwürdig.«
»Was sollen wir machen?«
»Die Bungalows abklappern.«
Brandt starrte wieder an die Decke. Immer noch spielten dort die Schatten Fangen. Das Handy hatte er auf seine Brust gelegt und laut gestellt. »Ich frage mich, wer ist denn so irre und versteckt sich im Haus gegenüber vom Gefängnis, aus dem er gerade geflohen ist?« Darauf wusste Wörner keine Antwort.
»Ach, egal. Wir müssen jede Chance nutzen. Falls wir Kühnert vor Albert Nagel und seinen Leuten erwischen, wird er vielleicht als Kronzeuge aussagen – und wir können diesen Mafioso endlich auf Zelle bringen.«
Der Kommissar überlegte, ob er zum Einsatzort fahren sollte. Aber wozu? Für den Zugriff würden sie seine Hilfe nicht benötigen. Sie würden mit oder ohne ihn das gleiche Ergebnis erzielen. So blieb er liegen und wartete lieber auf seine Tochter. Schließlich war sie das Wichtigste, was es in seinem Leben gab.
Draußen setzte ein hörbarer Sommerregen ein.
Brandt erhob sich und schritt zum Fenster. Er liebte solch ein Wetter, es roch nach Kindheit. In seiner Heimatstadt Kiel hatte es oft so geschüttet. Er drückte Charlottes Nummer. Er wollte auf keinen Fall schuldig daran sein, falls seiner Tochter etwas zustieße. Zu seiner Ernüchterung kam sofort die Mailbox. Vermutlich war ihr Handy wieder mal leer. Oder sie war sauer auf ihn, weil er ihr nicht sofort seine Taxidienste angeboten hatte. Die Welt war ungerecht.
Die Küche lag direkt gegenüber von Brandts Schlafzimmer, er machte sich einen Espresso Fat Cat -–75 Prozent Arabica, 25 Prozent Robusta, dunkle Röstung, ein wenig schokoladig. Die Dielen unter seinen Füßen knarzten und fühlten sich kühl an. Er schaltete den Laptop an und loggte sich ins System der Polizei ein.
Es war fast 3 Uhr nachts. Aber er saß auf dem Kanapee im Wohnzimmer in der Erkernische, die Beine hochgelegt, den Blick auf den Kaffeeröster Benson gerichtet. Ja, Brandt war ein Kaffeefreak und froh, direkt gegenüber der Rösterei eine Wohnung gefunden zu haben. Bei Besitzer Benjamin Pozsgai brannte noch Licht im Hinterzimmer des Ladens. Der junge Mann war schon zweimal Deutscher Röstmeister geworden. Brandt hielt die Tasse hoch, als würde er dem Champion zuprosten, und kippte den Shot hinunter. Genuss pur für die Geschmacksknospen.
Wörner würde den Job an der Rochusstraße schon gut erledigen. Brandt hätte beruhigt schlafen gehen können, stattdessen betrachtete er – der Kontrollfreak – Karl Kühnerts Gesicht auf dem Laptop. Kantig, schmal, den Bart wie vom Nikolaus und Augenringe wie die vom Panda. Er war der lebende Tod. Und der war jetzt ausgebrochen und machte die Gegend unsicher.
2 Schaukelmodus für Loreley
Eigentlich wohnte Marlon nur wenige Häuser von Brandt entfernt. Und eigentlich hätte er zufrieden neben Smilla im Bett liegen können. Stattdessen saß er gut zwei Kilometer entfernt in seinem Audi TT und tuckerte über die Venloer Straße. Bei McDonald’s brannte das ewige Licht der Fressbude, genau wie in den Fenstern des Hochhauses hinter der Rochuskapelle, wo die Frauen die Nacht durcharbeiteten. Marlon war übermüdet. Loreley hatte daheim einfach keine Ruhe gegeben. Jetzt lag sie da, frisch gewindelt und stupsnasig, auf dem Beifahrersitz im Maxi Cosi. Sie nuckelte friedlich vor sich hin. Autofahren beruhigte sie. 504 PS hatte der TT, und er klebte wie ein Kart auf der Straße, beschleunigte in nullkommanull Sekunden auf 300 Kilometer, aber Marlon hatte ihn in den Schaukelmodus versetzt.
Nur Vanillegeruch, kein Benzinduft.
Loreleys Gesicht war winzig. Schon bei der Geburt hatte sie Haare gehabt, schwarze Haare, die nun blond wurden – dänisch blond. Sah er Loreley, so sah er Smilla vor sich. Okay, der Hals war nicht ganz so schlank wie der von Mama, immerhin hatte Loreley Mamas grüne Augen und die Grübchen neben den Mundwinkeln. Smilla schlief wahrscheinlich schon, und sie war sicherlich froh, dass Marlon mit der Energiediebin Loreley im Auto saß und sie daheim endlich ein wenig Ruhe hatte. Ruhe … ein Wort mit vier Buchstaben, ein Wort wie Urlaub. Nichts mehr als Ruhe ersehnte Marlon. Aber die gab es nicht mehr, nie mehr. »Du hast ein Kind? Gewöhn dich dran! Es wird immer da sein!« Diese Sätze seiner Oma Rita gingen ihm durch den Kopf, während hinter den Scheibenwischern das Leben eine kühlende Dusche empfing. Was nutzt es, wenn du als Pate Ehrenfeld und halb Nippes beherrschst, aber am Ende Knecht deiner Tochter bist? Mr. Pampers, Chuck Norris an der Wickelkommode. Die Vaterrolle war nicht sein Ding. Theoretisch wollte er ein moderner Papa sein, immer pünktlich zur Krabbelgruppe, Dinkelkekse und Lastenfahrrad, nur war er in Wahrheit zu faul für den Job.
Was er nicht ahnte: Genau in diesem Moment inspizierte Wörner mit seinen Leuten im strömenden Regen den ersten Bungalow an der Rochusstraße. Resultat: Der 73-jährige Doktor Sondermann und seine Frau wurden aus dem Bett geklingelt – keine Spur von Karl Kühnert.
Marlon fuhr rechts ran in die Einbuchtung der Bushaltestelle. Offiziell durfte Loreley keinen Nuckel haben, denn Smilla hatte es verboten. Solch ein Sauger würde die Zähne von Kindern versauen, ehe sie überhaupt Zähne hätten. Seit Loreley auf der Welt war, gab es wieder ernst gemeinte Verbote und Regeln für Marlon. Freiheit war ein Geschmack, den er schon vergessen hatte. Hier im Auto, in seinem Restreich, gab er Loreley heimlich den Beruhigungspfropfen. Ansonsten versteckte er ihn in der Seitentasche der Fahrertür in einem Plastikbeutelchen, sorgsam umwickelt in einem Taschentuch und versteckt vor Smillas Blicken, hinterm Eisschaber. Marlon machte die Scheibenwischer aus, legte die Hände in den Schoß und schloss die Augen. Er musste kurz an Markus denken, der gestern für ihn gleich hier an der Wilhelm-Mauser-Straße abkassiert hatte. Einmal im Jahr gab es dort ein Radrennen – »Beckendorf zesamme« – und Markus fuhr immer mit. Bickendorf gehörte genauso wie Ossendorf zum Stadtbezirk Ehrenfeld. Das hier war alles untrennbar, denn Ehrenfeld hat ein großes Herz. Marlon genoss das Konzert des Regens, der auf die Scheibe tropfte. Doch genauso überraschend, wie der begonnen hatte, endete dieser nun. Es war mit einem Mal still, und das nuckelnde Geräusch von Loreley ließ Marlon abtauchen ins Traumland.
3 50.000 Dollar für die Vorhaut vom Heiland
Hinter Köln lag im Bergischen Land die kleine Gemeinde Obererde. Dort summte das Handy von Marlons Onkel Albert Nagel. Er war sogleich wach. »Falco« stand auf dem Display.
Albert nahm das Gespräch an und flüsterte: »Moment.« Silke lag neben ihm und schnarchte, obwohl sie angeblich nie schnarchte, sondern höchstens nachts mal schnurrte, wie sie selbst sagte. Er schlich sich die Treppe runter, durchquerte das Wohnzimmer im Dunkeln, stieß an den Couchtisch, fluchte und trat auf die Terrasse. Während es in Köln eben geregnet hatte, war in Obererde wieder kein Tropfen gefallen. Hier oben war es immer ein wenig mehr wie in der Toskana als dort unten im stickigen Köln. Ohne Rasensprenger wäre das Grün im Garten seiner Villa im römischen Stil schnell braun geworden. Er hockte sich auf die Liege am Pool. Von hier aus konnte er auf das nächtliche Köln hinunterschauen.
»Ich habe was für dich, Boss.« Falco nannte Albert »Boss«. Dabei war Albert seit gut 14 Jahren nicht mehr sein Boss. Falco war Ex-DDR-Boxmeister und Stasimitarbeiter gewesen, war nach dem Mauerfall in den Westen nach Köln immigriert, hatte für Albert im Linksrheinischen kassiert und war vor sechs Jahren mit einem russischen Militärfreund von Köln in die USA gezogen. Er arbeitete mit dem russischen Tokarev-Clan in New York zusammen – als Freischaffender. Falco sprach fließend Russisch, trank Wodka wie Kölsch und schnitt mit dem Messer nicht nur Frühlingszwiebeln.
»Weißt du eigentlich, wie spät es bei uns in Köln ist?«
»Ich weiß nicht mal, wie spät es hier ist. Aber ich weiß, was als Einsatz im Pott liegt …«
Falco machte eine Kunstpause. Er erwartete Alberts Frage.
Der ließ sich Zeit, weil er genervt war. Dann sagte er schließlich: »Was liegt denn im Pott?«
»Die Vorhaut von Jesus.«
»Wie?«
»Ja, wenn ich’s dir sage«, bezeugte Falco. »Sie ist in einem kleinen Kästchen auf einer Art Kissen. Das ist die echte Vorhaut von Jesus. Eingepackt war sie in ein Kreuz aus Holz.«
»Du hast echt ’ne Macke.« Das Wort »Macke« hatte Albert ein wenig zu hoch, zu tief oder zu laut gesagt. Jedenfalls hörte er Fußgetrappel im Haus, Krallen rutschten über die Holztreppe, dann rannten Dolce und Gabbana quer durchs Wohnzimmer und standen wenige Sekunden später röchelnd und bettelnd vor Alberts Füßen. Dolce war schwarz, Gabbana weiß, beide schon über die Schlachtreife hinweg. Möpse können lieben, und diese beiden liebten Albert und Würstchen. Albert schüttelte den Kopf. Nein, kein Leckerchen. Egal, wie sehr sie auch sabberten, nach 17 Uhr durften sie nichts mehr fressen. Auf der anderen Seite der Gesprächsleitung fragte Falco ungeduldig: »Also, Albert: Willst du die Vorhaut? Oder nicht? Der Typ hat 50.000 Schulden. Ist das Ding 50.000 wert?«
Immer noch konnte Albert den Anruf und das Anliegen kaum glauben. »Du fragst mich, ob ich bereit bin, 50.000 Dollar für die Vorhaut von Jesus zu zahlen.«
»Ja.«
»Der Typ hat Schulden bei dir, nicht bei mir. Warum rufst du mich an? Was habe ich damit zu tun?«
»Du bist katholisch. Und du bist Kölner. Du kannst die Vorhaut doch bestimmt gebrauchen?«
»Und warum? Soll ich sie in Paniermehl wälzen?«
»Überleg doch Mal, Boss. Für die Knochen der Heiligen Drei Könige habt ihr in Köln den Dom gebaut. Für die Vorhaut würde die Kirche garantiert einen Megadom bauen. Du musst sie also nur Kardinal Dähmel verkaufen. Der ist bestimmt hinter dem Ding her wie Dracula hinter der Blutkonserve.«
Albert hörte Stimmen auf Falcos Seite: »Du bist nicht allein?«
»Ich habe doch gesagt, dass wir pokern. Was ist los mit dir, Albert? Schläfst du noch?«
»Wie sieht das Teil aus?«
»Würde ich es nicht besser wissen, würde ich sagen: Das ist ’n schrumpeliger Tintenfischring, der zu lange in der Sonne gelegen hat. Ich schick dir mal ein Foto.« Albert hörte, wie Falco in seinem Sachsenenglisch am Pokertisch redete. Es machte klick.
Kurz darauf summte schon Alberts Handy.
Tatsächlich war auf dem ersten Foto ein offenes Kästchen in Form eines Holzkreuzes auf einem Pokertisch zu sehen. Genau in der Vierung lag ein kleines helles Kissen mit einem schwarzen Punkt darauf. Das sollte wohl die Vorhaut sein. Auf dem zweiten Foto hatte Falco eben diese Vorhaut in den Focus genommen. Das könnte allerdings sowohl eine halb versteinerte Vorhaut als auch ein verkokeltes Haargummi sein oder ein Mikroschokodonut, der an der Seite angeknabbert war.
»Was jetzt?«, hörte er wieder Falcos Stimme. »Euer Jesus hat so gut wie nichts hinterlassen, Nabelschnur, Schweißtuch und …«
»Ich muss nachdenken. Mit so was kenne ich mich nicht aus. Und 50.000 Dollar …«
»Pass auf, Albert. Lanza will das Ding einsetzen. Ich lass den Einsatz nur zu, wenn du mir die Vorhaut garantiert abnimmst. Ich kann damit nichts anfangen. Ich mach das nur für dich.«
»Na klar«, sagte Albert ironisch. Noch nie hatte Falco etwas »nur für Albert« getan. Falco sorgte immer für seinen eigenen Vorteil. »Gib mir ein paar Minuten. Ich ruf dich spätestens in einer Viertelstunde zurück.«
Albert wollte sich bei einer solchen Entscheidung nicht hetzen lassen, schon gar nicht von Schlitzohr Falco.
Zur gleichen Zeit durchforstete Wörner mit seinen Männern und Frauen den vierten Bungalow. Wieder ohne Erfolg, wieder keine Spur von Karl Kühnert. Albert legte das Handy aus der Hand, schubste Dolce ein wenig mit nackten Füßen zur Seite, holte sich eine Cohiba aus dem Humidor, nahm sich eine Auflage aus der Kiste, legte sie auf die Pool-Liege und sich selbst darauf. So war es besser. So konnte er denken.
Noch einmal setzte er sich auf die Kante, zündete seine Zigarre an, und dann blickte er, auf dem Rücken liegend, in den unendlichen Sternenhimmel. Köln war seine Stadt, und der Himmel über Köln gefiel ihm tausend Mal besser als der über Berlin. So nah war er der Unendlichkeit, so nah der Schöpfung, und zu seinen Füßen der Dom. Heilig war das alles, so heilig wie der Rauch der Cohiba. Er warf erneut einen Blick auf das Foto der Vorhaut. Wer glaubte heutzutage noch an Reliquien? Albert nicht. Allerdings stiegen auch keine Kölner auf den Kölner Dom, sondern nur Chinesen, Brasilianer, Leipziger und Amerikaner. Weltweit gesehen war der Glaube auf dem Vormarsch, selbst wenn in Köln ein paar Katholiken Steuern sparen wollten und die Kirche massiv unter der Triebhaftigkeit einiger ihrer Diener litt. Und natürlich unter Kardinal Dähmel, der seine geistigen Qualitäten schon im Namen trug. Ob die Eltern von Dähmel auch schon so waren? Und was war mit seinen Kindern? Albert schmunzelte in den Rauch hinein.
Vielleicht wäre eine solch popelige Vorhaut kein schlechtes Geschäft für ihn. Er sendete die Fotos weiter an Marlons Smartphone und schrieb: »Was hältst du davon? Das auf dem Kisschen ist die Vorhaut von Jesus. Original. Komm ich dran. 50.000 Dollar. Brauche schnell eine Entscheidung, ob ich sie kaufen soll.« Dann paffte Albert weiter in die Nacht und fühlte sich gut, wie er so zwischen all den Sternen lag und darüber entscheiden konnte, was mit der Vorhaut des Heilands geschehen sollte. Würde er die Vorhaut besitzen, besäße er als einziger Mensch ein Stück vom Heiland. Und das war zudem auch noch ein Stück vom besten Stück.
4 Eis mit Glücksvitaminen
Marlons Smartphone summte in der Mittelkonsole, Foto und Text. Was sollte das? Ehe er einen klaren Gedanken dazu fassen konnte, rief schon Albert an: »Was hältst du davon?«
»Ist das echt die Vorhaut von Jesus? Und sind das Jetons, die da auf dem Tisch neben dem Kreuz liegen?«
»Vergiss die Jetons. Was meinst du?«
»Das Ding erinnert mich ans Ende von der Pelle von ’ner Wurst.«
»Falco hat das Ding im Pokerpott. Soll ich es als Wetteinsatz annehmen?«
»Ich denke, Falco ist in New York?«
»Genau da pokern sie gerade. Ich muss ihm antworten, er ist in der Leitung.«
»Warum haben die überhaupt in New York die Vorhaut von Jesus? So was liegt doch normalerweise im Vatikan in einer Vitrine … Gibt es ein Zertifikat oder so was?«
Sein Onkel wusste es nicht. Marlon recherchierte auf dem Smartphone: 14 Vorhäute hatte es im Mittelalter von Jesus gegeben. Okay, der Mann war der Sohn Gottes, da reichte vermutlich eine Vorhaut nicht aus. Marlon las laut vor: »Jene Vorhaut – lateinisch Praeputium genannt – die von den Experten als die echte Vorhaut von Jesus eingestuft wird, wurde 1984 in einer Kirche nahe Rom entwendet. Bis heute sind die Diebe nicht gefasst worden.«
»Genau diese Vorhaut muss es sein«, sagte Albert, obwohl er das so »genau« gar nicht wissen konnte. »Also, ist das Ding 50.000 Dollar wert?«
»Keine Ahnung.«
»Du bist mein Neffe.«
Das war ein schlagendes Argument. Trotzdem fehlte Marlon die Expertise in Sachen Vorhäute. Doch wer kennt sich schon mit Vorhäuten aus und ist kein Rabbi? Er spekulierte: »Ich würde mal sagen, dass sie was wert sein könnte. Reliquien sind halt religiöse Aktien. Hab mal gelesen, dass ein paar Krümel von Marias getrockneter Muttermilch schon 1.000 Dollar bringen. Und vielleicht kann man Jesus wieder aus der Vorhaut klonen. Das haben die Chinesen schon mit Mammuts gemacht.«
Albert war kein religiöser Mensch, aber niemand musste sich über die Kirche oder die Vorhaut von Jesus lustig machen. So fragte er Marlon: »Bist du gläubig?«
»Nur im Dom«, entgegnete dieser, der die Situation nicht ernst nehmen konnte. Er hockte im TT an der Bushaltestelle, hinter ihm der Mäckes, neben ihm Loreley, und er redete über Jesus’ Präputium.
Sein Onkel meinte: »Dir ist schon klar, dass die Vorhaut vom Heiland nicht irgendein Scheiß ist? Es geht hier um eine heilige Sache. Religion ist – wenn es dir gut geht – nur das Reserverad im Wagen, aber wenn es dir schlecht geht, du einen Platten hast, dann muss das Rad ran, und dann bist du auf Religion angewiesen. Glaub es mir. Da kannst du lange auf den ADAC warten.«
In Marlons Ohren klang das alles schräg, aber Albert meinte es offenkundig sehr ernst. Und Streit mit ihm wollte er vermeiden – zumal nachts um 1.45 Uhr. »Entschuldige, bin gestresst. Loreley macht mich fertig. Smilla und ich …«
»Ich verlasse mich auf dich, Marlon«, sagte sein Onkel kurz und knapp. »Damit das klar ist.«
Damit war das Telefonat beendet.
Marlon schaute nachdenklich auf die Fotos und wieder auf sein Smartphone. Sanctum Praeputium, so der offizielle lateinische Name – heilige Vorhaut. Eine Frau soll sie nach dem Tod von Jesus 800 Jahre in Öl eingelegt haben, eine Nonne spürte Jahrhunderte später die Vorhaut auf der Zunge und schluckte sie herunter, aber dann lag sie doch wieder auf ihrer Zunge. Erklärung: Wie der Heiland, so ist auch die Vorhaut auferstanden – so wie Jesus auferstanden ist. Marlon las und konnte das Gelesene kaum glauben. Die Juden begraben die Vorhäute, da sie Teil des menschlichen Körpers sind. Loreley nuckelte wieder unruhig. Er klickte sich von der Vorhaut auf »Der Kot des Palmesels«. Es war die Kacke von jenem Esel, auf dem Jesus in Jerusalem eingeritten war. Auch werde die Muttermilch der Maria verehrt.
Loreley bekam Falten auf der Stirn. Gleich würde sie aufwachen.
Alle redeten von Fake News, aber was Marlon auf seinem Handy über Reliquien las, war kein bisschen besser. Fake News ohne Ende. Marlon legte das Smartphone zur Seite, setzte den Blinker und fuhr aus der Parklücke. Nur die Fahrgeräusche und die Vorwärtsbewegung des TT konnten ihn noch vor ihrem Erwachen retten.
Was sollte er seinem Onkel sagen: kaufen oder nicht kaufen?
Mit Tempo 30 ging es über die Venloer Straße zurück Richtung Neuehrenfeld. Auf den Gehwegen waren noch vereinzelt Gestalten unterwegs, die der Regen nicht hatte wegspülen können. Schließlich landete er auf der Subbelrather Straße an Sankt Peter. Im EisladenLiliana brannte Licht. Oder besser gesagt: In dem Laden neben der Eisdiele brannte hinter der milchigen Scheibe das Licht. Giuseppe rührte gerade frisches Eis für den morgigen Tag. Er hätte bestimmt einen Espresso für Marlon und eine Kugel Eis für Loreley, die gerade erwachte. Sie durfte noch kein Eis, aber Eis war gut, weil es Glückshormone hatte. Davon war Marlon überzeugt.
5 Wortwechsel mit K.o.
Wie durch ein Wunder fand er am Rewe einen Parkplatz – direkt schräg gegenüber der Eisdiele. Als er aussteigen wollte, kam eine junge Frau auf High Heels um die Ecke, gefolgt von drei Typen, die weniger hübsch waren. Sie belästigten die Frau und stellten sich ihr in den Weg. Marlon stieg aus, obwohl Loreley das nicht gut fand und ihren Nuckel ausspuckte, als hätte ihn jemand mit Haifischfett eingerieben. Sie war offenkundig dazu entschlossen, sich die 100-prozentige Aufmerksamkeit ihres Papas zurückzuerobern. Marlon hob den Nuckel von der Fußmatte, saugte selbst kurz daran, spürte ein paar Flusen in seinem Mund, schluckte und drückte den Nuckel wieder in den Mund seiner Tochter. Dann schaute er hinüber zu der Frau und den Typen. Durch das offene Fenster spürte er die Schwüle, die Regen hinterlässt.
Die Typen hatten sie umzingelt.
Marlon spürte das Adrenalin. Er drückte die Tür auf. Gefassten Schrittes überquerte er die Straße und lief direkt auf die Eisdiele zu. Noch ahnten die Kerle nicht, was er vorhatte.
Er fragte naiv: »Wisst ihr, wie spät es ist?«
»Was?«, entgegnete einer und machte eine Handbewegung, dass er gehen solle. »Verpiss dich.«
Marlon ging nicht darauf ein, sondern fragte die Frau: »Belästigen die dich?«
Sie hatte Angst und zu lange Wimpern, die zu ihren zu langen Fingernägeln und den aufgemalten Sommersprossen passten. Jetzt erst sah er, wie jung sie noch war. 18? Höchstens! Vermutlich war sie unter all der Schminke und dem künstlichen Kram noch jünger und naiv, was Männer anging. Warum ließen sie ihre Eltern nur so rumlaufen? Wenn seine Loreley in dem Alter war, würde er sie mit einer Pumpgun begleiten.
»Wir belästigen sie nicht«, mischte sich der kleinste der drei Kerle ein, der die Verpiss-dich-Handbewegung gemacht hatte. Er reichte Marlon gerade mal bis zur Schulter. Die drei Männer waren Mitte 20: blond, braun, schwarz. Alle Haarfarben und vermutlich Gene aus aller Welt – inklusive Deutschland. Die Stadt war ein Schmelztiegel. Der Kleine war humorlos und fragte: »Was is los?« Und pflaumte Marlon an: »Geh weiter!«
Marlon ignorierte ihn weiterhin und wiederholte seine Frage über den Kopf des Kleinen hinweg: »Belästigen die dich?«
»Was hat der da?«, fragte der Blonde, der neben Marlon stand und auf Marlons Shirt schaute.
Marlon sagte: »Kinderkotze.«
»Kinderkotze?«, wiederholte der Blonde belustigt.
»Ja, kann nur von dir kommen, die Kinderkotze.« Marlon provozierte ihn, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Er war selbst auf Krawall aus. Das Windelwechseln, Friedlichsein, Vatersein war nicht genug.
Und dann geschah es! Drei völlig unterschiedliche Dinge, die die Situation eskalieren ließen:
Erstens: Die Tür zu Giuseppes Eismacherei öffnete sich.
Zweitens: Erschrocken von dem schrappenden Geräusch der ruckelnden Tür, hob der Blondierte seine Faust und holte zum Schlag aus.
Drittens: Das ebenfalls blondierte Mädchen rannte auf seinen Stöckelschuhen schwankend los und knickte dabei um, humpelte aber danach weiter.
Ehe die Faust des Blondierten Marlons Gesicht erreichte, boxte ihm Marlon in die Magengrube, woraufhin der Kurze Marlon in den Magen schlagen wollte, Marlon jedoch dessen Faust zur Seite lenkte. Dann aber spürte er einen Schlag auf seinen Hinterkopf. Der dritte und unscheinbare Kerl, der weder groß noch klein war, hatte ihn fies mit dem Handy erwischt, sodass Marlons System sofort abstürzte.
6 Fingerspitzengefühl
Zurück zum Eisladen: Es war Giuseppes Gesicht, das Marlon eine halbe Minute später über sich sah. Schmal, freundlich und sorgenvoll.
»Marlon! Wach auf, Junge. Bist du verletzt?«
Marlon war noch nicht wieder klar im Kopf. Er sah den Kurzen und den Blondierten neben sich auf dem Boden liegen. Der dritte Typ musste geflohen sein. Er setzte sich aufrecht und fuhr sich mit der Rechten über den Schädel. Blut. Doch die Verletzung schien nicht tragisch, als er jetzt auf seine Hand schaute.
»Was ist passiert?«, wollte Marlon wissen.
Giuseppe ballte die Faust, und wenn er seine Faust ballte, glich sie eher einem Medizinball als einer Kirsche. Er hatte mal zu Marlon gesagt: »Wer gutes Eis machen will, braucht Fingerspitzengefühl und kräftige Hände. Wer das beste Eis machen will, der braucht meine Hände und viel Fingerspitzengefühl.« Nun streckte er Marlon die Hand entgegen, half ihm hoch und fragte: »Was machen wir mit denen?«
Eine Antwort erhielt er nicht, denn Loreley hatte sich dazu entschlossen, einen Schrei abzuliefern, der durch das geschlossene Fenster des TTs über die Straße bis hinüber zur Eisdiele zu hören war.
Marlon wollte gleich zu ihr sprinten, da zuckte er zusammen, denn seine Hüfte schmerzte. »Verdammt!« Somit humpelte er nunmehr auf die Sirene zu. Tür auf, Nuckel anfassen, nein, halt, erst das Blut mit dem Feuchttuch mit der Linken von der Rechten waschen, jetzt Nuckel rein in den Mund.
Gerade als Marlon erleichtert aufatmen wollte, spuckte Loreley den Nuckel wieder aus. Wieder Nuckel rein, wieder Gemotze unter dem Schutzschild des Nuckels. Marlon nahm Loreley aus dem Maxi Cosi, schaukelte sie im Arm. Er schnupperte kurz an ihrer Windel, doch die roch noch nicht streng, und zog die Fahrertür hinter sich zu. Vermutlich war Loreleys Geschrei bis auf die andere Rheinseite zu hören. Schon flog der Nuckel katapultartig auf den Boden. Loreley war außer sich und Marlon endgültig ratlos. Was er jetzt brauchte, war seine Frau. Wie sollte er seine Tochter sonst beruhigen? Ohne eine Brust ging das offenkundig nicht mehr. Da zog jemand von außen die Tür auf, und Giuseppe hielt eine Eistüte herein – direkt vor Loreleys Lippen. Die schaute erstaunt auf die Schokoladenkugel, nahm Geruch und Kühle wahr und verstummte.
Giuseppe sagte: »Hm, das ist lecker.«
Loreleys Augen waren eiskugelrund, die Tränen versiegten, und Giuseppe grinste: »Das ist die Magie der Kugel.«
»Du verarschst mich«, sagte Marlon.
Doch Loreleys Lippen wurden spitz und … Marlons Siemens-Handy klingelte. Das war keine Magie, das war sein Onkel, der endlich eine Antwort von ihm wollte.
Giuseppe drückte Marlon die Eistüte in die Hand. »Ich muss zurück – aufräumen.« Damit meinte er die Kerle, die noch auf dem Bürgersteig lagen.
Unbeachtet von Marlon und Giuseppe hatte Charlotte die Szene von der Straßenecke aus beobachtet. Sie ging schnurstracks über den Lenauplatz, vorbei an Benson Coffee und auf das Haus in der Eichendorffstraße zu, in dem schon ihr Vater im dritten Stock wartete. Der Schock steckte ihr noch in den Gliedern.
Marlon hielt das Eis in der Linken. Loreley saugte daran wie die Biene am Nektar. Sein Handy hatte er rechts. Alberts Stimme drang daraus hervor: »Also, Jung. Was’s nun?«
»Weiß nicht, Onkel Albert.«
»Ich aber. Und ich sage dir: Du fliegst nach New York und besorgst das Jesusteil. Ich verlasse mich auf dich.«
»Das ist echt Aufwand«, versuchte Marlon, die Reise zu vermeiden.
»Schlaf erst mal. Morgen besprechen wir alles.«
Es knackte in der Leitung.
Marlon fühlte sich von Albert überrumpelt. Der witterte offenkundig ein Geschäft. Vielleicht, so dachte Marlon, wäre es sogar ganz nett, endlich mal New York zu sehen, endlich mal rauszukommen, ein paar Tage raus aus Ehrenfeld, raus aus Köln, raus aus Deutschland. Er sah hinunter auf Loreley und drückte ihr ein wenig stärker das Eis an die Lippen. Sie küsste es. Schokolade. Schleck. Sie lächelte mit geschlossenen Augen.
Giuseppe weckte wenige Meter von ihnen entfernt die beiden Kerle mit einem Eimer Wasser und verscheuchte sie. Loreley schlief mit den Lippen auf der Kugel ein. Marlons Augenlider wurden schwer wie Rolltore. Er legte seine Tochter vorsichtig zurück in den Maxi Cosi, warf die Eistüte aus dem Fenster und parkte aus. Er schaltete das Radio an, zappte sich durch die Sender und blieb beim Domradio hängen. Nie hörte er diesen Sender, überhaupt hörte er selten Radio. Jetzt schien er bereit für Jesus und seine Vorhaut.
20 Minuten später wurde er von Smilla mit einem Kuss begrüßt.
Sie legte Loreley sanft in ihr Bettchen.
7 Meditation zum Hass
Karl Kühnert saß wie ein bärtiger Yogi im Schneidersitz vor dem deckenhohen Ofen und schaute durch das Sichtfenster ins Feuer. Wörner und seine Leute befanden sich noch zwei Bungalows entfernt – genervt von ihrer Erfolglosigkeit. Ganz in sich versunken war hingegen Kühnert. Er dachte an die schlechten und die legendär schlechten Tage mit seinem Stiefvater Ceylan Yanar – 76 Jahre alt war der, fett, glatzköpfig, untrainiert und endlich tot. Ceylan blutete den weißen Flokati rot. Er mochte die Farbe. Kühnert sprach zu ihm, als wolle er ihn beschwören: »Nur der Ohnmächtige besitzt die Kraft zu fliehen.« Im Klingelpütz hatte er meditiert und beim Bankdrücken Sprüche gelernt. Der Knast hatte ihm Zeit zur Besinnung gegeben. Ganz tief hatte er den Schmerz des Verrats auf sich einwirken lassen, ihn in Hass verwandelt, der ihm die Kraft zur Rache gab. »Meditation zum Hass«, so nannten es die Knastphilosophen Dieter & Mo, die einen Podcast aus der JVA Stammheim heraus betrieben. Der fette türkische Glatzkopf auf dem Flokati war nur der Anfang auf dem Pfad von Kühnerts Gerechtigkeit. Er mochte keine dicken Menschen. Schon gar nicht, wenn sie für Albert arbeiteten und seine Mutter ins Grab gebracht hatten.
»Fleischsaft ist rot, und rot ist der Tod.« Er wiederholte die Worte züngelnd wie die Flammen im Kamin. Dann schrie er den leblosen Körper an: »Du fette Sau!« Er hämmerte ihm mit der Faust auf den aufgequollenen Leib. »Leberfett! Fettleber!« Nie hatte er seinem Stiefvater etwas recht machen können. Ceylan war nur dominant gewesen – und Karl ihm gefügig wie ein Hund seinem Herrn. Jetzt lag Ceylan da, die Augen geweitet, der rote Fleischsaft trocknete im Flokati. Faser für Faser. Das ist der Unterschied von Pflanzen zu Tieren und Menschen. »Pflanzen kannst du teilen, ohne sie zu töten, Menschen sterben, wenn du sie teilst«. Knastphilosophen sprachen oft die Wahrheit.
Im Ofen loderte das Feuer, während die warme, schwüle Nacht den Bungalow umgab. Den gusseisernen Ofen hatte Kühnert damals extra für seinen Stiefvater geklaut. Eigentlich hätte er der Pate von Ehrenfeld werden sollen. Stattdessen war es das Omasöhnchen Marlon geworden. Nach all den Jahren, die Kühnert für Albert das Geld in Nippes eingetrieben und die dreckigsten Jobs erledigt hatte, hatten sie ihn geopfert. »Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.« Albert, Ceylan, Marcus und Marlon, alle hatten sie ihn geopfert. 15 Jahre sollte er in der JVA Ossendorf absitzen – minus ein paar Jahre wegen guter Führung. Aber bis dahin wäre er vermodert. Keiner von Alberts Leuten hatte ihn besucht. Den Mord an dem miesen Albaner Malush hatten sie ihm angehängt. Dabei war es Marlon gewesen, der den Kerl durchsiebt hatte, und nicht Karl Kühnert. Sein Herz glühte. »Fürchte dich, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, auf dass du ihn ewig in der Hölle hören mögest.«
Jetzt war Kühnert raus aus der JVA. Ganz unerwartet. Nicht vorzeitig entlassen, sondern vorzeitig geflohen. Seit fast einem Jahr hatten ihn Mauern, Türen und Schließer davon abgehalten, hierher zurückzukehren, um sich zu rächen. Einen Verräter nach dem anderen würde er sich vorknöpfen.
»Du Wichser!« Ceylan hatte ihn lange genug gedemütigt, jetzt hatte er zurückgestochen, direkt in die Halsschlagader. »Du Wichser, ich zieh dir die Lunge raus! Ich häng dich an deinen eigenen Därmen auf.« Kühnerts wirklicher Vater war Installateur gewesen und kein Arschloch wie dieser: »Wichser!«
Karl würde ab heute in Ceylans Bungalow an der Rochusstraße leben – direkt gegenüber der Haftanstalt, den die Leute im Volksmund »Klingelpütz« nannten. Niemand würde hier einen flüchtigen Häftling vermuten. Die Hitze im Zimmer wurde unerträglich. Kühnert zog sich das Hemd aus, damit er gleich kein Blut darauf haben würde. Ja früher, als kleines Kind, da hatte ihn seine Mutter Sommer wie Winter stets nackt auf dem Tripptrappstuhl essen lassen, damit er nicht seine Kleidung bekleckerte, sondern nur sich selbst. Bis heute aß er am liebsten mit bloßem Oberkörper. Er holte die Axt und eine Plane aus dem Schuppen hinter dem Haus. Letztere schob er unter den Toten. Dann begann er mit seiner Arbeit. Erst schlug er ihm die Gliedmaßen ab, Stück für Stück, Hand für Hand, Fuß für Fuß, und übergab sie dem Feuer. Die Öffnung war sogar groß genug für den Kopf. Es war ein Wunder, wie schnell Fleisch und Knochen brannten, wenn sie nicht über dem Grill, sondern direkt in der Flamme brannten. Kühnert hasste den Geruch verbrannten Fleisches. Er war Vegetarier. Niemals würde er Tiere essen. Das war Mord. Im Gefängnis war er der einzige Vegetarier im Trakt gewesen.
Nach getaner Arbeit rollte Kühnert den Flokati samt Plane zusammen, wickelte zur Sicherheit noch eine Plastikfolie darum, ging ins Bad und duschte und putzte sich mit Ceylans Bürste die Zähne. Nackt wie er war, schritt er durch den Flur. Wo mochte Ceylan seine Waffe versteckt haben? Er ging zurück ins Bad und schaute die Fliesen an. Eine wie die andere. Er hockte sich hin und zog den Schrank unter dem Waschbecken vor, ruckelte ihn hin und her, bis endlich eine Handlänge Platz dahinter war. Direkt neben dem Abflussrohr fehlte eine Fliese, nur eine Plastikkappe war auf die Wand montiert. Wie erhofft war dahinter ein Loch, und hineingestopft lag in einer Plastiktüte eine PPK samt Schalldämpfer und drei Magazinen. Er schob das Schränkchen wieder ruckelnd an die Wand und wischte kurz mit dem nassen Duschhandtuch die Schlieren vom Ruckeln auf dem Boden weg. Am Ende wollte er die Wohnung sauber hinterlassen. Sauberkeit war eine Charaktereigenschaft, die er penibel pflegte. Karl Kühnert zog sich wieder an, lief erneut den Flur entlang zum Wohnzimmer und zog die breite Glasscheibe auf. Draußen war es kühler als drinnen, und die Nacht war tief.
Jetzt erst schulterte er den Flokati und warf ihn zwischen die Büsche im Garten. Da würde so schnell keiner hinschauen, auch nicht der Nachbar. Eigentlich hätte er ihn auch verbrennen können, aber er war sich nicht sicher, wie sehr das Plastik und der Teppich stinken würden.
Kühnert wollte schon wieder durch die offene Schiebetür zurück ins Haus, da hörte er Fußgetrappel. Gummi auf Platten. Er schlich sich zur Sichthecke nach vorn: »Scheiße, Cops!« Die waren so dunkel gekleidet, dass nur das Mondlicht und die nahe Straßenlaterne sie verrieten.
Geistesgegenwärtig lief er ins Wohnzimmer, schaute sich noch einmal um. Alles wie vorher, nur das Feuer im Ofen. Das konnte er jetzt nicht mehr löschen. Zudem sah das dort hinter der Sichtscheibe nicht aus wie Knochen, es war alles nur noch ein Haufen zusammengeschmolzenes Zeugs.
Er stieg hinten im Garten auf die Bank an der Hauswand, zog sich am Dachrand hoch und kroch flach wie ein Leguan im fahlen Mondlicht über das Dach des Bungalows. Er fühlte sich wie in seinen Jahren bei der Bundeswehr, fühlte den jungen Rekruten in sich.
Von hier oben konnte er hinüber zum Klingelpütz schauen. Die Nacht war ruhig, einzig ein Summen hörte er weit über sich. Was war das? Ein kleiner roter Punkt leuchtete. Flog da etwas? Eine Drohne? Arbeitete die Polizei mit Drohnen? Er hob eine der Dachplatten an und sah in die Kuhle unter sich, während das Einsatzkommando der Polizei die Tür einrammte. Sein Stiefvater hatte das Versteck im Flachdach einst angelegt, weil er Angst vor der Polizei gehabt hatte. Mitten in dieser Spießersiedlung hatte er sich den Bungalow gekauft, um nicht aufzufallen. Aber falls die Polizei käme, wäre er bereit gewesen. Karl legte sich zusammengerollt wie ein Shrimp in die Kuhle. Noch einmal schaute er hinauf zu dem kleinen blinkenden Punkt am Himmel. Dann zog er die Platte über sich.
Augenblicklich war es stockfinster um ihn herum. Er kam sich vor wie in einem Grab. Unter sich hörte er die Stimmen Wörners und der übrigen Beamten, die den Bungalow durchsuchten, aber keine Spur von Karl Kühnert fanden. Sie wunderten sich lediglich über den heißen Ofen, doch den Geruch des verbrannten Fleisches bekamen sie dort unten nicht mit. Einer der Polizisten steckte seinen Kopf durch das Dachfenster. Der Lichtkegel seiner Taschenlampe konnte nichts Ungewöhnliches entdecken – Platte an Platte an Platte und alle in einem schmutzigen Rot. Ihm fiel nicht einmal auf, dass eine der Platten viel größer war als alle anderen. So zog der Polizist mit der Sturmhaube die Luke wieder zu, wunderte sich noch über den fleischigen Geruch, den er jedoch nicht zuzuordnen wusste. Schwein auf dem Grill riecht ähnlich wie Mensch im Ofen. Nicht weit entfernt gab es Schrebergärten. Dass Ceylan so stinken würde, damit hätte er jedenfalls nicht gerechnet.
Kühnerts Handy klingelte. Einsatzleiter Wörner stand direkt unter ihm und wunderte sich über das Klingeln. Er konnte es zu Kühnerts Glück nicht räumlich zuordnen. Stattdessen sagte er laut: »Ich hab’ euch gesagt, ihr sollt die Handys in der Wache lassen. Wer war das?«
Keiner seiner Leute meldete sich. Wörner wartete.
Dann beließ er es bei der Ermahnung und ließ das Restfeuer im Ofen löschen. Es folgte der Abmarsch, und Kühnert verharrte noch einige Minuten in seiner Shrimpsstellung. Er hielt sein Handy ganz dicht an seinen Körper. Da war in all der Dunkelheit wieder der Hass, der ihm keine Ruhe ließ. Er schob die Platte über sich zur Seite und atmete tief in die Nacht und die Sterne hinein. Noch immer war da der rote Punkt. Hätte die Drohne der Polizei gehört, so wäre Kühnert längst gefasst worden.
Über Loreley drehte sich zur gleichen Zeit keine Drohne, sondern das Planetenmobile aus Holz, das ihr Albert zur Geburt hatte schnitzen lassen. Marlon war in Smillas Arm eingeschnarcht, endlich ein wenig Schlaf in einer schlaflosen Kölner Nacht.
Kühnert schlich übers Dach. Er sprang hinunter in den Garten.
Vorn am Eingang zum Bungalow hatte die Polizei zwei Beamte zurückgelassen, die in einem Ford in Zivil warteten. Kühnert lief direkt hinter ihnen entlang und zum Parkplatz am kleinen Einkaufszentrum. Dort stand ebenfalls ein Polizeifahrzeug. Er konnte sich nur wundern. Was machten die alle hier? Er jedenfalls wollte sich keine weiteren Gedanken machen, denn er brauchte ein Auto. Darauf musste er sich konzentrieren. Die neueren Modelle konnte er nicht knacken, aber der alte Audi, der direkt an den Schrebergärten parkte, kam ihm gerade zupass. So schloss er ihn kurz und sah oben in der Windschutzscheibe wieder den roten Punkt am Himmel. Er gab Gas und bog nach links Richtung