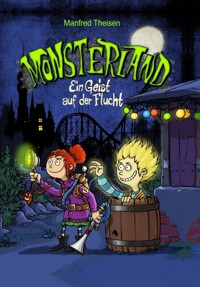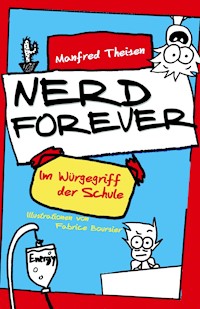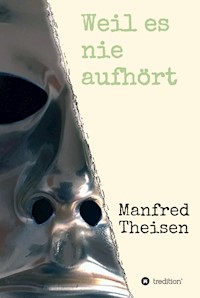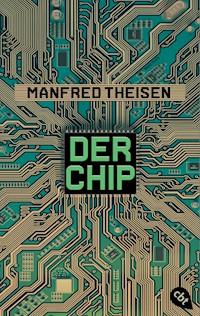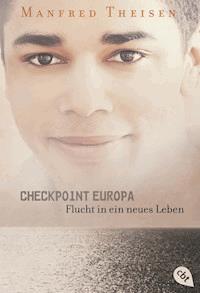6,99 €
6,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Lebensborn. Ein erschütterndes Thema. Bewegend erzählt.
Fritz verbringt die Sommerferien im Lebensborn, wo sein Vater leitender Arzt ist. Durch ihn weiß Fritz Bescheid: dass die Juden schlecht sind und die arische Rasse schnell vermehrt werden muss. Doch dann kommen ihm allmählich Zweifel, schließlich ist seine große Liebe Maria ganz anderer Meinung. Als Aniela, Marias ältere Schwester, ihr behindertes Kind nach der Geburt abgeben soll, muss Fritz eine folgenschwere Entscheidung treffen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2010
4,7 (18 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
DER AUTOR
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Copyright
DER AUTOR
Manfred Theisen wurde 1962 in Köln geboren. Er studierte Germanistik, Anglistik und Politik, forschte zwei Jahre für das deutsche Innenministerium in der Sowjetunion, arbeitete als Redakteur und leitete eine Kölner Zeitungsredaktion. Heute lebt er als freier Autor in Köln.
Von Manfred Theisen sind bei cbt und cbj bereits erschienen:
Amok (30175) Checkpoint Jerusalem (30249) Gesucht: Anne Bonny, Piratin (30373) Täglich die Angst (30363) Die Rotte (30458)
Erstes Kapitel
Ich sitze auf der Wiese und ziehe den Dolch, ramme ihn neben mir ins Gras. In kantigen Buchstaben steht Blut und Ehre auf dem Schaft. Die Luft, die mich umfängt, ist mild. Wenn der Sommer in Gang kommt, liebe ich den Platz neben der Wäscherei. Das Gras ist hier dichter als an irgendeinem anderen Flecken auf dem Grundstück - und es riecht erfrischend nach seifigem Dampf. Selbst wenn du schmutzig bist, fühlst du dich hier richtig sauber.
Heute Abend werde ich endlich wieder vorlesen. Ich übe also noch einmal den Text, lese leise im Buch, bewege meine Lippen lautlos dazu: Im ewigen Kampfe ist die Menschheit groß geworden - im ewigen Frieden geht sie zugrunde, steht dort in exakter Handschrift. Ich kann nicht so sauber die Buchstaben aufs Papier schreiben wie mein Vater - egal, wie sehr ich mich auch bemühe. Es gelingt mir nicht, denn ich bin nicht gesund.
Ein Schrei von Helene weht zu mir herüber vom Herrenhaus. Das erdfarbene Gebäude sieht mit seinen Türmchen und Vorsprüngen wie ein verwunschenes Märchenschloss aus. Keine der Tauben, die über der Eingangstür hockten, zuckt zusammen. Sie sind die verzweifelten Schreie der Mädchen gewohnt. Ich habe keine Lust zu lesen, starre aber unbeirrt ins Buch. Gleich wird Vater kommen, da er Helenes Schreie sicher auch gehört hat.
Seine Schritte nähern sich knirschend auf dem Kies. »Na, bist du fleißig? Bereitest du dich auf heute Abend vor?«
Ich sehe ihn an, als hätte ich ihn nicht erwartet. »Ja«, sage ich ruhig. »Wohin läufst du, Papa?«
Ein heller Schrei aus dem Herrenhaus ist die Antwort.
»Da hörst du es! Das Leben hat keine Zeit mehr.« Vater rennt die Freitreppe hinauf, trägt Uniformhose und frisch gebügeltes Hemd. Obwohl seit Jahren Krieg ist, sitzen die Bügelfalten und seine Bewegungen wirken trotz der Eile ruhig. Nichts kann ihn aus der Fassung bringen, höchstens mein Ungehorsam.
Blut und Ehre, sagt mir der Dolch, den ich kurz aus dem Boden ziehe und wieder kraftvoll hineinramme, ehe ich erneut ins Buch schaue. Vor zwei Jahren - es war ebenfalls Frühsommer - sind wir hierhergekommen. Und wir werden hierbleiben.
Ich blättere weiter. Das Buch, in dem ich lese, kann man nicht kaufen, in keinem Laden. Denn Vater schreibt es selbst. Immer ein neues Bündel Blätter fügt er jedes Jahr hinzu wie Jahresringe an einem Baum. Jetzt haben wir 1944. Das Büchlein ist bislang doppelt so dick wie mein Daumen. Wie dick wird es sein, wenn wir den Krieg gewonnen haben? In dem Buch hat er die wichtigsten Sätze des Führers und seiner Getreuen versammelt, Sätze, die einem zu Herzen gehen; Gedanken, die Hitler, Goebbels1 oder Himmler1 in ihren Schriften und Reden geäußert haben. Wenn ich die Worte Hitlers lese, so soll ich mir den Führer dabei vorstellen, wie er sie spricht, und bewege lautlos meine Lippen, höre innerlich eine heiser geschriene Stimme, fasse den Dolch und drehe ihn in der Erde wie in einem Körper. Irgendwann werde ich auch in den Krieg ziehen.
Ein Schrei dringt aus dem Herrenhaus. Ich will nicht wissen, was die Leute hinter der Mauer denken, die unseren Lebensborn* umgibt. Nun folgt ein Schrei Helenes auf den nächsten, dann herrscht Stille.
Helene ist jetzt Mutter.
Ich klappe das Buch zu, stecke den Dolch wieder weg und nehme einen Kiesel vom Pfad, werfe ihn, um die Tauben aufzuscheuchen. Sie fliegen über mich hinweg - zur Wäscherei, wo immer gearbeitet wird. Wir haben hier vierundzwanzig Säuglinge, da gibt es stets schmutzige Wäsche.
Selbst das einstöckige Gebäude der Wäscherei hat Verzierungen. Ein Männchen aus Stein lugt vom Giebel hinab auf den Eingang, aus dem es herausdampft, als würden dort die Wolken gemacht.
Ob Maria ihrer Mutter beim Waschen hilft? Wenn Maria lächelt, strahlt ein Engel. Ich gehe hinüber zur Wäscherei. Die Scheiben sind beschlagen. Ich horche an der Scheibe.
»Wieder auf der Lauer?«, fragt mich unerwartet Theodor Michels. Ich habe ihn nicht kommen hören. Trotz oder gerade wegen seiner Krücke, geht er leise wie ein Fuchs. Ein Granatsplitter hat ihm das rechte Bein zerfetzt. Wir haben Frankreich im Handumdrehen überrannt, aber Michels hat es blöd erwischt.
»Dein Vater mag es nicht, wenn du Maria nachspionierst«, sagt er.
»Wie kommen Sie darauf? Sie ist doch gar nicht da.«
»Und woher weißt du dann, dass Maria nicht in der Wäscherei ist?«
Michels’ Logik ist gnadenlos wie sein Gesichtsausdruck - hager und dunkel ist der SS*-Offizier, der immer Uniform trägt. Seine Tränensäcke liegen dick und violett unter seinen Augen. Er wird sich nie wieder gesund schlafen können. Ich fürchte mich vor ihm. Sicher hat er den finsteren Blick von der Front mitgebracht. Früher müssen seine Augen strahlend blau gewesen sein, aber unsere Feinde haben ihm den Glanz genommen. Mancher Jude hat auch blaue Augen, aber ihnen fehlt der Glanz. Am Glanze erkennst du die nordische Rasse*. Das weiß jeder.
Wenn Michels nicht so grimmig gucken würde, könnte er einem leidtun. Wenn du zu lange in das Maul des Monsters schaust, wirst du irgendwann selbst ein Monster. Und dieser Krieg ist ein Monster. Nicht umsonst sagt der Führer: Ich weiß mir Besseres als Krieg! Allein wenn ich an den Verlust des deutschen Blutes denke - es fallen ja immer die Besten, die Tapfersten und Opferbereitesten, deren Aufgabe es wäre, die Nation zu verkörpern, zu führen. Warum haben uns die Polen* den Krieg aufgezwungen?, frage ich mich. Warum sind die Völker nicht eins mit uns? Sie sind wie unartige Kinder, an deren Hintern man sich die Hand wund schlagen muss.
»Na, ich kann dich ja verstehen«, meint Michels und unterbricht meine Gedanken. »Ist ja auch ein hübsches Mädchen und heute ist richtig schönes Hitlerwetter. Da erwacht der große Junge in dir.« Er sagt es mit einem Augenzwinkern, steckt seinen Finger in den Mund und schnellt ihn wieder hervor. Es macht plopp. Er findet es lustig und ich soll auch lachen. Hält er mich für ein Kleinkind oder einen Idioten? Vater sagt, dass meine Gedanken zu langsam sind und meine Knochen brüchig. Das weiß jeder im Lebensborn und jeder ist deshalb nachsichtig mit mir.
»Na, dann will ich mal weiter. Warte auf sie und nutze die Gunst der Stunde, denn dein Vater und die Storchentanten«, damit meint er die Hebammen, »sind noch mit Helene und ihrem Sohn beschäftigt. Aber lass dich nicht von deinem Vater erwischen. Er hat eine harte Hand. Ich bewundere ihn, wie er seine neue Aufgabe meistert. Hut ab!«
Bislang war Vater nur Stellvertreter von Theodor Felten gewesen, der unseren Lebensborn leitet. Doch vorgestern ist Felten abtransportiert worden. »Er hat etwas an der Leber«, meinte Papa. »Das kann eine Weile dauern. Derweil muss ich mich nun auch noch um die geschäftliche Seite unseres Lebensborns kümmern.« Nun ist Papa also nicht nur Arzt, sondern auch Heimleiter.
Ich blicke kurz Michels nach, sehe auf seine gewichsten schwarzen Stiefel, in denen sich die Sonne spiegelt, und bleibe bei der Wäscherei - ich warte und hoffe, Marias Stimme zu hören. Aber es ist still, nur der seifige Geruch dringt zu mir nach draußen und ich atme ihn ein.
Später sehe ich Maria und ihre Mutter durch die beschlagenen Scheiben. Sie haben den weißen Überzug eines Kopfkissens in der Hand und ziehen an beiden Seiten daran wie Engel an den Wolken. Dann stützt Marias Mutter ihre Linke in die Hüfte und zieht das Tuch zwischen ihnen mit einem Ruck stramm. Maria lacht herzhaft und hält mit der Rechten dagegen und stützt ihre Linke in die Hüfte. Sie lächeln und beginnen, von einem aufs andere Bein im Kreis zu hüpfen. Es sieht witzig aus, und die Musik, der sie folgen, muss ein Marsch sein. Ich mag Märsche und sehe gern Soldaten marschieren. Zu zweit, zu dritt, zu viert …
Das Gesicht von Marias Mutter ist mit einem Mal vor mir. Sie wischt von innen den Nebel von der Scheibe und schaut mich groß an. Ich habe taggeträumt. Ich lächele und entschuldige mich durch die Scheibe. Obwohl sie mich sicher nicht hören kann. Sie verscheucht mich mit einer Handbewegung und Maria wendet sich ab, verschwindet wieder in den Wolken.
Ich gehe fort.
Vermutlich ist mein Gesicht rot vor Peinlichkeit. Manchmal ist es gut, dass man sich nicht mit seinen eigenen Augen sehen kann.
Es ist Abend. Wir sitzen im Kreis, unsere fünf Schwestern - alle blütenweiße Schürze über grauem Kleid und hübsche Häubchen auf dem Kopf -, dann noch Michels und ich. Nachtschwester Franziska sitzt am Klavier. Eigentlich beginnt ihr Dienst immer erst um 20 Uhr, aber sie ist die Einzige, die »vernünftig« - wie Vater meint - Klavier spielen kann. Sie spielt die Unvollendete von Schubert. Die Büste des Führers thront auf dem Kaminsims. Sein Blick fällt auf die gegenüberliegende Wand, wo ein Bild seiner Mutter Klara hängt, gerahmt von zwei Lorbeerbäumen. Das Knistern des Feuers erfüllt den Raum, als sei tiefer Winter.
Früher wurde zur Namensgebung die Glocke geläutet. Neulich haben sie die Glocke, die vorn am Giebel des Herrenhauses hing, zusammen mit der Kirchenglocke zur Bahnstation transportiert. Die Glocken sind für die Waffenfabrik bestimmt, denn Stahl ist knapp.
Ich fühle mich ein wenig unwohl, mein Uniformhemd kratzt ebenso wie die kurze schwarze Hose. Die endet eine Handbreit über dem Knie. Wenn du die Uniform frisch anziehst, so ist es, als würdest du in eine Schale steigen, die sich erst deinem Körper anpassen muss. Eigentlich darf ich die Uniform nicht tragen, aber Michels hat Vater überredet: »Das kannst du deinem Sohn nicht antun. Er muss durch seine Krankheit auf so vieles verzichten«, hat Michels gesagt und mir die Pimpfen-Uniform samt Dolch besorgt.
Vater führt Helene herein. Ihr Bauch hängt noch schwabbelig von der Geburt unter der Bluse. Im Arm trägt sie ihren Sohn. Papa ist anderthalb Köpfe größer als sie, sein Körper wirkt wie ein riesiger Schatten. Helene ist klein. Genau bei 1,55 Meter gibt es gleich neben der Eingangstür zum Herrenhaus eine Kerbe am Türrahmen. Vater hat sie geschlagen. Denn nur Frauen ab 1,55 werden von uns aufgenommen und Helene hat mit der Schädeldecke gerade mal bis an Vaters Markierung gereicht.
Es ist feierlich, wie sie in unserer Mitte mit ihrem Neugeborenen Platz nimmt. Ihre riesigen Augen haben kleine Schlupflider. Vor ihr auf dem Tisch ist die Flagge mit dem Hakenkreuz ausgebreitet. Helene ist sechzehn, hat eine schlanke Gestalt und ihre Haut ist hell, leicht rosafarben. Ihr dünnes blondes Haar hat sie sich hinten mit einem lilafarbenen Schleifchen zusammengebunden. Es sieht hübsch aus. Obwohl Helene erst seit wenigen Wochen bei uns lebt, versteht sie schon etwas Deutsch und vergisst langsam das Polnische, welches immer noch im Wartheland gesprochen wird. Michels meint, die Polen seien unbelehrbar. Helene hatte er gleich bei ihrer Ankunft auf dem Flur ermahnt, deutsch zu reden oder zu schweigen.
Der Neugeborene ist noch blonder als sie. Kein Jude, kein Russe ist in ihrem Blut und war auch nicht im Blut des Vaters. Der Junge ist still und seine Augen sehen neugierig hinauf zur Büste des Führers. Ob er ihn erkennt? Er wird sich das Gesicht einprägen, es in seine Träume nehmen. Ich selbst habe schon den Führer im Schlaf gesehen.
Franziska beendet ihr Spiel. Es ist augenblicklich ruhig im Raum - wie in einer Bibliothek oder einer Kapelle.
Kein Atem zu hören.
Vater mag die Stille. Ich weiß, wie ruhig es jetzt in ihm zugeht. Die Bügelfalte ist frisch. Die Zeit vergeht lautlos. Er liebt seine Arbeit und vergisst dennoch nie die nationale Sache.
Michels wird Taufpate sein, genau wie die schwergewichtige Oberschwester Josephine, die schlecht Luft bekommt. Ihr Atmen ist jetzt zu hören. Hat sie eben die Luft angehalten? Das Herz so fettleibiger Menschen muss pumpen, wie eine Maschine pumpt, die einen Panzer vorantreibt. Sie und Michels erheben sich. Zur Feier nimmt Michels sogar die Mütze ab, die ihm sonst auf seinem halb kahlen Schädel wie angewachsen erscheint. Er spielt mit der Rechten an dem aufgenähten silbernen Totenkopf, der unter dem Adler mit Hakenkreuz sitzt. Ich hätte gerne eine solche Mütze der SS, aber du musst sie dir erst verdienen. Nicht jeder darf zur Schutzstaffel. Ich ziehe mir derweil meine Strümpfe hoch. Sie rollen ständig herunter.
Ich mag Ordnung. Sie ist notwendig.
»Helene?«, sagt Vater und sieht sie durchdringend an.
Sie nickt. Ihr Blick ist immer noch stumpf, vermutlich ist sie einfach noch völlig erschöpft von der Geburt.
»Dein unbedingter Wille, dein Kind in Händen zu halten und es keinem anderen zu überlassen, beweist uns, dass du eine rassisch wertvolle Mutter bist. Daher wirst du von uns den Namen deines Sohnes empfangen, der ihn mit unserem Führer und unserem Volk verbindet.«
Helene legt ihr Kind zögernd in die Mitte der Flagge. Das Hakenkreuz ist die Sonne und genau ins Zentrum der Sonne kommt der Neugeborene.
Vater fragt: »Deutsche Mutter, verpflichtest du dich, dein Kind im Geiste der nationalsozialistischen Weltanschauung zu erziehen?« Helene weiß, was sie nun zu tun hat, und gibt meinem Vater mit Handschlag das Jawort. Auch Michels fragt er als SS-Paten: »Bist du bereit, die Erziehung dieses Kindes im Sinne des Sippengedankens der Schutzstaffel stets zu überwachen?«
Michels sagt ebenfalls »Ja« und gibt Vater den Handschlag. Dabei kann er nur mühsam sein Gleichgewicht halten. Schließlich stützt er sich sonst mit der Rechten auf die Krücke.
Vater greift zum Dolch und berührt mit der Spitze die Stirn des Täuflings: »So nehme ich dich hiermit in den Schutz unserer Sippengemeinschaft und gebe dir den Namen Rudolf.« Dabei dehnt er die erste Silbe in »Rudolf« wie eine Steinschleuder. »Trage den Namen Rudolf in Ehren.«
Wir erheben uns und strecken den Arm zum Gruß und halten so schützend die Hände über das neue Leben, um es in unserer Mitte aufzunehmen. Helene möchte ihren kleinen Rudolf wieder nehmen, aber Vater drängt sie mit einem Lächeln zur Seite und wickelt den Neugeborenen in die Flagge, »die ihm Schutz, Geborgenheit und Wärme bietet«. Wieder lächelt er Helene liebevoll an und übergibt ihr den Sohn. Ihr steigen Tränen in die Augen. Sie ist überwältigt. Wenn du Freudentränen schmeckst, so sind sie süßlich.
Wieder spielt Franziska Schubert. Die Musik setzt leise ein und behält ein ausgeglichen sanftes Tempo bei.
Dann gibt Vater ihr ein Zeichen. Franziska lässt ihr Spiel ausklingen. Vater und sie verstehen sich fast wortlos. Immerhin hat er ihr Kind mit einem Kaiserschnitt zur Welt gebracht.
Ich muss heute nicht mehr vorlesen. Mein Vortrag wird auf morgen vertagt, denn Vater bittet mich: »Schalte das Rundfunkgerät ein.«
Ich suche den Sender, der die Rede des Führers in Augsburg überträgt. Das Rundfunkgerät haben wir aus Köln mitgebracht. Es ist kein Volksempfänger*, sondern ein Telefunken-Gerät - Jubiläumsserie Weltsuper. Und zu Schwester Josephine sagt Papa: »Du kannst schon gehen, kümmere dich um sie. Helene muss ihren Sohn anlegen.«
Wir hören weiter die Stimme des Führers im Rundfunkgerät. Sie wirkt in mir wie ein Uhrwerk. Wenn der Führer spricht, wird die Zeit hörbar. Du kannst unseren Siegeszug genauso wenig aufhalten wie die Zeit. Der Zeiger schreitet im Stechschritt voran.
Später liege ich im Bett, denke an Maria, wie sie im Waschhaus steht - gehüllt in das Kleid aus Dampf. Ihr Gesicht ist schmal, ihre Nase klein wie der Mund. Maria ist ein zartes Luftwesen mit schwarzen Haaren, genau wie ihre Mutter.
Das Schnarchen meines Vaters unterbricht meine Gedanken. Er ist durch die Wand zu hören. Ohne Vater wäre ich alleine auf der Welt.
Die Schreie der Säuglinge dringen nicht bis hierher. Sie liegen im westlichen Trakt - gleich in der Nähe des Kreißsaales, wo Helene entbunden hat. Ich will in den Schlaf finden, aber meine Gedanken zappeln wie Würmer am Haken. Marias Gesicht geht mir nicht aus dem Sinn.
Als ich das Licht anschalten möchte, um noch etwas zu lesen, klopft es auf dem Flur an der Tür zu Vaters Zimmer. Eine weibliche Stimme ist auf dem Flur zu hören - es ist die hagere Entbindungsschwester Luise: »Kommen Sie bitte. Unsere Helene hat sich versündigt.«
Ich weiß nicht, was sie damit meint, aber ich schlüpfe in meine Hose, ohne meinen Schlafanzug auszuziehen, schleiche barfuß hinter Vater und Luise durch den Gang, der mir enger erscheint als am Tag. Luise hält einen Kerzenleuchter mit zwei Kerzen. Sie ist selbst Mutter von drei Kindern, wobei nur ihr jüngstes hier bei uns wohnt - es ist aber erst ein halbes Jahr alt, genau wie jenes von Nachtschwester Franziska.
Wo ist Franziska eigentlich? Es ist doch gar nicht Luises Art, in der Nacht zu arbeiten. Die winzigen flackernden Flammen leuchten ihnen den Weg. Warum legt Luise nicht den Schalter um? Warum machen sie kein elektrisches Licht?
Mir ist unheimlich. Ich will »Vater!« rufen, schlucke jedoch das Wort herunter. Er würde mich sofort zu Bett schicken. Der steinerne Fußboden ist kalt. Sie durchqueren den Saal, in dem die Säuglinge friedlich in ihren Bettchen liegen. Keine der Schwestern, die sonst in der Nacht über ihren Schlaf wachen, ist da. Es ist still, als sei etwas Furchtbares geschehen. Durch die Terrassentür, die hinaus in unseren Garten führt, dringt das Mondlicht.
Ich bleibe stehen, sehe im Halbdunkel die Bettchen mit den winzigen Körpern, Wabe an Wabe. Nur der Mond bescheint die Szene durchs Fenster, tunkt sie in ein bräunliches Licht. An der Stirnwand des Raumes prangt der Spruch:
»Heilig soll uns seinjede Mutter guten Blutes.«Heinrich Himmler, Reichsführer-SS
Auf einem Friedhof liegen die Körper ebenfalls dicht an dicht, gehüllt ins Jenseits und zugedeckt mit dunkler Erde. Hier im Säuglingssaal ruhen die weißen Deckchen auf ihnen. Atmen die Körper darunter? Ich höre sie nicht. Es ist ganz dunkel. Keines der Kinder schreit.
Vater und Luise sind weiter Richtung Kreißsaal gegangen, dem Schein der Kerze folgend. Ich laufe ihnen hinterher, gehe an Michels’ Zimmer vorbei - er schnarcht wie Vater. Als ich die beiden eingeholt habe und sie beobachte, sind sie nicht mehr alleine. Oberschwester Josephine und Schwester Claudia warten schon vor dem Wöchnerinnenzimmer auf sie. Eine Nachtversammlung, über der das Ölgemälde Mutter mit Kind an der Wand hängt. Gerade als Vater die Klinke herunterdrückt, stockt er und wendet sich in meine Richtung. Ich verberge mich hastig wie ein Dieb in einer Nische, in der ein Tisch steht, verkrieche mich darunter käfergleich. Hat er mich gehört? Bitte nicht! Ich kauere mich zusammen, meine Hände umfassen meine Schienbeine. So liegst du im Leib der Mutter. Mein Herz schlägt laut, es ist eine verräterische Maschine. Am liebsten würde ich mir den Dolch hineinrammen. Du stoppst die Maschine nur durch deinen Tod.
Ich horche. Nichts ist zu hören. Lediglich mein Herz.
Wo ist Vater?
Schritte.
Sie kommen näher, bleiben stehen. Kein Kies unter seinen Schuhen, nur die steinernen Platten des Flurs. Ein unerbittliches Klacken kommt auf mich zu. Ich schließe die Augen. Meine Füße sind kalt. Wenn du die Augen zumachst, bist du unsichtbar.
»Fritz? Was hockst du denn unter dem Tisch?« Es ist Vaters Stimme. Trotzdem werde ich die Augen nicht öffnen, verdränge seinen sanften Befehl, der mir sagt: »Steh auf.«
Ich werde ihn wegträumen, hinter meinen Augenlidern hat Vater keine Macht über mich, kein Mensch dringt bis zu mir vor. Ich bin krank, deshalb darf mich keiner ernst nehmen.
»Jetzt komm endlich da raus! Mach schon!«
Ich krieche unter dem Tisch hervor, stelle mich hin, das Kreuz durchgestreckt.
»So ist es recht, Fritz«, sagt die Stimme. »Du musst zurück in dein Zimmer. Du erkältest dich hier.«
Ich habe die Augen noch immer fest zu. Mein Kopf ist ein Tresor. Keiner wird meinen Kern rauben.
»Jetzt mach keine Dummheiten und geh! Ich habe zu arbeiten.«
Eine Hand drängt mich voran.
Ich gehe und Vaters Schritte entfernen sich. Er lässt mich allein, sonst kümmert er sich stets um mich. Mein Hirn war bei der Geburt unterversorgt. Ich habe im Geburtskanal festgesteckt. Da half auch keine Geburtszange. Keine Luft zum Atmen gab es dort zwischen Jenseits und Diesseits, zwischen Mutters Körper und der Welt. Meine Mutter wollte mich nicht loslassen. Sie wollte mich nicht in diese Welt werfen. Ohne Sauerstoff stirbt dein Gehirn.
Ich kneife die Augen fester zusammen, halte den Atem an. Das tue ich stets, wenn ich Angst habe. Mutter hat mich nicht mehr gesehen, wie ich im Hof gespielt habe und wie ich mit Vater von Münster nach Köln gezogen bin. Immer unterwegs waren wir. Die Ärzte des Führers sind dort, wo die Kinder des Führers sind. Du brauchst keine Freunde, du brauchst eine Idee. Von Köln sind wir hierher in den Lebensborn im Gau* Moselland gefahren. Ich sehe Mutters Gesicht. Haare glatt. Sie war ein ostbaltischer Typ mit hohen Wangenknochen. Eine Auserwählte. Ein Rassenforscher hat sie sogar fotografiert. Später wurde ihr Foto für ein Werbeplakat für die NS-Schwesternschaft benutzt. Vater schaut es sich nicht mehr an. Es bricht ihm das Herz. Sie und er haben sich geliebt und lieben sich noch immer.
Ich öffne die Augen. Es ist dunkel im Flur, Vater und Luise sind weg. Ich verharre kurz, gehe zurück, höre Theodor Michels’ Schnarchen, laufe durch den Säuglingssaal, wo ein Neugeborenes laut aufschreit und nach Luft schnappt. Ein Friedhof voller Lebewesen. Gleich wird Nachtschwester Franziska kommen und den Säugling beruhigen. Er weckt sonst alle anderen.
Zurück in meinem Zimmer, starre ich an die Decke. Meine Füße sind kalt, obwohl die Bettdecke darüberliegt. Ich warte auf Vater, während das Mondlicht für Licht und Schatten an der Decke sorgt - der Wind spielt mit den Blättern der Bäume. Es ist ein Schattentanz der Geister. Vaters Schritte klacken durch den Flur und bald schon wird er schnarchen und ich werde einschlafen. Was wohl mit Helene geschehen ist? Versündigt, hat Luise gesagt. Was kann das bedeuten? Wie soll sich eine Mutter versündigen?
Zweites Kapitel
Ich habe eben Maria durchs Badfenster gesehen, wie sie mit ihrer Mutter Katharina ins Waschhaus gegangen ist. Beide trugen einen hellblauen Kittel und werden gleich mit der Arbeit beginnen: Wolken machen.
Die Geschichte von heute Nacht schwirrt mir noch im Kopf herum, während ich die letzte Zahnpaste aus der Tube drücke. Das Hakenkreuz darauf ist zerknittert. Ich putze meine Zähne, als wolle ich sie abschleifen. Die bläuliche Flamme im Boiler, die fürs warme Wasser sorgt, beruhigt meine Gedanken. Vater sagt, ich soll die Tube eindrehen, nicht zerquetschen, um die weiße Paste bis zum Letzten herausdrücken zu können. Im Krieg müsse man sparen. Das sagt er auch bei der Leberwurstpelle. Ich quetsche die Tube trotzdem lieber aus. Am Ende streiche ich sie glatt, damit er meinen Ungehorsam nicht bemerkt. Er soll sich nicht aufregen.
Vater ist immer in meinen Gedanken, und sogar im Spiegel sehe ich in meinem Gesicht sein Gesicht, das auch ein Muttermal über der Oberlippe trägt. Ob ich später so aussehen werde wie er? Dann werden meine Haare glatt und nicht mehr so lockig sein. Aber meine Augen bleiben muttergrün. Der Spiegel hat einen Sprung. Er spaltet mein Gesicht in zwei Hälften. Manchmal frage ich mich, warum es keine neuen Spiegel in diesem Land gibt.
Was ist heute Nacht mit Helene passiert? Ich schrubbe über die Schneidezähne und spucke Paste aus. Weiße Spucke. Sauberkeit ist wichtig. Sauberes Blut. Blut und Ehre. Ich lege meine Linke stramm an die Hosennaht, die rechte Hand an den Dolch. »Und schießt mir der Russ’ ins Bein, so wird die Kugel nimmer tödlich sein« - reime ich. Der Mund in meinem Spiegelbild öffnet und schließt sich, als wäre es nicht mein Mund, und ich wiederhole lauter: »Und schießt mir der Russ’ ins Bein, so wird die Kugel nimmer tödlich sein!« Meine Stimme hallt durchs Bad. Dann schreie ich den Satz heraus! Die Zahnpaste spritzt mir mit dem Speichel aus dem Mund. Ich schließe fest meinen Mund, presse die Lippen aufeinander und grinse mich selbst breit an. Und spüle den Mund ein letztes Mal, kämme die Haare zur Seite - nun fängt der Tag an.
Im Frühstückssaal ist keiner mehr. Normalerweise weckt mich Vater. Wollte er, dass ich ausschlafe? Die Wände sind gelblich gestrichen und glänzen leicht. Es gibt noch Kakao in der Metallkanne und etwas Brot. Die Frauen essen in der Regel Haferbrei mit Zucker und roh geschabten Äpfeln. Vater achtet darauf, dass die Frauen gesund essen. Ich beiße ins Brot und kippe den kalten Kakao herunter, um möglichst schnell ins Waschhaus gehen zu können.
Draußen vor dem Fenster beleuchtet die Sonne den Berg. Er ist mit mächtigen Bäumen bewachsen, grün und saftig. Luxemburg* strotzt vor lebendiger Natur und in den Bergen hier soll es nur so von Geistern wimmeln. Riesige Felsen stehen dort, hoch wie Häuser und dunkel wie Nächte. Auch wenn es nur ein winziger Teil des Deutschen Reiches ist, so ist es doch einer der schönsten, im Westen stets von den Franzosen und Belgiern bedroht. Doch jetzt sind wir wieder ein Volk und niemand wird hier die Menschen unterwerfen.
Heute werde ich mit Maria reden. Ich will sie sehen. Ein Schrei ist zu hören, der Schrei einer Frau, die gerade gebiert. Vater ist sicher bei ihr. Und als Hebamme dürfte Josephine mit ihm arbeiten. Sie lässt es sich nicht nehmen, obwohl sie Oberschwester ist. Wieder ein Schrei. Wessen Schrei mag es sein? Ich kenne nicht alle Frauen, die in den Lebensborn kommen. Einige der Neugeborenen werden gleich nach der Geburt adoptiert. Die Väter der Kinder sehe ich nie. Die wichtigen Geschäfte des Lebens werden von den Müttern geführt. So hat jeder seine Arbeit - und Maria muss Wäsche waschen.
Die Fenster der Wäscherei sind wieder beschlagen. Morgens trifft die heiße Luft von innen auf jene vor der Scheibe, vor der ich stehe und die Vögel höre. Jeder von ihnen will sein Revier, sein Reich abstecken. Vogelgesang ist Kriegsmusik, die hübsch klingt. So, wie das glockenhelle Xylofon beim Marsch für die Melodie sorgt.
Ich nehme all meinen Mut zusammen und schiebe die Tür auf. Sie schabt ein wenig über den Boden, als würde ich in ein verwunschenes Schloss eintreten.
Hitze schlägt mir entgegen, dampfige Luft umhüllt mich.
»Was machst du hier?« Es ist Marias Stimme, die den Nebel durchdringt und zu ihrem zierlichen Körper passt, der langsam vor mir erscheint. Sie trägt eine
1
Mit einem Sternchen gekennzeichnete Wörter sind am Ende des Buches kurz erklärt.
cbj ist der Kinder- und Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House
1. Auflage Erstmals als cbj Taschenbuch Oktober 2010 Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform
© 2010 cbj Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Frank Griesheimer
he ‧ Herstellung: AnG
eISBN: 978-3-641-04607-1
www.cbj-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de