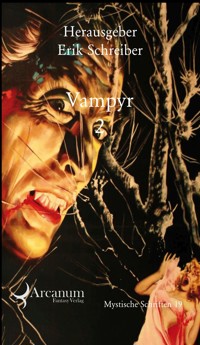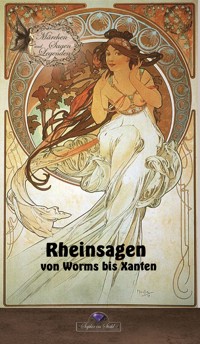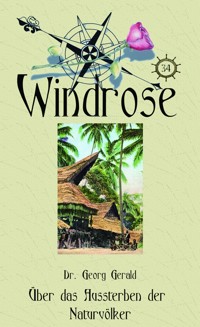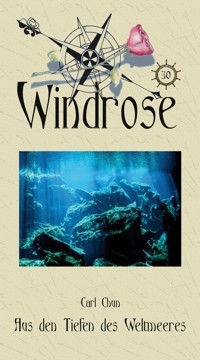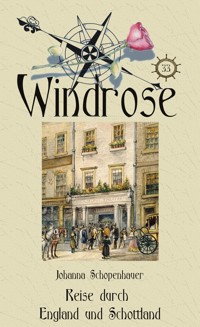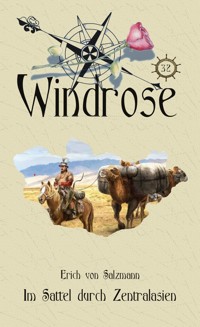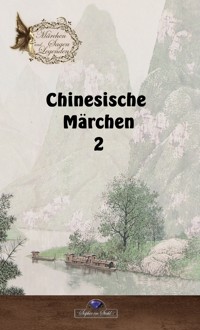
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Märchen Sagen und Legenden
- Sprache: Deutsch
Dieses Taschenbuch beschreibt Märchen und Sagen aus dem fernen China. Drachen, Feen, Götter sind seit Jahrhunderten faszinierende Wesen in Mythen und Geschichten, die in vielen Kulturen auf der ganzen Welt verehrt wurden. Gerade in China, mit seinem Vielvölkerstaat ist die Vielzahl der mystischen Wesen besonders Interessant. Der Inhalt wird aus alten Quellen bezogen und neu veröffentlicht. Mit dem vorliegenden Buch lernt man mit den Sagen und Märchen fremder Länder besser kennen. Die Sagen und Märchen geben einen Einblick in die damalige Zeit und finden sich zum Teil heute wieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Märchen Sagen und Legenden
Chinesische Märchen 2
Saphir im Stahl
Märchen Sagen und Legenden 20
e-book: 247
Titel: Chinesische Märchen 2
Erscheinungstermin: 01.07.2024
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Simon Faulhaber
Lektorat: Peter Heller
Vertrieb neobook
Herausgeber
Erik Schreiber
Märchen Sagen und Legenden
Chinesische Märchen 2
Saphir im Stahl
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Blinde und der Ölhändler
Der Kürbisberg
Die treue Meng-Djiang
Der Kuhhirt und die Weberin
Wie der Bauer Groschenklauber Geburtstag feierte
Prinz Achu und die schöne Ngoman
Wer ist der Sünder?
Das Glückskind und das Unglückskind
Die Höhle der Tiere
Der Panther
Die Mondjungfrau und die Sonnenjungfrau
Wie Hund und Katze Feinde wurden
Wie einer aus Gier nach dem Kleinen das Große verliert
Das große Wasser
Notscha
Die Mondfee
Die Reise nach dem Westen
Das Scheusal
Die seltsamen Abenteuer der tausend Handwerker
Sonne und Mond
Die Himmelskönigin
Nü Wa
Der Selbstmord des Ba Wang aus Teh-Chu
Eine Brücke aus Haarflechte
Asma
Vorwort
Die zweite Ausgabe der chinesischen Märchen umfasst wieder viele Sagen, Märchen und Legenden aus dem „Reich der Mitte“. In China leben heute 54 Nationalitäten, die herrschende Klasse sind jedoch die Han-Chinesen. Durch die vielfältige Bevölkerung sind auch die Legenden um Götter, Dämonen, Menschen und insbesondere Adlige und Beamte, sehr vielfältig. Es kommt durchaus vor, dass sich christliche und muslimische Sagen im chinesischen Gewand wiederfinden. Lange Zeit waren diese Religionen verboten. Daher war es nicht verwunderlich, dass die Mythen ein chinesisches Gewand erhielten.
Viele Erzählungen sind sich ähnlich, oder spielen in den unterschiedlichsten Epochen und wurden nur der herrschenden Klasse angepasst. Es kommt durchaus vor, dass innerhalb der Sannlungen Geschichten zweimal veröffentlicht wurden, um zu zeigen, wie sich die Erzählungen im Laufe der Zeit wandelten.
Jetzt wünsche ich gute Unterhaltung.
Peter Heller
Der Blinde und der Ölhändler
Ein blinder Musiker hatte sich mit seinem langen Stab bis an den seichten Fluss getastet und wusste nicht, wie er das jenseitige Ufer erreichen sollte. Da kam ein Ölhändler des Weges, der Mitleid mit dem Blinden fühlte und, dieser Gefühlsregung nachgebend, ihm zurief:
„Komm her, ich trage dich über den Fluss, halte unterdessen meinen Geldbeutel, damit mir nichts verlorengeht.“ Der Blinde, hocherfreut über diese Hilfe, setzte sich auf den Rücken des Mannes und hielt die schwere Tasche mit dem Kupfergelde, das der Ölhändler aus dem Verkauf seines Öles eingenommen hatte.
Als sie das jenseitige Ufer erreicht hatten, wollte der gutmütige Händler mit dem Dank des Blinden auch sein Geld in Empfang nehmen. Da aber erklärte der Blinde, das sei sein Geld. Er erhob auch gleich ein großes Geschrei und klagte Himmel und Erde die Gewalttat, dass der Händler ihn, den armen blinden Mann, berauben wolle.
Vergeblich verwahrte sich der Händler gegen diese erlogene Anschuldigung und verlangte sein Eigentum zurück. Das herbeilaufende Volk ergriff Partei für den Blinden und prügelte den Ölhändler durch.
Endlich brachte man die beiden immer noch streitenden Männer zum Mandarin. Hier knieten beide nieder, und jeder beteuerte, es sei sein Geld.
Der Mandarin hörte sie ruhig an, überlegte eine kurze Zeit, tat dann einige Fragen und sagte plötzlich: „Wir wollen in eurer dunklen Sache den Wassergott entscheiden lassen.“ Er ließ ein Gefäß mit Wasser bringen, den Inhalt des Geldsackes hineinschütten und die Münzen tüchtig im Wasser waschen.
Dann beugte er sich über das Gefäß und betrachtete nachdenklich die Oberfläche des Wassers. Nach einer kurzen Weile sagte er: „Das Geld gehört dem Ölhändler, und du, blinder Musiker, du Lügner und Betrüger, erhältst hundert Bambushiebe!“
Alle Anwesenden staunten über dieses Urteil, das der Mandarin aber sofort einleuchtend begründete.
„Seht her“, sagte er, „auf der Oberfläche des Wassers schwimmt Öl. Wenn der Mann Öl verkaufte, wurden seine Hände beim Ausmessen mit Öl begossen, und mit diesen ölbefleckten Händen nahm er das Geld in Empfang; es musste also die Spuren seines Geschäftes tragen.“ Auf dem Wasser schwamm wirklich das Öl in vielen großen Fettaugen.
Der Kürbisberg
Was ich nun erzählen werde, trug sich vor vielen, vielen Jahren zu, so dass niemand mehr weiß, in welcher Provinz es geschehen ist. Nur so viel ist sicher, so heißt es, dass bis heute irgendwo hinter einem Dorf ein Berg steht, der durch seine Form an einen riesengroßen Kürbis erinnert. Die Leute nennen ihn den Kürbisberg.
Früher war dort an Stelle des Kürbisberges eine ganz gewöhnliche Ebene. Damals lebte in einem fernen Dorf ein Jüngling namens Liu Ba-yüä. Er war ein fleißiger Bursche mit einem guten und schlichten Herzen. Besitz hatte er keinen. Zwar hatte sein Vater einst ein kleines Feld gehabt, doch der Gutsherr hatte ihn darum betrogen.
Liu Ba-yüä sammelte in den Wäldern Reisig, das er dann ins Dorf brachte. Da er so bitter arm war und nichts hatte als eine alte Hütte und zwei fleißige Hände, nannten ihn die Leute Armerle.
Armerle machte sich freilich nichts daraus, dass er nichts besaß. Wenn er fröhlich war, und das geschah oft, spielte er auf der Pfeife, die er sich aus einem Stück Schilfrohr gemacht hatte, die schönsten Lieder.
Eines Tages kehrte er von der schweren Arbeit nach Hause zurück und schlief fest ein. Plötzlich ging die Tür auf, und ein Greis trat ein, der sich auf einen Stock stützte. Er trat zum Jüngling und sagte freundlich: „Ich habe dir eine Zauberflöte aus Bambus gebracht. Sieh zu, dass du sie zu etwas Gutem verwendest.“
Ehe sich der Jüngling besann und für das Geschenk danken konnte, war der Greis verschwunden. Armerle erwachte und sagte sich, dass es bestimmt nur ein Traum gewesen sei. Doch was sah er da? Er hielt tatsächlich eine schöne Bambusflöte in der Hand!
Schnell legte er sie an die Lippen und spielte eine lustige Melodie. Die lieblichen Klänge erwärmten sein Herz, und sogleich war es ihm leicht und froh zumute.
Von dieser Zeit an trug Armerle die Flöte stets bei sich, und er spielte jedem auf, der zuhören wollte. Wenn er ein lustiges Liedchen spielte, lachte die Flöte, dass die Vögel auf den Ästen hüpften, die Ameisen mit den Fühlern im Takt schlugen und selbst der griesgrämigste Mensch lächeln musste. Manchmal kam es Armerle in den Sinn, wie allein und verlassen er war. Dann weinte die Flöte mit so jammervoller Stimme, dass die Blumen ihre Kelche schlossen, der Vogelsang verstummte und den Menschen die Tränen in die Augen traten. Vor der Hütte, in der Armerle wohnte, leuchtete der Spiegel eines Teiches. Weiden umgaben ihn, und im klaren Wasser tummelten sich Fischlein. Eines Tages kehrte Armerle nach Hause zurück, und da sah er, dass Kinder beim Teich herumtollten.
Plötzlich zog der munterste Bursche einen Fisch aus dem Wasser. Die Kinder kreischten vor Freude und liefen herbei. Armerle trat zu ihnen, und sein Herz erstarrte. Der arme Karpfen schlug um sich und schnappte nach Luft.
„Lasst ihn in Frieden!“, rief Armerle.
„Nein“, riefen die Burschen, „wir sind doch froh, dass wir ihn gefangen haben!“
„Höchstens“, fügten sie nach einer Weile hinzu, „höchstens, wenn du uns ein Liedchen spielst …“
Armerle nahm den Karpfen, warf ihn ins Wasser, legte die Flöte an die Lippen, und die Kinder hüpften herum und sangen.
Am nächsten Tag ging Armerle wie immer zum Teich, um sich zu waschen. Da kräuselte sich der Wasserspiegel, und der Karpfen steckte den Kopf heraus. Im Maul hielt er einen Kürbissamen, er schwamm zum Ufer, spie den Samen vor Armerle in den Sand und verschwand in der Tiefe.
Armerle freute sich. Er nahm das Samenkorn, lief damit nach Hause und setzte es vor seiner Hütte ein. Bald sprossen zarte Blättchen aus dem Boden und nach einigen Tagen tat sich eine schöne Blüte auf. Armerle begoss die Pflanze gewissenhaft und legte ihr eine kleine Leiter an, damit sie an etwas emporklettern konnte. Die Blüte verwelkte, ein kleiner Kürbis bildete sich und begann zu wachsen. Als er nach einigen Monaten reif war, hatte er eine solche Größe, dass sich niemand erinnern konnte, je einen ähnlichen gesehen zu haben. Die Leute kamen von weit her, um ihn zu bewundern, und Armerle hatte große Freude an seinem Kürbis.
An einem warmen Abend saß er noch ein Weilchen vor der Hütte. Ehe er sich’s versah, war die Nacht angebrochen. Im Licht des Mondes schaukelte der Kürbis langsam hin und her. Armerle lehnte sich an den Zaun, blickte zum Mond empor, zog die Flöte heraus und spielte.
Und da tauchte aus dem Kürbis der Schatten eines Mädchens auf. Armerle glaubte, dass ihn die Sinne täuschten. Er rieb sich die Augen, doch der Schatten verschwand nicht. Also richtete er sich auf und näherte sich zögernd der Erscheinung.
Beim Gartenzaun stand ein blutjunges Mädchen, schön wie eine Frühlingsblume, und lächelte. Dort, wo früher prall die Kürbisfrucht wuchs, lag nun eine leere Schale auf dem Boden.
„Wovor fürchtest du dich?“, ertönte es leise aus der Dunkelheit. „Tritt doch näher!“
„Wo kommst du her, Elfe?“, flüsterte Armerle verdutzt.
„Nenn mich nicht Elfe“, lachte sie mit lieblicher Stimme. „Ich wurde aus dem Kürbiskern geboren. Man nennt mich Kürbiskleinchen. Ich danke dir, dass du dich die ganze Zeit über so um mich gekümmert hast. Wenn du willst, werde ich deine Frau.“
Armerle war vor Freude außer sich. Beide verneigten sich in der hellen Mondnacht zur Erde und zum Himmel, und dann feierten sie Hochzeit.
Sie lebten in Liebe und Glück zusammen in der Hütte. Armerle ging jeden Tag in den Wald, um Reisig zu sammeln, und wenn er heimkehrte, erwartete ihn Kürbiskleinchen lächelnd auf der Schwelle.
Eines Tages geschah es, dass der Diener des Kaisers durch das Dorf fuhr. Er erblickte Kürbiskleinchen und war erstaunt ob ihrer unerhörten Schönheit. Als er in den Palast zurückkehrte, berichtete er so begeistert von ihr, dass der Kaiser sogleich den Befehl gab, sie zu ihm zu bringen; er wollte sie als seine Nebenfrau bei sich behalten.
Die Häscher kamen ins Dorf und gaben Kürbiskleinchen den Befehl des Kaisers kund. Armerle verlor vor Kummer fast den Verstand.
Kürbiskleinchen lächelte ihm jedoch zu und sprach: „Weine nicht und habe keine Angst! Gib mir die Schale meines Kürbisses mit, und komme in siebenmal sieben Tagen zu mir in den kaiserlichen Palast.“
Die Häscher packten Kürbiskleinchen und schleppten sie vor den Bezirksbeamten, der Beamte übergab sie dem Präfekten und der führte sie zum Kaiser.
Des Kaisers Herz begann wild zu pochen, als er das wunderschöne Mädchen sah.
„Willst du hier bei mir bleiben?“, fragte er sie.
„Ja“, nickte Kürbiskleinchen, „doch dein Palast gefällt mir nicht.“
„Was sagst du da?“, wunderte sich der Kaiser. „Im ganzen Land findest du keinen schöneren. Oder weißt du vielleicht von einem, der schöner ist?“
„Ja“, sagte Kürbiskleinchen. „Siebenmal sieben Tagesreisen östlich von hier ist der Kristallpalast, den kein anderer als der Nephritenkaiser für den Wahren Sohn des Himmels erbauen ließ. Wer nicht der Wahre Sohn des Himmels ist, der kann den Palast gar nicht sehen.“
Den Kaiser packte die Neugier, und er beschloss, mit seinem ganzen Gefolge und mit Kürbiskleinchen gen Osten zu reisen.
Als siebenmal sieben Tage vergangen waren, warf Kürbiskleinchen die Kürbisschale auf den Erdboden und sagte: „Verwandle dich in einen Kristallpalast!“
Mit einem Schlage stand vor dem Kaiser ein Palast, der glitzerte über und über in kristallenem Glanze, und der Kaiser und sein Gefolge traten ein.
Von diesem Augenblick war es, als hätte sie der Erdboden verschlungen. Am nächsten Tag stand an Stelle des Kristallpalastes ein hoher Berg, der hatte die Form eines Kürbisses, und in diesem Berg waren der Kaiser und sein Gefolge für immer verschwunden.
Währenddessen begab sich Armerle, wie ihm seine Frau geheißen hatte, in den kaiserlichen Palast. Als siebenmal sieben Tage verstrichen waren, trat er durch das offene Tor ein. Er traf weder den Kaiser an noch irgendeinen Vornehmen aus dessen Gefolge. Nur Kürbiskleinchen kam ihm entgegen.
Sie lebten dann noch lange glücklich in ihrem kleinen Dorf. Und der Berg, der den Kaiser verschlungen hatte und der in der Ferne gleich einem Riesenkürbis in den Himmel ragt, nennen die Leute seit damals den Kürbisberg.
Die treue Meng-Djiang
Der Chinesenjunge Wang ist von allen Kindern umringt, und Mäxchen Pfiffig hat gerade nach der großen Mauer gefragt, die einstmals um das Chinesenland gebaut war. Davon wollen sie alle auch etwas wissen.
„Ich will euch ein Märchen erzählen“, sagte der kleine Wang, „das ist schon fast 1500 Jahre alt und ist heute noch in jedem Dorf bekannt. Ich liebe es sehr. Passt auf: Der Garten der Familie Meng schloss sich an den der Familie Djiang an, und zwischen beiden Gärten lag eine Mauer. In einem Jahr nun pflanzten die Meng nahe an der Wand einen Kürbis, und die Djiang pflanzten ebenfalls auf der anderen Seite der Wand einen Kürbis. Beide Pflanzen kletterten die Mauer hinauf, wuchsen oben so fest zusammen, dass sie nur noch eine einzige Pflanze bildeten.
Nachdem diese Kürbisstaude wunderschön geblüht hatte, setzte sie eine ganz besonders große Frucht an. Als der Kürbis goldgelb geworden war, wollte die Meng wie die Djiang ihn ernten. Doch wem sollte er gehören? So beschlossen sie, ihn zu teilen und schnitten ihn auf. Da lag in ihm ein kleines wunderschönes Mädchen. Beide Familien rissen die Mauer ein, zogen das Kind gemeinsam auf und liebten es sehr. Es erhielt den Namen Meng-Djiang.
Zu dieser Zeit lebte in China der grausame und ungerechte Kaiser Shih-Huang. Dieser fürchtete die Hunnen, die von Norden her in sein Land einfielen, und ließ darum über die ganze Nordgrenze Chinas hin eine Mauer bauen. Doch weil er die Bauleute schlecht entlohnte und behandelte, so dauerte der Bau der Mauer sehr lange, kaum war ein Stück gebaut, so fiel ein anderes wieder ein, und nach langer Zeit war die Mauer immer noch nicht fertig.
Da gab einer der Palastheiligen des Kaisers, der seinen Geiz kannte, ihm einem teuflischen Rat: „Eine solche Mauer, die sich zehntausend Meilen hinzieht, kann man nur bauen, wenn man jedem Mauerstück von einer Meile Länge einen Menschen einmauert. Dessen Geist hält dann Wache über dieses Mauerstück.“
Dem Kaiser waren seine Untertanen so gleichgültig wie Gras und Kraut, und so folgte er dem Rate seines Dieners. Das ganze Land aber erzitterte über diesen Frevel. Die Männer flohen vor den Häschern des Kaisers, ballten sich zusammen, verfluchten ihn, wagten aber nichts zu unternehmen.
Nun gab es am Kaiserhof einen klugen Gelehrten, der sagte zu Shih-Huang: „Diese Art, wie Ihr Menschen zum Mauerbau verwendet, lässt das ganze Land erbeben. Es werden Unruhen ausbrechen, ehe noch die Mauer fertig ist. Ich habe von einem Mann Wan mit Namen gehört. Wan heißt „zehntausend.“ Ergreift diesen einen er wird für die Zehntausend-Meilen-Mauer genügen.
Der Kaiser befahl, diesen Wan suchen zu lassen. Wan war ein berühmter Seidenweber und wurde seiner wunderbaren Kunst wegen von allen Menschen geliebt. Kaum hörte er von dem grausamen Befehl des Kaisers, so floh er, und viele Menschen halfen und verbargen ihn.
Zu dieser Zeit war die schöne Meng-Djiang schon ein erwachsenes Mädchen. In einer hellen Mondnacht ging sie durch ihren Garten und erblickte den flüchtigen Wan, der sich auf einem Baum versteckt hielt. Als Wan das schöne Mädchen erblickte, fühlte er eine heiße Liebe zu ihr, sprang vom Baum herab und legte ihr eine seidene Schärpe um, auf der waren viele goldene Fische eingewebt.
Meng-Djiang versprach Wan, seine Frau zu werden, und verbarg ihn in ihrem Gartenhaus.
Als sie nach einiger Zeit sorglos beim fröhlichen Hochzeitsmahle saßen, kamen die Soldaten des Kaisers, rissen Wan von der weinenden Braut und schleppten ihn zur Mauer. Dort wurde er lebend in die Mauersteine eingeschlossen.
Meng-Djiang war ihrem Wan in herzlicher Liebe zugetan. Nachdem sie viele Wochen in Tränen und Kummer verbracht hatte, machte sie sich auf den Weg zur großen Mauer und wanderte über Berge und Flüsse. Als sie endlich an die gewaltige Mauer kam, verzweifelte sie. Wie sollte sie die Stelle finden? Weinend lief sie Tage und Nächte die Mauer entlang, und diese hatte mit ihrem Kummer Erbarmen, sie fiel auseinander und gab ihr den toten Geliebten frei.
Als der Kaiser von der Frau hörte, die ihren Mann gesucht hatte, kam er selbst, sie zu sehen. Und wie er ihre überirdische Schönheit sah, beschloss er, sie zur Kaiserin zu machen. Meng-Djiang konnte sich nicht wehren, stellte aber drei Bedingungen: Sie wollte, dass für ihren Mann eine neunundvierzigtägige Totenfeier abgehalten werde, dass der Kaiser und alle seine Beamten an dem Begräbnis teilnähmen, und dass man für sie, die zukünftige Kaiserin, eine neunundvierzig Klafter hohe Terrasse am Flussufer baue. Dort wolle sie für ihren Mann das Totenopfer vollbringen. Nur unter diesen drei Bedingungen wollte sie den Kaiser heiraten. Und der Kaiser gewährte sie ihr alle. Als alles fertiggestellt war, stieg Meng-Djiang auf die Terrasse und verfluchte den grausamen und ungerechten Kaiser, der nur an sich, nicht aber an sein Volk denke. Der Kaiser wurde bleich vor Zorn, doch ehe er etwas erwidern oder befehlen konnte, warf Meng-Djiang ihre mit goldenen Fischen gewebte seidene Schärpe in den Fluss und sprang ihr nach.
Jetzt befahl der Kaiser, den Fluss zu durchsuchen und sie in lauter kleine Stücke zu zerteilen. Aber so sehr sich die Soldaten mühten, den Befehl auszuführen, es gelang ihnen nicht: Der Leib Meng-Djiangs war nicht mehr zu finden. Sowie sie das Wasser berührt hatte, verwandelte sie sich in lauter kleine Goldfische, in denen die Seele der treuen Meng-Djiang nun für alle Zeiten weiterlebt.“
Der Kuhhirt und die Weberin
Der Kuhhirt war von Haus aus arm. Mit zwölf Jahren trat er bei einem Bauern in Dienst, seine Kuh zu weiden. Nach einigen Jahren ward die Kuh fett und groß, und ihre Haare glänzten wie gelbes Gold. Es war wohl eine Götterkuh.
Eines Tages, als er im Gebirge weidete, begann sie plötzlich mit Menschenstimme zu dem Kuhhirten also zu sprechen: „Heute ist der Siebenabend. Der Nephritherr hat neun Töchter, die baden heute im Himmelsee. Die Siebente ist über alle Maßen schön und klug. Sie spinnt für den Himmelskönig und die Himmelskönigin die Wolkenseide und waltet über die Näharbeiten der Mädchen auf Erden. Darum heißt sie die Weberin. Wenn du hingehst, ihr die Kleider nimmst, kannst du ihr Mann werden und erlangst die Unsterblichkeit.“
„Das ist ja im Himmel“, sagte der Kuhhirt, „wie kann man da hinkommen?“
„Ich will dich hintragen“, antwortete die gelbe Kuh.
Da stieg der Kuhhirt auf den Rücken der Kuh. Im Nu strömten aus ihren Füßen Wolken hervor, und sie erhob sich in die Lüfte. Es schwirrte ihm um die Ohren wie der Ton des Windes, und sie fuhren dahin, schnell wie der Blitz. Plötzlich hielt die Kuh an. „Nun sind wir da“, sagte sie.
Da sah er rings umher Wälder von Chrysopras und Bäume von Nephrit. Das Gras war aus Jaspis und die Blumen aus Korallen. Inmitten dieser Pracht lag ein hundert Morgen großer See. Grüne Wasser wallten wogend, und goldschuppige Fische schwammen darin umher. Dazu gab es unzählige Zaubervögel, die singend auf und nieder flogen. Schon von ferne sah er die neun Mädchen im Wasser. Ihre Kleider hatten sie alle am Ufer abgelegt.
„Nimm rasch die roten Kleider“, sagte die Kuh, „und verstecke dich damit im Wald, und wenn sie dich noch so zärtlich darum bittet, so gib sie ihr nicht eher zurück, als bis sie dir versprochen hat, deine Frau zu werden.“
Da stieg der Kuhhirt eilends vom Rücken der Kuh herunter, nahm die roten Kleider und lief hinweg. In diesem Augenblick wurden die neun Mädchen seiner gewahr. Sie erschraken sehr.
„Woher kommst du, Jüngling, dass du es wagst, unsere Kleider zu nehmen“, sagten sie. „Lege sie schnell wieder hin!“
Aber der Kuhhirt ließ sich's nicht anfechten, sondern duckte sich hinter eine der nephritnen Blumen. Da kamen acht der Jungfrauen eilends ans Ufer gestiegen und zogen ihre Kleider an.
„Siebente Schwester“, sprachen sie, „der dir vom Himmel bestimmt, ist zu dir gekommen. Wir Schwestern wollen dich mit ihm alleine lassen.“
So blieb die Weberin geduckt im Wasser sitzen. Sie schämte sich gar sehr und redete zu ihm: „Kuhhirt, gib mir schnell meine Kleider wieder!“
Aber der Kuhhirt stand lachend da. „Wenn du mir versprichst, meine Frau zu werden“, sagte er, „dann gebe ich dir deine Kleider.“
Die Jungfrau aber war nicht einverstanden. „Ich bin eine Tochter des Herrn der Götter“, sagte sie. „Ohne seinen Befehl darf ich nicht heiraten. Gib mir schnell meine Kleider wieder, sonst wird dich mein Vater bestrafen!“
Da sagte die gelbe Kuh: „Ihr seid füreinander vom Schicksal bestimmt. Ich will gern die Heirat vermitteln, und der Herr, Euer Vater, wird sicher nichts dagegen haben.“
Da sprach die Jungfrau: „Du bist ein unvernünftiges Tier. Wie könntest du den Ehevermittler machen?“
Die Kuh sprach: „Am Ufer da, der alte Weidenbaum, versuch es einmal, ihn zu fragen! Kann er sprechen, so ist eure Vereinigung vom Himmel gewollt.“
Und die Jungfrau fragte die Weide. Die Weide antwortete mit menschlicher Stimme:
Siebenabend ist heut, Der Kuhhirt die Weberin freit.
Da war die Jungfrau einverstanden. Der Kuhhirt legte die Kleider nieder und ging voran. Das Mädchen zog die Kleider an und folgte ihm nach. So wurden sie Mann und Frau. Nach sieben Tagen aber nahm sie Abschied von ihm.
„Der Himmelsherr hat mir befohlen, ich solle nach dem Spinnen sehen“, sagte sie. „Wenn ich allzu lange säume, fürchte ich, wird er mich bestrafen. Aber wenn wir jetzt auch scheiden müssen, so werde ich doch wieder mit dir zusammenkommen.“
Als sie diese Worte gesprochen, da ging sie wirklich weg. Der Kuhhirt lief ihr nach. Aber als er schon ganz nahe war, da zog sie einen ihrer Haarpfeile heraus und machte einen Strich quer über den Himmel. Dieser Strich verwandelte sich in den Silberfluss (Milchstraße). So stehen sie nun durch den Fluss getrennt und schauen nacheinander aus.
Seitdem kommen sie jedes Jahr am Siebenabend einmal zusammen. Wenn die Zeit gekommen ist, so fliegen die Krähen aus der Menschenwelt alle herbei und bilden eine Brücke, auf der die Weberin den Fluss überschreitet. An diesem Tag sieht man morgens und abends in den Bäumen keine einzige Krähe. Das hat wohl eben darin seinen Grund. Und außerdem fällt am Siebenabend häufig ein feiner Regen. Dann sagen die Frauen und alten Weiber zueinander: „Das sind die Tränen, die der Kuhhirt und die Weberin beim Abschied vergießen.“ Darum ist der Siebenabend ein Regenfest.