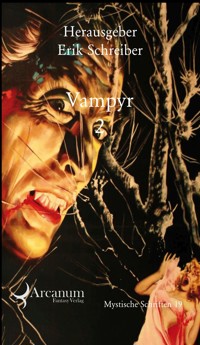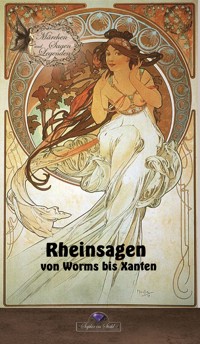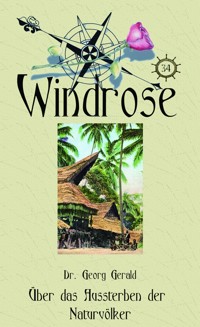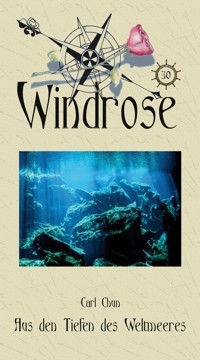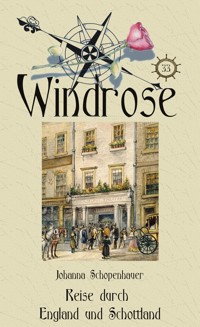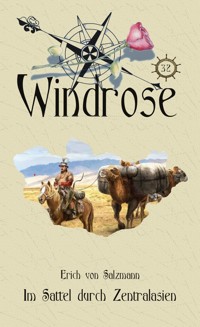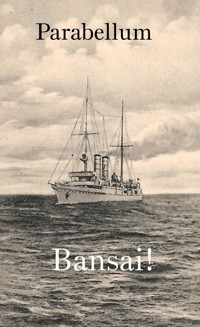
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Banzai! von Parabellum" von Ferdinand Heinrich Grautoff ist ein historischer Roman, der 1908 veröffentlicht wurde. Die Erzählung dreht sich um Themen wie Spannungen und Krieg, insbesondere um die Beziehungen zwischen Amerika und Japan in einer Zeit des drohenden Konflikts. Der Roman schildert anschaulich das militärische Leben und die politische Atmosphäre im Vorfeld des Krieges.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Parabellum
Bansai!
Saphir im Stahl
e-book Nr. 289
Ferdinand Grautoff (Parabellum) - Bansai! (1908)
Erscheinungstermin 01.06.2025
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild:
Lektorat Peter Heller
Vertrieb: neobooks
Herausgeber
Erik Schreiber
Parabellum
Bansai!
Saphir im Stahl
Es hatte ganz harmlos und unauffällig angefangen, wie immer. Wie das alles gekommen ist, und wie es sich vorbereitet hat, wie die Strömungen in Fluss kamen, das zu erzählen, ist nicht meine Sache. Das mag den Garnspinnern und Quellensuchern der Geschichtsschreibung überlassen bleiben. Sie mögen feststellen, wann drüben in Asien der Gedanke, dass der Zusammenprall kommen müsse, und dass man die Frucht nicht erst reifen lassen dürfe, die Massen des japanischen Volkes zu erfassen begonnen hat.
Dass wir aber hier in Amerika jahrelang in einem Zustande gelebt haben wie einer, der die dumpfe Ahnung hat, dass irgendetwas Schreckliches plötzlich hereinbrechen werde, und der dieses innere Angstgefühl immer wieder mit schlechtem Gewissen durch den Trubel und die Unruhe des Alltagslebens ersticken und übertäuben lässt, das fühlen wir heute alle, da wir jetzt wissen, welcher Punkt unsern Blick damals hätte fesseln sollen, welcher Aufgabe unsere Kräfte hätten dienen müssen. Aber wir gingen wie Schlafwandler umher und wollten das nicht sehen, was Tausende wussten, was Tausende sahen, erstaunt und besorgt wegen unserer Sorglosigkeit.
Und wir hätten durch den Vorhang blicken können, der uns die Zukunft barg. Denn dieser Vorhang hat Löcher, wir beachten sie nur nicht. Aber viele haben doch hindurchgesehen. Der eine, wenn er die Zeitung las und sie dann langsam auf den Schoß sinken ließ und sinnend vor sich hinstarrte und die Gedanken in weite Fernen wandern ließ, aus denen zu seiner Seele der leise Klang von Waffenlärm und Kriegsgetümmel drang wie das geheimnisvolle Summen und Rauschen der Meeresbrandung. Der andere, als er im Gewoge des Straßenlebens ein zufälliges Wort auffing und es eine Zeit lang mit sich herumtrug, bis es wieder versank im harten Wellenschlag des Werktages. Aber das Wort war nicht gestorben, es lebte weiter im Grunde des Bewusstseins, da wo unsere wühlenden Gedanken nicht mehr hindringen, und es erwachte wieder zu neuem Leben und ward nachts zu wilden Reitergeschwadern, die mit lautlosen Hufen über das kurze Steppengras dahinrasten. Es war Kanonendonner in der Luft, lange bevor die Geschütze geladen wurden.
Ich habe nicht mehr gesehen als andere. Als der Zukunft grauser Schrecken mich zuerst mit kaltem Hauch streifte, da habe auch ich es wieder vergessen. Es war in San Franzisco im Frühjahr 1907. Wir standen in einer Bar. Da entstand draußen auf der Straße wüstes Geschrei. Zwei Leute wurden drüben aus einem japanischen Speisehaus hinausgeworfen. In der Tür der Wirtschaft stand der japanische Wirt und stieß den Hut des einen mit dem Fuße über das Pflaster, dass er wie ein Fußball über die Straße kollerte.
„Hallo“, rief mein Freund Arthur Wilcox, „der Jap greift die Gentlemen an.“
Ich hielt ihn am Arme zurück, denn schon ergriff ein baumlanger irischer Polizist den Japaner, der laut Protest erhob und sich sträubte. Der Policeman fasste kräftig zu. Im nächsten Augenblick lag der Ire wie eine gefällte Fichte auf dem Pflaster. Mit einem Kunstgriff hatte der japanische Zwerg ihn scheinbar mühelos geworfen. Der Rest war eine wüste Rauferei.
Eine halbe Stunde später gingen in der völlig demolierten japanischen Wirtschaft nur noch ein paar Polizisten mit ihren Notizbüchern spazieren, unsre Leute hatten reinliche Arbeit gemacht. Wir standen noch lange in der Bar. „Das“, meinte Arthur Wilcox, „haben unsere Enkel einmal auszukämpfen.“
„Unsere Enkel nicht“, sagte ich, „aber wir.“ Warum ich das sagte, wusste ich damals nicht.
„Wir?“ lachte Wilcox mich aus, „nein, sieh mich an, sieh Dich an, sieh unser Volk an und sieh diese Zwerge an.“
„Das haben die Russen auch gesagt: Sieh die Zwerge an.“
Sie lachten mich aus, und ich lachte schließlich mit, aber ich konnte den Iren, wie er so unter dem Griff des Japaners zusammenknickte, nicht vergessen. Und plötzlich dämmerte in mir eine längst vergessene Erinnerung auf. Es war damals in Heidelberg, als ich in Deutschland studierte. Der Professor erzählte, wie der junge Goethe nach dem unrühmlichen Rückzug der preußischen Armee von Valmy mit den Offizieren am Wachtfeuer saß und man den Gründen der Niederlage nachsann. Als sie dann Goethe fragten, was er denke, sagte er wie von Sehergeist erfüllt: „Von hier und jetzt an beginnt eine neue Epoche der Weltgeschichte und Ihr könnt sagen, Ihr seid dabei gewesen.“ Und ich sah die rote Glut des Biwakfeuers und sah die Offiziere der ruhmreichen Armee Friedrichs des Großen, die es nicht fassen konnten, dass man vor den abgerissenen Rekruten der Revolution davongelaufen sei. Und ich sah neben ihnen einen Menschen höherer Art, wie er sich auf den Zehenspitzen reckte und durch den dunklen Vorhang hindurch einen Blick in die Zukunft erhaschte.
Damals vergaß ich das alles bald wieder, ich vergaß die gleichgiltige Straßenprügelei und vergaß, dass mich hier der eisige Hauch des Kommenden angeweht hatte. Erst dann, als das Unheil da war, fiel es mir wieder ein. Als die Schwerter zusammenklirrten, da wusste ich erst, dass mit dem allen, was wir an der staubigen Heerstraße der Geschichte gleichgiltig übersehen hatten, sich die kommende Katastrophe angekündigt hatte.
In Manila.
„Himmel Herrgott, noch einmal! Lassen Sie mich doch mit Ihren verdammten gelben Affen in Ruh‘!“, rief der Colonel Webster und schmetterte seine Faust dröhnend auf den Tisch, dass die Whisky- und Sodagläser erschreckt aufsprangen, sich dann ärgerlich wieder hinsetzten und noch ein paarmal missbilligend mit den Köpfen wackelten, so dass die bernsteinhelle Flüssigkeit über den Rand schwappte und in kleinen perlengemusterten Pfützen auf der Tischplatte stehen blieb.
„Na, wie Sie wollen, Colonel, ich gebe es auf, mit Ihnen zu streiten,“ warf der Lieutenant-Kommander Harryman kurz hin, „Sie lassen sich ja doch nicht belehren.“
„Belehren, darum handelt es sich nicht. Aber Ihre Sucht, überall japanische Umtriebe zu wittern, die ganze Politik mit dem japanischen Generalnenner auszurechnen und in jedem Kuli einen japanischen Spion zu sehen, nimmt ja geradezu pathologische Formen an. Nein, da kann ich Ihnen nicht folgen,“ versetzte Webster, dem der explosive Ausbruch seines leidenschaftlichen Temperamentes schon leidzutun schien.
„Wirklich nicht?“, fragte Harryman, indem er sich in seinem bequemen Korbstuhl Webster zuwandte und ihn halb ermunternd anblinzelte.
Solche erregten Auseinandersetzungen waren nichts Seltenes im Kasino von Manila, boten sie doch auch das einzige Gegengift gegen die bleierne geisttötende Langeweile im grauen Einerlei des Garnisonsdienstes. Und seit dem neuen Aufstand auf Mindanao und im ganzen Süden des Archipels bot die Frage nach den eigentlichen Gründen der neuen Rebellion, vielmehr die nach ihren heimlichen Urhebern immer neuen Anlass zu leidenschaftlichen Diskussionen. Und wenn beide Parteien, die, die hinter allem japanische Umtriebe vermutete und die andere, die sie gewissermaßen aus elementaren Gründen erklären wollte, an die Pumpenstöcke griffen, so sprudelte der Quell der Debatte stets ziemlich lebhaft; immerhin eine geistige Anregung nach der Körper und Gedanken gleichmäßig zermürbenden Hitze des Tages, der auch abends keine Abkühlung folgte.
Der lautlos zwischen den Stühlen hin und her eilende chinesische Boy tilgte die Spuren des Websterschen Wetterschlages und setzte einige neue Sodaflaschen auf den Tisch, worauf die Offiziere mit Sorgfalt von neuem ihren Trank mischten.
„Auch wohl ein Spion?“, fragte Webster zu Harryman hinüber und deutete mit dem Daumen über die Schulter auf den sich entfernenden Boy:
„Selbstverständlich, haben Sie je etwas anderes angenommen?“
Webster zuckte die Achseln. Man stumpfte weiter dahin und suchte im trägen Dämmerzustande einzelne halbverlorene Gedankenfäden wieder zu erhaschen. Harryman kaute nervös auf seinen Schnurrbartspitzen. Der Dampf aus zwei Dutzend Shagpfeifen setzte sich wie ein Nebelstreifen in der schwülen Luft der Tropennacht ab, die durch die offenen Fenster hereinflutete. Träge schleppte sich in großen Pausen an den einzelnen Tischen die Unterhaltung fort. Nur das Knistern der Korbstühle und das Glucksen und Plätschern des Sodawassers, wenn einer der Offiziere nach langem Zaudern die Energie fand, sich sein Glas von neuem zu füllen, unterbrach zuweilen die Stille. Unbeweglich wie Seehunde auf einer Sanddüne in heißer Mittagsstunde dämmerten die Offiziere dem Augenblick entgegen, da man anstandshalber zu Bett gehen konnte.
„Schauderhaft,“ stöhnte der Oberst Mc Ollon, „in diesem verdammten Nest wird man noch kindisch, ich verblöde bald,“ und dann machte er seinen ständigen Witz des Abends, indem er hinzufügte: „Mein Morgengebet ist jeden Tag: Lieber Gott, lass es doch Abend werden, Morgen wird es schon wieder von selber,“ was durch ein pflichtschuldiges beifälliges Grunzen aus einigen Stühlen beantwortet wurde.
Der Leutnant Parrington, Kommandant des kleinen einst den Spaniern abgenommenen Kanonenbootes „Mindoro“ – seitdem das Kreuzergeschwader nach Mindanao abgegangen, aushilfsweise wieder in Dienst gestellt – trat ein und ließ sich in einen Korbstuhl neben Harryman fallen, worauf der chinesische Boy fast unhörbar auf seinen breiten Filzschuhen neben ihm auftauchte und die Flaschen mit dem Painexpeller der Tropen vor ihn hinstellte.
„Kabelnachrichten, Parrington?“, fragte der Oberst Mc Ollon vom andern Tisch herüber.
„Gott bewahre,“ gähnte Parrington, „alles noch kaputt. Wir sitzen hier noch immer wie unter der Glocke einer Luftpumpe.“
Harryman fiel es auf, dass der Boy wie erschreckt einen Moment Parrington anstarrte, dann aber sofort die mongolische Allerweltsunschuldsmiene aufsteckte und mit seinem gewohnten Grinsen schlangengleich wieder zur Tür hinausglitt.
Harryman hatte das fatale Gefühl eines augenblicklichen Unbehagens, konnte sich aber zu einem klaren Gedanken nicht durchringen und gab den Versuch, diesem instinktiven Empfinden auf den Grund zu gehen, ärgerlich wieder auf, indem er vor sich hinmurmelte: „Man wird noch verrückt in dieser tropischen Hölle.“
„Auch nichts von der Flotte?“ knüpfte Oberst Mc Ollon wieder an.
„Radikal nichts, weder drahtlich noch drahtlos. Es ist, als ob die übrige Welt ins Bodenlose versunken wäre. Seit sechs Tagen nicht ein Sterbenswörtchen von der Außenwelt.“
„Glauben Sie an das Seebeben?“ warf Harryman spöttisch dazwischen.
„Warum denn nicht?“ gab der Oberst zurück.
Harryman sprang auf und ging mit langen Schritten ans Fenster, warf den Rest der Zigarette hinaus und zündete sich eine neue an. Beim Aufflammen des Streichholzes sah man in den scharf beleuchteten Gesichtszügen des Commanders ein ironisches Zucken; er war wieder in Kampfstimmung.
„Merkwürdig bleibt ja die Sache. Unser Heimatkabel schnappt zwischen Guam und hier ab, das Hongkong-Kabel versagt, sogar unsere Inselleitung ist unbrauchbar, es muss ja eine gewaltige Naturkatastrophe gewesen sein …“, echote es an einem anderen Tische.
„… Um so gewaltiger, als wir auf dem Lande nichts von ihr gemerkt haben,“ sagte Harryman, blies einen nachdenklichen Dampfstrahl von sich und schwang sich zwischen beiden aufgestützten Armen rückwärts auf die Fensterbrüstung.
„Gewiß, erscholl es zurück, aber wie wollen Sie sich das erklären?“
„Erklären“, rief Colonel Webster dröhnend, „unser Kamerad, von der U.S.A. glorreichen Marine hat, für alles nur eine Erklärung, seinen japanischen Logarithmus, mit dem er alles ausrechnet. Wir werden jetzt hören, dass auch dieses Seebeben auf japanische Niederträchtigkeiten zurückzuführen ist, wahrscheinlich durch japanische Taucher oder gar Unterseeboote,“ und der Colonel begann herzhaft zu lachen.
Harryman ignorierte diese Wiederaufnahme des Streites von vorhin und paffte nur, den Kopf zurückgeworfen, nervös in die Luft.
„Im Ernst,“ begann der Oberst wieder, „Harryman haben Sie eine Erklärung?“
„Nein,“ versetzte Harryman kurz, „aber erinnern Sie sich vielleicht, wer uns die erste Aufklärung über das Versagen der Kabel gab? Der Kapitän der japanischen „Kanga Maru““, die seit Dienstag neben dem „Monadnock“ liegt, den ich die Ehre habe, zu kommandieren.“
„Aber, verehrtester Harryman, Sie sehen Gespenster“, wandte der Oberst ein, „der japanische Kapitän übergab die neusten Hongkonger Blätter dem Hafenamt und war ganz erstaunt, dort zu hören, dass unsere Kabel nicht funktionierten …“
„Als er eine Depesche nach Hongkong aufgeben wollte,“ versetzte Harryman scharf.
„Um seine Ankunft in Manila zu melden“, bemerkte Colonel Webster trocken.
„Und die Hongkonger Blätter brachten doch bereits Schilderungen der Verheerungen des Seebebens, der Flutwellen, der Schiffskatastrophen“ kam es von anderer Seite.
„Ganz besonders aus diesem Archipel, wo wir leider das Vergnügen haben, uns zu befinden, und wo wir nichts von dem allen gemerkt haben,“ gab Harryman zurück.
„Sie wollen doch wohl nicht behaupten,“ wandte der Oberst ein, „dass die Berichte über diese Katastrophen eine Erfindung purer Phantasie seien – eine Erfindung englischer Blätter in Hongkong?“
„Weiß ich nicht,“ versetzte Harryman, „Hongkonger Blätter sind für mich keine Beweismittel,“ und fügte dann leiser hinzu: „Ja der Mensch ist groß, und die Zeitung ist sein Prophet.“
„Aber Sie wollen doch nicht bestreiten, dass ein solches Seebeben stattgefunden haben kann, wo wir doch die eklatantesten Folgen seit sechs Tagen mit der Kabelunterbrechung vor uns haben“, fing Webster wieder an.
„Haben wir das wirklich?“, sagte Harryman, „sind Sie dessen sicher? Vorläufig haben wir als Beweismittel für dies angebliche Seebeben nur einen japanischen Kapitän, den ich übrigens scharf beobachten lasse und ein Bündel Hongkonger Zeitungsmakulatur. Was weiter die Gespensterseherei anbetrifft – er gab sich einen Schwung von der Fensterbank, ging auf Webster zu und hielt ihm einen Bogen Papier entgegen – so pflege ich andere Quellen zu benutzen als die englisch-japanischen Moniteure.“
Webster blickte flüchtig in das Blatt und sah dann Harryman fragend an: „Was ist das? Verstehen Sie das?“
„Ja“, sagte Harryman knapp. „Diese Bilderchen stellen unsern Ausrottungskrieg gegen die Indianer dar. Weidlich übertrieben und in das Blutig-Schauderhafte verzerrt, was übrigens kaum nötig war, denn diese Ereignisse sind kein Ruhmesblatt in der Geschichte unsers Volkes. Hier oben“ erklärte Harryman, während mehrere Offiziere, darunter der Oberst, an den Tisch traten, „sehen Sie die Geschichte mit den an die Indianer gelieferten infizierten Decken aus den Fieberhospitälern, hier die Abschlachtung eines Indianerstammes, hier als Gegenstück den Kampf um den Vulkankegel auf Ilo-Ilo, wo die Tagalen schließlich in die Krateröffnung getrieben wurden. Und hier zum Schluss die Nutzanwendung für die Tagalen: Wie die Amerikaner den roten Mann vernichtet haben, so werdet auch ihr unter der Herrschaft Amerikas langsam zugrunde gehen. Sie haben auf Ilo-Ilo eure Volksgenossen in den Schlund des Vulkans gestürzt. Dieser Krater wird euch alle verschlingen, wenn ihr nicht die Waffen, die die spanische Knechtschaft einst brachen, jetzt gegen die Befreier von 1898 kehrt, die eure Bedrücker geworden sind.“
„Woher haben sie den Wisch?“, fragte der Oberst gespannt.
„Soll ich Ihnen hundert, Tausende besorgen?“ gab Harryman kühl zurück.
Der Oberst drückte die Asche in seiner Pfeife mit dem Daumen zusammen und fragte obenhin: „Sie verstehen japanisch?“
„Und Tagalisch,“ ergänzte Harryman schlicht.
„Und Sie meinen, dass Tausende …?“
„Millionen von diesen Bilderbogen mit japanischem und malayischem Text auf den Philippinen vertrieben werden“, sagte Harryman bestimmt.
„Unter unsern Augen?“, fragte ein Leutnant naiv.
„Unter unsern Augen“, entgegnete Harryman lächelnd, „die derlei Dinge sorglos übersehen.“
Kolonel Webster erhob sich und gab Harryman die Hand: „Ich habe Ihnen unrecht getan“ sagte er mit herzlichem Tone. „Ich gehöre jetzt zu Ihrer Partei.“
„Von Partei ist keine Rede“, erwiderte Harryman mit Wärme, „oder vielmehr, es wird bald nur noch diese Partei geben.“
„Halten Sie,“ fragte der Oberst dazwischen, „den angeblichen japanischen Angriffsplan auf die Philippinen, den die „North China Daily News“ um die Jahreswende veröffentlichten, wirklich für echt?“
„Das kann man nur dann beurteilen“, entgegnete Harryman, „wenn man weiß, wer jenes Schriftstück dem Schanghaier Blatt und mit welcher Absicht gegeben hat.“
„Wieso?“
„Nun,“ fuhr Harryman fort, „es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Echt oder unecht. Echt, dann ist es eine Indiskretion eines Japaners, der sein Vaterland an ein englisches Blatt verrät, an ein englisches Blatt, das im Besitz dieses wichtigen Dokumentes nichts Eiligeres zu tun hat, als dem verbündeten Japan mit dieser Veröffentlichung diplomatisch in die Suppe zu spucken. Bedenken Sie drei Unwahrscheinlichkeiten: Verrat, Indiskretion und dann dem verbündeten Japan den Knüppel zwischen die Beine. Das widerspricht einmal dem geradezu hysterischen Nationalitätsbewusstsein der Japaner, widerspricht ihrer absoluten Schweigsamkeit und Geheimniskrämerei, widerspricht auch der bisherigen Praxis unserer englischen Vettern seit ihrer wilden Ehe mit Madame Chrysantheme …“
„Also nicht echt?“, fragte der Oberst.
„Bedenken Sie doch, was wollte denn jener angebliche Kriegsplan. Japanischer Überfall auf Manila mit der Flotte und 80 000 Mann Landungstruppen und dann nach kubanischem Muster Eingeborenenaufstand, der unsere Truppen langsam verbraucht, während die Herren Japaner nichts weiter zu tun haben, als die Sache zur See zu erledigen, und Roschestwenskis Spuren dürften unsere Admirale schrecken.
„Meiner Ansicht immerhin das sicherste Verfahren, die Philippinen einzuheimsen“, erwiderte der Oberst nachdenklich, „dazu daheim bei uns, als Bundesgenosse, die wachsende allgemeine Unlust, den Archipel zu halten und noch mehr Millionen in das asiatische Zweiggeschäft zu stecken.“
„Ganz ohne Frage“, fuhr Harryman hastig fort, „wenn Japan weiter nichts will als die Philippinen.“
„Aber was in aller Welt denn sonst noch?“ warf Webster dazwischen.
„Die Herrschaft über den Pacific“, sagte Harryman bestimmt.
„Handelsherrschaft?“, fragte Parrington, „oder …?“
„Nein, auch politisch, mit festen Brückenköpfen“, entgegnete Harryman.
Der Oberst hatte sich wieder gesetzt und studierte das Flugblatt. Parrington pflückte zerstreut die Etikette seiner Whiskyflasche ab, die anderen schwiegen nachdenklich. Nebenan kündete eine Uhr mit hastigem singenden Schlage die zehnte Stunde und zerhackte das beklommene Schweigen in lauter kleine Stücke.
„Und wenn es nicht echt wäre“, begann der Oberst wieder mit rauer Stimme, räusperte sich und wiederholte leise: „Und wenn es nicht echt wäre.“
Harryman zuckte die Achseln.
„Dann wäre es eine Falle für uns, uns nach der falschen Seite hin zu orientieren,“ ergänzte sich der Oberst selber.
„In die wir bereits mit vollen Segeln hineinstürmen“, fuhr Webster fort und betonte jedes einzelne Wort, wobei seine Gedanken aber anscheinend schon weiter vorauseilten.
Harryman nickte und drehte an seinem Schnurrbart.
„Was sagten Sie?“ fuhr Parrington empor, und blickte von Webster zu Harryman, erhielt aber keine Antwort …, „hineintappen in die Falle?“
„Zwei Regimenter“, sagte Webster mehr zu sich als zu den andern und fragte dann lebhaft zu Harryman hinüber: „Wann sollen die Transporter ankommen?“
„Die Steamer mit zwei Regimentern an Bord sind am 10. April von Frisko abgegangen, müssten also – er zählte an den Fingern – jetzt hier sein.“
„Nein, sie gehen gleich nach Mindanao“, sagte Parrington.
„Direkt nach Mindanao?“ Der Oberst sann schweigend nach. Dann wie plötzlich erwachend fuhr er fort: „Und seit sechs Tagen die Kabelstörung …!“
„Nein wir wissen nichts,“ gab Parrington dazwischen, „seit sechs Tagen weder von der Flotte noch sonst.“
„Harryman“, sagte der Oberst ernst, „glauben Sie an eine Gefahr? Wenn das alles eine Falle wäre, so wäre es ja das Dümmste, was wir tun könnten, unsere Transporter ganz unbeschützt … Aber das ist ja alles Unsinn, die Hitze trocknet hier ja die Gedanken förmlich aus. Nein, nein, das kann ja alles nicht sein, das sind ja Fieberphantasien aus dem gärenden Brodem dieses gottverfluchten Landes!“ Er drückte auf den Knopf der elektrischen Klingel, hinter ihm erschien der Boy in der Tür: „Pailung, Soda!“
„Parrington kommen Sie mit? Ich habe mein Boot um 10 Uhr bestellt“ fragte Harryman.
„Harryman, Sie wollen schon gehen,“ widersetzte sich Webster, „Sie kommen noch zeitig genug an Bord Ihrer Schildkröte, oder wollen Sie auch nachts ihren Japaner von der – was für ein Maru war es noch …?“ Er vollendete nicht, da der Oberst ärgerlich auf den wieder eintretenden Boy deutete.
„Ach was“, knurrte Webster missgelaunt, „so'n Vieh, das sieht und hört nichts.“
Der Oberst maß Webster kalten Blickes und mischte dann geräuschvoll seinen Trank.
Schweigend gingen Harryman und Parrington am dunklen Hafenkai entlang, laut hallten ihre Schritte auf den Steinplatten der Ufermauer durch die stille Nacht. Auf der andern Seite der Straße zeigten huschende Schatten an den erleuchteten Fenstern einiger Hafenspelunken, über denen trübbrennende Lampen baumelten, und verhaltener Stimmenlärm, dass es dort noch hoch herging. Nur wenige Schritte noch bis zu der Stelle, wo der gelbe Lichtkreis der Laternen die weißen Anzüge der Matrosen in den beiden Kriegsschiffsbooten erkennen ließ. Parrington blieb stehen. „Harryman,“ wiederholte er die Frage von vorhin, „glauben Sie an eine Gefahr …?“
„Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht“, sagte Harryman erregt, dann ergriff er beide Hände Parringtons und fuhr hastig mit leiser Stimme fort: „Ich lebe seit Tagen schon wie in einem Traumzustande. Mir ist es, als läge ich in einer Fieberphantasie, mein Kopf brennt und die Gedanken müssen immer auf einen Punkt zurück, sie bohren und wühlen, und ich habe das Gefühl, als richte sich ein grässliches Auge auf mich, dessen Blick ich nicht ausweichen kann. Ich habe das Empfinden, als könne ich jeden Augenblick aus diesem Dämmerzustande erwachen, und das Erwachen wäre noch furchtbarer.“
„Harryman, Sie haben Fieber, Sie sind krank und stecken andere Leute an, nehmen Sie Chinin!“ Parrington stieg in sein Boot, die Ruder setzten ein und rauschend durchschnitt der Bug das schwarze Wasser und verschwand in der Dunkelheit, aus der sich nur die von einem fahlen gelben Lichtschein umsäumte Silhouette des ersten Rudergastes, der die Bootslaterne verdeckte, wie ein seltsames Phantom heraushob.
Harryman blickte dem Boote der „Mindoro“ ein paar Minuten sinnend nach und murmelte: „Der hat freilich kein Fieber, das mit Chinin nicht zu kurieren ist.“ Dann bestieg er sein eignes Boot, das alsbald auch von der schwülen Sommernacht verschluckt wurde, während das dunkle Wasser gluckernd und rauschend gegen die Planken schlug. Die hohe Kaimauer mit ihrer langen Reihe gelber und weißer Lichtflecken blieb zurück und sank langsam auf die Wasserlinie herab. Vorüber an der riesenhohen Wand eines englischen Dampfers, die die platschenden Ruderschläge in seltsam hohlem Echo zurückgab, und dann hinüber zum „Monadnock“, der Hafenschildkröte, wie der Soldatenwitz den Monitor nicht ohne Berechtigung getauft hatte, ein unbeholfenes Fahrzeug, das sich mit seinem Deck nur wenig über der Wasserlinie erhob und mit seinen gewölbten Rücken, den niedrigen Drehtürmen und den dazwischen liegenden Aufbauten wirklich einer Schildkröte nicht unähnlich war. Harryman konnte nicht schlafen und ging zum wachthabenden Offizier auf die Brücke. Die leichte Brise, die von den Bergen herkam, gab dort wenigstens etwas Kühlung.
*
Parrington hatte an Bord der „Mindoro“ den Befehl vorgefunden, am anderen Morgen die Ablösungsmannschaft für die Funkspruchstation nach Mariveles zu bringen. Früh um 6 Uhr hatte das kleine Kanonenboot die Leute an Bord genommen und steuerte nun quer über die blaue Bucht von Manila auf die kleine Felseninsel Corregidor zu, die neuerdings schwer armiert wie ein spitzer Steinblock zwischen den mächtigen Bergkulissen mitten in dem Eingang zur Manilabai liegt. Unter dem grauen Sonnensegel hockten die Soldaten stumpfsinnig auf ihren Gepäckstücken. Einige schliefen, andere starrten über die Reeling in das blaue durchsichtige Wasser, das der Bug des kleinen Fahrzeuges in langen Wellenstreifen aufrollte. Aus dem offenen Skylight des Maschinenraumes scholl der scharfe Taktschlag der Maschine und der heiße Ölbrodem strich über das Deck, die glühende Hitze zur Unerträglichkeit steigernd. Der Mann am Ruder döste schläfrig vor sich hin. Parrington stand auf der Kommandobrücke und suchte mit seinem Glase die steilen Bergränder am Eingang der Bucht und die bizarren Formen der kleinen Vulkaninseln ab.
Auf der ganzen weiten Wasserfläche außer ein paar Fischerbooten mit ihren braunen Mattensegeln nicht ein Schiff zu sehen. Jetzt lenkte das Kanonenboot in die nördliche Einfahrt ein, die langen, in der Sonne matt blinkenden Geschützrohre in den Werken von Corregidor wurden sichtbar. Oben auf den in den Felsen gehauenen Batterien war nirgends ein lebendes Wesen zu entdecken, nur unten auf der kleinen Plattform mit dem Signalmast neben der Nordbatterie schritt ein Posten unter Gewehr langsam auf und ab. Parrington rief dem neben ihm stehenden Signalgast zu: „Geben Sie nach Corregidor das Signal hinüber: Wir lösen die Funkspruchmannschaft in Mariveles ab und laufen auf der Rückfahrt Corregidor an.“ Die Batterie von Corregidor antwortete mit einem Flaggenspruch und die bunten Fähnchen, die zwischen der Plattform und dem schlaff oben am Flaggenmast herunterhängenden Sternenbanner geschäftig auf- und niederkletterten, verständigten Parrington davon, dass der Colonel Prettyman ihn in Corregidor nachher zum Lunch erwarte. Langsam kroch die „Mindoro“ an der Küste entlang bis zu der kleinen Felsenbucht von Mariveles, wo an den wenigen verwahrlosten Häusern des Ortes die abzulösende Hälfte des Funkspruchpostens, der auf der Höhe der Sierra de Mariveles seine Station hatte, bereits auf die Ankunft des Kanonenbootes wartete.
Die „Mindoro“ machte am Pier fest. Der Austausch der beiden Abteilungen vollzog sich schnell, die neue Mannschaft ging von Bord und verstaute ihr Gepäck auf zwei Maultierkarren, die es zu der steilen Bergeshöhe hinaufschaffen sollten, wo ein paar flache weiße Häuschen als helle Flecke an der grauen Bergwand die Lage der Funkspruchstation erkennen ließen, deren riesenhoher Mast mit seinen Drähten einsam in die blaue Luft ragte. Die abgelösten Funkspruchleute, denen man die Freude anmerkte, von diesem verlassenen, langweiligen Posten fortzukommen, machten es sich unter dem Sonnensegel bequem und begannen mit der Besatzung der „Mindoro“ über die alltäglichen Nichtigkeiten des militärischen Dienstes zu schwatzen. Ein heulender Ton aus der Dampfpfeife der „Mindoro“ hallte von den Bergwänden zurück, ein Abschiedsgruß an den kleinen Trupp, der gefolgt von den beiden Maultierkarren bereits langsam an der Berglehne emporkletterte. Die „Mindoro“ warf vom Pier los und wollte, nachdem sie um die Landzunge von Mariveles herum war, gerade die Richtung auf Corregidor nehmen, als der Signalgast auf der Kommandobrücke Parrington auf einen schwarzen Dampfer aufmerksam machte, der anscheinend unter großer Fahrt von der See her auf den Eingang der Manilabai zusteuerte. „Endlich mal wieder ein Schiff“, sagte Parrington, „wollen doch abwarten, was für ein Bursche das ist.“ Während die „Mindoro“ fast ohne Fahrt schwerfällig auf den breiten Wogen hin und her schlingerte, blickte Parrington durch sein Glas nach dem fremdem Dampfer hinüber. Auch die Besatzung des Kanonenbootes war auf das Schiff aufmerksam geworden und erging sich in Vermutungen über die Nationalität dieses seit einer Woche für Manila so seltsamen Gastes. Die Funkspruchleute erzählten, dass sie den Dampfer bereits vor zwei Stunden von oben gesehen hätten. Parrington setzte sein Glas ab und sagte: „Ungefähr 4000 Tonnen, aber er hat keine Flagge. Da können wir rasch abhelfen“ und zum Signalgast: „Fordern Sie ihn auf, die Flagge zu zeigen“ und gleichzeitig riss er an der Schnur der Dampfpfeife, um den Fremden aufmerksam zu machen.
Nach wenigen Sekunden erschienen am Heck des einkommenden Dampfers die deutschen Farben, und die gleichzeitig am Fockmast hastig emporfliegenden Signalflaggen charakterisierten das Schiff als den deutschen Dampfer „Danzig“ von Hongkong kommend. Kurz darauf sah man, wie an Bord der „Danzig“ ein Boot klargemacht wurde, dann stoppte der Dampfer; der weiße Kutter ging zu Wasser und steuerte direkt auf die „Mindoro“ zu.
„Wirklich zu gütig“, sagte Parrington, „dass er uns ein Boot schickt, was mag er wollen?“ Er gab Befehl ebenfalls zu stoppen und das Fallreep klar zu machen und erwartete, den deutschen Kutter gespannt verfolgend, dessen Ankunft. Zehn Minuten später betrat der erste Offizier der „Danzig“ die Kommandobrücke der „Mindoro“, stellte sich ihrem Kommandanten vor und bat um einen Lotsen durch die Minensperre.
Parrington sah ihn erstaunt an, „Minensperre? Verehrtester, Minensperre? Wir haben keine Minensperre.“
Der Deutsche starrte Parrington ungläubig ins Gesicht. „Sie haben keine Minensperre?“
„Nein“, sagte Parrington, „wir pflegen unsere Häfen nur im Kriege mit Minen zu sperren.“
„Im Kriege“, sagte der Deutsche, dem anscheinend Parringtons Antwort ganz unverständlich war, „aber Sie befinden sich doch im Kriege.“
„Wir im Kriege?“ gab Parrington vollkommen fassungslos zurück, „wir im Kriege, mit wem denn, wenn ich fragen darf?“
„Ich denke, der Augenblick ist zu ernst zu unpassenden Scherzen“, antwortete der Deutsche spitz.
In diesem Augenblick drang lauter Lärm vom Achterdeck der „Mindoro“ herauf, erregtes Stimmengewirr und kräftige amerikanische Flüche. Parrington eilte an den Reeling und blickte ärgerlich hinüber. Es fand ein erregter Disput zwischen der Mannschaft in dem deutschen Kutter und den amerikanischen Matrosen statt, aus dem nur die häufig wiederholten Worte „damned Japs“ verständlich waren. Er wandte sich wieder zu dem deutschen Offizier um und sah ihn unschlüssig an. Der blickte, leise vor sich pfeifend, scheinbar verstimmt aufs Meer hinaus.
Parrington ging auf ihn zu und sagte, seine Hand ergreifend: „Wir verstehen uns offenbar nicht, was liegt vor?“
„Ich komme, um Ihnen mitzuteilen,“ entgegnete der Deutsche scharf und bestimmt, „dass der Dampfer „Danzig“ heute Nacht die Blockade gebrochen hat und dass der Kapitän Sie höflich um einen Lotsen durch die Minensperre ersucht, damit wir den Hafen von Manila erreichen können.“
„Sie haben die Blockade gebrochen?“, schrie Parrington den Deutschen in höchster Erregung an, „Mann, Sie haben die Blockade gebrochen, was heißt das?“
„Das heißt,“ entgegnete der Deutsche kühl, „dass sich die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, was Ihnen, als Kommandant eines ihrer Kriegsschiffe, nicht unbekannt sein dürfte, seit einer Woche im Kriege mit Japan befindet und dass ein Dampfer, der die feindliche Blockade gebrochen hat und Ladung für Manila – Konterbande für Manila hat, wohl Anspruch darauf erheben kann, durch die Minensperre hindurchgeleitet zu werden.“
Parrington griff hinter sich, an der Reeling eine Stütze suchend, sein Gesicht war aschfahl geworden und er machte bei den Erklärungen des deutschen Offiziers den Eindruck völliger Hilflosigkeit, so dass der andere sofort wieder einlenkte, da er die geradezu unwahrscheinlich seltsame Situation allmählich zu verstehen begann.
„Seit sechs Tagen,“ wiederholte er, „befindet sich Ihr Land im Kriege mit Japan und wir durften wohl voraussetzen, dass Sie, als die Nächstbeteiligten, über diese Tatsache unterrichtet seien.“
Parrington gewann seine Fassung wieder, „Dann ist also die Kabelstörung …“, er vollendete nicht, „aber das ist ja entsetzlich, das ist ja ein Überfall, wie wir ihn … Verzeihen Sie,“ sagte er entschlossen zu dem Deutschen, „ich brauche Ihnen wohl nicht mehr zu versichern, dass ich von Ihren Mitteilungen vollständig überrascht bin, in Manila hat kein Mensch von alledem eine Ahnung. Die Kabelstörung seit sechs Tagen wurde uns von einem japanischen Dampfer als die Folge einer vulkanischen Katastrophe erklärt und seitdem sind wir bei der Unterbrechung aller Verbindungen vollkommen ohne jeden Kontakt mit der Außenwelt. Wenn Japan uns wider alles Völkerrecht den Krieg erklärt hat, so haben wir in Manila bisher überhaupt nichts davon gespürt, nur das Ausbleiben der regelmäßigen Dampfer und überhaupt allen Schiffsverkehrs in den letzten Tagen ist uns verdächtig vorgekommen. Aber jetzt, verzeihen Sie, jetzt gilt es zu handeln. Bleiben Sie an Bord!“
Die Dampfpfeife der „Mindoro“ gab drei heulende Töne von sich, während das Kanonenboot mit voller Fahrt auf Corregidor zusteuerte. Parrington ging in seine Kajüte, schloss seinen Schreibtisch auf und stöberte in nervöser Hast darin herum. Da war der Kriegssignalkodex, er nahm das Buch und sprang die Treppe zur Kommandobrücke wieder empor, brüllte den Signalgast an: „Machen Sie Signal nach Corregidor: Kriegssignalkodex, wichtige Mitteilung.“ Dann rief er selbst, hastig in dem Buche blätternd, dem Signalgast die einzelnen Flaggen zu, die prompt an der Leine in die Höhe sausten. Dazwischen schrie er den Mann am Ruder an: „Geben Sie noch einmal Befehl in die Maschine: Der Kahn soll laufen, was die Kessel halten.“
In fieberhafter Erwartung stand Parrington auf der Kommandobrücke, die Hände um die heißen Eisenstäbe der Brüstung der Brücke gekrampft und mit den Augen die sich rasch verkleinernde Entfernung zwischen der „Mindoro“ und der Landungsbrücke auf Corregidor abmessend und in Gedanken in Hundertmeterstücke zerteilend. Als die „Mindoro“ in die nördliche Einfahrt zwischen Corregidor und dem Festlande einbog, wurden weit in der Ferne am Ende der weiten schier unbegrenzten Fläche der Bai die Manila umgrenzenden Höhenzüge wie lange Wolkenbänke sichtbar, während die Stadt selber in dem weißen Dunst, der den Horizont verschleierte, unsichtbar blieb. In dem Moment, als die Bergkulissen diesen Ausblick freigaben, sah Parrington in der Gegend des Hafens von Manila plötzlich eine dunkle Rauchwolke aufwallen, die sich schnell vom Untergrunde loslöste und einer Fumarole über dem Gipfel eines Vulkans gleichend emporschwebte, dabei langsam in bizarre Formen wie ein zerzauster Wattebausch zergehend. Kurz darauf dröhnte ein dumpfer Knall wie ein ferner Donnerschlag herüber. „Sollte das eine neue Teufelei von den Halunken sein?“, fragte Parrington zu dem Deutschen hinüber, ihn auf die aufsteigende Wolke aufmerksam machend, deren Ränder jetzt im hellen Sonnenlichte schneeweiß erglänzten. „Möglich“, sagte dieser kurz.
Ein wirres Durcheinander herrschte auf der Landungsbrücke von Corregidor. Kopf an Kopf gedrängt standen dort die Artilleristen, der Ankunft der „Mindoro“ harrend. Jetzt bahnte sich durch die dicht gestaute Menge ein Offizier seinen Weg und, am äußersten Rande der Landungsbrücke stehend, rief er zu der sich durch die blaue Flut rauschend heranwühlenden „Mindoro“ hinüber: „Parrington, was sind denn das für Sachen?“
„Wahr, alles wahr“, brüllte der durch ein Sprachrohr zurück, „die Japaner überfallen uns, der deutsche Dampfer da draußen bringt uns die erste Nachricht davon. Seit sechs Tagen haben wir den Krieg.“ Die „Mindoro“ stoppte und gab eine Trosse nach der Landungsbrücke hinüber, die dort von vielen diensteifrigen Händen erhascht und festgemacht wurde.
„Hier ist mein Zeuge“, rief Parrington zu dem Colonel Prettyman am Lande hinüber, „der erste Offizier des deutschen Dampfers „Danzig“.“
„Ich komme zu Ihnen an Bord“, antwortete Prettyman, „eben habe ich Ihre Nachricht durch Funkspruch nach Manila weitergegeben. Dort will man sie natürlich auch nicht glauben.“
„Dann haben Sie eine große Dummheit gemacht“, rief Parrington entsetzt, „sehen Sie da“, er zeigte auf die Wolke über dem Hafen von Manila, „das hat sicherlich unserm Freunde Harryman vom „Monadnock“ das Leben gekostet. Oh, seine Ahnung hat ihn dann nicht betrogen.“
„Harryman an Bord des „Monadnock““, ihm das Leben gekostet?“ fragte Prettyman verwundert zurück.
„Leider wird es so sein“, sagte Parrington, „neben ihm liegt seit vier Tagen der japanische Dampfer, der uns die Nachricht von dem famosen Seebeben brachte. Wenn Sie einen Funkspruch nach Manila gegeben haben, dann hat der Japaner ihn verstehen können, denn er hat Funksprucheinrichtung an Bord, mir fielen noch heute Morgen die Drähte bei ihm auf.“
Jetzt lag die „Mindoro“ fest an der Landungsbrücke, Colonel Prettyman sprang über die Laufplanke auf das Kanonenboot hinüber und begab sich in Parringtons Kajüte, wo sich beide mit dem deutschen Offizier zusammen einschlossen. Wenige Minuten später kam eine aufgeregte Ordonnanz an Bord und verlangte stürmisch den Colonel zu sprechen, ward eingelassen und brachte ihm mit dem soeben von Manila eingetroffenen Funkspruch die Bestätigung des Verdachtes, den Parrington soeben geäußert, nämlich die Nachricht, dass der Monitor „Monadnock“ durch eine unerklärliche Explosion auf der Reede von Manila in die Luft gesprengt sei.
Parrington fuhr vom Stuhle auf und schrie den Colonel an: „Dass nur wenigstens dem verfluchten Japaner sein Lohn wird, wollen Sie nicht hinübergeben: Verdacht, dass der Japaner neben dem „Monadnock“ ihn durch einen Torpedo gesprengt hat. Vielleicht ist man in Manila sonst so naiv und lässt den Kerl noch aus dem Hafen. Nein,“ rief er, sich selbst unterbrechend, „nein, darauf können wir nicht warten, da müssen wir selber schleunigst eingreifen. Colonel, gehen Sie nur an Land, ich fahre auf Manila zu, um den Halunken noch abzufassen. Und Sie,“ zu dem Deutschen gewandt, „gehen Sie, bitte, an Bord Ihres Schiffes und laufen Sie in die Bucht ein, Minen …“ hier stockte ihm die Stimme, „haben wir hier nicht.“
Dann raste er wieder auf die Kommandobrücke. In fliegender Hast wurden die Trossen gelöst und die „Mindoro“ steuerte wieder mit aller Fahrt, der der alte Kasten fähig war, in die Bai hinein. Parrington hatte seine ganze Selbstbeherrschung angesichts der neuen Aufgabe, die ihm die blitzschnell aufeinanderfolgenden Ereignisse stellten, wieder gefunden. Ein Zug grimmiger Freude umspielte seine Züge, als er nach einer Stunde mit seinem Glas mitten in der Bucht die „Kanga Maru“ mit Kurs auf Corregidor entdeckte.
Mit einer Ruhe, als ob es sich um ein tägliches Manöver handelte, gab Parrington seine Befehle. Die Artilleristen standen an den beiden kleinen Geschützen des Kanonenbootes und die Gefechtsrollen waren verteilt.
Langsam verminderte sich der Abstand zwischen beiden Schiffen. „Es ist der Japaner,“ sprach Parrington vor sich hin. „Jetzt gilt es, Harryman zu rächen. Aber keine Sentimentalitäten, wie Seeräuber wollen wir die Bande zusammenschießen. Kein Signal, keine Warnung, nichts, nichts!“ murmelte er vor sich hin.
„Das erste Geschütz hört auf mein Kommando“, rief er dann von der Brücke herunter zu der Mannschaft an der kleinen 5,7 cm-Kanone auf dem Vorderdeck der „Mindoro“. Die „Mindoro“ fiel etwas nach Steuerbord ab, so dass sie den Japaner breitseits bekam und beide Geschütze gegen ihn ins Feuer bringen konnte.
„500 Meter! Ziel: Maschinenraum! Erstes Geschütz Feuer!“ Dumpf dröhnte der Schuss, über die sonnige blaue Wasserfläche, einen weißen Rauchstrahl hinjagend. Die Granate schlug ungefähr 100 in vor dem Japaner auf den Wellen auf, verschwand in ihnen und erschien wieder kurz vor der Schiffswand des Dampfers, in ihr dicht über der Wasserlinie ein schwarzes Loch mit zackigen Rändern zurücklassend.
„Famos gemacht“, schrie Parrington hinunter. „So weiter! Mit zehn Schüssen haben wir den Kerl.“ Rasch war der 5,7 cm von kräftigen Armen wieder geladen, die Kanoniere standen wie alte Troupiers an ihrem Geschütz, das Schuss auf Schuss auf den Japaner abgab; fünf oder sechs Treffer in der Wasserlinie. Das Achtergeschütz der „Mindoro“ nahm sich inzwischen die Decksaufbauten des Japaners vor. Klaffende Löcher brachen überall in der Schiffswand auf, der Schornstein zeigte dunkle Risse, aus denen brauner Rauch drang. Das Deck war binnen einer Viertelstunde ein wüstes Chaos von zerbrochenen und zerbogenen Eisenstangen, zerschossenem Blech und zersplittertem Holzwerk. Dann quoll aus allen Löchern in der Schiffswand, aus den Skylights und aus den Schornsteintrümmern plötzlich weißer Dampf hervor, in der Mitte des Dampfers hob sich das Deck und die explodierenden Kessel warfen die Trümmer von Maschinenteilen und Decksaufbauten hoch in die Luft.
Das alte Siegeslied vom Sternenbanner scholl von der „Mindoro“ zu dem sinkenden Japaner hinüber, dessen Mannschaft mit einem gellenden Wutgebrüll antwortete. Die „Kanga Maru“ legte sich nach Backbord über und verschwand in den Wellen, über die noch ein paar letzte amerikanische Granaten hinfegten.
„Feuer stoppen!“ kommandierte Parrington, dann wendete die „Mindoro“ und nahm wieder direkten Kurs auf Manila. Das Werk der Vergeltung war vollbracht und die heimtückisch hingemordete Besatzung des „Monadnock“ gerächt.
Als die „Mindoro“ im Hafen von Manila anlangte, herrschte in der Stadt die fürchterlichste Aufregung. In den Straßen wurde Generalmarsch geschlagen. Die Stelle, wo am Morgen noch die Hafenschildkröte in träger Ruhe gelegen hatte, war leer.
*
Die Explosion des „Monadnock“ wurde im ersten Augenblick als eine zufällige Katastrophe angesehen. Trotz der Mittagsstunde erschien auf der Reede alsbald eine Anzahl Boote, die alle der Unglücksstätte zustrebten, wo ein breiter, dichter Rauchschleier langsam auf der Wasserfläche hinkroch. Da man nicht wusste, was sich in dieser Wolke noch für neue Schrecknisse bergen mochten, wagte keines der Boote sich weiter vor. Nur zwei weiße Marinepinassen von den im Hafen liegenden Kanonenbooten glitten unter kraftvollen Ruderschlägen in die graue Dunstmasse hinein und es gelang ihnen auch, noch ein paar Leute von der Besatzung zu retten.
Einer von diesen erzählte: Etwa zwei Minuten, nachdem man auf dem „Monadnock“ einen Funkspruch erhalten hatte, der jedoch in der Geschwindigkeit nicht mehr entziffert wurde, habe man eine dumpfe Erschütterung des ganzen Schiffskörpers und gleich darauf noch eine empfunden. An der Steuerbordseite des „Monadnock“ seien zwei weißaufsprudelnde schäumende Wassersäulen emporgeschossen, die das niedrige Deck vollständig überschüttet hätten, dann sei der Monitor von einer dritten Explosion förmlich auseinandergerissen worden, vielleicht dass eine Mine die Munitionskammern getroffen und entzündet habe. Es konnte keinem Zweifel unterliegen, dass diese Torpedos von dem seitwärts des „Monadnock“ liegenden japanischen Dampfer stammten. Die „Kanga Maru“ hatte nämlich plötzlich den Anker schlippen lassen und war schleunigst davongefahren. Der Japaner hatte die letzten Tage – wie man sich jetzt erinnerte – stets unter Dampf gelegen, nach Angaben der Schiffsmannschaft, weil man stündlich das Eintreffen der Ladung auf Landungsprähmen erwartete, aus denen man sie dann sofort übernehmen wollte. Damit hatten die Japaner das ständige Liegen unter Dampf plausibel gemacht. Die „Kanga Maru“ hatte also wahrscheinlich von vornherein den Hafen nur aufgesucht, um den Monitor als das einzige wirkliche Kriegsschiff in Manila zu zerstören. In den japanischen Handelsdampfer waren anscheinend unter Wasser Torpedorohre eingebaut worden, die es ermöglichten, sobald das erste verdächtige Zeichen die Gewissheit gab, dass der Kriegszustand in Manila bekannt sei, augenblicklich den „Monadnock“ zu sprengen. Der Funkspruch von Corregidor aus hatte somit in der Tat das Schicksal des „Monadnock“ entschieden. Die „Kanga Maru“ lanzierte ihre beiden Torpedos und versuchte dann zu entkommen. Dass sie unterwegs mit der „Mindoro“ zusammentraf, lag allerdings außerhalb der japanischen Berechnung, die die in Manila nach der Zerstörung des „Monadnock“ herrschende Verwirrung jedenfalls so hoch eingeschätzt hatte, dass man hoffte, unter ihrem Schutz unbehelligt ausreißen zu können.
Auf den wenigen Schiffen auf der Reede von Manila wurden unter dem Eindruck dieser Ereignisse alsbald die Lösch- und Ladearbeiten eingestellt, die meisten Dampfer lichteten die Anker und gingen, sobald Dampf auf und die Maschinen klar waren, weiter hinaus auf die Reede, denn von irgendeiner Seite war plötzlich das Gerücht ausgesprengt worden, die „Kanga Maru“ habe Minen gelegt, was sich freilich nicht bestätigte, aber auf einzelnen Schiffen eine förmliche Panik entfesselte. Von der Stadt her dröhnte der scharfe Trommelschlag und der schmetternde Hörnerklang des Generalmarsches, der die Garnison alarmierte; man sah, wie von Soldatenabteilungen die Hafenkais gesäubert wurden und die öffentlichen Gebäude militärische Posten erhielten.
Die amerikanischen Kompagnien durcheilten im Geschwindeschritt die Straßen des europäischen Viertels, und der Anblick des Militärs war das erste beruhigende Moment in der gewaltigen Aufregung, die die weiße Bevölkerung mit Bekanntwerden der Alarmmeldung erfasst hatte. Die alten spanischen Batterien am Hafen, soweit sie noch vorhanden, wurden von Artilleristen besetzt, während ein Bataillon auf den Wällen des Stadtteiles Intra muros den Sicherheitsdienst übernahm und fünf Bataillone der Garnison sofort ausrückten, um die Besatzung der Redouten und Forts in der Kette der Befestigungen nach der Landseite zu verstärken.
Der Stadt Manila und der Arsenale in Cavite, wo ebenfalls alle Verteidigungsmaßregeln getroffen wurden, war man damit sicher. Dagegen machte man die Erfahrung, dass ein großer Teil der eingeborenen Bevölkerung dem amerikanischen Militär gegenüber schon vielfach eine freche Unbotmäßigkeit zeigte und keinen Hehl daraus machte, dass man über die politische Lage besser unterrichtet gewesen sei als die Amerikaner selber. Das waren die ersten Wetterzeichen und allmählich erinnerte man sich, dass man auch schon in den Tagen vorher ähnliche Beobachtungen gemacht hatte, so hatte man beispielsweise mehrfach in der Stadt und draußen Revolutionsflaggen entfernen lassen müssen.
Die Lage der Amerikaner war eine außerordentlich prekäre geworden, und als am Nachmittage beim Gouverneur ein Kriegsrat abgehalten wurde, beschloss man, sobald die Filipinos Neigung zeigten zu Aufstandsversuchen, die gesamten Streitkräfte zum Schutze Manilas, Cavites und der einzigen nach Norden führenden Eisenbahnlinie zu konzentrieren, alle übrigen Garnisonen aber zurückzuziehen und den Archipel einstweilen sich selber zu überlassen. So konnte man hoffen, wenigstens das, was man besetzt hielt, mit Aussicht auf Erfolg behaupten zu können. Selbstverständlich war sofort der Belagerungszustand über die Insel verhängt worden und der nächtliche Wachtdienst wurde von starken Militärpatrouillen übernommen.
Zu einem ernsten Zusammenstoß war es am Nachmittag vor dem Parlamentsgebäude gekommen. Als nämlich bekannt wurde, dass zugleich mit der Verkündung des Kriegsrechtes auch das Parlament für geschlossen erklärt worden war, strömte die Bevölkerung in hellen Haufen nach dem Parlamentsgebäude. Und als dann auf dessen Dache die amerikanische Flagge eingezogen und – wer es getan, ist nie festgestellt worden – an ihrer Stelle sich plötzlich die Katipunanflagge, das ehemalige Feldzeichen der Aufständischen, die Trikolore mit der Sonne im dreieckigen Felde, dort oben entfaltete, entfesselte dieser Anblick eine rasende Begeisterung und einen so wilden Fanatismus, dass es einer amerikanischen Kompagnie erst mit dem Bajonett gelang, den Platz zu säubern. Wenn es damals rätselhaft schien, woher jenes Riesenexemplar der Katipunan stammte, so sollten schon die nächsten Tage darüber aufklären, wie sorgfältig der Eingeborenenaufstand vorbereitet worden war.
Als am Abend desselben Tages die Offiziere der Garnison sich wieder am gewohnten Orte versammelten, herrschte eine ernste, gedrückte Stimmung, da man sich einem unsichtbaren Feinde gegenüberbefand. Der Meinungsstreit über die Gefährlichkeit der Mongolen war mit einem Schlage ausgeschaltet und diejenigen der Offiziere, deren Auffassung die schnelle Entwicklung der Dinge in den letzten Stunden recht gegeben hatte, waren so rücksichtsvoll, es ihre Kameraden, die weniger weitblickend als sie gewesen waren, nicht fühlen zu lassen, dass sie den Gegner unterschätzt hatten. Eine solche plötzliche Katastrophe hatte denn ja auch niemand erwartet, und die Unsicherheit darüber, was draußen in der Welt geschehen sein mochte, wirkte lähmend auf alle Entschlüsse. Was man für die Verteidigung vorbereiten konnte, war geschehen oder befand sich in der Ausführung, aber jedes Anzeichen fehlte, von welcher Seite man den Feind nun wirklich zu erwarten hatte.
Die Hauptsorge blieb zunächst, ob das nach Mindanao ausgelaufene Geschwader bereits den Ausbruch des Krieges erfahren hatte. Auf alle Fälle galt es, dieses und die aus San Franzisko zu erwartenden Truppentransporte vor ihrer Ankunft bei Mindanao zu warnen. Die einzigen Schiffe, die für diesen Zweck zur Verfügung standen, waren die paar kleinen, aus der spanischen Konkursmasse von anno 1898 stammenden, Kanonenboote, die man nach dem Auslaufen des Kreuzergeschwaders in aller Eile erst notdürftig hergerichtet und in den Hafendienst wieder eingestellt hatte. Ließen diese Kanonenboote auch hinsichtlich der Schnelligkeit alles zu wünschen übrig – einen Vorsprung von sechs Tagen hätte ja schließlich auch der schnellste Turbinenkreuzer nicht eingeholt – so gab es doch eine geringe Hoffnung, gerade mit diesen unscheinbaren Fahrzeugen, die sich nur wenig von dem Typus eines Handelsschiffes unterschieden, den Zweck des Unternehmens zu erreichen, d. h. den wahrscheinlich vor Manila kreuzenden japanischen Blockadeschiffen zu entgehen. Das alles aber nur unter der vagen Voraussetzung, dass die Japaner, so wenig sie bisher Manila angegriffen, ebenso auch das Kreuzergeschwader bei Mindanao vorläufig unbehelligt gelassen und ihre Kräfte nach einer anderen Richtung konzentriert hätten. Aber nach welcher? Immerhin galt es, auch eine so geringe Möglichkeit, das Geschwader noch warnen zu können, zu benutzen. Denn was hätte die Vernichtung des „Monadnock“ für einen anderen Sinn haben können, als eine Verbindung zwischen Manila und dem Geschwader zu unterbinden. An das kleine Schiffsgerümpel der Kanonenboote hatte der Feind anscheinend nicht gedacht. Oder war draußen bei Mindanao etwa alles schon zu Ende? Jedenfalls galt es, den Versuch zu machen.
Unter den Kommandanten der Kanonenboote entstand ein hitziger Wettstreit darum, wem von ihnen die Ehre zu teil werden sollte, den Plan auszuführen. Zwei Kanonenboote liefen, nachdem sie Kohlen genommen, noch am Abend aus, um in südöstlicher Richtung, zwischen der Wolke von kleinen Inseln mitten durch den Archipel hindurch, die Ostseite von Mindanao zu gewinnen, um dort in der voraussichtlichen Fahrtrichtung der Truppentransportschiffe diesen aufzupassen und sie eventuell nach Manila zu geleiten. Von beiden Fahrzeugen hat man nie wieder etwas gehört; es heißt zwar, dass sie im Kampfe mit einem japanischen Kreuzer, nach tapferer Gegenwehr, untergegangen seien. Der Zweck ihrer Mission war inzwischen dadurch unausführbar geworden, dass jene fünf Mail-Steamer schon vor drei Tagen mit zwei japanischen Torpedokreuzern östlich von Mindanao zusammengetroffen, zur Streichung der Flagge und zur Übergabe aufgefordert, und dann, als dieses Ansinnen natürlich entrüstet zurückgewiesen wurde, durch mehrere Torpedoschüsse versenkt worden waren. Nur wenige Überlebende der Besatzung wurden von den Japanern aufgefischt.
Zum Dank für seine schnelle Entschlossenheit und die Vernichtung der „Kanga Maru“ wurde dem Kommandanten der „Mindoro“ der Auftrag, mit drei anderen Kanonenbooten zu versuchen, den Chef des Kreuzergeschwaders in der Nähe – wahrscheinlich südwestlich – von Mindanao aufzusuchen, um ihn von dem Kriegsausbruch zu benachrichtigen und ihm den Befehl zur Rückkehr nach Manila zu überbringen.
Die Abfahrt der vier Kanonenboote fand bei einbrechender Dämmerung statt. Um den Zweck dieser Expedition vor der eingeborenen Bevölkerung zu verschleiern, wurde ostentativ davon gesprochen, dass die Kanonenboote nur den Sicherungsdienst vor der Einfahrt zur Bucht von Manila übernehmen sollten. Man hatte an Bord aller vier Fahrzeuge Funkspruchapparate gebracht, die aber erst unterwegs installiert werden sollten, damit durch sie die vier Kommandanten stets in Fühlung miteinander bleiben konnten und auch in der Lage waren, schon auf größere Entfernung hin ihre Fühler nach dem Kreuzergeschwader auszustrecken.
Am anderen Vormittage befanden sich die vier Kanonenboote mitten in der Mindorostraße. Unter dem Schutze der Dunkelheit mussten sie durch die Blockadelinie des Feindes unbemerkt hindurchgekommen sein, jedenfalls hatten sie nichts von ihm gesehen. Demnach konnte die Blockade von Manila nur eine sehr lockere sein. Am Ausgang der Mindorostraße sichteten die Kanonenboote, die mit geringem Abstand voneinander in Kiellinie fuhren, einen anscheinend englischen Dampfer, der ihren Kurs kreuzte. Sie versuchten ihn anzusprechen; sobald der Engländer dies aber bemerkte, vermehrte er seine Fahrt, wobei sich bald herausstellte, dass er schneller war als die Kanonenboote; und wollten diese nicht eine nutzlose Jagd aufnehmen, so musste man darauf verzichten, von dem fremden Kapitän irgendwelche Nachrichten zu erhalten. So setzten die Kanonenboote ihre Fahrt fort, die einzigen Schiffe auf der weiten Fläche der Philippinischen Inlandssee.
Nachmittags kam ein weißer Dampfer mit Gegenkurs in Sicht. Die Ansichten, ob man es mit einem Kriegs- oder Handelsschiff zu tun habe, wechselten in schneller Folge. Um sich Gewissheit zu verschaffen, ließ der Kommandant der „Mindoro“, die als Spitzenschiff fuhr, eine Schwenkung nach Steuerbord machen, worauf sich das fremde Schiff als ein Ozeandampfer von etwa 3000 Tonen erwies, dessen Nationalität bei der weiten Entfernung noch nicht zu erkennen war. Immerhin war es möglich, dass man es mit einem Hilfskreuzer aus der japanischen Handelsmarine zu tun hatte. Der Kommandant der „Mindoro“ ließ deshalb seine Schiffe gefechtsklar machen.
Mit gespannter Aufmerksamkeit wurde der Kurs des fremden Dampfers verfolgt, der seine Fahrt unbeirrt auf direkt nördlichem Kurse fortsetzte. Als er ungefähr 500 Meter über Backbord voraus von der „Mindoro“ entfernt war, forderte diese als Führerschiff den Fremden aus, die Flagge zu zeigen, worauf die englische Flagge am Heck erschien. Voll Kampfbegier hatte man an Bord der Amerikaner darauf gerechnet, hier mit einem Japaner, dem man zu viert überlegen gewesen wäre, zusammenzutreffen; die englischen Farben am Flaggenstock des Fremden bereiteten daher eine allgemeine Enttäuschung. Da machte der eine Offizier der „Mindoro“ Parrington darauf aufmerksam, dass die ganze Bauart des fremden Dampfers ihn als ein Schiff der „Nippon Yusen Kaisha“ charakterisiere, deren Dampfer ihm von seinem früheren Kommando an Bord eines amerikanischen Kreuzers in Schanghai bekannt seien; der Kommandant möge sich durch die englische Flagge nicht täuschen lassen. Sofort gab dieser Befehl, durch einen blinden Schuss den Kapitän zum Beidrehen aufzufordern, und als dieser trotzdem seine Fahrt fortsetzte, folgte ein scharfer Schuss aus dem Buggeschütz der „Mindoro“, dessen Granate dicht vor dem Dampfer auf dem Wasser aufklatschte. Jetzt schien der Fremde zu stoppen, machte jedoch eine scharfe Wendung nach Steuerbord und suchte mit voller Fahrt zu entkommen. Gleichzeitig verschwand die englische Flagge am Heck und wurde durch das rote Sonnenbanner Nippons ersetzt.
Parrington ließ die Flottille sofort das Feuer auf den feindlichen Dampfer eröffnen. Dieser hatte seinen Leichtsinn in wenigen Minuten schwer zu büßen. Sein Führer hatte offenbar darauf gerechnet, dass die Amerikaner noch über den Ausbruch des Krieges im unklaren seien und hatte geglaubt, die Kanonenboote unter neutraler Flagge ungehindert passieren zu können. Es war ja auch unwahrscheinlich, dass vier kleine Kanonenboote die Blockadelinie vor Manila forciert haben sollten, viel eher konnte man annehmen, dass diese Schiffe, noch ahnungslos von dem Stande der Dinge, auf irgendeiner Expedition begriffen seien, die mit dem Eingeborenenaufstand zusammenhing. Das Feuergefecht währte kaum zehn Minuten, worauf der japanische Hilfskreuzer, der nur mit zwei leichten Geschützen, die hinter der Achterdeckskajüte sehr geschickt versteckt aufgestellt waren, antwortete, mit dem Heck zuerst in den Fluten versank. Es war immerhin ein kleiner Erfolg, der den Geist der Besatzung der Kanonenboote belebte.
In den nächsten Stunden überholten die Amerikaner ein paar malayische Segler, die unbeachtet gelassen wurden, später kam ein kleiner schwarzer Frachtdampfer in Sicht, anscheinend mit Kurs von Borneo auf Manila. Schwerfällig arbeitete sich das kleine Fahrzeug durch die Fluten vorwärts, von der im Laufe der letzten Stunden sich immer mehr verstärkenden Dünung kräftig auf- und abgewiegt. Gegen 3 Uhr war das fremde Schiff so nahe, dass seine Flagge – die niederländische – zu erkennen war. Durch einen Flaggenspruch wurde es aufgefordert beizudrehen, worauf der erste Offizier der „Mindoro“ mit einem Boot zu dem Fremden hinüberfuhr. Eine halbe Stunde später verließ er die „Rotterdam“ wieder, worauf diese kehrt machte und nach der Richtung, von der sie gekommen, zurückfuhr. Der Kapitän der „Rotterdam“ war von dem amerikanischen Offizier über die Blockierung von Manila unterrichtet worden, was ihn veranlasste, seine Absicht, Manila anzulaufen, aufzugeben.
Die Nachrichten, die man auf diese Weise erhielt, lauteten sehr bedenklich: Die „Rotterdam“ kam aus dem Hafen von Labuan, wo bereits über einen siegreichen Kampf zwischen japanischen Schiffen und dem vor Mindanao stationierten amerikanischen Kreuzergeschwader ziemlich bestimmte Nachrichten vorgelegen hatten. Das Gefecht sollte vor etwa fünf Tagen, demnach sofort nach Ausbruch des Krieges, stattgefunden und mit der gänzlichen Vernichtung der Amerikaner durch überlegene feindliche Streitkräfte geendet haben.
Das Kreuzergeschwader brauchte jedenfalls nicht mehr vom Ausbruch der Feindseligkeiten benachrichtigt zu werden, und so beschloss Parrington, gemäß seiner Instruktion mit seinen vier Schiffen nach Manila zurückzukehren. Als die Flottille sich gegen Abend kurz vor Sonnenuntergang wieder ungefähr in der Mitte der Straße von Mindoro befand, machte das letzte der Kanonenboote Meldung, dass ein großes weißes Schiff, anscheinend ein Kriegsschiff, von Südosten aufkommend gesichtet werde, dass der Flottille mit großer Fahrt auflaufe. Bald war ein hochgebauter weißer Dampfer zu erkennen, dessen Gefechtsmarsen über seinen kriegerischen Charakter keinen Zweifel ließen. Es konnte sehr bald ausgemacht werden, dass der Kreuzer ungefähr 15 Seemeilen lief, und unter diesen Umständen war ein Ausweichen unmöglich.
Parrington ließ seine Kanonenboote sich in Dwarslinie formieren und die Maschinen in höchster Dampfspannung arbeiten. Vielleicht, dass man unter dem Schutze der Dunkelheit dem Feinde entkommen konnte. Bis dahin war es freilich noch eine volle Stunde.