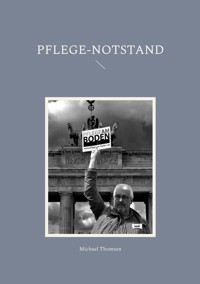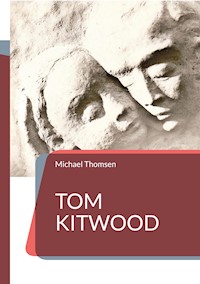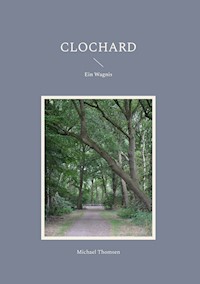
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Matthias Meyer hat sein altes Leben satt und beschließt, das Leben eines Clochards zu führen und reist mit seinem Fahrrad unter falscher Identität durch Europa. Er bricht alle Bindungen ab und schildert als Ich-Erzähler am Anfang des Romans seine existentiellen Beweggründe und seine Sicht auf die Welt. Nach ein paar Wochen lernt Matthias in Frankreich Michaela kennen. Die beiden kommen sich näher und schon bald tritt Matthias anders als geplant in ein neues Leben ein. Ebenso wie Matthias, der sich selbst gegenüber Michaela mit seinem falschen Namen Mikkel ausgibt, trägt auch Michaela ein Geheimnis mit sich herum. Bei einem Besuch der deutschen Hauptstadt treffen sie zufällig auf Andreas, den obdachlosen Bruder von Matthias. Andreas wiederum hat zufällig Susanne, die drogensüchtige Klassenkameradin von Matthias, kennengelernt. Und nun überschlagen sich die Ereignisse und man findet eine Leiche im Landwehrkanal. Als Michaela und Matthias von dem Todesfall hören, haben sie einen Plan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch:
Der 47-Jährige Matthias Meyer hat sein altes Leben satt und beschließt, das Leben eines Clochards zu führen und reist mit seinem Fahrrad unter falscher Identität durch Europa. Er bricht alle Bindungen ab und schildert als Ich-Erzähler am Anfang des Romans seine existentiellen Beweggründe und seine Sicht auf die Welt.
Nach ein paar Wochen lernt Matthias in Frankreich die 39-jährige Michaela auf einem Campingplatz kennen. Die beiden kommen sich näher und schon bald tritt Matthias erneut und anders als geplant in ein neues Leben ein.
Ebenso wie Matthias, der sich selbst gegenüber Michaela mit seinem falschen Namen Mikkel ausgibt, trägt auch Michaela ein Geheimnis mit sich herum, das sie ihm später beichtet. Den Sommer über bereisen sie wieder Frankreich und Deutschland.
Bei einem Besuch der deutschen Hauptstadt treffen sie zufällig auf Andreas, den obdachlosen Bruder von Matthias.
Andreas wiederum hat zufällig Susanne, die drogensüchtige Klassenkameradin von Matthias, kennengelernt. Die beiden beginnen eine Beziehung. Nach der Einnahme starker Drogen gerät Susanne in einen Wahn und erschlägt Andreas eines Abends im Rausch. Andreas Leiche wird Wochen später in einem Kanal gefunden. Zunächst kann die Polizei nicht die Identität des Leichnams feststellen; lediglich der zerfetzte Pass mit dem Namen Meyer gibt einen Hinweis. Als Michaela und Matthias von dem Todesfall hören, haben sie einen Plan.
Inhalt
1. Futur Zwei
2. Mikkel
3. Marina
4. Wagnis
5. Natur
6. Böses
7. Jakobsweg
8. Alias
9. Michaela
10. Andreas
11. Susanne
12. Rausch
13. Metz
14. Zuhören
15. Jürgen
16. Loire
17. Berlin
18. Esau
19. Alterssitz
Epilog
1. Futur Zwei
Plötzlich war er einfach weg, sagten die Nachbarn. Und sie meinten - Mich.
Sein Fahrrad war weg und er hatte sich nirgends wirklich abgemeldet, keinen Termin vorgeschoben, Ende April, bei schönstem Frühlingswetter, so sagten sie. Einen kurzen Brief hatte er hinterlegt: „Brauch mal ein paar Tage Ruhe und Zeit zum Nachdenken, bin wieder mit dem Fahrrad los! Melde mich. Bis später. Ich liebe Euch!“ So schrieb er, einen Zettel auf dem Küchentisch hinterlassend.
Und sie zitierten: Mich.
Und seine Frau war gleich bei all der scheinbaren Normalität stutzig; warum bezog er alle mit „Euch“ ein? Das war befremdlich für sie. Er meldete sich nicht. Über Handy war er nicht zu erreichen, auf WhatsApp keine Reaktion, nicht am nächsten Morgen, am übernächsten Abend und nicht eine Woche später. Noch zwei Wochen später gab es kein Lebenszeichen bis sie sich entschloss, die Polizei zu alarmieren. Die Arbeit rief an. Die Kinder fragten unentwegt. Die Nachbarn hatten keine Ahnung. Bei Verwandten war er nicht aufgetaucht. Wohin war er abgetaucht?
Es war auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches. Hin und wieder fuhr ich eben ein paar Tage mit Zelt und vorgeplanter Route irgendwelche Touren, von denen ich schon als Junge immer wieder geträumt und die ich viel zu selten umgesetzt hatte. Diesmal wagte ich den großen Sprung, war dann einfach mal: Weg!
Nach dieser wagemutigen Entscheidung wurde vieles anders. Tage und Wochen später gab es keine Lebenszeichen, keine Meldungen per SMS oder WhatsApp. Ich rief nicht an, nicht nach dem ersten, nicht nach dem zweiten und auch nicht nach dem dritten Tag. Mein schlechtes Gewissen wurde - vom Umgewöhnen und Beschäftigt Sein mit Zeltaufbau, Nachtlager sichern, Waschen, den naheliegenden Herausforderungen halt - betäubt.
Vom Emsland aus war ich unwiederbringlich Richtung Ruhrgebiet und weiter der Süd-Sonne folgend unterwegs. Und nach über einer Woche im Entschluss gereift; es gab kein Zurück mehr! Der Rücken schmerzte und das Sitzbein auch, aber die bleiern beruhigende Schwere des Loslassens hatte mich erfasst und ich schlief trotz ungewohnter Matratze, Temperaturschwankungen und gelegentlichen Mückenattacken ziemlich gut.
Ich hatte es endlich umgesetzt, was mich vor Jahren in tiefster Depression anfesselte und mich einfach nicht loslassen wollte: Den Gedanken zu fliehen vor all denen, die Erwartungen hatten, hatte ich in die Tät umgesetzt. Denn oft unterließen es die Erwartenden im Gegenzug ebenso meine Erwartungen zu erfüllen. Erwartungen der anderen, denen ich aus Sicht der anderen scheinbar so gut folgen konnte, aber denen ich nicht immer gern folgen wollte, denen ich meist nur aus Pflichterfüllung gefolgt war und deren Erfüllung mich ständig fühlen ließ: Ich werde ausgezehrt. Energie und Kraft wurde unablässig abgesaugt. Von mir blieb so am Ende – nichts, nur Leere!
War mein Leben bis dahin darauf hinuntergebrochen, immer nur Erwartungen anderer zu erfüllen? Sollten sie doch warten – ohne mich. Denn wo blieb sonst: Ich? Ich wollte nicht mehr verantworten müssen, worauf ich keinen wirklichen Zugriff hatte. Wie konnte ich noch mit mir selbst übereinstimmen, also: mit den eigenen Erwartungen im Einklang sein, und zwar einschließlich der Erwartungen der anderen, wenn die Erwartungen von Gesellschaft und Vorgesetzten immer weiter überbordeten? Von „Entschleunigung“ sprachen sie zu Beginn der Sitzung und erteilten neue Aufträge am Ende des Meetings.
Ich wollte nicht mehr Verantwortung, vor allem für andere und für Dinge außerhalb meines freien Zugriffs tragen müssen, wollte frei mich fühlen und – ganz simpel – mich von einer anderen Art Leben überraschen lassen oder – ich würde im Selbstmitleid aufgehen. Trost in der Ferne und gelegentlich - im Rotwein finden.
Die Fantasie hatte mich immer öfter in dieses Reich jenseits der bestehenden Bindungen entlassen. Einfach nur weg! Loslassen. Niemandem mehr Rechenschaft schuldig sein. In mir und bei mir sein, Natur, aber - paradox mags klingen -, auch Menschentrubel und die Begegnungen anderer genießen, ohne wirklich dabei irgendwie unnötig involviert zu sein, ohne verstrickt zu werden darin, was andere an Wollknäueln in den Ring der multiplen Fallstrickgelände hereinwarfen. Frei sein. Voyeur des Geschehens, das sich vor meinen Augen abspielen würde, unberührbar dabei und doch angekettet an Wirklichkeit, den Launen des Wetters freilich ausgesetzt. Geldmangel und schlechtes Wetter, die größten Hürden, aber eben nicht mehr vornehmlich der andere, jeder andere Mensch, und dessen Forderungen und Erwartungen. Das Gefühl, sowieso nichts ausrichten zu können, was die Vernunft gebietet, das hatte sich bei mir festgesetzt. Was nützte da politisches Engagement, wenn doch Geld und die Interessen der Mächtigen die Welt weiter regiert.
Vor einem zu hohen, eigenen Anspruch hatten mich Therapeuten und Freunde gewarnt. Sie hatten gut reden! Sie hatten meine Probleme nicht! Fand ich doch meinen Anspruch gar nicht so hoch, wollte nur gute Leistungen zeigen, mit mir selbst zufrieden und im Einklang sein, Lösungen finden für das Problematische, nach vorne schauen. Und ich wurde dabei immer wieder ausgebremst. Das raubte Kraft, das zog hinab, das brannte mich aus. Sollte ich zurück in diese Tretmühle? Da waren nicht nur die Erwartungen der Frau, der Kinder, der Nachbarn, der Mitarbeiter*innen, die Forderungen der Vorgesetzten oder einer imaginären Gesellschaft. Denen konnte ich entsprechen, aber ich wusste, es wird mich wieder aushöhlen und alle Kräfte rauben bis zum nächsten Absturz…
Hatte ich bisher nicht immer alles für andere getan? Um anderen zu gefallen? Ich merkte jetzt, dass ich etwas (anderes) für mich tun musste. Ich wollte nicht mehr abnehmen, damit ich für andere ansehnlicher und attraktiver wurde, sondern ich wollte es für mich, weil ich Mich wieder leiden und in den Spiegel schauen können wollte; nicht weiter Ballast mitschleppen, der mich drückt und hindert, das zu tun, was mir und meinem Körper Freude macht.
Hatte ich früher geschrieben, um anderen zu imponieren, um etwas „Großes“ zu schaffen und zu Papier zu bringen, etwas Bedeutendes, um vielleicht berühmt und anerkannt zu werden, alles möglichst gedankenschwer, zu sehr Vorbilder nachäffend, so wollte ich von nun ab von mir selbst erzählen können. Ich fühlte mich nach solchen Gedanken gut, freier und ohne Zielvorgaben, meinem inneren Erleben, Wahrnehmen und Denken locker folgend wie ein Gerät mit einem vollen Akku.
Die Kinder waren längst auf eigenen Wegen. Von dem, was ich mir wünschte, längst in unerreichbarer Distanz. Keine Kredite mehr, aber auch keinen Besitz, keine Immobilie. Ich hatte nichts, nichts geerbt, nichts erworben, nichts mit Geldanlagen aufgebaut, denn ich hatte diese noch so kleinen Beiträge für Geldanlagen nicht; nur ein Konto, lange Jahre lebten wir in den Miesen. Endlich hatten wir dann sogar etwas Geld ansparen können, aber es reichte nicht für Sorglosigkeit im Hinblick auf finanzielle Sicherheit. Größere Anschaffungen oder gar ein Immobilienkauf außer Reichweite, den Banken waren wir irgendwann schlicht zu alt für Kredite.
Außerhalb meiner Zugriffsmöglichkeiten musste ich machtlos zusehen, wie die Zinseszinsen Vermögenden und Besitzern von Kapital bei geschickter Manövrierung an den Börsen ein Leben ohne echte Geldsorgen verschafften. Ihr Geld „arbeitet“, sagten die Vermögenden und dachten noch völlig selbstsicher, das wäre ihr redlicher Verdienst. Sie fürchteten nur den Börsencrash, den wirklich und dann hochklagend. Die, die alles am Laufen hielten und für Lohn arbeiteten, hielten eben auch das Börsenunternehmen so am Laufen, dass Aktionäre Renditen erhielten. So im Ganzen betrachtet, bedachten sie das nicht.
Mittlerweile eingefahren und gebunden an diverse Pfadabhängigkeiten und blind folgend dem Mantra vom ewigen Wachstum und weiter steigender Effizienz aller möglicher Prozesse, hatten wir uns den Trends ergeben und ließen zu, dass nicht in Zukunft investiert und Folgeschäden der Lebensstile uneingepreist den Folgegenerationen überlassen wurden, sondern ein Status Quo mit atemberaubenden, Divergenz fördernden Kräften, getarnt als Fortschritt, erhalten blieb, der das Potential barg, alles mit sich ins Verderben zu führen.
Ein Sechstel eines jeden Jahrgangs in den Industrienationen wird durch Zinseszins und Erbschaft in den Besitz einer größeren Summe Vermögens gelangen als die Hälfte der Bevölkerung sie im ganzen Leben durch Arbeit verdienen kann. Dabei können wir nur tatenlos zuschauen und müssen wieder mal unsere Neidgedanken unterdrücken. Denn: Wir könnten ja gänzlich und unverhofft auf dieser anderen Seite stehen. Wir schaffen es nicht einig zu werden, da der Dschungel der Meinungen die Klarsicht und Solidarität verschluckt. Und auch wenn wir das Gefühl haben, auf falschen Pfaden zu wandeln, wagen wir es nicht, sie zu verlassen, weil uns die Angst, herunterzufallen oder Verzicht üben zu müssen, davon abhalten.
Die allermeisten Menschen verstehen nicht die Logik von Zinseszins über die Jahre; sie treiben mit im Strudel dieser Berechnungen, die sie nicht begreifen. Das erste Reiskorn auf dem Schachbrett, es bleibt ihnen noch fassbar und sie folgen der Verdopplung noch bis acht oder zehn – und dann wir ihnen allmählich mulmig und sie beginnen zu ahnen, was sie nicht verstehen und verstehen nicht: Warum?
Und auch die Kraft der besseren Argumente wird flüchtig, wenn sie merken, dass jedes einzelne Argument in komplexen und differenziert zu erklärenden Zusammenhängen steht, denen sie nicht weit folgen können. Sie schalten ab und da freuen sich Demagogen, Ideologen und die Vermögenden, weil keine nennenswerten Gegenbewegungen mehr entstehen. Der eindimensionale Mensch hat überlebt.
Vor all dem hatte ich nun endgültig kapituliert und zog mich aus diesem Dschungel zurück. Und ich danke dem Teil in mir, der das Mutig Sein hervorkehrte. Ein Teil, der in vielen von uns verborgen ist und der doch so viel mehr bewirken kann. Immerhin gelang es mir immer wieder, kleinere Geldbeträge, mal 20, mal 50 mal 400 Euro unbemerkt abzuzweigen und zu verschicken, um den Plan umsetzen zu können. Dazu später mehr.
Mehr als glücklich war ich mit Marina. Und doch war dieses Glück eine Gefangennahme, denn es war und blieb gekettet an Erwartung, an eine unerfüllbare Ausformung des Perfekt Seins. Aber - auch von ihrer Seite - empfand ich stets schwer und drückend eine unerfüllbare Erwartungshaltung und Sorge, spürte den Druck der Verantwortung, der mich ängstigte, mir nämlich vorzustellen, was sie dachte, wie es mit mir werden würde, wenn ich alles einfach hinter mir ließ.
Was würde, was könnte sie denken? Das musste ich völlig ausblenden lernen, sonst würde ich mich nie befreien können, so sehr ich sie liebte. Auch davon musste ich mich befreien, von ihrer Liebe, von allen Gedanken und Sorgen meiner Liebgewonnen. Sonst ginge es weiter mit mir - bergab.
Sie war Anker, Freundin, Geliebte, Garant für unsere Familien- und Nachbarschaftsidylle, fleißig und so unsagbar selbstlos. Ich begehrte sie und liebte ihren Geruch, ihre Hingabe auch beim Sex. Das alles würde ich vermissen, aber dennoch konnte es mich nicht aufhalten. Etwas Stärkeres, Unerklärbares in mir trieb mich dennoch, endgültig und allem zu entfliehen.
Das würde sie und das konnten alle anderen nicht verstehen. Und ich verstand es eigentlich auch nicht. Diesen Sprung zu wagen. Solch ein Wagnis passte eigentlich nicht zu mir. Ich verstand mich selbst nicht, hatte ich mich doch noch nie verstanden. Wie konnte ich so etwas tun? Es war auch eine Befreiung von Bindung, von Angesogenwerden. Mein Mut war also übermächtig und er katapultierte mich in dieses Abenteuer hinein und in eine völlig andere, neue Welt hinaus.
Ich fragte mich: Wie lange hatte ich, wenn es gesundheitlich gut lief, noch zu leben? 15, 20, vielleicht 30 oder gar 40 Jahre? Wenn es mal Mich richtig trifft, ob Sturz, ob Herz, ob Krebs, da wäre ich quasi ungekämmt und ein Elend mehr. Das war Bürde nach dem Mut, aber die Entschlossenheit siegte.
Was wollte ich für mich und mein Leben? Das war sehr ambivalent und die eine Seite davon traute ich mich nicht mehr zu gehen. Ich hatte Respekt und vielleicht sogar Angst davor. Die andere war noch riskanter, aber sie schlich sich immer wieder als Wunschvorstellung zurück in mein Denken.
Und so dachte ich: Wieviel braucht der Mensch – wie ich – zum Über-Leben? Und irgendwann hatte es dann begonnen, dass ich im Futur Zwei zu denken pflegte. Was wird von mir nach meinem Tod gesagt werden? Wie würde man mich in Erinnerung behalten? Was wollte ich, das ich bis dahin getan haben würde? Und ich erkannte, dass mein bisheriges Leben ein Schrotthaufen gewesen sein würde, wenn ich nicht umsteuerte. Nur in welche Richtung? Erwartungen einerseits und blockende Menschen andererseits führten mich zum Clochard.
Ich hatte nach Monaten – oder waren es Jahre? – endlich wieder die Kraft gefunden, die mich überhaupt etwas planen ließ, noch mehr hatte ich den Mut gefunden, einen ersten Schritt ins Ungewisse zu wagen. Es musste alles „Scheißegal“ sein, sonst würde ich am Ende keine Chance gehabt haben. Ich wollte Ballast abwerfen und mich vom Druck befreien.
Mein bisheriger Tagesablauf war alles andere als frei, aber meist sehr gut ge-füllt, aber eben nicht er-füllt und oft bar der zum guten, zumindest gesunden, Leben notwendigen Pausen. Der Wecker um Viertel nach Sechs, manchmal erst viertel vor Sieben. Dann Kaffeemaschine angestellt, Duschen, Rasieren, Anziehen, Kaffee in die Thermoskanne gegossen, eine Flasche Mineralwasser in die Tasche fürs Büro. Im Wohnzimmer eine Tasse Kaffee geschlürft. Essbares kriege ich so früh morgens noch nicht runter. Vor der Abfahrt zur Arbeitsstelle noch Zähne geputzt. Auf der Arbeit gegen 07:15 Uhr Postfach nachgeschaut, Computer angeworfen, Berichtseinträge und Mails lesen. Termine gecheckt. Um 08:30 Uhr Frühbesprechung bis 09:15 Uhr. Anschließend Telefonate, Schreibtischarbeiten, Kundengespräche, Dokumentationsrecherchen, Mitarbeitergespräche, Rundgang. Meistens fand ich dafür leider keine Zeit wegen dringender Telefonate oder Führungen, manchmal mittags nach 12 Uhr mit Kolleg*innen aus der Verwaltung, da schaffte ich schon mal ein oder zwei Brötchen und ein oder zwei Tassen Kaffee.
Natürlich landeten die Telefonate bei mir, so dass die Pause ungern unterbrochen wurde oder ganz ins Wasser fiel. Postmappe durchgeschaut und am frühen Nachmittag wieder Besprechungen aller Art, meist moderierte ich und weil ich aus Erfahrung wusste, dass meine Protokolle von mir rasch erstellt wurden, führte ich meistens auch Protokoll, gleich in den Laptop. Organisierte interne Fortbildungen und nahm an Schichtübergaben teil. Ab etwa 16:00 Uhr folgten meist wieder Einzugs- und Bewerbungsgespräche. Gegen 17:00 Uhr fand ich Zeit für die Dienstplangestaltung, Abrechnungen und Erstellung von Standards und Verfahrensanweisungen. Meist wurde ich unterbrochen von Anrufen der Mitarbeiter*innen oder von Kunden oder Interessenten.
Ich freute mich immer, wenn ich Aufgaben und Herausforderungen möglichst zeitnah und zügig abarbeiten und bewältigen konnte. Vor 17:30 Uhr hatte ich fast nie Feierabend, war froh, wenn ich vor 20:00 Uhr wieder zu Hause war. Etwa einmal pro Woche fanden auch Abendveranstaltungen statt. Hin und wieder auch Dienst an Wochenenden, auch gerne mal zwei oder drei Nächte einspringen für kurzfristig ausfallenden Nachtdienst. Einmal habe ich die Mutter von drei Kindern aus dem Urlaub geholt, weil ich sonst niemand erreichen konnte und wieder mal den Dienst selbst sonst hätte übernehmen müssen. Vor Geschäftsführung und Mitarbeitervertretung musste ich mich später, wie in einem Tribunal, rechtfertigen. Wie konnte ich nur so herzlos sein? Gab es denn keine andere Lösung? Egal wie ich es machte, es landete am Ende immer auf meinen Schultern.
Meine durchschnittliche Arbeitszeit lag am Tag bei 10 bis 12 Stunden. Als führende Leitungskraft waren laut Tarif meine Überstunden mit dem Gehalt vergolten. Wenn ich´s dann durchrechnete und das Gehalt durch die tatsächlich geleisteten Stunden dividierte, stellte ich fest, dass ich deutlich weniger pro Stunde verdiente als die meisten meiner Mitarbeiter*innen. „So ist das nun mal in sozialen Berufen, und Du hast es dir ja selbst ausgesucht, also meckere nicht rum!“ Das sagten mir Männer aus anderen Berufen, die in der Verwaltung der Stadt genauso viel, und am Fließband von VW mehr verdienten und noch immer mehr verdienen als ich.