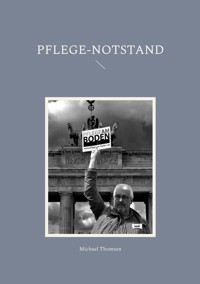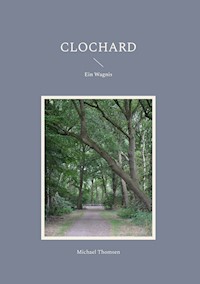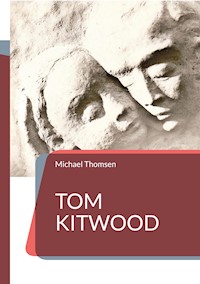Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, nach einer Zeit einer ungeheuer auseinandergehenden Vermögensschere, kriechen aus dem Bauch der Weimarer Republik die Gespenster, die den Zweiten Weltkrieg gebären. Gut hundert Jahre später wiederholen sich scheinbar Dinge, die die Demokratie längst glaubte, überwunden zu haben. Überlebt hat schließlich auch der Keim, der die Welt ab 1933 fast zum Einsturz brachte. Das Braune, in den 2000er Jahren zunächst noch blaugefärbt, erwies sich zäher als viele es wahrhaben wollten. Einfache Sätze im Vagen, durchdrungen von Unwahrheiten, Halbwissen und unaufgearbeiteter Geschichte, enthemmen sich in sozialen Netzwerken und bringen die elaborierten Gedankengebäude und kritische Analysen von Journalisten, Wissenschaftlern und Künstlern zum Einsturz und gipfeln in diversen Verschwörungstheorien oder graben sich ein in ideologischen Konstrukten. Auf diesen Trümmern bewegen wir uns heute. Der Roman beschreibt zwei Stränge; einerseits zeichnet er beispielhaft ein mögliches Zeitgeschehen vom Ende des 2. Weltkriegs bis Mitte der 1990er Jahre nach, andererseits gibt die Freundschaft zweier Jungen noch Hoffnung, dass aufklärerisches Denken einen braunen Sumpf noch trocken zu legen vermag. Heute können viele die Wahrheit nicht mehr mit bloßem Auge erkennen. Verwechselungen aller Art vermehren Unglück und Leid, befeuern krudes Denken und gebären Narrative wie von Verrückten. Manchmal, aber nur manchmal, finden Menschen einen Weg da heraus. Dieser Roman mag vielleicht ein Lehrstück dafür sein, dass eben nicht alles ans Licht kommt, was da hinkommen sollte. Und manchmal, nur manchmal, scheint es auch gut zu sein, wenn etwas im Dunkeln bleibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lichtung
manche meinen lechts und rinks könne man nicht velwechsern werch ein illtum
(Ernst Jandl, 1966)
Inhalt
Prolog
Personen
Am Baggersee
Nach Krieg Zeit
Die Villa
Lehrzeit
Freundliche Aufnahme
Kinobesuche
Schulzeit
Vergangenheitsbewältigung
Scheidung und Tod
Im Treppenhaus
Wohnungstausch
Kofferinhalt
Recherchen
Hypothesen
Zahngold
Spurensuche
Helsingborg 1945
Die Schwester
Rollenwechsel
Neue Zeiten
Abflug
Dokumente
Rechtsruck
Kur
Der Brief
Brauner Sumpf
Wehrsportgruppe
Koma
Blutgruppen
Schweigepflicht
Verwechselung
Registerkarte
Beichte
Vortrag
Brief
Prolog
Lange ungeübt, in epischer Breite Erzählstränge zu entwickeln, drängten sich mir eines Abends Bilder und Szenen auf, die geradezu danach schrien, in Textformen gegossen zu werden.
Irren ist menschlich, heißt es. Aber Irrtümer und Verwechselungen aufzuklären, sie ans Licht zu bringen, kann helfen, klarer zu sehen und sich also in der Welt besser zurechtzufinden. Aber nicht immer ist das gesund. Und außerdem kommt dennoch zu wenig ans Licht, was da hingehörte. Das Meer ist voll von Unsichtbarem. Vieles Berichtenswerte aus der Geschichte bleibt ungezählt und unerzählt. Der Friedhof der Unbekannten und ihrer Lebensgeschichten ist unendlich groß. Drum wage ich mit diesem Roman eine Beschreibung von Möglichkeiten privatgeschichtlicher Verläufe über einen Zeitrahmen, der sich über die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts erstreckt.
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, nach einer Zeit einer ungeheuer auseinandergehenden Vermögensschere1, kriechen aus dem Bauch der Weimarer Republik die Gespenster, die den Zweiten Weltkrieg gebären. Gut hundert Jahre später wiederholen sich scheinbar Dinge, die eingekleidet in Achtundsechziger- und Baby-Boomer-Jeans wieder zulassen, dass Krieg uns immer näher rückt, aber auch, dass Menschen unverdient reich werden auf Kosten der Menschen, die abhängig Arbeit wählen müssen, denen keinerlei großes Erbe zufällt, um würdevoll oder weniger würdevoll leben zu können.
Traumatisiert und noch immer festgezurrt im Denken der schon Jahrzehnte zuvor erfolgten Indoktrinationen und infolge eines Zeitgeistes, der „unwertes Leben“ verstand wie eine Notwendigkeit des Denkens von Tierzüchtern, begannen nach dem Zweiten Weltkrieg die Menschen mehr und mehr, alles in zwei entgegengesetzten Polen zu verorten. Es gab gute und böse Menschen, fleißige und faule, kluge und dumme und es gab Ost und West, Markt – und Planwirtschaft, Frieden und Krieg, reich und arm, links und rechts, schwarz und weiß. So erfolgten die jeweiligen Zuschreibungen und immer befanden sich die anderen im falschen Lager. Heute sehen wir die Ergebnisse solcher Spaltungen in Debatten und Diskussionen in Parlamenten und öffentlichen Medien.
Eine Mischung aus Darwinismus, Wachstumsglauben, Neoliberalismus und Utilitarismus mischte sich mit dem Erbe der nationalsozialistischen Gedankensplitter. Dazwischen schien es nichts zu geben oder wurde am Wachsen gehindert. Das Böse wurde als absichtsvoll dargestellt, das Gute kam aus sich heraus. Ein Denken zwischen - oder im Hin und Her dieser Pole wurde schnell verdächtig. „Entweder – Oder“, hieß die Devise.
Doch ganz allmählich begannen einige Menschen zu ahnen, dass es etwas dazwischen geben musste. Die ökologischen Folgen der Art des Wirtschaftens wuchsen wie die Wurzeln eines Baumes und deren Pilzgeflechte in die Zwischenräume des Denkbaren.
Überlebt hat schließlich auch der Keim, der die Welt ab 1933 fast zum Einsturz brachte. Das Braune, in den 2000er Jahren zunächst noch blaugefärbt, erwies sich zäher als viele es wahrhaben wollten. Einfache Sätze im Vagen, durchdrungen von Unwahrheiten, Halbwissen, unaufgearbeiteter oder verdrängter Geschichte und interessegeleitetem Kampf, enthemmten sich in sozialen Netzwerken und brachten die elaborierten Gedankengebäude und kritische Analysen von Journalisten, Wissenschaftlern und Künstlern zum Einsturz und gipfelten schließlich in diversen Verschwörungstheorien oder gruben sich ein in ideologischen Konstrukten. Auf diesen Trümmern bewegen wir uns heute.
Die Generation der nach 1945 geborenen geriet im Laufe ihrer Erwerbsbiografie sehr häufig in Überlastungs-konstellationen. Zwar erlernte dann ein Teil der überlasteten Babyboomer das, was unter Vertretern späterer Generationen längst etabliert ist: Nein sagen, achtsam sein, Grenzen setzen. Die nachfolgenden Generationen bewältigen Stress eher, indem sie sich mit eigenen Zielen und der Sinnhaftigkeit von Aufgaben beschäftigen, ein Fortschritt immerhin. Die Babyboomer hingegen erlebten als späte Nachkriegsgeburten noch im Zuge eines stärker ausgeprägten Pflichtbewusstseins, dass das Verhältnis aus eigener Leistung und Gratifikationen wie Gehalt, Anerkennung oder Lernmöglichkeiten nicht ausgeglichen war und so ihr Stresserleben potenzierte. Viele blieben dabei auf der Strecke, in Lehrer-Arbeitslosigkeit, in falschen Berufen, strandeten in Sucht oder Depression, und hätten dabei ein Korrektiv im demokratischen Diskurs sein können. Stattdessen folgten einige dem Aufruf nach einem Marsch durch die Institutionen, wo sie sich verloren.
Heute können wir die Wahrheit nicht mehr mit bloßem Auge erkennen. Verwechselungen aller Art vermehren Unglück und Leid, befeuern krudes Denken und gebären Narrative wie von Verrückten. Manchmal, aber nur manchmal, finden Menschen einen Weg da heraus. Dieser Roman mag vielleicht ein Lehrstück dafür sein, dass eben nicht alles ans Licht kommt, was da hinkommen sollte. Und manchmal, nur manchmal, scheint es auch gut zu sein, wenn etwas im Dunkeln bleibt.
Michael Thomsen, im Juni 2024
1 Vgl.: Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, München 2014 (von der Alfred Terjohn im Roman zweifelsfrei profitierte.)
Personen
Gisela Pierer (Fabrikantentochter, Jg. 1936)
Jonathan Terjohn (Architektur, Arztsohn, Jg. 1938)
Alfred Terjohn (Arzt, Vater von Jonathan, Jg. 1917)
Gaby (deren Tochter, verstorben 1977, Jg. 1960)
Gernot (deren Sohn, Jg. 1964)
Gerhold (Freund von Gernot, am selben Tag geboren)
Melanie Engel, alleinerziehende Mutter von Gerhold (Jg. 1947)
Hilde Engel (Mutter von Melanie, Jg. 1922)
Barbara Reus (Notarsgattin, Jg. 1920)
Gudrun Reus (Taufpatin von Gerhold, Jg. 1945)
Ewald Scherzinger (Polizist, Jg. 1942)
Solveigh Sönniksen (Schwedische KZ-Insassin, Jg. 1921)
Irena Sönniksen (Schwedische Historikerin, Jg. 1923)
Sun Chi (Thailänderin mit chinesischen Wurzeln, Jg. 1947)
Am Baggersee
Als Gabriele Terjohn, die älteste und erstgeborene, fast siebzehnjährige Tochter des Architekten Jonathan Terjohn und dessen geschiedener Ehefrau Gisela, geborene Pierer, 1977 an einem lauen Sommerabend in einem Baggersee ertrank, nachdem sie zuvor etliche Schnäpse und Bier mit einigen ihrer Freundinnen und Klassenkameraden konsumiert und sich dann voller Übermut in den See gestürzt hatte, um es den Jungen zu beweisen, was ein Mädchen kann, war ihr jüngerer Bruder Gernot gerade im pubertierenden Alter von 13 Jahren.
„Ihr glaubt, ein Mädchen kann das nicht?“ hatte sie gerufen und war losgesprintet in Richtung See, kopfüber ins nasse Element getaucht und war nach ein paar Kraulzügen plötzlich nicht mehr zu sehen. Die anderen Mädchen hatten noch Minuten vorher ihre Taschen gepackt und mit den Fahrrädern schon die Heimfahrt angetreten, als Gaby, wie sie von allen genannt wurde, noch auf eine Runde mit Hochprozentigem den drei Jungen zugeprostet hatte.
Die grölenden Jungen hatten, Bierflaschen in der Hand, ihr nachgeschrien und sie angefeuert. Als sie aber einige Sekunden lang nichts mehr von dem Mädchen sahen oder hörten, wurden alle plötzlich still und schauten sich ungläubig an.
Stunden später, nachdem THW und Feuerwehr sich aufmachten, um Boot und Tauchanzüge wieder auf die Fahrzeuge zu schaffen, lag der weißbleiche Körper des Mädchens unter einer Decke und wartete darauf, vom Bestattungsunternehmen Habedank in die blanke Metallkiste und dann auf den schwarzgrauen Kombi gehievt zu werden.
Ein schlechtes Gewissen plagte noch Jahre später den einen oder anderen Jungen, die dem Szenario damals beigewohnt hatten. Hatten sie das Mädchen, ihre Klassenkameradin und Freundin, mit ihrem Einflößen von Alkohol und provozierenden Reden und mit gemeinsamen Klatschen befeuerten Gegröle nicht – letztendlich – in den Tod getrieben? Sie wurden ruhiger und – fleißiger, schafften das Abitur und vermissten sie irgendwann nicht mehr. Die Zeit heilt bekanntlich so manche Wunde.
Ihr Bruder Gernot fand noch tagelang später keine Tränen, auch fand er keine Worte, als er vom Tod der Schwester erfuhr. Stumm und mit leerem, noch immer staunenden Augenschlag, verfolgte er die Begräbniszeremonie. Die Mutter, beim Vater eingehakt, hatte bereits viele Tränen vergossen und schritt dem Tross geradezu apathisch voran. Der Vater, gebeugt, den Blick auf den Boden geworfen und aufgedunsenem Gesicht, konnte am Grab seine Tränen nicht zurückhalten.
Gernot wunderte sich, dass ihn dieses Weinen nicht ansteckte, wie er doch im umgekehrten Fall in Schule und schon im Kindergarten nicht ernst bleiben konnte, wenn sein Freund Gerhold Faxen machte und Witze riss. Und so sah er sprachlos, aber mit aufmerksamem Blick, dem ungewohnten Geschehen zu, suchte die Gesichter der Jungen aus Gabys Klasse in den Bänken beim Herausgehen aus der Kirche. Er hatte seinen Großvater Alfred nicht unter den Trauergästen entdecken können. Später erfuhr er von der Mutter, dass Alfred eine Reise nach Thailand gebucht hatte und nicht bereit war, diese zu stornieren.
Von nun an luden Gernots Eltern, trotz der Scheidung, alle Liebe, Umsicht und Sorge auf den einzigen Sohn und Erben der florierenden Fleischfabrik. Gernot hatte seine ältere Schwester stets bewundert, die Klassenbeste und Sportskanone, die so kurz vor dem Abitur ihr Leben ließ.
Nach Krieg Zeit
Eine Beileidskarte hatte Gerholds Mutter Melanie Engel dessen Klassenkameraden Gernot geschickt und den Jungen allein zur Beerdigung gehen lassen. Auch ihn erblickte Gernot in einer der letzten Reihen. Ihre Blicke trafen sich kurz, um dann - irgendwie „wissend“ - weiterzuwandern.
Gerhold war der beste Freund von Gernot. Kam er doch aus einem anderen Milieu, so vereinte die beiden doch ihr ähnlich klingender Name und eine gewisse Ähnlichkeit in den Gesichtszügen und ein paar gleiche Neigungen. Gerhold war darüber hinaus Klassenkamerad von Gernot. Sie waren beide am gleichen Tag im Dezember geboren worden. Das fanden beide witzig. Und es führte sie immer wieder zusammen.
Gerholds Mutter Melanie erinnerte sich sehr gut an diesen Tag im Jahr 1964 im Marienhospital. Das Kind, das sie nicht gewollt hatte und welches nun immer wieder an ihrer Brust lag und sie für allen Schmerz durch seinen treuen Blick und unschuldig nach der Brust forschenden Mund entschädigte, der endlich ihre Brustwarze fand, um wohlig zu saugen, und der bei ihr eine Mischung aus Verzeihen, Mitleid und Wohlwollen hervorrief.
„Hier ist ihr Kleiner,“ sagte die Schwester und reichte ihr das Kind. Die Geburt war trotz der allgemeinen Hektik auf der Wöchnerinnenstation problemlos verlaufen, das Kind gesund und wohlauf. So ein kleines Bündel, das musste man liebhaben, dachte sie und dennoch liefen ihr die Tränen, denn das Kind hatte einen Vergewaltiger als Vater.
Gerhold wohnte mit seiner Mutter zur Miete in einer kleinen Wohnung in einer Reihenhaussiedlung. Die Miete fraß einen Großteil ihrer Einkünfte aus den verschiedenen Jobs. Melanie war alleinerziehend und hielt sich mit Putz-Jobs in einer Behörde und in diversen Haushalten über Wasser.
Ihr Leben war bis hierhin nicht sehr glücklich verlaufen. Die Mutter, eine Mischung aus Strenge und Eigensinn, sah in der Tochter lediglich eine Belastung, ein „Blag“, das durchgefüttert werden musste. Ein wenig Eifersucht spielte vielleicht auch etwas mit, weil ihr Ehemann und Vater des Mädchens, die Kleine sichtlich mochte und sie stets bei Vorwürfen der Mutter in Schutz nahm.
Melanies Vater Friedrich war im Februar 1947 einbeinig aus dem Krieg zurückgekehrt. Ausgehungert und halberfroren war er eines Abends zur Tür hereingetreten. Seine Frau saß rauchend und lachend mit zwei Tommys und seiner Schwägerin Clara am Küchentisch. Der gespenstige Anblick des riesigen Mannes, der dort im Türrahmen auf dem linken Bein und einer überdimensioniert erscheinenden Krücke unter der linken Achsel stand, ließ das Gelächter unvermittelt verstummen. Wie in Zeitlupe erhob sich Friedrichs Ehefrau, etwas unschlüssig, was sie sagen sollte.
„Fiete!“ rief sie endlich aus und hielt zweifelnd in ihrer Bewegung inne. Jetzt sah sie die Tränen im Gesicht dieses Hünen, die so gar nicht zu der Erinnerung an ihn passten. Gleichwohl trieb dieser trostlose Anblick und diese Männer-Tränen nun auch ihr die Tränen unter die Augen. Die beiden englischen Soldaten hatten derweil ihre Jacketts übergezogen und schlichen sich zur Hintertür heraus.
„Mein Gott, Fiete!“ rief nun auch die Schwägerin und drückte ihre halb gerauchte Zigarette aus. „Was hat der Krieg nur aus dir gemacht?!“ schob sie noch hinterher als seine Frau Friedrich an die Hand nahm, ihn wie forschend ansah und fragte: „Und wir dachten schon, du kämst gar nicht wieder.“ Jetzt erst zog sie sich zu ihm heran und umarmte ihn auf den Zehen stehend.
Die lebenslustige Mutter liebte Geselligkeit und sie war eine starke Raucherin. Friedrich, traumatisiert vom Krieg, fühlte sich wie ein Krüppel. Dennoch erholte er sich in den folgenden Wochen. Die Tommys blieben weg, aber ihre Schokolade und die Zigaretten brachte Hilde gelegentlich mit nach Hause. Friedrichs Jobsuche blieb ohne Ergebnis. Niemand wollte den Maschinendreher einstellen. Bei der Wehrmacht war er Fahrer eines Generals. Mit seinem Schwager baute er ein Auto so um, dass es auch der einbeinige Friedrich lenken konnte. Nach den ersten Fahrten für die Tommys und einigen Sonderfahrten, hatte er endlich etwas zum Haushalt der Eheleute beisteuern können. Zu dieser Zeit muss auch Melanie gezeugt worden sein.
Melanie wuchs in eher ärmlichen Verhältnissen auf. Als der Vater erkannte, dass er mit anderen Männern ob seines fehlenden Beines nicht mithalten konnte, wurde er depressiv, zog sich immer weiter zurück, sprach nur noch wenig und verließ irgendwann nicht mehr die Wohnung. Hilde musste den Lebensunterhalt in den schwierigen Nachkriegszeiten irgendwie aufbringen, schlichtweg um die Wohnung halten und genügend zum Essen kaufen zu können. Sie fand zwar einen Job als Verkäuferin, aber es reichte vorne und hinten nicht.
An einem späten Vormittag, Melanie war gerade aus der Schule und vom Einkaufen zurück, um das Mittagessen vorzubereiten, fand die Elfjährige ihren Vater im Bett schlafend vor. Sie hatte vergeblich nach ihm gerufen und als sie näher ans Bett trat und die weit aufgerissen Augen sah und seine kalte Hand spürte, wusste sie, dass er tot war.
Friedrich war durch eine Bronchitis zusätzlich geschwächt und hatte Schmerz- und Schlafmittel, die er wegen seiner Phantomschmerzen und Depression bekam, gehortet und am Vorabend mit reichlich Hochprozentigem eingenommen. Melanie und Hilde hatten die Wohnung am Morgen in dem Glauben leise verlassen, dass der Vater und Ehemann, wie schon in den letzten Wochen, noch am Schlafen sei.
Bereits vier Wochen nach der Beisetzung füllte sich der Küchentisch wieder regelmäßig mit Besuchen von englischen Soldaten oder Männern aus der Behörde und - immer gern mit dabei - Hildes Schwester Clara. Die Männer aus der Behörde hatte Clara eingeladen. Die fast zwölfjährige Melanie wurde, wenn die Besuche schon am Nachmittag begannen und Musik aus dem Radio in der Küche den Geräuschpegel der schwatzenden und Späße treibenden Gäste nach oben trieb, von „Tante Clara“ zum Kippensammeln auf die Straße geschickt. Melanies Mutter und Tante Clara waren Kettenraucherinnen und an Tabak ranzukommen, war in der Nachkriegszeit nicht leicht.
Melanie schlich sich am späten Abend hinauf auf den Dachboden, wo sie ungesehen von den Gästen und der Mutter in der Wohnung ihre Ruhe hatte und sich mit Decken und Kissen eine kleine Bleibe geschaffen hatte, wo sie so schnell niemand aufsuchen oder finden würde.
Irgendwann blieb einer der Gäste über Nacht und Melanie hörte das Stöhnen der Liebenden im Nachbarraum. Diesmal war es kein Tommy, sondern ein schmächtiger Kerl mit freundlichen Augen und mit viel Humor, der gerne Witze erzählte und sich freute, wenn auch Melanie lachte. Hilde und der Schmächtige wurden ein Paar, aber wohnten weiter und zum Glück, wie Melanie fand, in getrennten Wohnungen.
Die Villa
Als Melanie im Alter von 14 Jahren die Volksschule abschloss, begann sie auf Weisung der Mutter und gegen die Empfehlung der Lehrerin eine Lehre als Hauswirtschafterin. Die Lehrerin sah, dass dieses Mädchen fleißig war und stets genügend Ehrgeiz aufbrachte, um mehr aus sich zu machen. Sie hatte eine schöne Handschrift und bewies beim Handwerkeln großes Geschick. Melanie hätte durchaus eine höhere Schule besuchen können, aber die Mutter sah sich mit der Finanzierung und Begleitung ihrer Tochter völlig überfordert.
Ihre erste Stelle in der Villa des Arztes Alfred Terjohn und der Familie dessen erwachsenen, mit einer Fabrikantentochter verheirateten Frau des Sohnes Jonathan fühlte sich dennoch für Melanie zunächst an wie eine Befreiung, da sie nicht mehr zu Hause schlafen musste, sondern in einer Dachkammer der Vorortvilla ihre Ruhe fand und nicht mehr den allabendlichen Trubel in der mütterlichen Wohnung anhören musste, der ihr oft den Schlaf geraubt hatte. Nur gelegentlich hörte sie aus der Wohnung des Arztes seltsame Geräusche, aber dabei dachte sie sich nicht viel. Der alte Herr konnte ja schließlich in seiner Wohnung machen, was er wollte; es interessierte sie nicht.
In der zweiten Etage des Hauses lebte also der 47-jährige Arzt Alfred Terjohn, Sohn eines schon früh verstorbenen, sehr vermögenden Bankiers aus Süddeutschland und einer im Krieg getöteten Mutter mit schwedischen Wurzeln. Er war als noch junger Mann im Juni 1947 schwer verletzt aus dem Krieg zurückgekehrt. Er sprach nie darüber, wie es zu den Verletzungen gekommen war, erholte sich aber recht rasch, verbrachte dabei die meiste Zeit im Haus und kam dann irgendwann wieder einer ärztlichen Tätigkeit im nahgelegenen Krankenhaus nach und widmete sich in seiner Freizeit der Beschäftigung mit Börsenkursen oder unternahm längere Reisen.
Alfred hatte bereits 1937 vor dem Krieg, noch als Medizinstudent eine junge Krankenschwester geschwängert, deren Sohn von ihm alimentiert wurde. Die Krankenschwester wechselte in eine Arztpraxis. Sie kam so der Entlassung des Vaters zuvor, der sicherlich mit Konsequenzen des damaligen Chefarztes zu rechnen gehabt hätte. So blieb ihre Schwangerschaft eine Angelegenheit zwischen Alfred und ihr. Allerdings hatte sie Alfred gegenüber vor ihrer Kündigung gedroht, wenn er nicht für den Unterhalt des Jungen sorgen würde, dass sie dann seinen Fauxpas ans Licht bringen würde. Da bereits Gerüchte im Umlauf waren, gab der Medizinstudent dem Verlangen der Krankenschwester nach und zahlte in den folgenden Jahren für sie monatlich eine auskömmliche Summe.
Alfreds Mutter wollte er erst nicht einweihen, aber als diese merkte, mit welchen Summen Alfred das Vermögen der Familie monatlich belastete, musste er das Ganze am Ende doch zugeben. Die Mutter gab daraufhin ihren Segen zu dieser Liaison und freute sich insgeheim darüber „Oma“ geworden zu sein. Ohne wiederum Alfred in Kenntnis zu setzen, hielt die Mutter bis zu ihrem Versterben im Winter 1944, also bis zum Ende des Krieges noch Kontakt zur Mutter ihres Enkelsohnes.