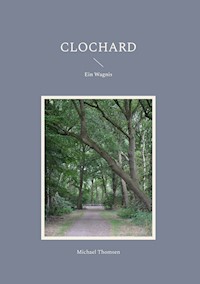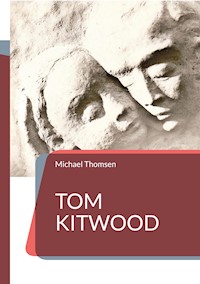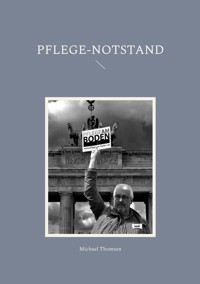
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Michael Thomsen schildert im ersten Teil des Buches seine persönlichen und subjektiv gefärbten Erfahrungen über einen Zeitraum von 1988 bis 2023, was den Gegenstandsbereich Pflegenotstand angeht. Im zweiten Teil hat er diverse Publikationen und Notizen unterschiedlicher Couleur ungefähr chronologisch zusammengestellt; ein Mix aus Briefen, Gedichten, Fachartikeln und Statements zum berufspolitischen Geschehen. Möglicherweise eine Fundgrube für historisch Interessierte und Pflegewissenschaftler für Ihre Arbeiten zum Themenkomplex!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Erinnerungen
Schriften und Artikel ab 1993
Artikel, Schriften und Essays ab 2011
Artikel, Schriften und Briefe ab Mitte 2015
Tag der Pflege – zu Grabe getragen?
Corona-Zeiten
Die Zukunft der Pflege – eine Katastrophe?
Zum Autor
Literatur
Vorwort
Ich schildere im Folgenden meine persönlichen und subjektiv gefärbten Erfahrungen über einen Zeitraum von 1988 bis 2023, was den Gegenstandsbereich „Pflegenotstand“ angeht. Als ein mit einer Krankenschwester verheirateter Intellektueller, spät und eher verlegenhaltshalber in den Pflegeberuf Hineingestossener, mögen vielleicht historisch Interessierte und Pflegewissenschaftler eine kleine Fundgrube finden für Ihre Arbeiten zum Themenkomplex!
Im ersten Teil des Buches erzähle ich von meinen persönlichen Erfahrungen und Schlussfolgerungen. Daran anschließend habe ich diverse Publikationen und Notizen unterschiedlicher Couleur ungefähr chronologisch zusammengestellt; ein Mix aus Briefen, Gedichten, Fachartikeln und Statements zum berufspolitischen Geschehen.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Michael Thomsen, im April 2023
Erinnerungen
Im Jahr vor dem Mauerfall begann ich meine Ausbildung zum Krankenpfleger. Ich war damals schon 32 und hatte nach vergeblichen Versuchen als Assessor des Lehramts an Gymnasien in den Schuldienst zu kommen, mich dafür entschieden als Vater zweier Kinder einen sicheren Arbeitsplatz im Gesundheitswesen zu finden.
Nach meinem zweiten Staatsexamen im Jahr 1986 fasste ich im Mai 1988 dann ernsthaft den Gedanken, eine Ausbildung als Krankenpfleger zu absolvieren. Im Schuldienst gab es damals kaum eine Chance, mit bestimmten Fächerkombinationen angenommen zu werden. Heute fehlen auch aus meiner Generation Lehrer. Aus damaliger Sicht versprach das Gesundheitswesen doch eine gewisse Arbeitsplatzsicherheit und ich fühlte mich dem auch gewachsen und konnte es mir gut vorstellen. Schon die „Pflege“ meiner beiden Kinder (Jahrgang 1983 und 1986) machte mir Freude und erfüllte mich.
Ich schrieb das Arbeitsamt an und bat um Vermittlung, aber von da kam so gut wie nichts Brauchbares zurück. Auch sah man keine Möglichkeiten der Unterstützung hinsichtlich einer solchen „Umschulung“. Erste Antworten bei Krankenpflegeschulen und Krankenhäusern ließen direkt oder zwischen den Zeilen durchblicken, dass man mich für diese Art der Tätigkeit „überqualifiziert“ hielt.
Heute, über 36 Jahre später, ist mir klar, dass gerade in dieser Haltung ein schwerwiegender Fehler der gesamten Pflegebranche gelegen hat und wohl noch immer liegt. Man betrachtete sich selbst als Berufsgruppe eher als Appendix der Medizin, irgendwie Funktion besitzend, aber doch nicht wirklich systemrelevant. Pflegen als traditionell weibliche Aufgabe war sozusagen der Medizin untertan und wurde nicht als eigene Profession verstanden. Pflegen kann eigentlich jeder, dachten viele auch innerhalb der Berufsgruppe! Und dazu reichte ein Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife.
Aber Abiturienten oder Studenten gar, das passte nicht ins Klischee. Was an Wissen für die Pflegekräfte nötig war, wurde in der Regel von Medizinern unterrichtet. Am Ende führte diese, gegenüber Akademikern geübten Vorbehalte von Seiten der Pfleger und Schwestern und ihrer damaligen Eliten dazu, dass dort, wo über die reine Pflegetätigkeit hinaus, besondere Qualifikationen, Talente und Kompetenzen notwendig waren, Menschen aus dieser Branche hin gespült wurden, die diesen Aufgaben gar nicht gewachsen waren, und die, welche es waren, verließen relativ früh den Beruf ganz oder flohen aus den praxisnahen Teilen in das Studium der Medizin oder sie schlugen eher akademische Richtungen ein. Es bildete sich – zumindest praxisnah – nie eine echte Elite aus, die sich gegenüber anderen Berufsgruppen, insbesondere gegenüber den Medizinern, oder gegenüber politischen Entscheidungsträgern, rhetorisch oder intellektuell durchsetzen oder zumindest behaupten konnte.
Zwar gab es Ende der Achtziger erste Studienfächer und erste Pflegeprofessor*innen, aber die brauchten erstmal ein paar Jahre, um ihr Studienfach abzustecken. Viele hoben dabei ab und verloren die Tuchfühlung zur Basis und pflegten eine Art Elfenbeinprofession. Später gab es erste Forschung, allerdings blieb diese sehr lange stark der sozialwissenschaftlichhermeneutischen Wissenschaftsverwandten verpflichtet mit vorrangig dialogischer Forschungsmethodik. Die Schnittstellen zu den Naturwissenschaften und der Medizin wurden nur zaghaft befüttert. Was aber fast bis heute kaum berücksichtigt wurde, waren Wirtschaftswissenschaften und die Fragen rund um Arbeitsorganisation und Arbeitsplatzgestaltung.
Überhaupt stand überall in den Veröffentlichungen der Pflege-Branche „der Patient im Mittelpunkt“! Aber das Geschehen zwischen „Patient“ und Pflegekraft, die Interaktion also und die Frage nach den Ressourcen der Pflegenden, ihre Work-Life-Balance kamen erst zur Sprache, als es in dem und für den Beruf längst zu spät war. Stellenabbau und zunehmende Arbeitsbelastung hatte einen zunächst unauffälligen und dann ab etwa 2010 evidenten Berufsausstieg der Pflegenden nach sich gezogen.
Ich bewarb mich also um eine Krankenpflege-Ausbildung, erhielt aber zunächst – wie gesagt - nur Absagen. Ich hatte damals fünf Krankenpflegeschulen angeschrieben. Vier von fünf hatten abgelehnt! Erst das Landeskrankenhaus, das bereits Erfahrung hatte mit „Akademikern“ und von Zuschüssen vom Arbeitsamt profitierte, hatte dann eine Zusage erteilt. Und so begann ich im Herbst 1988 meine Ausbildung zum Krankenpfleger an der Krankenpflegeschule des Landeskrankenhauses.
Ausbildungszeit
Nach den ersten Wochen theoretischen Unterrichts mit viel Hygiene und Paragraphen kam ich auf die damalige Aufnahmestation, wo die schwersten, meist hoch aggressiven und schwer und akut erkrankten Patienten, aufgenommen wurden.
Diese Station war damals eine geschlossene, reine Aufnahmestation, direkt neben einer „Intensivstation“ für besonders schwere Fälle. Dort kamen meist harmlosere Fälle von selbstgefährdeten oder fremdgefährdenden Menschen auf mit Suchterkrankungen, allerart Psychosen, hochdepressiven Menschen, Manikern und oft Suizidgefährdete und Verwahrloste, eigentlich das komplette Spektrum. Dort war es wichtig, zu beobachten und gut zu kommunizieren.
Hin und wieder begleitete ich ausgesuchte Patienten zu einem kurzen Spaziergang nach draußen; dabei besuchten wir auch ein kleines Café mit Einkaufsmöglichkeiten am Rande des Krankenhausgeländes. Zum 51-jährigen Dieter, der schon sehr lange auf der Station war und stark depressiv war hatte ich eine recht gute Beziehung aufgebaut. Dieter kam morgens nicht aus dem Bett und war sehr schweigsam, er sprach selten, aber es gelang mir doch hin und wieder ein kurzes Gespräch mit ihm zu führen. Manchmal kam er den ganzen Tag nicht aus dem Bett; alle Versuche ihn zum Aufstehen zu bewegen blieben dann erfolglos. Wenn es ihm besser ging, durfte ich ihn dann zur kurzen Ausflügen nach draußen begleiten. Einmal kamen wir zurück und er war erschöpft und wollte in der Eingangshalle kurz ausruhen. Ich hatte einen Moment lang meinen Blick auf ein Ankündigungsplakat gerichtet und als ich mich umdrehte, war Dieter weg. Ich geriet sofort in Panik und schaute überall umher, aber ich fand ihn nicht. Erst Minuten später fand ich ihn in einem Verwaltungsgang, wo er auf einem Besucherstuhl saß, und mein Herankommen beobachtete. Wir beide taten so, als sei nichts geschehen. „Ach, hier bist du!“ sagte ich. „Wollen wir weiter?“ fragte ich nach außen gelassen und ruhig wirkend und war am Ende froh, dass er mir nicht „entwichen“ war.
Ich zeigte neben ein wenig Talent auch die Bereitschaft, mit Mimik und Gestik zu sprechen. Das kam mir zugute, als ich einmal einen jungen Taubstummen (Interessant, dass ich mich an sein Gesicht und viele Begegnungen, nicht aber an seinen Namen erinnern kann!) betreuen durfte, dessen Mimik und Gestik ich mich immer bemühte, richtig zu deuten. Er konnte auch etwas von den Lippen ablesen und die Verständigung klappte ganz gut, so dass ich manchmal gegenüber anderen Pflegern und dem Arzt wie ein „Übersetzer“ fungierte. Allerdings neigte er zu sehr impulsivem und hochaggressivem Verhalten, besonders, wenn er Alkohol konsumiert hatte. Er erhielt auch Ausgang und musste mit Erschrecken erleben, wie er von der Feuerwehr und Polizei einmal nach einem Ausgang eingewiesen wurde. Ich wurde hinzugerufen als schon vier oder fünf kräftige Pfleger auf ihm lagen, um ihn zu fesseln. Das bewirkte bei mir gefühlsmäßig eine seltsame Mischung aus Mitleid, Unverständnis, Ohnmacht und Unsicherheit. Dabei sah ich auch wie bei einem Pfleger die Brille zu Bruch ging und ich werde das Gefühl bis heute nicht los, dass damals die Vorgehensweise der Ärzte und Pfleger unverhältnismäßig, zumindest inadäquat gewesen war.
Damals erprobte man später bei diesm Patienten ein Medikament, dass bei Aufnahme von Alkohol umgehend Brechreiz herrufen sollte. Ob es gelungen war, habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich traf ihn aber zwei Jahre später in einem offenen Langzeitbereich wieder und wir freuten uns sehr, uns da wieder zu sehen.
Die anderen Pfleger waren überaus unterschiedlich. Vom älteren, fast phlegmatischen „Wärter“, der mit den Patienten nur das Nötigste sprach und der mich immer wieder von den Patienten aborderte, um mich in irgendein belangloses Gespräch zu verwickeln, bis hin zum einfühlsamen und um Verständnis bemühten Kollegen, konnte ich alle Facetten der Betreuung feststellen. Die meisten wurden nicht meine Vorbilder. Besonders ärgerten mich Pfleger, die immer wieder die Patienten provozierten und sie nicht als Menschen wahrnahmen, sondern als Opfer ihrer Erkrankung, über die sie sich nicht selten lustig machten.
Da war zum Beispiel der etwa 45-jährige Heiko, ein etwas übergewichtiger Schizophrener, der fiel herumlief und unzählige, schwer zu deutende, skurril-chaotisch wirkende Bleistiftzeichnungen anfertigte, die unter anderem die „Menschenmachmaschine“ darstellen sollten. Gelegentlich steigerte er sich derart in seinen Wahn, dass er unerträglich und ein wenig übergriffig wurde, was für das Pflegepersonal nicht gerade angenehm war, weil er zudem wegen der hochdosierten Neuroleptika stark sabberte und beim Sprechen Speichelfetzen von sich stieß. Manchmal steigerte er sich derart, dass er nicht mehr zu führen war und begann zu schreien. Leider reagierten manche Pfleger dabei nicht deeskalierend, sondern feuerten sein Befinden mit abschätzigen Sprüchen noch weiter an, sodass es am Ende zu massiven Handgreiflichkeiten kam.
Bei einem seiner „Schübe“, so nannten es dann die Experten um mich herum, wurde auch Heiko gefesselt und ans Bett gefesselt. Ich sah dem Ganzen eher tatenlos zu und richtete nur selten, eher freundlich das Wort an Heiko. Heikos Medikation wurde erhöht, er wurde quasi abgeschossen damit.
Als ich nach dem Wochenende am Montag zum Spätdienst kam und sein Zimmer betrat, um nach ihm zu sehen, lag er noch im Bett, zwar nicht mehr angebunden, mit Bauchgurt fixiert, aber sichtlich verändert und ohne Anzeichen, die auf psychotisches Erleben hindeuten würden. Nach ein paar Wortwechseln sprach er mich folgenden Worten an: „Übrigens Michael, das fand ich sehr gut von Dir! Du hast mich fair behandelt und warst gut zu mir.“ Er meinte den Vorfall vor drei Tagen, der zu seiner Fixierung geführt hatte. Die Medikamente hatten ihre Wirkung. Aber ich war völlig konsterniert. Denn ich dachte, dass er sich – wahnbedingt – gar nicht genau daran erinnern würde, dass er es gar nicht könne.
Im Nachhinein wurde mir klar; er ist nicht dement, sondern wird heimgesucht von Wahrnehmungen, die nur er hat, die andere nicht teilen, geschweige denn nachvollziehen können.
Ich hatte ihn im Gegensatz zu den anderen Pflegern auf dem Höhepunkt seines Wahnerlebens ernst genommen. Es waren nicht einfach „Einbildungen“, sondern was er innerlich erlebte, war – für IHN – real. Und das hatte ich intuitiv gelten lassen, dafür dankte er mir. Aber was mich besonders beeindruckte und mir das Verständnis für Psychotiker, speziell aus dem schizophrenen Formenkreis noch erweiterte, war die Erkenntnis, dass er sich an die Details noch erinnern konnte, er hatte keine Amnesie, sondern konnte durchaus das Reale neben dem Wahnhaften erinnern.
Ich muss ihm Nachhinein noch für diese Erfahrung danken, denn ich habe mich später im Umgang mit Psychotikern bemüht, sie auch im schlimmsten Zustand noch ernst zu nehmen und es nicht an Wertschätzung fehlen zu lassen.
Auf der Akutaufnahmestation sah ich auch meinen ersten Dekubitus. Ein relativ junger Mann, der ab der Lendenwirbelsäule gelähmt war und im Rollstuhl saß, kam aus irgendeinem Grund zur Aufnahme. Er hatte kein Gefühl unterhalb seines Bauchnabels und ich glaube, er war auch mit einem transurethralen Katheter versorgt. Als ich ihn am Abend versorgen wollte, sah ich am Steiß eine etwa 10 Zentimeter große, fast kreisrunde Wunde, etwa einen Zentimeter tief und er schrie gleich: „Scheiße, ich hab´n Deku. So ein Mist!“ Und er fluchte, was das Zeug hält. Als ich den Stationsleiter dazu rief, merkte ich bei ihm gleich eine gewisse Verunsicherung, denn behandlungspflichtige Wunden waren auf dieser Station eher selten. Solgleich wurde ein weiterer „Fachmann“, sprich Pfleger, hinzugerufen, der „Eisen und Fönen“, anschließend Wundränder mit Mercurochrom behandeln und mit Mull und Fixomull stretch abdecken, anordnete.
Zu dieser Zeit waren die pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse ausnahmsweise mal weiter als die Medizin, denn die Mediziner ordneten genauso an und die meisten Pflegekräfte handelten danach, noch Jahre später! Selbst zwei Jahre später auf der Inneren im Marienhospital wurde so oder ähnlich verfahren, es gab keinen einheitlich, wissenschaftlich fundierten Standard dazu. Noch im Jahr 2001 als ich als Pflegedienstleiter im Altenheim arbeitete, ordneten Ärzte noch Mercurochrom an, obwohl schon längst die unter Einhaltung von Hygienerichtlinien praktizierte feuchte Wundbehandlung bei tieferen Wundgeschwüren Stand des Wissens war.
Und obwohl es bereits Wundmanagement gab, vor allem betrieben durch Firmen, die entsprechende Präparate und Methoden schulten und anboten, und die wissenschaftlichen Erkenntnisse bereits lange bestanden, hinkte die Praxis dieser „Theorie“ weiter deutlich hinterher. Ja, ich erlebte bei meinen jeweiligen Einsätzen auf verschiedenen Stationen der Krankenhäuser nicht nur einen zunehmenden Angebotsmix hinsichtlich der Therapieoptionen, sondern vor allem stellte ich fest, dass in der Pflege jeder machte, was er wollte und es immer vom Fortbildungsgrad und Engagement der jeweiligen Stationsleitungen abhing, welcher „Empfehlung“ man gerade folgte.
Zum 1. Mai 1989 sollte ich auf einer Station in der Geriatrie eingesetzt werden, im Prinzip ein Langzeitbereich. Ich stellte mich etwa 14 Tage vorher auf der Station kurz vor und erschien überpünktlich am 1. Mai um 06:00 Uhr auf der Station. Man gelangte dorthin über einen zentralen Fahrstuhl. Zunächst einmal trafen nach und nach die Pflegenden der Station ein, wir waren am Ende fünf oder sechs Personen; ich war quasi zusätzlich da. An eine Art Übergabe kann ich mich nicht erinnern, nur, dass wir im Stationszimmer lange zusammensaßen und einige rauchten. Vor der offenen Zimmertür zum Flur hin war eine Kordel gespannt, die den Patienten und Besuchern signalisieren sollte, dass ein weiteres Eintreten nicht erwünscht war. Das anwesende Personal unterhielt sich etwa 40 Minuten lang und irgendwann blies jemand zum Aufbruch.
Ich wurde angewiesen aus einem Drei-Bett-Zimmer Frauen zum Duschen zu begleiten. Es gab im Übrigen auch Zimmer mit noch mehr Patienten. Die Patientenzimmer waren in der Regel nach außen ausgerichtet. Zentral waren die meisten Arbeits- und Vorratsräume. Am Ende des Flures ging es kopfseitig ins Bad, das an der anderen Seite eine weitere Tür hatte, die auf den Flur führte, der an der anderen Seite der Station an Patientenzimmern und Dienstzimmer vorbeiführte. Dabei kreuzte man dann den Verbindungsflur, der auch den Einlass in einen der Fahrstühle ermöglichte, wenn man den dazu notwendigen Schlüssel besaß.
Ich betrat also das Zimmer, in dem es stockdunkel war. Auch das eingeschaltete Licht erhellte kaum den Raum. Drei Betten standen links, zueinander parallel und hintereinander. Bei allen waren die Bettgitter hochgezogen und alle drei waren mit einem Bauchgurt fixiert. Die Frauen hatten lediglich Flügelhemdchen an. Die letzte der drei Frauen hatte einen braunverschmierten Mund und ebensolche Hände. Sie aß gerade genüsslich ihren eignen Kot.
Ich hatte keine Ahnung, wie ich die Frauen aus dem Bett kriegen sollte, da sie ja fixiert waren und mit Bauchgurten hatte ich es bisher nicht zu tun gehabt. So verließ ich das Zimmer wieder und suchte nach einem der Pfleger*innen, fand auch eine Schwester, die gerade mit einer Windel über den Flur ging und sagte ihr, dass ich gar nicht wüsste, wie ich die Frauen da aus dem Bett kriege. „Ach so! Ja, das kannst du ja auch noch nicht wissen.“ sagte sie, holte einen Magnetschlüssel aus dem Dienstzimmer und zeigte mir, wie man das Magnetschloss am Bauchgurt öffnet. Sie zig sich Gummihandschuhe an entfernte der Frau am Ende den Kot aus den Händen und aus dem Mund, wischte mit Krepppapier ab und wies mich an, der Frau aus dem Bett zu helfen und sie dann zum Flur zu begleiten. Ich fand keinen Morgenrock oder Hausschuhe. Sie musste, nur mit dem Flügelhemdchen bekleidet, das ich mit der rechten Hand hinten geschlossen hielt, halbnackt den Flur entlang gehen. Dabei war ich sehr erstaunt, dass sie doch recht sicher lief.
Als ich die Badezimmertür öffnete, war ich zunächst erstaunt über die Größe des Raumes und blickte gebannt auf einen der Pfleger, der einer völlig entblößten Frau Waschschaum ans Gesäß und vorne an die Scham sprühte und mit einem Schlauch abduschte. Der Pfleger hatte eine lange, weiße Gummischürze und Gummistiefel an. Mein Blick wanderte unterdessen verwundert nach rechts, wo ein weiterer Pfleger einer alten Frau Unterwäsche anzog.
„Du kannst sie schon mal ausziehen!“ rief mir der Gummistiefelträger zu. Mir hatte es die Sprache verschlagen. Wortlos und verirrt umherblickend, löste ich die Schleife am Nacken der Frau und behielt das Flügelhemd etwas ratlos in der Hand. Der andere Pfleger zeigte mit dem Finger auf ein Gestell auf Rädern, an dem zwei weiße Stoffsäcke hingen. Oben auf war ein Plastikdeckel. Ich ging hin, hob den Deckel und warf das Hemdchen hinein. Unterdessen hatte sich der Gummistiefelträger die Frau geschnappt, die ich gebracht hatte. Sie war ein paar Meter weggelaufen und er begleitete sie nun zum Schlauch und begann auch sie abzubrausen. „Du kannst schon die nächste holen“, rief er mir zu. Und so holte ich eine Frau nach der anderen in diese „Wasch-Straße“!
Es gab auch ein paar bettlägerige Frauen, die von den Schwestern im Bett gewaschen und „gewindelt“ wurden. Teilweise zeitgleich begannen schon andere Pflegende damit, das Frühstück zu reichen. Lauwarmer, gesüßter Milchkaffee, in den die mit Butter und Marmelade beschmierten Brotstückchen eingetunkt wurden. Das Ganze dauerte etwa ein und eine halbe Stunde, danach versammelten sich die Pflegenden gegen 09:15 Uhr wieder im Dienstzimmer, um Kaffee zu trinken und zu rauchen. Ihre meist privaten Gespräche wurden immer wieder unterbrochen von einzelnen Patienten, die die Kordel beiseite nahmen, um das Dienstzimmer entweder mit einem unverständlichen Gemurmel oder stumm zu betreten. Entweder wurden sie angeschnauzt, das Zimmer zu verlassen oder mit sanfter Gewalt hinausgeführt.
Zwischendurch gab es Medikamente. Rote Säfte oder Tropfen in kleinen Metallbechern meist. Atosil, Haloperidol waren die meist vergebenen. Nach dem Mittagessen aus der Zentralküche gab es noch vor Ende der Schicht eine Runde Windelwechsel. Kontakt zu den Patienten wurde selten aktiv aufgenommen; meist reagierte man auf die extremen Läufer oder schaute, wer da wieder schrie oder gefallen war.
Ich blieb auf dieser Station etwa drei Monate und passte mich an. Gut waren Schüler, die schnell waren und erzählen oder (den Kolleg*innen) zuhören konnten. Einmal machten wir sogar einen kleinen Spaziergang mit ein paar Patient*innen in ein nahe gelegenes Waldstück. Leider waren regelmäßige Ausflüge wegen der geringer werdenden Personaldecke nicht möglich. Der Ärztliche Direktor hatte vor Jahren verfügt, dass es keine geschlossenen Gärten mehr geben sollte. In diese Gärten hätten aber die Patienten viel öfter, auch bei geringerer Personaldecke, hinauskönnen und hätten sich freier an frischer Luft bewegen können. Der Direktor aber wollte nicht, dass die Öffentlichkeit den Eindruck bekam, man würde dort die Patienten die Freiheit nehmen.
Als ich einmal im Treppenhaus einer Krankenschwester von einer anderen Station begegnete, sprach diese mich an: „Ach du bist der, der sagt: ´Wer schreit hat Unrecht! ´ Na, das lass mal nicht den Direktor hören.“ Sie ließ mich leicht verblüfft mit dieser Andeutung allein. Tatsächlich hatte ich diesen Spruch wohl einmal im theoretischen Unterricht gemacht und das hatte sich dann im Haus verbreitet.
Bei diesem Ausflug saßen zwei der fünf Frauen für eine Pause auf einer Parkbank. Eine der beiden aß eine Banane und schaute mich dabei an. Ich wurde wiederum von den beiden Pflegern beobachtet. Nun hatte die Frau keine Zähne und sie hatte auch kein Gebiss, schob daher die Banane ein paar Mal genussvoll im Mund rein und raus. Ich selbst dachte mir gar nichts dabei, zumal ich damals noch in keiner Weise vertraut war mit so etwas wie oraler Befriedigung. Auf jeden Fall sah ich im Augenwinkel, wie sich die beiden Pfleger kurz grinsend anschauten. Das Ganze ging noch eine Weile, bis die Frau die Banane schließlich doch verschlang.
Ich fragte einen der beiden Tage später am Ende eines Spätdienstes, warum sie denn gegrinst hätten. Daraufhin erzählte mir der Pfleger, dass die besagte Frau im Nachtdienst mit einem Pfleger Oralverkehr gehabt habe. Dieser sei dabei beobachtet worden und wurde strafversetzt. Sie deuteten also das Gebaren der Frau gewissermaßen als eine Art „Anmache“ mir gegenüber. Deswegen hätten sie grinsen müssen. Im Nachhinein wunderte ich mich über die Gelassenheit der beiden angesichts des aus meinen Augen unverzeihlichen Fehlverhaltens des Nachtpflegers und ich dachte, was wohl sonst so noch in diesen Psychiatrien abging!
Meine erste Begegnung mit dem Tod
Wegen eines personellen Engpasses auf einer anderen Station der Geriatrie sollte ich bei einem Frühdienst einspringen und eine Krankenschwester unterstützen. Ich begleitete sie gleich nach der Übergabe und dem morgendlichen Raucherpalaver auf ein Zweibett-Patientenzimmer. Dort lag ein alter Mann, das andere Bett war nicht belegt. Beim Nähertreten blieb sie plötzlich stehen und hielt etwa zwei Meter vor dem Bett inne, starrte auf den Mann, drehte sich kurz zu mir um und sagte: „Du, ich glaub, der is hinne!“ Dann drehte sie sich zurück in Richtung Zimmertür und sagte beiläufig: „Du kannst ja schon mal anfangen. Ich komm gleich wieder.“
Sie verließ das Zimmer und ich armer Unterkursschüler stand wie angewurzelt da. Völlig perplex! Noch nie in meinem ganzen Leben hatte ich – außer meiner Tante Helga kurz vor der Beerdigung als kleiner Junge aus zehn Meter Entfernung – einen Verstorbenen gesehen. Tatsächlich gruselte es mich ein wenig und ich traute mich nicht, ihn anzufassen, sondern starrte wie gebannt, ob nicht doch ein Lebenszeichen zu erkennen wäre. Auch hatte ich keine Ahnung, was, wie und womit ich anfangen sollte. Ich empfand die Situation als völlig irreal und traute mich kaum näher heran, sondern suchte irgendeinen Anlass, etwas zu tun, aufzuräumen oder so etwas. Warum war die Schwester rausgelaufen? Sollte man nicht erst mal prüfen, ob der Mann wirklich tot war?
Ich muss so ein paar Minuten gestanden haben. Vielleicht war ich auch ein paar Schritte hin und her gegangen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war ich froh, als die Schwester dann zum Glück doch recht schnell wieder da war, einen Kollegen im Schlepptau. Wenig später trat dann auch der Stationsarzt hinzu. Und nun wurde endlich für mich umdisponiert. Anstatt die Situation für mich dann wiederum als Lernchance zu nutzen und mich erklärend und behutsam miteinzubeziehen, wurde kurzerhand entschieden, dass ich anderer Stelle doch nützlicher sei und woanders helfe.
„Du, ich glaub, der is hinne!“ 23.10.1989, ich werde den Namen meines ersten Toten nicht vergessen. Der Umgang mit Sterben und Tod im Krankenhaus, damals empfand ich das alles furchtbar und menschenunwürdig!
Ich erlebte während meiner Ausbildungszeit noch weitere „befremdliche Situationen“, die ich aber hier mit Rücksicht auf meine damaligen Kolleg*Innen und auch auf mich selbst nicht weiter ausbreiten möchte.
Ich absolvierte mein Examen am 19. September 1991 mit der Bestnote 1,0 im mündlichen, schriftlichen und praktischen Teil.
Erste Berufserfahrungen als Fachkraft
Ich hatte mich nach Ende meiner Ausbildung im Stadtkrankenhaus beworben. Gleichzeitig hatte ich mich an der Universität für ein berufsbegleitendes Studium eingeschrieben. „Lehrpersonen an Schulen des Gesundheitswesens“ nannte sich der Studiengang unter der Leitung von Jutta Dornheim. Ich wollte später irgendwann mal in die „Unterrichtspflege“, also in Krankenpflegeschulen unterrichten. Die Veranstaltungen fanden meist am Wochenende statt und um alles unter einen Hut bringen zu können, bat ich um einen 30-Stunden-Wochen-Vertrag. Ich musste zwar auch an Wochenenden arbeiten, hatte aber meist freitags frei.
Die Stationsschwester der internen Station im Klinikum war so alt wie ich und hatte eine sehr gut organisierte Einheit und ein gutes Team geschaffen, zwei Pflegehelfer, und sieben Examinierte. Die examinierten Pflegekräfte mussten nicht nur reihum Nachtdienst tun, sondern auch reihum den monatlichen Dienstplan schreiben. Dadurch haben alle viel gelernt und viel mehr Verständnis für die Nöte und Belange der Stationsorganisation und die Interessen der Mitarbeiter entwickelt. Echtes Teamwork eben! So waren am Ende alle relativ gleich erfahren und wenn einer mal ausfiel, dann gab es eben immer kompetenten Ersatz. Auch Anleitung fand statt. Meine Arbeit wurde gezielt beobachtet und bewertet.
Seit diesen Erfahrungen bin ich ein Skeptiker hinsichtlich eines Primary Nursing.
Das Arbeiten war anstrengend und immer von Zeitnot geprägt. Es verging kaum ein Dienst, nach dem man nicht das Gefühl hatte, etwas vergessen zu haben oder irgendeinem Patienten nicht wirklich gerecht worden zu sein. Auch staunte ich über das, vor allem zeitliche Pensum der Ärzte. Viele meiner damaligen Kollegen teilten mir diese Erfahrungen und die Unzufriedenheit. Aber leider organisierten sich kaum Pflegekräfte in der Gewerkschaft, den meisten Schwestern war dies ehedem als „Diakonissen“ nicht erlaubt.
Sehr gut in Erinnerung habe ich noch das moderne Kommunikationssystem. Jedes Zimmer verfügte über eine Gegensprechanlage. Wenn jemand, sei es Patient, Arzt oder Pfleger/in, einen Ruf absetzte, lief der in einer Zentrale auf und wurde von dort weitergegeben. Ich empfand das als sehr hilfreich, denn so war man in der Regel bei Notfällen oder Hilferufen schneller im Zimmer oder konnte die Dringlichkeit abschätzen. Das ersparte auch viele Wege. Mich wundert im Nachhinein, dass damals die „Datenschützer“ Sturm gelaufen sind. Darüber hinaus gab es einen Bettendienst und später einen Hol- und Bringe-Dienst, was beides das Pflegepersonal spürbar entlastete.
Besonders in Erinnerung sind mir auch die Nächte. Ich habe die Station später immer als „Turbo-Geriatrie“ bezeichnet. Denn auffällig war schon, dass in der überwiegenden Mehrzahl sehr alte Menschen zur Behandlung (Rektoskopie, EKG, Sono-Abdomen, Gastroskopie, u.v.m.) kamen. Und als sehr belastend empfand ich damals – und noch heute – das, vor allem nächtliche – Sterben. Nicht nur einmal musste ich dem Frühdienst mitteilen, dass in meiner Nacht jemand verstorben war, meist ohne dass Angehörige zugegen waren, um sie zu begleiten. Ich musste alten Frauen beim Sterben zusehen, denn meist kamen die Ärzte dann doch zu spät. Ich musste sehen, wie ein frischer Schlaganfall-Patient aus dem Bett über das hochgezogene Bettgitter stürzte, wie bei einem jungen Mann nicht erkannt wurde, dass er tablettenabhängig war und fast starb, wie mir eine Frau im Nachtdienst beim Drehen in die Arme fiel, als ich zufällig neben dem Bett stand, wie ein junger Mann, den ich noch kannte vom Landeskrankenhaus kannte, im akuten Schub eingeliefert war, als er sich mit einem Küchenmesser zum wiederholten Mal den Bauch aufgeschlitzt hatte. Ich durfte ihn in einer der darauffolgenden Nächte verbandstechnisch versorgen, festgeschnallt im Vierbettzimmer.
Hin und wieder gelang es mir auch lebensrettende Maßnahmen aufgrund meiner Ausbildung vorzunehmen. So erinnere ich mich an eine alte, adipöse Frau, die in Herzbettlage sukzessive, trotz medikamentöser Unterstützung über Perfusor ins Lungenödem rutschte. Ich nahm bei ihr – da der Arzt noch immer woanders in Beschlag war - mittels Blutdruckmanschetten mehrfach sogenannte „unblutige“ Aderlässe vor, die ihr sichtlich Erleichterung verschafften.
Was mich auch bis heute verfolgt, sind die Delir-Patienten, besonders einer, der eine Lungenentzündung entwickelte und letztendlich wegen der Gabe von Distraneurin zur Delirbehandlung nicht in der Lage war, den Schleim ausreichend abzuhusten und trotz massiver körperlicher Abwehrhandlungen verstarb. Heute ist Distraneurin beispielsweise in Österreich verboten, da es stark atemdepressiv wirkt.
In Folge meiner Empörung über die Rahmenbedingungen für die Pflegekräfte im Krankenhaus schrieb ich aus einer Feierlaune heraus 1992 meinen ersten Artikel, eine Satire, für eine Fachzeitschrift, der tatsächlich veröffentlicht wurde. Das war dann letztendlich der Beginn meiner Tätigkeit als Autor, denn ich schrieb danach noch weitere Artikel, zum Beispiel zur Pflege-Personal-Regelung (PPR), zur Dokumentationspraxis und zum Pflegenotstand. Es folgten später noch anspruchsvollere Artikel im Zuge meiner Fachweiterbildung.
Ich habe von da ab - neben Fachartikeln und Büchern - immer wieder bei facebook, durch öffentliche Briefe, Briefe und Mails an Politiker*innen oder explizit zum Thema Pflegenotstand in Fachzeitschriften oder im Internet publiziert.
Geriatrische Rehabilitation
1992 wechselte ich als stellvertretende Stationsleitung zu Geriatrie. Das wurde nach dem Referendariat zu meiner zweiten Hölle. Und das lag nicht allein an den Rahmenbedingungen und der Krankenhausleitung, sondern auch an den Mitarbeitenden. Vielleicht die Hälfte der Mitarbeiter war geeignet und davon waren noch welche, die nicht belastbar waren und ständig krank wurden. Sicher wäre die Krankheitsquote unter geringerem Arbeitsdruck und besseren Rahmenbedingungen nicht so hoch ausgefallen, aber das ständige Mit-Unterbesetzung-Arbeiten und die schlechte Organisation sowie die wenig privilegierte Stellung der Pflegebranche zehrte die guten und fähigen Krankenpflegekräfte über Gebühr aus, so dass irgendwann auch gesunde und relativ resiliente Leute schlapp machten oder kündigten.
Zwischenzeitlich hatten wir in der neu eröffneten Klinik zwar Erfolge und das Ansehen der Klinik wuchs, aber spätestens als die Fallpauschalen eingeführt wurden und die Verweildauer der Patienten deutlich sank, ging uns doch nach und nach die Luft aus. Nur meine Weiterbildung zum Fachkrankenpfleger (Jahre später) gab mir am Schluss noch etwas Zuversicht und Hoffnung, so dass ich mich, zumindest teilweise, dem Hamsterrad entziehen konnte. Aber die unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich Organisation und zur Personalbesetzung gegenüber meinen Vorgesetzten ließen mich schließlich aktiv über Alternativen nachdenken und suchen.
Anfänglich fehlte es an Equipment und Material, wie Bettseitenteile und Duschhocker, teilweise aber auch an fortgebildetem Personal. Später rieb uns die Handlangerfunktion gegenüber den anderen Berufsgruppen auf. Gesundes Selbstbewusstsein und pflegefachliches Wissen, sowie rhetorisches Geschick waren Mangelware. Verbesserungsvorschläge und Initiativen meinerseits wurden vereinnahmt und von anderen (Berufsgruppen) gern ohne Skrupel an ihr Jackett geheftet.
Aber vor allem die Arbeitsintensität korrumpierte Gesundheit und Zuversicht. Ich werde bis heute einige Dienste nicht vergessen. Einmal war es derart anstrengend, dass ich sogar zu spät zum Nachtdienst kam, weil ich nach dem vorangegangenen Nachtdienst! verschlafen hatte. In der Nacht zuvor hatte eine Ärztin bei einer kritischen Patientin mir aufgetragen, alle 15 Minuten Blutdruck, Puls und Atmung zu kontrollieren. Das war schlichtweg unmöglich, aber ich konnte mich nicht dagegen wehren und schaffte mehr schlecht als recht noch drei oder vier Mal in den letzten fünf Stunden diesen Auftrag zu erfüllen, der aus meiner Sicht zudem übertrieben, zumindest unverhältnismäßig, war.
Die meisten Ärzte scherten sich einen Dreck um das Pflegepersonal. Ihnen war schlichtweg egal, was pflegerisch (und nicht selten medizinisch notwendig!) zu tun war; sie sahen es nicht! Unsere Klagen gelangten nicht an ihr Ohr oder sie hielten es für übertriebenes Gestöhne und wollten es einfach nicht mehr hören.
Allerdings gelang es mir bei den vorgesetzten Ärzten einen guten Ruf zu erarbeiten. Man lobte mein Fachwissen, meine Umsicht und mein Organisationsgeschick und sparte da nicht an Lob. Das tat mir gut und hielt mich länger aufrecht als viele andere.
Die Fachweiterbildung zum „Fachkrankenpfleger für Geriatrische Rehabilitation“ im Bildungszentrum des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe unter der Leitung von Karla Kämmer begann ich im April 1996 und beendete diese im Februar 1998 mit der Note 1,6. Highlights waren hier die Hospitationen in Hannover-Langenhagen und Heidelberg.
In Ansehung der hohen Unzufriedenheit der Mitarbeiter im Hinblick auf ihr pflegerisches Selbstverständnis schrieb ich am 8. August 1999 im Namen mehrerer Stationen eine Überlastungsanzeige an die Klinikleitung, die Pflegedienstleitung und die Betriebsratsvorsitzende. Damals wusste ich noch nicht, welche Kriterien für eine solche Anzeige zu erfüllen sind und machte also den Fehler erstens zu lang zu schreiben und zweitens keine konkreten Fälle anzugeben. Hier der Text:
„Hiermit stellen die Pflegenden der Stationen *** fest, dass ein deutliches Missverhältnis besteht zwischen der Pflegebedürftigkeit der Patienten einerseits und der Quantitätdes Personals auf der anderen Seite. Wir stellen fest, dass die Versorgung der uns anvertrauten Patienten speziell an den Wochenenden, in den Spätdiensten ab 17.30 Uhr, in der Nacht und phasenweise in der Frühschicht bis 9.30 Uhr nachweisbar zum Schaden der Patienten, zur nachhaltigen Verschlechterung des Arbeitsleistungsvermögens mit hoher Krankheitsanfälligkeit, zu massiven Verschlechterung des Arbeitsklimas und zum Anstieg von Überstunden geführt hat. Stürze von Patienten, entstandene Dekubiti, Zunahme von Spastik bei Apoplektikern, Zunahme von Harnwegsinfekten, unnötigen Dauerkathetern, Aspiration von Flüssigkeiten, unzureichende Trinkmengen, zunehmende Aggressionen bei Demenzkranken, Kontrakturen, Verweigerung von Mitarbeitern, Spätdienst zu tun (Überlastung!), und vieles mehr!
Grundsätzlich müssen zunächst die examinierten Pflegekräfte genötigt werden, Ausfallzeiten von Kollegen aus ihrer geplanten Freizeit heraus zu kompensieren. Im Ergebnis wird ihnen die Regenerationsmöglichkeit sowie die Wahrnehmung familiärer Verpflichtungen genommen. Sie wagen kaum noch, ans Telefon zu gehen, da jeder Anruf ein Aufruf zum Dienstantritt außer der Reihe sein könnte. Ein Überstundenberg und eine zunehmende Krankheitsanfälligkeit wird so systematisch aufgebaut. Erfahrungsgemäß sind die anfallenden Überstunden nicht auszugleichen!