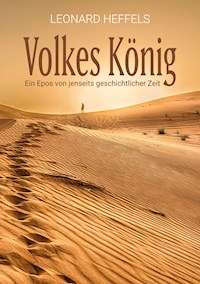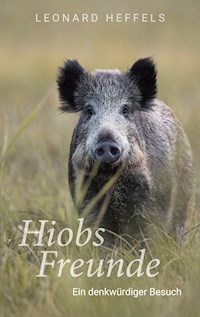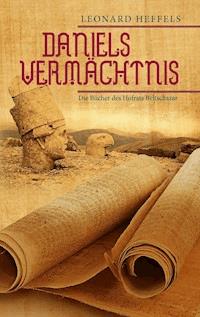
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Religiöse Eiferer gefährden die Einheit des Staates im Zweistromland. Andersgläubige werden eingeschüchtert, Machthaber versuchen aus dem Zwist der Religionsgruppen politisches Kapital zu schlagen, die Freiheit des Wortes weicht der Selbstzensur. Mesopotamien im 6. Jahrhundert v. Chr. Der alte Fürst Beltschazar hat einen Schreiber bestellt. Semi, der seit der Machtübernahme der Perser ohne Anstellung ist, freut sich über den lohnenden Auftrag. Beltschazar will seine Geschichte für künftige Zeiten aufzeichnen lassen. Als der verschleppte Jude Daniel kam er vor über 60 Jahren nach Babylon. In kurzer Zeit stieg er zum engen Vertrauten und geschätzten Berater des Königs auf, des mächtigen Herrschers Nabu-kudurri-usur. Der Monarch war augenscheinlich beeindruckt vom festen Glauben des Judäers und von der Wirkmacht seines Gottes Jahwe. Die Priester des Marduktempels sahen es alles andere als gern. Aber was hatte der Herrscher tatsächlich im Sinn, als er den Glauben an Jahwe beförderte? Warum machte er Beltschazar zum Verwalter über die südlichen Lande mit den mächtigen Religionszentren Nippur, Borsippa und Uruk? Je mehr Semi vom alten Hofrat über das Wechselspiel von Macht und Religion erfährt, umso stärker gerät er selbst zwischen die Fronten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Irak, 6. August 2005
Commander Steve McBride vom Unterstützungsbataillon der 1. Kavalleriedivision schwitzt heftig in seiner staubigen Tarnuniform. Dabei ist es erst später Vormittag. Selbst wenn die Klimaanlage auf den höchsten Stand gedreht ist, herrscht in seinem Schützenpanzer M1 Bradley noch eine brütende Hitze. Er ist aufgewachsen in Montana, liebt die frische Luft in den Bergen, die trockene Kälte. Schon in Texas, wo seine Division ihr Hauptquartier hat, fand er die Sommermonate eine Zumutung. Aber zu Hause gab es kaltes Bier und schattige Gärten. Dagegen war ihm dieses Land gleich nach seiner Verlegung von Fort Hood wie ein Vorhof der Hölle erschienen. Nicht dass der Krieg hier unten so grausam gewesen wäre. Seine Einheit hatte sich nur wenig an den direkten Kampfhandlungen beteiligen müssen. Ihr Auftrag war es vor allem gewesen, die Versorgung der Fronttruppen mit Treibstoff, Munition und Nahrung zu sichern. Eigentlich hatten sie den Krieg ja ganz gut überstanden. Sie plagten sich vor allem mit den Sandstürmen und der ewigen Hitze herum. Bald nach der Kapitulation der irakischen Armee hatte man sie hierher geschickt, zum Stützpunkt Babylon südlich von Bagdad. Seit mehr als einem Jahr ist er nun schon hier, mal abgesehen von den zwei Monaten Urlaub in der Heimat. Die Zeit bei seiner Frau und seiner kleinen Tochter in Waco war schnell vorbeigegangen. Das, denkt er nun bitter, war vielleicht sogar gut, denn wir hatten uns nicht mehr viel zu sagen. Am Ende war er fast froh gewesen, als er zurück zu seiner Einheit musste. Commander McBride richtet sich im Turm auf, schiebt das M240 Maschinengewehr zur Seite, nickt seinem Richtschützen zu und blickt missmutig auf das vertraute Gelände vor ihm. Wir bewachen alte Steine, denkt er achselzuckend und grinst. Die meisten sind nicht einmal alt, wie man ihnen erklärt hat. Saddam hat die zerfallene Stadt neu errichtet und überall gewaltige Mauern aus rotem Ziegelstein hochziehen lassen. Natürlich sollte auch ein Palast für den Hurensohn nicht fehlen. Der Commander hat keine Ahnung von der Vergangenheit des Ortes und daher findet er die Nachbauten des flüchtigen Diktators durchaus imposant. Aber Plünderer erwischt haben sie kaum welche, höchstens mal ein paar Rotzbengel aus den nahe gelegenen Dörfern verjagt, die sich nach Sonnenuntergang zwischen den Mauern herumtrieben. Was gibt’s denn hier auch zu plündern? Soweit er weiß, sind die wertvollen Sachen alle längst in Museen verfrachtet worden. Ein paar Bruchstücke von diesen glasierten Ziegeln liegen wohl noch rum und offensichtlich gibt es Leute, die bereit sind viel Geld dafür zu bezahlen. Der Commander schüttelt unwillkürlich den Kopf. Schon verrückt, denkt er, dass hier fast 2000 Mann herumsitzen um diese Geisterstadt zu bewachen. Aber er weiß natürlich, was man von Politikern zu erwarten hat. Die hohen Herren drüben in Washington stellen sich gern vor die Weltpresse hin und setzen sich als Beschützer alter, bedrohter Kulturdenkmäler in Szene. Also schicken sie uns für viel Steuergeld in die verdammte Wüste, während mein alter Herr daheim kaum mit seiner Rente auskommt. Dann kann man ja schon fast froh sein, dass wir jetzt die Polacken hier haben. Eine Ruinenstadt bewachen können die doch genauso gut. Irgendjemand im Oberkommando war schlau genug denen die Führung zu überlassen. Egal! Besser hier seinen Dienst schieben als sich in Bagdad den Arsch wegblasen zu lassen. Oder in Falludscha! Da gehen jetzt fast täglich Bomben hoch. Diese hinterhältigen Bastarde sind wie Ratten, denkt er grimmig, man kann sie nicht ausrotten. Er lässt seine rechte Hand auf dem M240 ruhen und blickt nach hinten, wo der Infanterietrupp gerade aufsitzt. Wir können die nicht besiegen und sollten besser so bald wie möglich wieder nach Hause fahren. Er weiß, dass seine Jungs genauso denken. Sie alle haben die Schnauze voll von den scheiß Booby Traps und diesen Scheißarabern. Sie alle verachten die Winkelzüge der Politiker – auch wenn das keiner von ihnen einem Vorgesetzten jemals laut sagen würde – und haben den Wüstensand mehr denn satt.
„Sergeant, ruft er in sein Mikrofon, „hören Sie auf Ihre Eier zu kratzen und schmeißen Sie den Dampfer an. Wir machen eine Vergnügungsfahrt durch Babylons Sandbucht. Mal sehen, ob wir auf Saddams Riesenburg ein paar Raubritter entdecken.“
„Ein Kasten Babylon Bier wäre mir lieber, Lieutenant, Sir“, kommt die launige Antwort des Fahrers, unmittelbar gefolgt vom dröhnenden Lärm des Achtzylinder Dieselmotors.
„Wir fahren am neuen Hubschrauberlandeplatz vorbei, Sergeant. Aber passen Sie auf, die Pioniere haben dort einen ganz schönen Schutthaufen hinterlassen.“
„Von diesen Scheißern erwartet man ja nichts anderes als große Haufen, Sir.“
Raues Gelächter kommt vom Heck, wo die Infanteristen sitzen. Sie fahren im gemäßigten Tempo los und die Gleisketten werfen den feinen Straßensand fast liebevoll auf. Die GIs schauend gähnend durch ihre Schießluken. Sie sind nur wenige Hundert Meter weit gekommen, da meldet sich der Fahrer.
„Lieutenant, Sir?“
Der Commander hat es schon gesehen. Ein großer Geröllhaufen versperrt ihnen den Weg. Keine Schranke, kein unüberwindliches Hindernis für einen Bradley, aber ein Schild fordert sie auf zurückzufahren und den ebenfalls neu angelegten Parkplatz großräumig zu umfahren.
„Drehen wir um, Sir?
Commander McBride konnte auch später nicht genau sagen, was ihn zu seinem nächsten Befehl bewegte. Vielleicht war es der leicht provozierende Tonfall des Fahrers, vielleicht sein Bedürfnis nach Spaß und Abwechslung, bedingt durch monatelanger nervtötender Routine in dieser Ödnis. Es war, so würde er später sagen, eine spontane Entscheidung gewesen.
„Was meinen Sie, Sergeant, können Sie uns da sicher hinüber bringen?“
„Hinüber, Sir? Sie meinen über diesen Haufen drüber?“
Der junge Unteroffizier klingt gleichermaßen erstaunt wie begeistert von der Idee.
„Genau das.“
„Kein Problem, Sir.“
„Gut, dann zeigen Sie uns mal, was Sie drauf haben, Sergeant!“
Der Fahrer setzt ein Stück zurück und hält dann kurz inne, so als würde er sich sammeln im Angesicht der vor ihnen aufragenden Hürde. Dann brüllt der 600 PS Motor und die Auspuffrohre spucken schwarzen Rauch aus. Der Schützenpanzer macht einen Satz nach vorne und die Gleisketten greifen quietschend in den trockenen Schutt, der unter dem Gewicht der 18 Tonnen Stahl zerbröselt und zusammengedrückt wird. Scheinbar mühelos erklimmt das schwere Gefährt den unförmigen Schotterhügel. Die Besatzung wird aber gehörig durcheinander geschüttelt und die Infanteristen grölen und feixen. Doch gerade in dem Augenblick, da der Panzer über den Rand des kleinen Hügels nach vorne kippt und auf ein schmales Schuttplateau rollt, taucht vor ihnen ein Bulldozer mit gesenkter Schaufel auf, der direkt auf sie zufährt. McBride schreit seinen Befehl auszuweichen, aber der Fahrer hat schon reagiert und das Fahrzeug macht fast auf der Stelle eine 90°-Drehung, wonach es ruckartig nach vorne schießt. Bevor der Sergeant das Gefährt wieder auf Kurs bringen kann, neigt es sich schon stark zur Seite und dem Fahrer bleibt keine andere Wahl als den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, wenn er vermeiden will, dass sie mit der rechten Flanke zu tief in den weichen Sand am Fuße des Schutthaufens versinken. So kommt es, dass der M1 Bradley von Commander Steve McBride an diesem glutheißen Augusttag im Jahre 2005 unversehens auf das Ausgrabungsgelände eines irakisch-deutschen Forschungsteams rollt. Die Arbeiten auf dem Feld waren schon bald nach der Verschärfung der Sanktionen gegen das Saddam-Regime eingestellt worden. Fast vier Jahre lang hatte kein Archäologe das Gelände betreten. Das sollte sich nun aber bald dramatisch ändern. Der Commander gibt den Befehl anzuhalten, sobald der Panzer eine wieder einigermaßen waagerechte Position erreicht hat.
„Damned!“ Er weiß, dass der Major ihm den Kopf abreißen wird, wenn sich erst einmal die Iraker aus dem Staatsrat beim Generalstab beschwert haben. Er schaut sich um, um zu sehen, wie sie am schnellsten vom Buddelplatz der Professoren wieder runterkommen. Etwa 20 m hinter ihnen ist die Absperrung des Forschungsfeldes. Sie müssten den leichten Zaun einreißen. Anschließend könnten die Jungs vom Infanterietrupp ihn wieder halbwegs herrichten. Er zögert noch einen Moment, dann drückt er sein Helmmikro näher an den Mund. „Sergeant, direkt hinter uns ist ein Zaun. Da hinein machen wir uns jetzt einen hübschen Notausgang. Aber schön langsam!“
Der Panzer rollt rückwärts, kommt aber nicht weit. Nach nur wenigen Metern gibt plötzlich der Boden unter der Last des schweren Gefährts nach und der Bradley bricht mit dem Heck fast zwei Meter tief ein, so dass er mit einer nahezu exakten 45°-Neigung zum Stehen kommt. Ein kollektiver Aufschrei aus dem Kampfraum. „What the hell…?“
Commander McBride weiß sofort zweierlei. Erstens wird er nun melden müssen, dass sie im wissenschaftlichen Sperrgebiet eingebrochen sind. Und zweitens wird er Ärger bekommen, mal abgesehen vom ganzen Papierkram. Er ahnt freilich nicht, dass er soeben ganz ungewollt die ihm völlig unbekannte Wissenschaft der Altorientalistik zu einem Durchbruch in ihrer Forschung verholfen hat, einem Durchbruch, dessen ganzes Ausmaß man allerdings erst viele Jahre später wird ermessen können. Denn sein Aufklärungsfahrzeug hat gerade die Decke eines der umfangreichsten Verwaltungsarchive des neubabylonischen Reiches durchstoßen. Es ist gewiss nicht die älteste Sammlung dieser Art. Wie sich später herausstellt, sind die jüngsten Urkunden etwa 2400 Jahre alt. Das an sich ist nicht wirklich etwas Besonderes im Zweistromland. Aber der Inhalt dieser Textdokumente wird Wissenschaftler weltweit in helle Aufregung versetzen.
Inhaltsverzeichnis
Teil 1: Der Auftrag
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Teil 2: Die Prüfung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Teil 3: Das Vermächtnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Personen
Glossar
Teil 1: Der Auftrag
Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde; und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kundwürde und du deines Herzens Gedanken erführest.
DANIEL 2, 29-30
1
Im Schatten kleiner Palmen, nah an der Einfassung des Daches ruht ein sehr alter Mann, in edlem Tuch gewandet, auf einer schlichten, in seiner Schlichtheit aber vornehmen Liege. Das geölte Zedernholz der Lehne glänzt warm und anheimelnd. Das tiefe Rot der Kissen leuchtet wie von innen heraus, kraftvoll und gleichsam besänftigend. Halb zurückgeneigt, halb aufgerichtet, scheint er zu schlafen. Sein Haupt ist leicht auf die Brust gesunken, dort gebettet im hellen Grau seines Bartes. Aber seine grünen Augen blicken lebhaft unter den buschigen Brauen hervor. Und wach ist auch sein Wesen, aufmerksam in der Gegenwart dieser himmlischen Stadt, aufmerksam auf das, was sich ihm in Erinnerung bringt. Ihm gefällt diese Stellung. Es ist die Lage, in der er sich immer befunden hat. Nicht, dass er übermäßig viele Stunden im Bett verbracht hätte. Geschlafen hat er selbst in seinen jungen Jahren immer nur wenig. Aber er war sein Leben lang halb der Traumwelt des Schlafes, halb dem Raunen des Himmels zugewandt, ergeben aber nicht erlahmend, aufmerkend aber nicht auflehnend. Und mit den Jahren wurde ihm die Grenze zwischen Schlaf und Scharfsinn, zwischen Traum und Tat durchlässig wie ein hauchdünner Schleier. Seitdem ist er gewahr: Es schwingt in allem, was um ihn herum gesagt und getan, ein anderes Geschehen mit wie ein himmlischer Chor, der tönend dem Trachten der Menschen höheren Sinn verleiht. Und doch ist er kein Träumer, nie gewesen, kein Schwärmer, kein unbeteiligter Zuschauer. Überhaupt hat er stets mehr gehört als gesehen, gehorcht. Und so war auch sein Tun – eher ein Horchen, ein Gehorchen.
Überall auf dem Dach stehen Sträucher und Bäumchen in großen Tongefäßen. Auch sie, denkt der Greis sinnierend, gehören zum Nachlass des Königs: die grünenden Dächer der Stadt. Der König! Sein König. Längst herrscht ein anderer, ein Eroberer, ein Großer, doch für ihn ist der Herrscher von damals immer noch der König, er, der die Dächer seines Palastes in üppige Gärten verwandelte. Sah man je einen Monarchen, der den Sitz seiner Herrschaft so lieblich schmückte, der das Wasser des Euphrats Stufe um Stufe hin abwärts lenkte und das Grün vom Himmel herab in die Ebene ergoss? Der Herr gab ihm die Macht, den Reichtum und die Weisheit dieser Stadt eine wahrlich glanzvolle Gestalt zu verleihen.
Langsam lässt der Alte seinen Blick über das weitläufige Stadtgebiet östlich des Flusses schweifen, hinüber zum Markt-Tor, wo Händler aus aller Welt ihre bunten Waren feilbieten, hin zu den prunkvollen Bauten des Eridu, des Viertels am Großen Tor, und weiter nach Schuanna am Urasch-Tor, wo er als junger Mann oft stundenlang saß und den Handwerkern bei ihrer Arbeit zuschaute. Hinüber wandert sein Blick zu den Prachtstraßen des Kadingirra am herrlichen Ischtar-Tor, hin zum Belet-Eanna-Tempel am Kanalufer, in dem er als Lehrling an geheimen Riten teilnahm, und weiter nach Kullab am Marduk-Tor, wo jetzt viele Perser ihr Domizil haben. Drüben vom Zababa-Tor her bis zum großen Kultort, den sie „Die-Götter-achten-Marduk“ nennen, erstreckt sich das beschauliche Te-e, die Heimat vieler Beamter und Schreiber. Jenseits des Flusses, auf dem Westufer – er weiß es mehr, als dass er es sieht – befinden sich weitere Viertel: Drüben am Adad-Tor leben die Söhne und Töchter seines Volkes, einst verschleppt aus der Heimat wie er. Nunmehr gewachsen ist ihre Gemeinde und im Volke heißt man die Gegend inzwischen Jehud. Daneben gelegen ist Tuba nahe dem Schamasch-Tor, wo vor allem Fischer, einfache Soldaten und Dirnen leben. Und dort zum Flussufer hin liegt Kumar, das sich vom Aku-Tor bis zum Enamtila erstreckt, wo das erhabene Eschmah gebaut wurde, und schließlich Bab-Lugalirra. Pfeilgerade sind die Straßen, rechteckig die Grundrisse der mehrstöckigen Gebäude und ebenso rechteckig ist die Stadt selbst, eingefasst von einer gewaltigen Mauer. Wann war er zuletzt dort draußen? Wie lange ist es her, dass ihn sein Weg jenseits des Enlil-Walls, jenseits der zweiten Stadtmauer, führte? Viele Jahre sind vergangen, seitdem der Herrscher ihn von seinem Amt befreite. Danach war er kaum noch im Lande unterwegs.
Sein Blick gleitet an der Kimmung entlang, folgt dem Flusslauf nach Süden und fällt schließlich, wie am Ende einer langen Reise, auf den Tempelbezirk inmitten dieser größten und schönsten aller Städte – und ruht dort lange. Es scheint als würde jede Straße zu guter Letzt dorthin führen, zu diesem innersten Heiligtum der Chaldäer, das sie selbst Esagila nennen, die Geburtsstätte Marduks, ihres vornehmsten Gottes, und der Platz, an dem der Mensch erschaffen wurde. Er weiß wohl, es ist für die Knechte Merodachs nicht bloß die Mitte der Stadt, sondern die Mitte der gesamten Weltebene. Und von dort erhebt sich wie ein Fels in den Himmel das Etemen-an-ki, der Turmtempel, der im Glauben der Hiesigen das Fundament von Himmel und Erde ist.
Monumentales, denkt der Greis, wahrhaft Gigantisches schuf der König, einen Ort, der nicht nur ihn selbst, sondern auch sein Reich überdauerte, jenes stolze Königtum über die vier Weltgegenden. Es welkte, als die Zeit gekommen war, so wie die Blüten auf den Dächern der Paläste rasch und leise vergehen. Und auch das jetzige Reich und die ihm folgenden werden vor Gott keinen Bestand haben. Er weiß es. Die Gesichte von einst begleiten ihn weiter bis heute, klar und eindringlich.
2
Semi kauert auf einem kleinen Teppich am Boden. Die Beine angewinkelt, den Rücken gerade, das Haupt mit den dunkeln Locken gebeugt, die feingliedrigen Hände im Schoß, sitzt auch er so, wie er einen Großteil seines Lebens verbracht hat. Vor sich hingelegt hat er seine Schreibpinsel aus Binsen, heute vor Sonnenaufgang frisch geschnitten am Ufer des großen Stromes. Daneben steht ein kleines Fässchen, dessen Inhalt ihn durchaus mit Stolz erfüllt. Bereits seit vier Geschlechtern rühren die Männer seiner Sippe diese schwarze Tinte nach einer eigenen Rezeptur an. Dazu hat man schon vor langer Zeit mehrere seltenen Akaziensträucher von ägyptischen Händlern erworben und auf heimischen Feldern angebaut. In seinen Händen hält er eine Schriftrolle ausreichend für ein kleines Buch: 14 Ellen feinstes Papyrus, sorgsam verklebt und geschnitten. Er blickt zufrieden auf die ersten wenigen Abschnitte, die er gestern geschrieben hat, gerade Zeilen feinster Schriftzeichen. Großer Nabu! Wenn er daran denkt, dass manche Gelehrte und Vornehme immer noch Akkadisch schreiben. Auf Tontafeln! Er hat das öfter beobachtet und es ist ihm immer sehr mühsam vorgekommen. Da der Lehm rasch trocknet, müssen die Schreiber rasend schnell arbeiten. Wenn der Herr nicht zügig genug spricht und länger nachdenkt, bekommt der Ton schon Risse. Und dieser Herr hier, dass hatte er sofort gemerkt, lässt sich Zeit, scheint förmlich in seine Gedanken zu versinken. Semis Binse jedoch ist geduldig. Verstohlen schaut er zum greisen Fürsten hinüber.
Erschrocken war Semi hochgefahren, als vor wenigen Tagen Soldaten der Palastgarde an seiner Tür pochten. Hastig war er zur Tür gelaufen, da er einen Notfall befürchtete, doch dann war kein anderer als Schutruk, der Reichskommissar des Königs, vor ihm gestanden und hatte Zutritt zu seinem Haus verlangt. Den Abgesandten des persischen Monarchen hatte Semi bisher bloß ein- oder zweimal mit großem Gefolge auf der Straße vorbeireiten sehen. Er wusste, dass der hohe Beamte unmittelbar seinem Gebieter Kurasch unterstand, dass er häufig das riesige Reich des gottgleichen Herrschers bereiste und hierher entsandt war, um die Verwaltung im Land der Sumerer neu zu gestalten. Am Hofe verfügte er wohl über gute Beziehungen. Selbst mit Ugbaru, dem mächtigen Statthalter war er, wie es hieß, schon seit Jahren befreundet. Man sagte, der Mann wäre herrisch und streng, und seine kantigen Züge schienen Volkes Urteil zu bestätigen. Semi war nicht wohl dabei gewesen, plötzlich diesem persischen Herrn gegenüber zu stehen. Früher, unter der Herrschaft des tragischen Nabu-na‘ids, hatten er und sein Ältester gelegentlich für die Beamten des Hofes gearbeitet. Als nun der hochgestellte Abgesandte des neuen Herrschers seine Schwelle betrat, fürchtete er zunächst, die früheren Geschäfte seien ihm zum Verhängnis geworden. Doch es zeigte sich bald, dass seine Sorge unbegründet war. Was den Kommissar zu ihm führte, war ein Auftrag, allerdings ein recht ungewöhnlicher. Fürst Beltschazar, so wurde ihm gesagt, wünscht, dass die wichtigsten Ereignisse seines Lebens aufgezeichnet werden. Die Schriften sollten anschließend nach Jerusalem in der Provinz Juda überbracht werden. Der Alte stamme daher und wolle sich seinem Volk wohl in Erinnerung bringen. Beltschazar. Beltschazar! Natürlich war ihm der Name bekannt. Es gab wohl kaum ein Mann zwischen Ninive und Ur, der keine Berichte über seine Weisheit und Wunder gehört hätte. So lange er sich erinnern konnte, sprach man von Beltschazar als einem Heiligen, dem die Krone und das Reich viel verdankten. Es überraschte ihn daher, dass der frühere Fürst und Berater immer noch lebte. Er müsse, überlegte er, inzwischen uralt sein.
Wie er bald erfuhr, war das Alter des einstigen Hofrats tatsächlich der Grund für den ungewöhnlichen Besuch. „Der Fürst ist hochbetagt“, hatte der Kommissar erläutert. „Sein Geist ist noch immer wach und klar, aber schwach geworden ist sein Auge und seine Hand hat Kraft und Festigkeit verloren. Er ist nicht mehr in der Lage selbst zu schreiben. Wie man hört, fällt ihm auch das Lesen schwer. Deshalb hat er den Hof um Hilfe gebeten.“
Semi hatte abgewartet, das verwirrte Haupt gesenkt, das Gemüt voll wachsender Unruhe. Die Beklemmung, die er verspürte, wunderte ihn selbst. Jetzt, da sich seine Überraschung über den hohen Besuch gelegt hatte, konnte er sich diese Anspannung nicht erklären. Der Auftrag würde sicherlich gut entlohnt werden, versuchte er sein Herz zu besänftigen. Er konnte damit rechnen, eine größere Schrift anfertigen zu müssen. Wenn ein so alter Fürst erst einmal anfing zu reden, war bestimmt nicht bald mit einem Ende zu rechnen. Reichlich Silber stand zu erwarten. Aber ganz gleich, was er überlegte, seine Unruhe ließ sich nicht vertreiben.
Der Kommissar indes hatte Semi kaum beachtet und schon nach wenigen Augenblicken weiter gesprochen. „Unsere Schreiber beherrschen weder die Sprache noch die Schrift des Landes so gut, dass wir einen von ihnen zum Fürsten schicken könnten. Die Chaldäer, die für uns arbeiten, werden dringend in der Lagerverwaltung gebraucht. Da hat man sich an Euch erinnert. Es heißt, Ihr seid immer zuverlässig gewesen.“
Für Semis Ohren hatte das durchaus einleuchtend geklungen und trotzdem war eine dunkle Ahnung über ihn gekommen. Ein bedrohlicher Schatten legte sich auf sein Gemüt. Ein Gefühl von Misstrauen bedrängte ihn. Im Herzen spürte er, dass der Kommissar ihm etwas verheimlichte. Etwas fahrig versuchte er sich ins Gedächtnis zu rufen, was er über Beltschazar wusste. Er entsann sich, dass der Mann zeitlebens viele Bewunderer hatte, dass man ihn als gerecht und bescheiden pries. Man erzählte sich, dass er die Sprache der Engel verstünde, dass er Träume auslegen und wilde Tiere zähmen könne. Semi hatte schon sagen hören, der Gottesmann wäre in der Lage, die Zukunft vorherzusagen. Sicher war jedoch, dass die Herrscher am Hof stets auf ihn gehört hatten. Die alten Könige haben ihm vertraut, sich ihm wohl auch anvertraut, und ihn als Dank für seinen weisen Rat irgendwann zum Fürsten gemacht. Und es gab noch etwas, das er mit Sicherheit wusste: Beltschazar hat immer auch Feinde gehabt. Er war ja kein Chaldäer, keiner von hier. Er war ein Verschleppter aus der westlichen Provinz jenseits des Bitteren Sees. Er betete nicht zu Sin, Marduk oder Schamasch. Sein Gott hieß nicht Anu, sondern Jahwe. Er war nie bereit gewesen, dass Knie für andere Götter zu beugen, aber trotzdem irgendwie immer damit durchgekommen. Das ärgerte manche Priester sehr. Und der Hass auf ihn schien im Laufe der Jahre eher gewachsen zu sein. War es das, was er befürchtete, den Zorn der Götter auf sich zu ziehen? Gewiss würden es die mächtigen Mardukpriester nicht gerne sehen, wenn er sich diesem alten Jehuden zu Füßen setzen würde um seine Geschichte, die Geschichte eines Ungläubigen aufzuzeichnen. Vielleicht wäre es doch besser, wenn er den Auftrag nicht annähme. Aber letztlich waren diese Überlegungen bedeutungslos, denn er hatte schnell verstanden, dass er nicht wirklich eine Wahl hatte – und dass Schutruk, dieser herablassende Herr, das wusste. Einen Auftrag des Königs abzulehnen war schlechterdings unmöglich. Da hätte er ebenso gut gleich auswandern können. Schließlich war es ihm gelungen, dem Kommissar das Versprechen abzuringen, dass er sich alleine – ohne Wachen oder Diener – mit dem Alten treffen könnte. Schutruk hatte keine Einwände gehabt. Vielmehr lag dem Hof in dieser Angelegenheit, wie er sich ausdrückte, viel an Vertraulichkeit.
Schon kurz nach Sonnenaufgang des folgenden Tages war der Hauptmann der Palastgarde in Begleitung zweier Wachmänner gekommen um ihn zum Haus des rätselhaften Hofberaters zu führen. Dieser schien sie erwartet zu haben und war schweigend im schattigen Innenhof seines Hauses gestanden, als sein Diener die Gäste hereingeleitete. Freundlich hatte der Greis seinen neuen Schreiber empfangen und ihn dabei mit lebhaften Augen gemustert. Semi erinnert sich noch genau, dass er vom Blick des Mannes zwar verunsichert, aber nicht eingeschüchtert gewesen war. Er hätte sich damals nicht vorstellen können, dass die Begegnung mit diesem Beltschazar sein Leben tiefgreifend ändern würde. Der Hausherr sah alles in allem eher harmlos und friedfertig aus. Bald nach der Begrüßung hatte er den Hauptmann mit einem höflichen Nicken gedankt und entlassen.
Ein Räuspern reißt Semi aus seinen Gedanken und er blickt hoch. Beltschazar schaut ihm direkt in die Augen und lächelt. Da erst versteht er, dass der Mann ihn gerade gebeten hat zu lesen, vorzulesen, was er gestern aufgezeichnet hat.
3
Geboren wurde ich im Land Gottes, im Königreich Juda als siebter und jüngster Sohn einer Frau aus dem Stamme Davids. Meine Mutter hieß Ruth und trug damit den gleichen Namen wie die treue Ahnherrin jenes großen Königs. Die Urgroßmutter Davids war einst aus dem Osten zum Volke Israels gestoßen, eine tapfere Witwe, die in der Ferne zum wahren Glauben fand. Mein Vater Schimea war Chronist am Hofe Jojakims in der heiligen Stadt. Zeitlebens sammelte er Erzählungen und Geschichten über unseren Stamm, seine Könige, Kultorte und Kriege – anfangs aus Neigung, später auch im Dienste des Königs. Er war ein sanftmütiger Mann, ein gern gesehener Gast bei jedem Gelage, dem alle gebannt zuhörten, sobald er anhob zu erzählen. Bei der ersten Belagerung Jerusalems durch den großen Nabu-kudurri-usur starb er, wenige Woche vor der Niederlage Jojakims, des herrischen, unbelehrbaren Monarchen meines Volkes. Einen Großteil des Hofstaats, aber ebenso vermögende Händler und Gutsbesitzer verschleppten die Besatzer nach Babylon. Auch mich traf dieses Los. Ich war damals gerade 15 Jahre alt.
Keinem Heer der Welt wäre es möglich gewesen, die heilige Stadt einzunehmen, hätte Gott weiter seine Hand über sie gehalten. Aber Jahwe, der Gebieter des Himmels und der Erde, hatte seinen Richterspruch gefällt. Er ließ zu, dass Jerusalem fiel, dass eine Übermacht aus dem Osten die Kinder Israels niederrang. Er, der Allmächtige, ließ zu, dass die Töchter des Volkes gequält, die Priester bedroht und am Ende gar der Tempel geschändet und geplündert wurde. Er, der unsere Vorfahren aus der Knechtschaft am Nil befreit hatte, erlaubte einem fremden Herrscher erneut, sein Volk zu knechten. Er, der einst die Kinder Israels aus Ägypten geführt hatte, gab sie jetzt in die Hände Babylons. Zu lange waren unsere Herzen voller Hass gewesen, unsere Worte von Lügen vergiftet, unsere Taten von Missgunst gelenkt. Gott hatte gesehen, wie die Stämme Jakobs sich gegenseitig bekämpften, wie die Gesetze des Moses mit Füßen getreten wurden, wie die Priester mehr und mehr der Macht des Goldes erlagen. So gab es keinen anderen Weg: Wir wurden gerichtet.
Semi schweigt, lässt die Schriftrolle in seinen Schoß sinken und blickt hoch. Er hatte erwartet, dass der weise Mann mit gesenktem Haupt, vielleicht sogar mit geschlossenen Augen aufmerksam lauschend dasitzen würde. Doch als er nun zu ihm hinüberschaut, blickt der Greis ihn unverwandt an. Semi stutzt. Etwas in diesen überraschend jungen Augen verwirrt ihn, etwas, das er nicht erwartet hat – nicht hier. Der Schreiber braucht einen Moment um zu erkennen, was es ist. Dann schlägt er unsicher seine Augen nieder, als ihm klar wird, dass der Alte ihn mit Mitgefühl anschaut. Ja, er irrt sich nicht, dieser hoch gestellte Herr, dieser geschätzte Berater von Königen, zeigt – Anteilnahme. Und sie gilt ihm, nicht dem, was er gerade vorgelesen hat. Das bringt ihn durcheinander, macht ihn unschlüssig. Üblicherweise schauen die Herren ihn, den bestellten Schreiber, gar nicht an. Sie erteilen ihre Befehle, tadeln oder drängen, schicken ihn fort, lassen ihn rufen. Ansonsten aber behandeln sie ihren Schreiber wie einen Sklaven, das heißt, sie beachten ihn nicht. Auf der Suche nach einer Erklärung fragt sich Semi, ob er einen Fehler gemacht hat und sein Auge streift erneut die Schriftrolle in seinen Händen. Doch er ist sich ziemlich sicher, kein Wort aus dem Mund des Mannes überhört zu haben. Was er soeben gelesen hat, ist genau das, was ihm gestern diktiert wurde. Vielleicht will der Herr seinen Spott mit ihm treiben. Er hält den Blick gesenkt und wartet. Er weiß, es steht ihm nicht zu, unaufgefordert zu sprechen.
„Wie heißt du?“
„Semi, mein Herr.“
„Ein aramäischer Name.“
„Ja, Herr.“
„Weißt du, wer ich bin?“
Der Schreiber zögert kurz. „Man nennt Euch Beltschazar, Herr.“
Der Alte nickt. „Und dort, wo ich herkomme?“
Wieder zögert der Jüngere, versteht die Frage nicht genau. „Ihr habt mich gestern zu schreiben geheißen, dass Ihr aus Jehud kommt, Herr.“
„Ja, aber wer bin ich dort?“
Der Schreiber runzelt die Stirn. „Verzeiht, Herr, ich verstehe nicht.“
Der Alte lächelt nachsichtig. „Wir sind immer drei, Semi. Das, was war, treibt uns von hinten an. Das was werden will, kommt uns entgegen.“
Semi wundert sich über diese Worte und wartet geduldig, aber Beltschazar verstummt wieder. Schließlich traut sich der Schreiber nachzufragen. „Und das Dritte?“
„Das Dritte, Semi, ist ein Zeuge. Der Zeuge ist da. Er sieht und hört, wie Gottes Plan sich entfaltet.“
Semi schweigt. Ihm ist schleierhaft, wovon der Greis redet. Er weiß nicht, was er davon halten, was er sagen soll. Und noch weniger weiß er, wohin dieser Auftrag ihn führen wird.
Als würde er die Ratlosigkeit seines Schreibers ahnen, kehrt der Alte zurück zu seiner Frage. „Daniel, nannte mich mein Vater am achten Tag nach meiner Geburt. Damit gab er mir einen Namen, der einem Weg gleichkam, einem Auftrag. ‚Gerichtet von Gott‘ hieß er mich, verstehst du, gerichtet. Und fürwahr: Der Herr gab mir eine Richtung, hat mich aufgerichtet und ausgerichtet – nach Osten hin, hierher, zum fruchtbaren Zweistromland, das einst fast alle unserer Stam-mesväter gebar.“
„Verstehe“, murmelt Semi, aber er merkt selbst, wie wenig überzeugend er klingt.
Erneut huscht ein mildes Lächeln über das fein gerunzelte Gesicht. „Ja, das ist gut, mein Sohn, denn nur wenn du das begreifst, kannst du den Weg verstehen, den ich dich bitte nachzuzeichnen. Es ist der Weg zwischen Daniel auf der einen und Beltschazar auf der anderen Seite, zwischen einem Gott, der richtet, und einem Gott, der beschützt. Siehst du, die meisten Menschen kennen nur eine Seite. Sie schwören auf das, was sie sehen, klammern sich an das, was man sie lehrte zu glauben. Mit Feuereifer und gewetztem Schwert verteidigen sie es. Und sie hassen die, die etwas anderes glauben. Du weißt, wovon ich spreche.“
Semi stutzt, seine Augen weiten sich. Ungläubig starrt er auf den Greis. Könnte es sein …, fragt er sich. Aber … wie ist das möglich?
Einmal mehr blickt der Mann ihm geradewegs in die Augen. Seine Stimme wird noch etwas weicher. „Wurde nicht deine Schwiegertochter von den Priestern bestraft, weil sie sich aus Liebe zu Enlil, dem Gott ihrer Heimatstadt, weigerte Marduk als den höchsten Gott anzuerkennen? Hast du nicht hohe Abgaben für sie entrichtet, um ihr zwei Wochen Tempeldienst zu ersparen?“
Der Schreiber ist sprachlos. Seine Züge entgleiten ihm. Er merkt nicht, wie sich sein Mund öffnet. Sein Herz rast. Fassungslos fragt er sich, woher dieser Beltschazar davon weiß. Ich habe mir doch alle Mühe gegeben, überlegt er, den Streitfall aus der Öffentlichkeit zu halten. Wer hat geredet?
Doch die nächsten Worte seines Gegenübers lassen Semi auf einen Schlag erkennen, dass er in die falsche Richtung denkt. „Sie ist eine kämpferische Frau“, fährt der Alte fort, „eine – wie du findest – wahre Tochter Ischtars. Diesen Stolz, diesen Widerspruchsgeist hast du immer an ihr gemocht. Ist es nicht so?“
Da weicht die Bestürzung des Schreibers einer großen Verwunderung. Denn Semi ist überzeugt: Das kann dem Greis niemand erzählt haben. Keiner weiß es, keiner außer ihm. Eine seltene Mischung aus Furcht und Freude erregt sein Gemüt, als ihm aufgeht, was geschehen ist. Dieser uralte Gottesmann hat in sein Herz geschaut, hat ihn gesehen – nicht den Schreiber, nicht den Familienvater, nicht den Aramäer, sondern ihn selbst. Und im Geschautwerden fühlt er, dass in ihm etwas lebt, etwas da ist, von dem er bisher nichts ahnte. Es ist ein Blick, der das Verborgene entbirgt.
Beltschazar bemerkt die Verblüffung des Schreibers nicht oder er tut so, als ob, und kehrt zu seiner Überlegung zurück. „Was meinst du, Semi, wie viele Leute eher ihre Brüder töten würden, als ihre Meinung aufzugeben? Na? Die meisten Menschen lassen ihren Glauben nicht gerne in Frage stellen. Sie fürchten ihre Götter und tun alles sie milde zu stimmen. Sie fürchten Unheil und betteln inbrünstig um den Segen ihrer himmlischen Beschützer. Die Namen ihrer Wohltäter tragen sie ständig auf den Lippen, aber selten im Herzen. So groß ist ihre Angst vor der Macht böser Dämonen, dass sie mit Feuereifer gegen vermeintlich falsche Götter ins Feld ziehen, sobald sie überzeugt sind, damit das Wohlgefallen ihrer eigenen Gönner zu erlangen. Es ist bei den Menschen nicht anders als bei den Tieren: Angst macht sie gewalttätig. Und sie verengt ihnen ihr Blickfeld. Deshalb sehen viele nicht, was ist. Sie verharren im Dunkeln, weil sie das Licht noch mehr fürchten als die Dunkelheit. Fürchtest du die Dunkelheit, Semi?“
Die plötzliche Frage überrascht den Schreiber und ohne darüber nachzudenken, verneint er sie sogleich. Doch dann ist er sich nicht so sicher, ob die Antwort zutreffend ist.
Beltschazar nickt zustimmend. „Das ist gut. Wer im Dunkeln harrt, verteidigt die Lüge und bekämpft die Wahrheit. Das solltest du bedenken, mein Schreiber. Deine Aufgabe ist nicht ungefährlich.“
Semi erschrickt bei diesen Worten. Beim Nabu! Das hat mir noch gefehlt. Dass es schwierig werden würde, ahnte ich sogleich. Jetzt also auch noch gefährlich. Doch weshalb? Wovon redet der Mann? Gefährlich ist das Kriegshandwerk, aber doch nicht die Schreibkunst! Er seufzt. Was dieser Beltschazar erzählt, beunruhigt ihn. Der Alte spricht in Rätseln, gewiss, doch Semi ist sich sicher: Ein Wirrkopf ist er nicht. Das sagt ihm sein Herz. Vielmehr hat er das Gefühl von ihm geprüft zu werden, ohne zu wissen, was er tun oder sagen muss, um die Prüfung zu bestehen. Er fühlt sich unbehaglich. Einerseits ist ihm alles an diesem Mann fremd, andererseits spürt er ein tiefes Vertrauen, das er sich nicht erklären kann. Und auch wenn er seltsam ist, irgendwie beeindruckt ihn dieser Greis, seine bewegte Vergangenheit, vor allem aber seine kraftvolle Gegenwart. Semis Neugierde ist geweckt. Und außerdem hat er eh keine Wahl. Wie zur Antwort, nimmt er seine Binse zur Hand, taucht den Pinsel in die Tinte, hält ihn über dem Papyrus bereit und blickt erwartungsvoll zum Gottesmann hinüber.
4
Meine ersten Lebensjahre verbrachte ich in Gibea, auf einem Hügel unweit der heiligen Stadt. Schon als ich drei oder vier Jahre alt war, zogen wir von dort nach Jerusalem. Aber als mich chaldäische Soldaten meiner geliebten Heimat entrissen, verfolgten mich Bilder und Gerüche aus den Gassen und Häusern der Stadt meiner Herkunft. Ich litt furchtbar unter der Trennung von Mutter und Geschwistern. Doch Gott zeigte Erbarmen und ließ mich nicht ohne Begleitung in die fremde Welt unserer Feinde ziehen. Er stellte mir meine Freunde zur Seite, die die Chaldäer ebenfalls zur Überführung an den Hof des Königs bestimmt hatten. Hananja war der Sohn eines Hauptmannes, der wie mein Vater bei der Belagerung Jerusalems ums Leben gekommen war. Mischaels Vater war Verwalter am Hofe Jojakims gewesen. Die Besatzer hatten ihn begnadigt. Asarja schließlich war der Sohn eines einflussreichen Bauherrn, der im Dienste des Königs mehrere Verteidigungsanlagen errichtet hatte. Es hieß, die Chaldäer hätten ihn ebenfalls verschleppt. Soweit wir wussten, gehörte er jedoch nicht unserer Schar an.
Wir waren nach den Gesetzen des Herrn erzogen. Wir hielten uns für Kinder Jahwes, eines Gottes, der allen heidnischen Göttern himmelhoch überlegen war. Und je weiter wir uns vom Land unserer Väter entfernten, je stärker wir umgeben waren von fremden Sprachen, Speisen und Sitten, umso mehr hielten wir uns selbst für überlegen, nicht nur von schöner Gestalt und gebildet, sondern auch von Gott erwählt, Söhne Abrahams, vom Herrn für würdig erachtet geprüft zu werden. Deshalb blickten wir auf die Ungläubigen herab, rümpften unsere Nasen, wenn sie ihre derbe Kost zubereiteten, machten uns über die sonderbare Tracht ihrer Priester lustig, wandten uns ab, wenn sie ihre Gebete sprachen. Ja, wir waren hochmütig. Meine Freunde sind deswegen durchs Feuer gegangen, durch eine Glut, die ihre Herzen von Dünkel und Eitelkeit befreite, die ihre Seelen läuterte. Für mich hatte der Herr jedoch andere Prüfungen vorgesehen.
Wir zogen zunächst nach Norden zur großen Oasenstadt Tadmur, von dort weiter nach Resafa, wo wir uns endlich ostwärts wandten. Nach mehreren Wochen durch wüstes Land und Hitze erreichten wir schließlich den Euphrat. Ich war überwältigt. So einen mächtigen Strom hatte ich nie zuvor gesehen. Vor allem aber begeisterte mich der Reichtum der Flussauen: weitläufige Palmenhaine, wogende Gersten- und Weizenfelder, riesige Pistazienbäume, schwere Weintrauben an üppig rankenden Rebstöcken, gut gepflegte Gärten mit brusthohen Sesampflanzen und zahlreichen Hülsenfrüchten an Aufbauten aus kunstvoll zusammengesteckten Holzstangen. Viele Menschen lebten hier und allen schien es gut zu gehen. Überall sah man lebensfrohe und gut genährte Kinder, die miteinander spielten oder ihren Eltern bei der Arbeit halfen. Sogar das Vieh machte einen gesunden, ausgeglichenen Eindruck. Es war offensichtlich, dass wir ein gesegnetes Land betraten. Ich dachte an meine Heimat, an die oftmals kargen Erträge der Felder, wenn der Regen nur spärlich gefallen oder gänzlich ausgeblieben war. Hier schien der Fluss das Land ständig mit ausreichend Wasser zu versorgen. Ich weiß noch, dass mir damals mit dem Blick auf das satte Grün dieser blühenden Flure erste Zweifel kamen. Ich fragte mich, ob nur Kanaan das Land sei, in dem Milch und Honig fließen. Könnten nicht auch andere Lande vom Himmel begünstigt sein, unter Gottes Gnaden stehen? Ich wusste natürlich, was man sich in Juda über den Reichtum der Chaldäer sagte. Schon als Zwölfjähriger hatte ich Berichten von Händlern und Gesandten über goldene Türme und riesige Städte im Zweistromland gelauscht. Aber immer hieß es, die Heiden hätten alles nur auf ihren Feldzügen erbeutet, sie seien ein Volk von Kriegern und Räubern.
Doch was ich nun mit eigenen Augen sah, strafte diese Erzählungen Lügen. Diese Menschen waren keine Eroberer, keine mordlustigen Diebe oder Plünderer, sondern friedliche Hirten und fleißige Bauern. Am meisten aber beeindruckte mich, dass die Bewohner dieser Auen offensichtlich glücklich waren. Es wurde viel gescherzt und gelacht. Die Menschen halfen sich gegenseitig, teilten die Erträge ihrer Gärten miteinander oder trieben einen regen Tauschhandel. Wie ich später erfuhr, mussten sie zwar Abgaben entrichten, aber die Steuerlast war nie drückend, wurde nie als ungerecht empfunden und den Menschen blieb genug übrig um ihre Kinder und Knechte zu ernähren. Auch meine Freunde betrachteten alles mit großen Augen. Ich sah ihnen an, dass sie verwirrt waren. Es ging ihnen wie mir. So hatten wir uns die Heimat unserer Feinde nicht vorgestellt. Es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Wirklichkeit dieses großen Reiches unsere Vorurteile widerlegte.
Wir zogen am Fluss entlang weiter in den Süden. Überall wurden wir von den Einheimischen neugierig beäugt, stießen aber nirgendwo auf Feindseligkeit. Manche tuschelten, manche lachten, andere riefen den Soldaten etwas zu, das wir nicht verstanden. Einige Kinder trauten sich nah an uns heran, plapperten aufgeregt und fragten uns irgendetwas. Wir sagten ihnen unsere Namen. Manchmal standen die Leute nur stumm da und betrachteten die vorbeiziehende Schar. Doch kann ich mich nicht erinnern, dass wir jemals beschimpft wurden und nie habe ich erlebt, dass man faule Früchte oder Steine nach uns warf.
Schließlich gelangten wir nach Babylon. Schon von weitem sahen wir die hoch aufragenden Mauern, die damals gerade verstärkt und teilweise neu errichtet wurden. Je näher wir kamen, umso mehr staunten wir über die Ausmaße der Befestigungsanlagen. Wir sahen hunderte, vielleicht sogar tausende Arbeiter, die zu Bautrupps eingeteilt waren und unermüdlich gebrannte Ziegel, Geröll und Erde heranschleppten und hinaufbeförderten. Als wir durch eines der Tore schritten, erkannten wir hinter dem wuchtigen Wall eine zweite Mauer, die fast genauso hoch war wie die erste. In der Schlucht zwischen den Wällen hoben weitere Arbeiter einen tiefen Graben aus. Unaufhörlich entstiegen halbnackte Männer mit schweren Körben auf ihren Rücken der Grube und trugen den lehmigen Aushub hinauf zur breiten Dammkrone der äußeren Mauer. Wir wussten es damals noch nicht, aber im zweiten Jahr unserer Verschleppung würden wir oben auf der inneren Mauer zwischen den Zinnen stehen und gebannt verfolgen, wie das Wasser des Euphrats den Graben flutet. Auch die Stadt selbst war Schauplatz großer Bauarbeiten. Im Vorbeigehen erkannten wir, wie eine sehr breite, gerade Straße aufwändig mit Ziegeln, Erdpech und großen Steinplatten angelegt wurde. Wir konnten nicht umhin die Sorgfalt der Bauherren zu bewundern. Lange verweilen durften wir allerdings nicht. So nah am Ziel hatten unsere Bewacher es offenbar eilig ihre „Beute“ abzuliefern. Meine drei Freunde und mich führten sie zu einem schlichten und offenbar neuen Gebäude. Dort wies ein Aufseher uns einen Wohnraum zu. Wie wir bald erfuhren, hatte man uns in der weitläufigen Palastanlage des Königs untergebracht.
Es zeigte sich, dass man bereits viele Verschleppte in das Haus gebracht hatte, junge Männer aus Ninive und Kalach, aus Mazamua und Arrapcha in den Bergen, aus Karkemisch und Damaskus, aus Gasa und Arwad am Oberen Meer, aber auch aus Schuschan. Es waren ausnahmslos Söhne bedeutender oder vermögender Väter. Sie waren wie wir: jung, gebildet, stolz und mit edlen Zügen. Wir hatten inzwischen ein wenig Aramäisch gelernt und erfuhren von ihnen, dass wir Diener am Hof des Königs werden sollten. Das bestätigte uns der Oberkämmerer Aschpenas, der am Abend unserer Ankunft erschien. Wir sollten, so sprach der Verwalter, uns glücklich preisen und Marduk, dem großen Wohltäter des Reiches, danken, dass er uns diese Ehre zuteilwerden ließ. Der weise Monarch Nabu-kudurri-usur wünsche eine kluge, in den Wissenschaften bewanderte Dienerschar, die besten Köpfe aus allen Teilen seines großen Reiches. Noch aber, so betonte Aschpenas, seien wir nicht mehr als Lehm aus dem Boden einiger Randprovinzen. Es käme nun darauf an, unsere Rohmasse wie Tonziegel zu gestalten, sie in bewährte Formen zu pressen, das königliche Siegel in unsere Seelen einzudrücken, uns einen umfassenden Eindruck von der Größe und Würde des Hofes zu vermitteln, und schließlich unsere Bildung mit einer Glasur aus chaldäischer Weisheit zu veredeln. So sprach der Kommissar und wir merkten wohl, dass er es liebte dergestalt zu reden. Und dann hielt der stolze Mann eine Lobrede auf seinen Herrn, den Herrscher der vier Weltgegenden, den mächtigen Sohn des siegreichen Nabu-apla-usur.
Was die Machthaber genau mit uns vorhatten, erfuhren wir erst am nächsten Morgen, als der Aufseher Wardum erschien, der drei Jahre lang unser Betreuer bleiben sollte. Drei Jahre – so lange würde unsere Ausbildung zu Hofdienern dauern. In dieser Zeit hätten wir Aramäisch und Akkadisch zu lernen, Sternen- und Heilkunde, Rechtsprechung und Baukunst. Während dieser Jahre der Lehre, so versicherte uns Wardum erfreut, seien wir Gäste des Königs. Der Herrscher selbst hätte die Hofküche angewiesen die fremden Lehrlinge täglich mit frischem Fleisch und Wein zu versorgen. Wir waren überrascht. Das war ein sehr großzügiges Angebot, gewiss, einem edlen Herrscher würdig. Keiner von uns hatte damit gerechnet, so freundlich empfangen und bewirtet zu werden. Dessen ungeachtet mussten meine Freunde und ich die höflichen Gaben ablehnen. Unser Glaube hielt uns dazu an, genaue Speisevorschriften zu beachten. Die Braten dieser fremden Leute zu essen und ihren Wein zu trinken, wäre ein grober Verstoß gegen die Gesetze unseres Propheten gewesen. Die Freigiebigkeit des Königs brachte uns in Verlegenheit. Was sollten wir tun? Ich hatte in Wardum sogleich einen freundlichen, hilfsbereiten Menschen erkannt und so bat ich ihn um eine kurze Unterredung. Sobald wir alleine waren, schilderte ich ihm unsere Gewissensnot. Keineswegs, so betonte ich, wollten wir den König beleidigen oder seine hochherzige Gastlichkeit verachten. Der Monarch könne ja nicht wissen, dass der Gott Israels seinem Volk für die Mahlzeiten genaue Anweisungen gegeben hat. Ich bat den Aufseher uns statt Fleisch und Wein lediglich Gemüse und Wasser vorzusetzen. Ich bat für mich und meine Freunde um eine Ausnahme. Als ich geendet hatte, blickten seine wässrigen Augen mich bedauernd an. Er verstehe zwar, beteuerte Wardum, dass es uns wichtig sei, aber er könne für uns keine Sonderbehandlung bewilligen. Er sorgte sich offenbar um unser Wohlsein und nahm an, dass uns die pflanzliche Nahrung bald blässlich und schwach aussehen lassen würde. Wenn der König das sähe, raunte der Aufseher, träfe mich sein ganzer Zorn. Der brave Mann fürchtete sich vor seinem Herrn. Ich versuchte ihn zu beruhigen und schlug ihm eine Probezeit vor. Zehn Tage lang sollte es uns gestattet sein, nur Wasser und Gemüse zu uns zu nehmen. Danach sei es an ihm, unserem Betreuer, zu beurteilen, ob wir durch das karge Essen an Kraft und Farbe verloren hätten. Weil es seinem Wesen entsprach seine Mitmenschen bei ihren Bemühungen zu unterstützen, willigte Wardum schließlich ein. Nach zehn Tagen war er überrascht und sehr erleichtert, als er uns Judäer begutachtete. Keine Spur von Blässe oder Schwäche! Unsere Glieder waren fest und kraftvoll, unsere Haare und Fingernägel dick und glänzend, unsere Haut rein und makellos, unsere Augen klar und leuchtend. Nun war Wardum überzeugt, dass uns die pflanzliche Kost gut bekam. Wir jedoch wussten, dass Gott allein für unser Wohlbefinden gesorgt hatte und weiter sorgen würde.
5
„Wie? Ihr wollt entschädigt werden? Habt Ihr die Aufzeichnungen denn schon beendet?“
Semi weicht den Augen des Kommissars aus. Er hat heute Morgen lange mit sich gerungen, bis er endlich das Herz hatte hierher zu kommen. Nun scheint ihn der Mut schon wieder zu verlassen. Einen Moment lang überlegt er, Schutruk um Verzeihung für sein ungehöriges Eindringen zu bitten und diesen Innenhof unter tiefen Verbeugungen schnell wieder zu verlassen. Das wäre gewiss besser als von den Wachen rüde hinausgeworfen zu werden. Dann aber ermannt er sich und hebt entschlossen sein Haupt. Ich komme ja nicht als Bittsteller, denkt er beherzt, will keine Almosen erbetteln. Es steht mir doch zu, was ich möchte. „Verzeiht, Herr, aber ich sehe mich gezwungen um einen Vorschuss zu bitten. Zwei Tage war ich nun beim hochwürdigen Beltschazar und vieles hat der weise Fürst bereits meiner Binse anvertraut. Nun zeigt sich aber, dass noch viele Tage werden folgen müssen, vielleicht sogar Wochen. Ich habe Weib und Kinder, zwei Lehrlinge, Knechte…“ Semi beißt sich auf die Unterlippe. Verflucht, denkt er, jetzt rede ich doch wie ein Bittsteller. Er setzt neu an. „Ich habe Unkosten, Herr. Wie jetzt schon absehbar ist, werde ich mehrere Buchrollen benötigen. Ihr habt gewiss Kenntnis davon, dass hochwertiger Papyrus – und nur solcher kommt für diesen Auftrag in Frage – teuer ist. Die Händler erlauben mir nicht, mich bei ihnen zu verschulden. Sie geben ihre Ware nur gegen Silber heraus.“
Schutruks strenger Blick nimmt den Schreiber prüfend in Augenschein. Dann nickt er langsam, fast unmerklich, und schlendert in Gedanken versunken zu einer Liege hinüber. Als er sich hingesetzt und zurückgelehnt hat, lässt er seine kalten Augen erneut auf Semi ruhen. Schließlich gibt er sich versöhnlich und leutselig. „So, so, der große Beltschazar hat viel zu erzählen…“ Auffordernd streckt der Kommissar das Kinn vor.
„Gewiss, Herr. Der Fürst blickt auf ein langes Leben zurück. Und er scheint sich an viele Begebenheiten gut erinnern zu können.“
„Was…ähm…erzählt er denn so?“
Semi erschrickt ob dieser Frage. Sofort wittert er Gefahr. Sein Herz fängt wie wild an zu hämmern. Seine Gedanken geraten in einen Strudel. Was erwartet der Kommissar? Für jeden Schreiber zwischen dem Oberlauf der großen Flüsse und dem Meer von Pars heißt das erste Gebot – Verschwiegenheit. Der Sprecher schreibt nicht, der Schreiber spricht nicht. Wie oft hat sein Meister ihm diesen Satz ins Gemüt gehämmert? Noch bevor der Lehrling in der Lage ist auch nur einen Pinsel zu schnitzen, hat er schon Eines gelernt: Du schweigst – unter allen Umständen! Was du geschrieben, gehört dem, der es gesprochen hat. Semi weiß nur zu gut, dass seinesgleichen unweigerlich in Schwierigkeiten gerät, wenn er nicht gelernt hat, die ihm anvertrauten Geheimnisse des Sprechers zu wahren. Es gab Fälle in der Vergangenheit, in denen Schreiber verklagt wurden und schließlich hohe Bußgelder zahlen mussten oder gar die amtliche Erlaubnis verloren, ihr Handwerk auszuüben. Aber das ist dann auch schon bedeutungslos, denkt er düster, denn wer einmal bekannt ist als ein Schreiber, der seine Zunge nicht zu hüten vermag, bekommt eh keine Aufträge mehr.
Schutruk richtet sich auf, wendet sich dem Schreiber zu.
„Nun, ich höre…“
Semi sieht sich in Bedrängnis. Er fragt sich, ob der Kommissar ihn auf die Probe stellen will. „Herr, wie Ihr wisst, erlaubt mir das Gesetz nicht, darüber zu reden.“
„Das Gesetz? Das Gesetz? Ihr steht im Dienst des Königs, Mann. Seine Hoheit Kurasch von Persien, unser aller König, ist das Gesetz.“
Semi versucht sich noch einmal aus seiner misslichen Lage zu befreien. „Ich kann mir vorstellen, dass Beltschazar dem König gerne Bericht erstattet und …“
„Vergesst nicht“, schleudert ihm Schutruk entgegen und deutet mit ausgestrecktem Zeigefinger auf ihn, „welche Hand Euch nährt, Schreiber, woher alles Silber kommt! Vergesst niemals, wem Ihr Dank schuldet!“ Dann setzt er sich wieder hin, richtet seinen Umhang und mustert den Schreiber missbilligend. „Also …?“
„Er erzählt von früher, Herr…“
„Was?“
„Wie er als Knabe hierher kam.“
Der Kommissar seufzt. „Ahura, steh mir bei, die alten Geschichten!“
„Oh ja, Herr, uralt. Wenige sammeln so viele Jahre wie dieser Fürst. Und nun, am Ende seines Weges, denkt er an die Anfänge zurück. Bloß Kindheitserinnerungen, Herr…“
„Spricht er missbilligend über das Volk der Chaldäer?“
„Mit keinem Wort, Herr!“
„Redet er von seinem Glauben?“
„Eigentlich bewundert er die ganze Zeit nur die Größe und Herrlichkeit des Babylonischen Reiches, Herr.“
„Keine Bekenntnisse, keine Schmähungen?“
„Nicht einmal eine Andeutung, Herr.“
Schutruks Miene verrät weder Missfallen noch Befriedigung. Er winkt einen Diener herbei und flüstert ihm etwas zu, worauf der Mann sich eilig entfernt. Dann wendet sich der Kommissar wieder Semi zu. „Beim Verlassen des Hohen Hauses wird man Euch 20 Schiklum übergeben. Das müsste Euch für deine nächsten Ausgaben hinlänglich entschädigen.“
Semi verbeugt sich erleichtert und will sich entfernen.
„Hört zu, Schreiber, Ihr werdet mich auf dem Laufenden halten. Wenn sich Beltschazar über seinen Glauben auslässt, will ich es erfahren. Sofort.“
Semi nickt vage und ist froh, als er den Ort endlich verlassen kann.
6
Als die drei Jahre unserer Ausbildung vorbei waren, wurden wir dem großen Herrscher vorgeführt. Bis dahin hatten wir den König nur aus der Ferne gesehen, etwa bei den jährlichen Götterfesten. Dort aber waren wir immer nur Teil einer riesigen jubelnden Menge und kaum in der Lage gewesen den Monarchen genauer zu betrachten. Jetzt endlich war der Tag gekommen, an dem wir dem großen Nabu-kudurri-usur gegenüberstehen sollten. Man ließ uns in einen sehr weitläufigen Saal eintreten, wo wir uns in einer langen Reihe aufstellen mussten. Da standen wir nun: vierzig redegewandte, kluge und ehrgeizige Schönlinge, die wie die meisten jungen Männer ihren Wert maßlos überschätzten. Insgeheim dachte wohl jeder von uns, den Machthaber mit seiner geistvollen Erscheinung beeindrucken zu können. Auch ich war, wie ich mit Bedauern gestehe, damals sehr von mir selbst eingenommen. Als der König schließlich die Halle betrat, lediglich begleitet von Aschpenas, der wenige Schritte hinter ihm ging, spürte ich sogleich diesen unbedingten Herrscherwillen, der mir auch später immer wieder imponieren sollte. Nabu-kudurri-usur hatte etwas Gebieterisches an sich, das einerseits erschreckte, andererseits aber auch ein Gefühl von Sicherheit verlieh. Wer sich mit ihm anlegen wollte, hatte gewiss Grund sich zu fürchten. Wer jedoch bereit war seine Herrschaft anzuerkennen, konnte mit seinem Schutz und seiner Großzügigkeit rechnen. Er hatte sich schon früh im Felde bewährt. Noch unter seinem Vater Nabu-apla-usur war er als Heerführer gegen die Völker am Oberen Meer gezogen. Wegen seiner Unerschrockenheit und Durchsetzungskraft hatte er rasch die Anerkennung und Bewunderung seiner Kämpen erworben. Wir frisch geformte Höflinge wussten natürlich von seinen siegreichen Schlachten und hartnäckigen Belagerungen. Von den Chaldäern waren wir zu Chaldäern erzogen worden. Wir hatten gelernt uns als Mitsieger und nicht länger als Besiegte zu betrachten. Deshalb leuchteten unsere Augen vor Ehrfurcht, als der mächtige Herrscher unsere Reihe abschritt.
Unsere Bewunderung schien den Monarchen jedoch nicht zu berühren. Er fing an uns Fragen zu stellen. Einen stämmigen Offizierssohn aus Kalach fragte er, wer am besten für die Wasserverteilung im Land zuständig sein sollte. Müsste die Aufgabe in den Händen der Dorfältesten bleiben, wie es bisher der Fall war, oder sollten sich Hofbeamte darum kümmern, wie manche Statthalter empfahlen? Einen dunkelhäutigen Mann ägyptischer Herkunft fragte er, wie die vielen Schrifttafeln des Hofes aufgehoben werden müssten. Wie könnte dafür gesorgt werden, dass bestimmte Schriften schnell wieder zur Hand wären? Wen sollte man mit dieser Aufgabe betrauen? Wieder einen anderen befragte er nach den Kosten und Nutzen der Ziegelbrennerei. Es waren stets Fragen, die sich um Brauchbarkeit, Zweckmäßigkeit und geeignete Lösungen für lebensnahe Probleme kreisten. Ich bewunderte die ausgewogenen Antworten meiner Kameraden, die geschickte Darstellung der jeweiligen Vor- und Nachteile. Alle vermieden es sich eindeutig für die eine oder andere Möglichkeit auszusprechen, wohl um letztlich dem König die Wahl zu lassen. Aber mir entging nicht, dass unserem Herrn und Förderer dieses Lavieren missfiel.
„Du da“, sagte er auf einmal und zeigte auf mich, „welches Land sollten wir als nächstes erobern?“ Ich bemerkte, wie meine Freunde mich von der Seite erschrocken anschauten, als wollten sie mich mit den Augen warnen: Sei bloß vorsichtig! Aber mir war ohnehin klar, dass mich der Monarch mit dieser Frage in eine Schlangengrube gestoßen hatte. Eine falsche Bewegung, ein falsches Wort und ich würde empfindliche Bisse davontragen. Trotzdem verspürte ich keine Angst, oder genauer gesagt nicht meine Angst. Etwas an der Frage verwirrte mich und ich brauchte einige Augenblicke, bis mir klar wurde, was es war: Sie passte sonderbarerweise nicht zum Fragensteller. Ich konnte seiner Hoheit Hunger nach weiteren Eroberungen nicht sehen, aber ich fühlte etwas anderes. Ich fühlte in mir selbst des Königs Sorge um den Erhalt seines riesigen Reiches. Nabu-kudurri-usur erkundigte sich zwar nach einer weiteren Ausdehnung, aber seine eigentliche Frage war: Wie kann ich dieses Reich zusammenhalten? Das war das Problem, das ihn zunehmend umtrieb. Ich erkannte es so deutlich wie die rötlichen Adern in den Steinplatten zu meinen Füßen.
„Eure Hoheit“, begann ich, „schon jetzt brauchen Boten mehrere Wochen um Euren Befehl an die Grenzen des Reiches in den Nordwesten zu tragen. Und weitere Wochen verstreichen, bis Euch von dort eine Antwort erreicht. Würde das Reich sich noch weiter ausdehnen, könnte die Verbindung in die Grenzgebiete leicht ganz abbrechen. Die Gefahr bestünde, dass Euer Reich in einzelne Landesteile zerfiele. Deshalb, Hoheit, ist jetzt die Stunde gekommen, für den Zusammenhalt von Land und Volk zu sorgen.“ Ich sprach ganz ruhig und verspürte auch keine Scheu vor dem mächtigen Herrscher. Der nun musterte mich genauer, kam auf mich zu und blieb unmittelbar vor mir stehen. „Wie heißt du?“, fragte er mich und ich nannte ihm meinen chaldäischen Namen. „Beltschazar“, meinte er dann, „sprich und sage mir, wie deiner Meinung nach für den Zusammenhalt im Reich gesorgt werden soll? Was würdest du deinem Monarchen raten?“ Mag sein, dass es den König damals beliebte seinen Spott mit diesem anmaßenden Jüngling in seinem Thronsaal zu treiben. Wenn es so war, muss es mir entgangen sein. Vielmehr ging ich ernst und ausführlich auf seine Nachfrage ein.
„Hoheit, die Antwort auf Eure Frage liegt nicht weit von hier vor allen Augen ausgebreitet, zwischen der alten Stadt am Ostufer und den neuen Vierteln drüben am Westufer. Einst befahlt Ihr den Bauherren des Hofes eine gewaltige Brücke über den breiten Strom zu errichten. Doch kein Baumstamm war lang und kräftig genug, 230 Ellen Wasser zu überspannen. Und ein Steingebälk, das lediglich auf den Gestaden aufruht, wäre eingebrochen. Wie also wurde die Weite des Euphrats überbrückt und Ost und West miteinander verbunden? Nun, wir wissen alle, wie die Baumeister das Problem lösten. Sie verteilten die Last des Gebälks auf mehrere Stützen, die sie auf dem Grund des Flusses bauen ließen. Hoheit, die Brücke ist ein erhabenes Bild Eurer Macht und Größe. So wie sie getragen wird, wird auch Eure Herrschaft gesichert: durch mächtige Stützen in den Weiten des Reiches.“
Als ich innehielt, weil ich meinte alles Nötige gesagt zu haben, war es plötzlich so still, als hätte ein Dämon uns alle in steinerne Statuen verwandelt. Nabu-kudurri-usur schwieg zunächst und schien verärgert zu sein. Er ging hinüber zu seinem Thron, nahm die wenigen Stufen im Schwung und ließ sich nieder. „Willst du damit sagen, Beltschazar“, fragte er schließlich, „dass die oberen Städte mir nicht treu ergeben sind?“ Dank dem Dünkel meiner Jugend scheute ich mich nicht darauf zu antworten. „Hoheit, Treue setzt ein Gefühl der Verbundenheit voraus, so wie die Bande des Blutes zwischen dem Sohn und seinem Vater. Die Städte des Reichs aber haben alle ihre eigenen Götterkulte und die Priester sind ihrem eigenen Tempel näher als dem Palast im fernen Babylon. Nippur hat den Enlil-Kult, Eridu den Ea-Kult, Uruk den Anu-Kult, Harran ehrt vor allem Sin, in Borsippa beten die Menschen zu Nabu und Nusku, in Sippar vor allem zu Schamasch. Unnötig die Aufzählung fortzuführen. Und als wäre das noch nicht genug, gibt es darüber hinaus die verschiedenen Riten der fremden Völker am Oberen Meer oder in den Bergen am Oberlauf der Flüsse.“ Du scheinst ja gut informiert zu sein“, unterbrach mich der König. „Was würdest du deinem Herrn raten?“ In dem Moment erst bemerkte ich, wie weit ich mich vorgewagt hatte. Aber mir war auch klar, dass ich jetzt nicht einfach verstummen konnte. Also straffte ich mich innerlich und machte meinen Vorschlag. „Hoheit möge in Erwägung ziehen, neben Babylon eine zweite, vielleicht sogar eine dritte Residenz weiter flussaufwärts zu erwählen. Ihr, Hoheit, Ihr allein seid das, was uns alle vereinigt. Zeigt Euch Eurem Volk, gebt den Söhnen des Volkes einen Vater, der ihnen nahe ist!“
7
„Nun“, lächelt der graue Fürst, „er hat mir nicht gleich den Kopf abschlagen lassen, der große König. Ich hatte Glück“, stellt er fest und grinst in Richtung Schreiber, dessen melodischer Stimme die heutigen Aufzeichnungen nochmal zum Klingen gebracht hatte.
Semi ist sich nicht sicher, ob er darauf etwas erwidern soll. Bis jetzt hat der Alte mit ihm nicht ein Wort über das Geschriebene gesprochen. Wenn der Mann von Früher erzählt, ist es, als tauche er ein in einen Strom, der ihn davonträgt, weit weg. Aber nun hat er zu ihm gesprochen, hier und jetzt, hat eine launige Bemerkung gemacht, ganz entspannt, fast schon leutselig. Semi erwidert den Blick des Alten. „Hattet Ihr gar keine Angst, Herr?“
„Angst?“ Der Greis denkt einen Moment nach. „Ich fürchtete nicht um mein Leben, nicht bei meiner ersten Begegnung mit Nabu-kudurri-usur und auch später nicht. Aber schon immer habe ich mich gefürchtet nicht zu genügen, die Erwartungen der anderen nicht erfüllen zu können. So war es auch damals. Ich stand dort in diesem riesigen, herrlich geschmückten Thronsaal vor dem größten Herrscher der Welt und – hatte Angst ihn zu enttäuschen.“ Er hebt den Kopf und schaut den Schreiber an. „Du bist überrascht? Sprich!“
„Nun, Herr, es stimmt. Ich bin verwundert“, beginnt Semi unsicher. „Nach Eurem Bericht zu urteilen, macht der junge Höfling Beltschazar auf mich keinen schüchternen, erst recht keinen eingeschüchterten Eindruck. Im Gegenteil! Beherzt und mit viel Überzeugungskraft beantwortet er die ausgesprochen heikle Frage des Monarchen. Er traut sich sogar dem Herrscher einen weitreichenden Ratschlag zu ...“ Plötzlich bricht Semi ab. Was ist bloß über ihn gekommen, dass er so daherredet? Beschämt senkt er das Haupt, überzeugt, den Greis nun verärgert oder gekränkt zu haben.
Doch der alte Mann lächelt bloß und nickt zustimmend. „Ich verstehe deinen Einwand, mein Junge. Aber so sind wir Menschen: widersprüchlich, wie ein Gewand, das man aus vielen Fetzen zusammengeflickt hat. Wir sind beileibe nicht wie die Götter – oder Engel, wie ich sie nenne. Deren Gewänder sind nahtlos, deren Wesen ist ohne Brüche wie ein unversehrtes Widderhorn, und deshalb ist ihr Ton immer klar und stimmig. Selbst die Tiere sind in ihrer Art stimmig, verhalten sich nicht widersinnig. Aber wir Menschen müssen uns immer aufs Neue mit Gegensätzen plagen. Wir denken Ja – aber auch Nein. Wir fühlen Liebe – aber auch Hass. Wir tun etwas – und ärgern uns, wenn es andere auch tun. Ja, es stimmt, ich sprach damals am Hofe Nabu-kudurri-usurs ziemlich verwegen und eifrig. Ich fürchtete mich zwar den Anforderungen des Herrschers nicht zu genügen, glaubte in meinem Innersten aber gleichzeitig felsenfest, etwas ganz Besonderes zu sein. Und ich war ja auch etwas Außergewöhnliches, nicht wahr? Ein Kind Gottes in der Hauptstadt der Heiden, ein Seher im Lande der Blinden?“
Semi reißt entsetzt seine Augen auf. Nun war es gesprochen, das abfällige Wort. Im Geplauder nach der Arbeit, im gemütlichen Licht der untergehenden Sonne hatte der Alte es abgelegt, sein Bekenntnis. Kind Gottes hat er sich genannt – und Heiden uns Chaldäer. Semi erschaudert, als ihm klar wird, dass er diese Äußerungen wird melden müssen.
Der Greis sieht die Bestürzung im Gesicht seines Schreibers, grinst breit und fängt an zu lachen. Es ist ein vergnügtes Lachen ohne eine Spur von Boshaftigkeit. Dann wird er wieder ernst. „Siehst du, Semi, jetzt bist du erneut auf meinen Hochmut hereingefallen, wie schon beim Lesen meiner Aufzeichnung. Aber das kenne ich inzwischen zur Genüge. Sogar wenn ich scherze und mich selbst verspotte, glauben die Menschen, ich meine es ernst. Ich habe aufgehört, mich darüber zu wundern.“
Der Schreiber hockt weiter angespannt am Boden, sein Blick geht starr ins Leere. Die Beteuerung des Alten, er habe nur gescherzt, scheint ihn nicht erreicht zu haben.