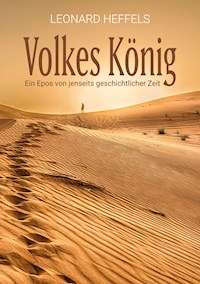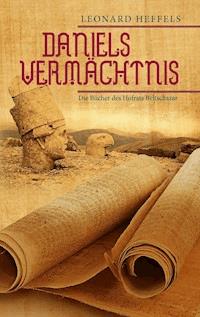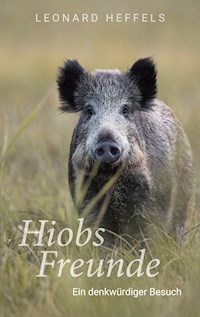
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Männer suchen ihren gemeinsamen Freund Hiob, der sich in die Ödnis zurückgezogen haben soll. Als sie ihn finden, sehen sie sich einem himmelschreienden Leid gegenüber, das den einst vom Erfolg Verwöhnten über Nacht heimgesucht hat. Das böse Schicksal des alten Freundes weckt in jedem von ihnen tief sitzende Ängste. Alles, was die Freunde Hiob erwidern, raten oder vorwerfen, offenbart diesem, wovor sich die Männer selbst am meisten fürchten. Auch Hiob kennt die Angst. Als er noch gesund und wohlhabend war, plagte ihn oft das Gefühl, seines Glückes nicht wert zu sein. Doch nun ist er entschlossen, für seine Würde zu kämpfen und gegen sein Los aufzubegehren. Aber ein Held ist er nicht, weil er sich mit Gott anlegt, weil er sich traut dem Herrn die Stirn zu bieten. Tapfer und weise zugleich ist der Gottverlassene nur, weil er der Angst nicht gestattet, ihn zu beherrschen. Damit lässt er auch die Gottesfurcht hinter sich und wagt den Weg des Vertrauens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leonard Heffels studierte Kunst in Maastricht und Pädagogik in Amsterdam. In seinem literarischen Werk setzt er sich intensiv mit biblischen Themen auseinander und bewegt sich dabei im Grenzbereich zwischen Lyrik und Prosa, so zum Beispiel in „Wer mit Gott geht…“ und „Volkes König“. Auch seine Novelle „Marthas Geschick“ ist geprägt von einem lyrischen Sprachstil, der eine große atmosphärische Dichte schafft. Damit wirft er ein neues Licht auf ihre Protagonisten, die einfühlsam und tiefsinnig dargestellt werden. Bei TWENTYSIX erschienen von ihm ferner der historische Roman „Daniels Vermächtnis“, „Dinahs Ehre“ und der unkonventionelle Glaubensroman „Sieben“. Unter dem Pseudonym Nerodal Feh Fesl veröffentlichte er den zweiteiligen Roman „Die Vorbotin“.https://www.leonard-heffels.org
Die Personen
Hiob
Der einst sehr erfolgreiche und vermögende Mann ist eine Kämpfernatur. Durch harte Schicksalsschläge hat er in kurzer Zeit alles verloren, am Ende auch seine Gesundheit.
Bildad
Der Bronzeschmied ist ein Freund Hiobs aus besseren Zeiten. Er bestimmt gern, wie etwas gemacht wird, und ist für seinen Starrsinn bekannt.
Elifas
Der einfühlsame und hilfsbereite Freund Hiobs ist heilkundig, aber manchmal auch etwas mutlos.
Zofar
Der dritte Freund Hiobs zeichnet sich durch seinen Geiz aus. Er gilt als übertrieben sparsam und prangert gern die mutmaßliche Verschwendung anderer an.
Elihu
Der junge Priester wirkt distanziert und hochmütig. Offensichtlich verfügt er mehr über Bücherwissen als über Weisheit.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
1
Langsam hebt er sein verhülltes Haupt, darauf bedacht kein Geräusch von sich zu geben. Aber seine Vorsicht ist unbegründet. Zutraulich ist es geworden, das Schwein, denkt er und blickt auf das graubraune Tier, das im Schatten der Felsen leise grunzend wühlt. Es traut sich hierher, völlig arglos oder unbekümmert bis nah an mein Bergloch. Ganz kurz nur hebt es den Kopf, blickt zu mir herüber und senkt seinen Rüssel wieder in den Schlamm. Es hat mich bemerkt, denkt er, es hat mich gesehen und gesehen, dass es gut ist. In diesem kurzen Moment nur, da unsere Blicke sich kreuzten, noch bevor es blinzelte und wieder wegschaute, war klar, wo jeder von uns seinen Platz hat. Zumindest war es ihm so erschienen. Das massige Tier hatte irgendeine Wurzel ausgegraben und hielt nicht einmal mit dem Kauen inne. Aber es hatte die Lage erfasst, so als hätte es die Wahrheit aus der Wurzel gekaut, so als müsste es gar nicht genau hinsehen, sondern vielmehr gründlich kauen und die Situation erschmecken. Ich werde gekostet, denkt er, es nagt an mir, so wie ich selbst an mir nage, an der bitteren Frucht meines Baumes. Nun traut es sich, das Schwein, traut sich die Augen zur Erde hin zu senken, denn ich, das wird ihm klar, bin diesem Eber vertraut, graubraun verdreckt und versteckt in der Erde, im Spalt eines Felsens.
In der Nacht hat es geregnet, nicht stark, aber lange. Erst kurz vor dem Morgengrauen hörte es auf. Als die Sonne aufging, war der Himmel fast wolkenlos. Dann wurde die Luft dunstig, inzwischen ist sie warm und trocken. Zu trocken. Das grob gewobene Tuch seines Gewands scheuert auf der entstellten Haut. Er greift nach einer Tonscherbe, die er aufgehoben, aus dem Wasser gehoben, als er gestolpert und sein Krug am Felsen zerschellt war drüben beim Bach. Er griff noch im Straucheln danach und sah sogleich, mehr als dass er es spürte, wie sie scharfkantig seine Innenhand aufritzte. Eine dreieckige Scherbe war aus dem Krugganzen gebrochen, aber merkwürdig: Das untere Drittel des Gefäßes hatte sich abgelöst und war heil geblieben. Es war wie er selbst: aus dem Ganzen gebrochen, eine zerstörte Form, zerschlagen am Boden – und doch nicht gänzlich zerbrochen. Seitdem schöpft er Wasser mit dem Krugrest, führt ihn vorsichtig an die Lippen, als müsse der Mund die Schale erst noch herbeiflüstern.
Seine Hand hat inzwischen die Scherbe erstastet. Er schiebt sie unter den Ärmel seines Umhangs und schabt über schorfige Stellen, über die fleckige, gerötete Haut seiner Arme. Er beugt sich vornüber, um sich über Backe und Stirn zu kratzen und kratzt bis es blutet. Unter dem Druck der Scherbe, des heraus gebrochenen Stückes, brechen sie auf, die großen Geschwüre des Niedergerungenen.
Die Schweine sind einen Steinwurf weit ins Wäldchen hinein gelaufen. Er sieht sie nicht mehr, aber er hört sie im Unterholz grunzen. Weiter hinab hin zum Dorf sind die ersten Hirten unterwegs. Er hört das Blöken der Schafe, wenn der Wind zu ihm herüberweht. Die Leute aus der Siedlung dulden ihn, aber er weiß, sie tun es nur so lange, wie er hier draußen ausharrt. Ein alter Bauer überließ ihm etwas Stroh für sein steiniges Bergloch. Manchmal bringt ein Hirte ihm ein Stück Brot, ein paar Feigen oder eine Handvoll Erdmandeln. Sie geben willig, aber nicht so sehr aus Mitgefühl, mehr als ein Opfer, das man bringt, um ein übles Los fernzuhalten. So als wären sie bemüht einen bösen Dämon milde zu stimmen. Widerwillig, fast ängstlich lassen die Bauern ihn auf den Feldern nachernten. Sie wissen, was ihm geschehen ist, diesem Schweigsamen. So mancher fragt sich: Wie furchtbar muss der Frevel dieses Mannes sein, dass der Himmel ihn so unerbittlich bestrafte. Man sieht, wie er sich über das geschnittene Korn krümmt, die wenigen aufgelesenen Ähren in einem Stofffetzen gesammelt. Man sieht ihn die rohen Körner kauen, aus dem nahe gelegenen Bach trinken.
Viele wissen noch, obwohl man nicht mehr darüber spricht, wer dieser Mann einst gewesen ist. Ja, man weiß von den riesigen Herden, die er einst sein Eigen nannte, vom Glück seines Hauses, von kräftigen, kühnen Söhnen, von keuschen, sterngleichen Töchtern. Hoch angesehen waren sie alle – vor allem jedoch das Oberhaupt selbst. Es gibt noch einige im Dorf, die früher für ihn gearbeitet haben als Tagelöhner, als Schnitter und Helfer bei der Schafschur. Er war immer gut zu ihnen, gewiss. Aber dann hat er Gott schrecklich erzürnt, muss ihn erzürnt haben.
2
Bapur schaut auf von seiner Herde, als er seinen Ältesten kommen hört. Er sieht den Jungen behände über Steine hüpfen, sieht den Beutel schlaff an seiner Seite. „Hast du getan, was ich dir gesagt habe, Saruk?“, ruft er ihm zu.
„Ja, Vater. Ich habe alles auf den flachen Stein beim Wasser gelegt.“ Inzwischen ist der Sohn beim Vater angekommen und hockt sich zu ihm. Er schaut ihn prüfend von der Seite her an. „Er war nicht da, ich habe ihn zumindest nicht gesehen.“
Bapur schaut in die Ferne. Vielleicht hat er seinem Sohn gar nicht zugehört. Dieser versucht es noch einmal.
„Ihr habt mir nie erzählt, Vater, wer dieser Mann ist und weshalb wir ihm Essen bringen. Kennen wir ihn, ist er ein Verwandter, ein Knecht von früher vielleicht?“
„Ein Knecht war er nie, mein Junge, zumindest nicht so, wie du es meinst. Im Gegenteil! Viele Knechte hörten auf ihn. Auch ein Verwandter ist er nicht. Er ist ein Hebräer. Es ist noch gar nicht so lange her, da sah das Leben dieses Mannes noch ganz anders aus.“
„Wie, dieser alte Bettler in seinen dreckigen Lumpen war einmal ein Herr?“ Der Junge schaut seinen Vater ungläubig an.
„O ja, er war ein Herr, er war sogar der Größte weit und breit.“
„Was ist passiert?“, drängt Saruk, als er merkt, dass sein Vater schon wieder schweigend seinen Gedanken nachhängt.
„Alles hat er verloren und alles in kürzester Zeit, mein Sohn, zunächst die Herden. Als die Sabäer ihm alle Rinder und Eselinnen raubten, da mag der eine oder andere noch Schadenfreude empfunden haben. Immerhin war er vermögend und mehr als jeder andere vom Erfolg verwöhnt. Mancher hoffte wohl selbst größer zu werden, dadurch dass er geringer wurde. Und als ein plötzliches Feuer vom Himmel auch noch sein gesamtes Kleinvieh verbrannte, es geradezu aufzehrte, da meinte noch jeder: Davon wird er sich erholen. Aber dann überfielen drei Chaldäer-Horden das Lager seiner Leute und verschleppten seine Kamelherde bis auf die letzte Stute. Außerdem fielen alle seine Knechte den Räubern und Feuern zum Opfer. Da wurde es still in den Häusern und Hütten der Nachbarn und Angst um das eigene Gut und Getier ergriff die Stammesgenossen.“
„Haben die Räuber uns auch überfallen?“
„Nein, wir bekamen sie nie zu Gesicht. Aber die Angst ging um. Schließlich wich das furchtsame Schweigen aber einem entsetzten Aufstöhnen. Es ging alles ganz schnell: Ein Wüstensturm, so wurde erzählt, erdrückte das Haus seines Erstgeborenen. Nicht nur diesen erschlug das Gebälk, auch seine Schwestern und Brüder, die dort mit ihm waren. Als man dem Vater die schmerzliche Zeitung überbrachte, zerriss er sein Gewand und schor sich das Haupt kahl. Seine Trauer war grenzenlos; er hatte auf einen Schlag alle Nachkommen verloren.“
Der junge Hirte schaut unwillkürlich in die Richtung, aus der er gekommen.
„Ich weiß, was du denkst, mein Junge. Du hast ihn beobachtet.“
„Er war nicht da, Vater.“
Bapur schüttelt den Kopf. „Nicht heute, aber vielleicht letzte Woche oder vorletzter Woche.“
Saruk nickt und senkt schuldbewusst die Augen. Dann blickt er wieder hoch. „Was ist mit ihm, Vater?“
Bapur lässt sich Zeit mit der Antwort. „Er verlor“, beginnt er schließlich, „nicht nur seinen ganzen Stolz – und bei Assur, das war schlimm genug – sondern auch sein Gesicht, sein Angesicht. Er verlor nicht nur sein Ansehen bei den Leuten im Land, er wurde tatsächlich unansehnlich. Keiner der Seinen konnte mit ansehen, konnte zusehen, wie ihn das Übel angriff. Eine böse Seuche entstellte seine Züge und jeder wandte sich ab, wenn er ihn kommen sah.“
„Aber…“, stottert der Junge, „ich meine … wie …?“ Dann bricht er ab und schaut seinen Vater aus großen Augen an. Sein Mund ist offen stehen geblieben, so als würden Lippen und Zunge sich weigern weitere Worte herauszulassen.
„Ja, mein Junge“, nickt der Vater, „ja, auch wir waren damals sprachlos. Es verschlug uns die Sprache. Wir fanden keine Worte. Keiner konnte ihn trösten, nicht einmal seine Verwandten. Sie alle blieben stumm, verstummten angesichts unaussprechlichen Leids. Auch wir konnten uns nicht erklären, wie es möglich war, dass einem einzigen Menschen so viel Unglück zustieß. Und das Unglück hatte zugestoßen, ihn durchstoßen, abstoßend gemacht – wir alle konnten es bezeugen.“
Er schaut erneut über seine Herde hinweg, senkt dann den Blick und schüttelt den Kopf.
„Es war etwas zutiefst Unheilvolles an ihm. Es schien uns, als hätten ihn die Götter selbst heimgesucht, als würden Dämonen mit ihm ringen, ihn niederwerfen, ihn richten.“
„Du meinst, dass die Götter ihn bestraften?“, überlegt Saruk, der versucht das Unsägliche zu verstehen. „Dann muss er aber ein schlimmer Übeltäter gewesen sein, ein ganz, ganz gemeiner Bösewicht.“
Der Vater heftet seine Augen auf den Sohn und blickt ihn an, als würde er etwas Neues an ihm entdecken, etwas Neues und doch auch allzu Vertrautes.
„Ja“, sagt er schließlich, „das muss er wohl gewesen sein, ein ganz gemeiner Bösewicht. Aber…“, er zögert, „keiner von uns vermochte an ihm auch nur den kleinsten Makel oder Frevel zu erkennen. Und genau das war uns so unheimlich.“
3
Zofar wischt sich den Schweiß von der Stirn. Heute scheint es wieder so heiß zu werden. Er stöhnt leise beim Gedanken daran. Sie hätten doch nachts weiter reiten sollen, so wie er vorgeschlagen hatte. Aber Elihu hatte sich geweigert und gemeint, sie sollten Schutz vor dem Regen suchen. Dabei ist er doch der Jüngere, dieser Levit. Man sollte meinen, einem jungen Mann macht so ein bisschen Regen nichts aus. Aber er ist ein Empfindlicher, dieser Elihu, feingliedrig, hoch aufgeschossen, dünnhäutig. Er schaut schon immer so, als würde ihm alles zuwider sein, als wäre ihm das alles hier eine einzige Zumutung.
„He, Bildad, bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ich sehe weder Herden noch Hirten.“
Das war Elifas, der Zofar in seinen Gedanken unterbricht. Von allen Freunden ist der ihm der Liebste, der Treueste. Elifas ist stets ruhig, hilfsbereit, verständnisvoll und friedliebend. Schon sein kugelrunder Kopf zeigt, dass er nicht gerne aneckt. Und er macht gern alles richtig, stellt gern alle zufrieden, der Gute, still und leise. Manchmal ziehen die anderen ihn auf und nennen ihn ihren Diener makellos.
„Du hast doch selbst gehört, was die im Dorf uns sagten: Dem Bach entlang gen Morgen bis hin zu der Stelle, wo die Felsen ansteigen. Es kann nicht mehr weit sein.“
Unaufgefordert hatte Bildad die Führung ihrer kleinen Reisegruppe übernommen. Die anderen ließen es geschehen, denn Bildad machte das wirklich gut. Er ist ein praktischer Mensch, überlegt Zofar, als er jetzt zu ihm hinüberschaut, ein guter Planer, der immer alles im Griff zu haben scheint. Mit seiner stämmigen Gestalt, seinem harten Nacken und seinem kräftigen Kinn sieht er fast aus wie ein Ringer. Aber Zofar weiß, Kämpfe interessieren ihn nicht. Eigentlich ist Bildad ein ausgeglichener Charakter, nur Veränderungen mag er nicht. Alles Unwägbare macht ihn unruhig.
„Vielleicht haben sie uns zum Narren gehalten“, gibt er nun selbst zu bedenken, „vielleicht liegen dort drüben bereits Räuber im Hinterhalt, um uns hinterrücks zu erstechen.“
„Ich glaube kaum“, grinst Bildad, „dass die Dorfbewohner uns für besonders vermögend gehalten haben – so wie du ausschaust!“
Bildad und Elifas lachen und er, der von den Freunden Aufgezogene, spürt sehr deutlich, auch ohne sich umschauen, dass selbst der ernste Elihu höhnisch und genüsslich in sich hineinlächelt.
Während sie auf ihren Eseln bachaufwärts trotten, prüft Zofar in Gedanken ihre Vorräte. Sie haben gestern ein kleines Vermögen für Brot, Käse und Früchte ausgegeben. Er selbst hat gelernt, mit wenig auszukommen. Aber die anderen stopfen in sich hinein, wessen sie habhaft werden können. Es würde sie wundern zu erfahren, wie wenig man eigentlich braucht. Leider sind es seine Freunde offenbar gewohnt in Saus und Braus zu leben, und er befürchtet, dass ihre Vorräte kaum für drei Tage reichen werden. Immerhin scheinen die es sich leisten zu können. Sie haben ihm ihre Reisekasse überlassen und da hat er gemerkt, bei denen klimpert’s ordentlich im Beutel. Und wie man sieht, bringen sie ihr Geld reichlich unter die Leute. Vor allem Elihu ist richtig vornehm gewandet, denkt er ein wenig empört, aber auch die beiden anderen tragen edles Tuch. Schon reichlich verschwenderisch, das Ganze.
„Hört ihr das?“, ruft Elifas auf einmal. „Dort vorne sind Schafe. Wir haben die Herde erreicht.“
„Das klingt eher nach einem einzelnen Tier“, meint Bildad nüchtern, „vielleicht einem Ausreißer. Lasst uns nachsehen!“
Bald schon entdecken sie zwischen einigen kleineren Weißdornsträuchern ein Schaf, das mit einem Vorderbein in den engen Spalt zwischen zwei Steinbrocken gerutscht ist und feststeckt. Offenbar ist es schon länger in seiner bedauerlichen Lage. Die dunkle Haut des Beines ist an den scharfen Kanten des Felsen wund gescheuert und das nervöse Tier wirkt erschöpft.
Ohne länger zu überlegen springt Elifas von seinem Esel und eilt hilfsbereit zum Schaf hinüber. „Wir müssen es befreien und das Bein, wenn nötig, schienen. Helft mir mal!“ Und dann als er merkt, dass die anderen sitzen bleiben, blickt er sich fragend um.
Bildad geht das Mitleid und Helfergebaren seines Freundes zu weit: „Wir können doch nichts dafür, dass das Tier sich eingeklemmt hat. Es genügt, wenn wir nachher den Hirten Bescheid sagen.“
Von hinten meldet sich nun auch Elihu: „Was kümmert uns die Kreatur? Lass es! Die Hirten werden es schon finden – oder die Löwen. Gottes Schafe sind gezählt.“
„Was soll das jetzt heißen?“, ärgert sich Elifas, „Gottes Schafe sind gezählt. Meinst du, Er hat sie abgezählt; es geht Ihm keins verloren? Hat er dieses hier mitgezählt? Oder zählt es vielleicht gar nicht zu den Seinen?“
Elihu lässt sich nicht aus seiner Ruhe bringen: „Das Los des Schafes, aller Schafe, liegt in Gottes Hand.“
„Du meinst, Gott wünscht nicht, dass wir dem armen Tier helfen?“ Elifas seufzt vernehmlich. Ihn enttäuscht die Kaltherzigkeit ihres jungen Begleiters.
Zofar mischt sich ein. Er hat andere Sorgen. „Ob wir nun helfen oder nicht“, meint er beschwörend, „es muss klar sein, dass wir nachher nicht für den Schaden zu zahlen haben. Was ist, wenn der Besitzer behauptet, wir hätten sein Schaf verschreckt, da sei es in den Spalt gestolpert? Wir können uns kein Bußgeld leisten.“
Elifas wendet sich wieder dem Schaf zu. „Ihr seid mir feine Nachbarn“, verkündet er über seine Schulter hinweg und es ist klar, dass für ihn die Sache damit entschieden ist. Behutsam nähert er sich dem Tier, versucht es zu beruhigen. Schließlich schaut er sich um, findet einen Stock, hebt ihn auf und stemmt damit die Steine soweit auseinander, dass das Tier aus seiner Falle klettern kann. Elifas legt seine Hände um das Vorderschienbein des zittrigen Schafes, merkt aber schnell, dass nichts gebrochen ist. Sobald er das Tier loslässt, springt es davon. Ein bisschen Zuneigung hätte es schon zeigen können, denkt er ein wenig enttäuscht, sitzt auf und folgt den anderen, die bereits weiter geritten sind.
4
Er sieht sie kommen, bevor sie seine Nähe auch nur erahnen, sieht und erkennt sie sofort. Eine eigentümliche Mischung aus Freude und Furcht erfasst ihn. Beide hat er lange nicht mehr empfunden. Worüber freuen? Wovor fürchten? Hat er nicht alle Freude zu Ende gefreut, ausgefreut? Alle Siege und Erfolge so freudig durchlebt, dass jedes Hochgefühl aufgebraucht ist? Wie ein längst ausgeleerter Weinschlauch kommt er sich vor, trocken, hart und rissig. Und wer die Freude verloren hat, was hat der noch zu fürchten? Schmerzen? Sind schon da! Der Tod? Wäre eine Erlösung!
Und doch spürt er jetzt etwas wie Furcht, wie eine innere Unruhe, eine bange Erwartung. Da wird ihm klar: Es ist die Wahrheit, die ihn erzittern lässt, die einzige Macht, die er noch fürchtet, die ihm etwas bedeutet. Er bangt um die Wahrheit. Sie ist alles, was ihm geblieben, alles, was er jetzt noch verlieren kann. Und gleichzeitig verbindet sich mit dem Anblick der Kommenden ein Gefühl der Freude, der Vorfreude, als läge in ihrer Ankunft eine Ankündigung, als würde ihr Erscheinen ihm künden: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht.
Ihre letzte Zusammenkunft erscheint ihm wie ein Bild aus einer fernen Vergangenheit – oder aus einem fernen Land, wie ein Traumbild. Die Erinnerung daran verblasst und er fragt sich: War das nur Einbildung, war das gar nicht ich damals, der mit den Freunden gescherzt und gefeiert hat? Damals, als das Leben noch süß war. Nun ist es bitter und auch die Süße ist eine Erinnerung, eine Gaumenerinnerung, die verblasst. Er kann sie nicht mehr kosten. Wie also, wundert er sich, sollen ausgerechnet diese fremd Gewordenen die Wahrheit seines Loses lichten?