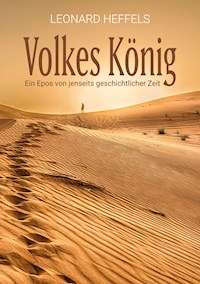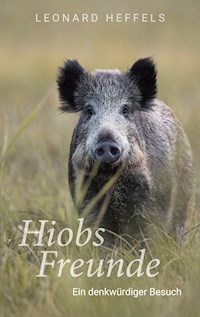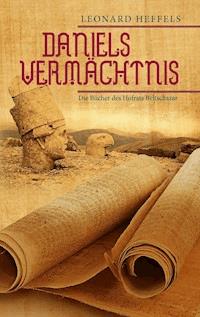Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was verbindet einen gut vernetzten Unternehmensberater mit einer hochmütigen Pröpstin und einem sarkastischen Kabarettisten? Auf den ersten Blick gar nichts. Und doch scheinen sie sich gegenseitig auf den Plan zu rufen. Ähnlich ergeht es Mehrings, dem Inhaber einer Sicherheitsfirma. Eines Tages steht er der attraktiven Notfallmedizinerin Conradi gegenüber. Ist das Fügung oder doch bloß Zufall? Und warum bringt der an sich harmlose Unfall eines Schülers das Leben seiner Lehrerin durcheinander? Was hat den smarten Journalisten Vogel geritten, sich auf ein Thema zu stürzen, das bald sein Renommee gefährdet? Die sieben Zeitgenossen in diesem Roman haben wenig miteinander gemeinsam. Nur eines: Irgendwie stehen sie alle am Scheideweg. Da kommen die anderen gerade recht. Es zeigt sich bald, dass ihre Beweggründe tiefer reichen, als sie selbst glaubten. Überhaupt lernen sie vor allem das voneinander: anders zu glauben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leonard Heffels studierte Kunst in Maastricht und Pädagogik in Amsterdam. In seinem literarischen Werk setzt er sich immer wieder mit biblischen Themen auseinander. Dabei bewegt er sich im Grenzbereich zwischen Lyrik und Prosa. Immer wieder spürt er dem Sinngehalt der archaischen biblischen Gestalten nach. Bei TWENTYSIX erschienen die Novellen „Marthas Geschick“ und „Hiobs Freunde“ sowie die epische Dichtung „Wer mit Gott geht“, ferner die Romane „Daniels Vermächtnis“ und „Dinahs Ehre“ und der Gedichtband „Urtypisch“. Leonard Heffels lebt mit seiner Frau in München.
Inhaltsverzeichnis
Dissonanzen
Neue Töne
Resonanzen
1. Dissonanzen
Der Gang zur Garderobe war eng und schwach beleuchtet. Mit seinem durchaus stattlichen Körper schien Joachim Schwan zu groß für den schmalen Flur. Tatsächlich ging er leicht gebückt, was ihm eigentlich gar nicht entsprach. Es war eine spontane Idee gewesen, die ihn hierhergeführt hatte, hinter die Bühne dieses kleinen Theaters. Er machte es gern so, ging seiner Intuition nach, folgte seinen Einfällen und war damit immer gut beraten gewesen. Nun stand er also vor der Tür einer Umkleide, hinter der er den Star des heutigen Abends anzutreffen hoffte. Einen kurzen Augenblick fragte er sich, wozu der Mann überhaupt eine Umkleide brauchte. Kostümiert war der auf jeden Fall nicht gewesen. Nun ja, duschen würde er wohl müssen. Joachim Schwan horchte kurz, aber von der anderen Seite der Tür war nichts zu hören. Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf und klopfte an, kurz und energisch, wie er es immer zu tun pflegte. Die dumpfe Luft im schmucklosen Korridor schien jeden Laut zu verschlucken. Nichts rührte sich und er klopfte ein zweites Mal.
„Ist offen!“, klang es durch die Tür.
Noch ehe er seine Hand auf die Klinke gelegt hatte, war Joachim Schwan bewusstgeworden, dass der Mann, dem diese Stimme gehörte, gereizt war, ungeduldig. Er war sich dessen sofort ziemlich sicher. Aber er bemerkte nicht, dass der Klang dieser Stimme ihn innerlich kleiner werden ließ. Für den Bruchteil einer Sekunde schlüpfte er in eine sehr ungewohnte Rolle: Er wurde zum Bittsteller. Hätte er damals diese subtile Veränderung an sich wahrgenommen, wäre ihm später einiges an Ärger erspart geblieben. Zumindest wäre er in der Lage gewesen manche Entscheidungen vorausschauender zu treffen.
Der Mann saß auf einem Drehstuhl, der eher wie ein Chefsessel aussah. Er hatte sich dem unerwarteten Besucher zugewandt, den großen Schminktisch im Rücken. Die Leuchten des Spiegels umgaben seine Gestalt wie eine Pop-Art-Aura. Der Anflug eines höhnischen Grinsens lag auf dem Gesicht.
Perfekt inszeniert, dachte Schwan, dem der schrille Kontrast zwischen der lichten Umrahmung und der dunklen Gestalt natürlich ins Auge sprang. Der Mann trug eine modische schwarze Lederjacke mit weitem Revers und verschiedenen Reißverschlüssen und Schnallen. Er hatte sie sich lässig übergeworfen, so als ob er gerade im Gehen gewesen war, als Schwan anklopfte. Hatte er sich extra nochmal hingesetzt, Platz genommen auf seinem goldumkränzten Thron? Sein kahlrasierter Schädel glänzte matt, die Augen lagen dunkel in ihren Höhlen. Er sagte kein Wort und machte auch keine Anstalten sich zu erheben. Trotzdem war seine Wirkung äußerst lebendig. In der Ankündigung der heutigen Vorstellung war von einer kraftvollen Bühnenpräsenz die Rede gewesen. Hier in der Enge dieser kleinen Garderobe schien sie dem Besucher noch stärker als vorhin im Saal, wo er eine der hinteren Reihen gewählt hatte. Schwan, der die Stille nie lange aushielt, sah sich genötigt, etwas zu sagen. „Herr Feig, ich …“
Weiter kam er nicht, denn der Angesprochene gebot ihm mit einer großen, schlanken Hand zu schweigen. Er hatte sie kaum richtig erhoben. Es war mehr ein leichtes Zucken gewesen wie der intime Wink eines Dirigenten an ein ihm ergebenes Orchester. „Sie sind … lassen Sie mich raten … Sie sind Unternehmer, nein, Personalchef einer Bank wahrscheinlich.“ Er winkte den Besucher herbei und der konnte nicht anders, als dieser Aufforderung Folge zu leisten.
Schwans Statur war imposant und doch schien er vor diesem Mann zu schrumpfen. „Herr Feig, ich …“
„Man hat Sie beauftragt“, unterbrach ihn der Bühnenkünstler abermals, „die nächste Betriebsfeier zu organisieren, stimmt’s? Und jetzt möchten Sie mich engagieren um Ihrer totlangweiligen Veranstaltung ein bisschen Leben einzuhauchen.“
Schwan war zu verblüfft um etwas sagen zu können. Das passierte ihm nicht oft, war er doch für seine Schlagfertigkeit bekannt.
„Vergessen Sie es““, entschied der Kahlköpfige, „kein Interesse!“
Kurz schien es, als müsste Schwan unverrichteter Dinge wieder gehen, doch da befreite er sich mit einem amüsierten Lachen aus der verqueren Situation. „Tolle Vorstellung!“, brachte er prustend hervor, „große Klasse!“ Er genoss es, so schnell und geschickt wieder die Oberhand gewonnen zu haben, denn er sah wohl, dass er sein Gegenüber verunsicherte.
Ernst Feig, der gefeierte Kabarettist, der Meister gnadenloser Worte, der letzte Realist, wie er sich gerne nannte, verlor einen Moment die Vorherrschaft über die Szene. Gab ihm dieser joviale Besucher ein Lob, ein giftiges Kompliment zu seiner heutigen Show, oder machte er sich über ihn lustig und weigerte sich, seine Ablehnung ernst zu nehmen? Feig pfiff auf Anerkennung ebenso wie auf Kritik und hatte es im Grunde immer getan. Das wollte er diesem Banker auch zeigen. „Ihre ist dagegen ganz miserabel“, entgegnete er kühl, fast desinteressiert. „Was wollen Sie?“
„Joachim Schwan, Unternehmensberater“, stellte sich Schwan vor. Mit einem fragenden, leicht spöttischen Blick reichte er dem Bühnenmann die Hand, die dieser tatsächlich ergriff. „Das mit dem Unternehmer war also gar nicht so verkehrt. Mich aber für einen Banker zu halten, werte ich mal als eine gezielte Gemeinheit – eine Déformation professionelle, wenn Sie so wollen – und nicht als ein seriös gemeintes Assessment, ein bisschen frech, ein bisschen autoritär. Egal! Sie können eben auch nicht aus Ihrer Haut heraus, stimmt‘s? Und genau so habe ich mir Sie auch vorgestellt. Übrigens: Ihre Furcht vor langweiligen, leblosen Veranstaltungen ist wohl ebenfalls berufsbedingt. Langweilig ist ja die verheerendste Kritik für jeden Entertainer.“ Das letzte Wort sagte Schwan fast genüsslich und er dachte an eine Behauptung Nietzsches, nach der eine kleine Rache oft gerechter sei als gar keine.
Ernst Feig war inzwischen aufgestanden, nahm sein Handy vom Schminktisch, blickte kurz darauf, steckte es ein. Seine Bewegungen waren von einer eindrucksvollen Gelassenheit. Er war es gewöhnt, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und hatte es tatsächlich geschafft, sich von diesem Interesse nicht abhängig zu machen. So merkwürdig das anmutete, gründete doch sein Erfolg zum größten Teil darin, dass er Applaus und applaudierende Zuschauer stillschweigend verachtete. Auch jetzt, während sein ungebetener Gast plapperte, hielt er es nicht für nötig, höflichkeitshalber zuzuhören. Er lehnte diesen Typen nicht ab, er beachtete ihn gar nicht und nahm ihn im Grunde nicht intensiver wahr als das spärliche Mobiliar in dieser Garderobe.
Schwan spürte das und fragte sich kurz, ob der Mann vielleicht ein Autist wäre. Als Feig auf die Tür zustrebte, stellte er sich ihm in den Weg. „Wollen Sie mal runter von der Bühne?“
Feig blickte ihn an. „Wo ich bin, ist immer Bühne. Also, was soll das?“
„Ich habe einen Beratungsauftrag und möchte Sie an meiner Seite dabeihaben.“
Feig gelang das Kunststück auf Schwan herabzublicken, obwohl dieser fast ein Kopf größer war. Dann sprach er mit Nachdruck, als würde er zu einem Begriffsstutzigen reden. „Ich habe keine Lust bornierte Banker zu beraten, wie sie besser in ihrem bornierten System zurechtkommen können.“
„Keine Banker, Herr Feig, Christen!“
„Was?“ Jetzt war der Kabarettist zum ersten Mal ehrlich überrascht.
„Ja, Christen, Kirchenleute.“
Mike Mehrings nickte immer wieder weg. Weder die schmucklosen Wände des Wartezimmers, noch die gedämpften Stimmen der Kranken und Verletzten, noch die typischen Krankenhausgerüche boten ausreichend Anreiz ihn wachzuhalten. Vor allem aber setzte ihm das untätige Herumsitzen zu. Dabei sollte die Sorge um seinen Sohn Mehrings Physis eigentlich mit Adrenalin so sehr überschwemmt haben, dass er hellwach sein müsste. Aber irgendwie hatte die Ruhe der Ärztin ihm so viel Vertrauen eingeflößt, dass sein Kontrollbedürfnis nun gänzlich befriedigt war.
Mehrings hatte ein ausgeprägtes Kontrollbedürfnis, immer schon gehabt. Die Gründung einer eigenen Security-Firma, die er seitdem leitete, schien da schon fast unausweichlich, zumindest aber konsequent. Ihm war durchaus bewusst, dass er unmöglich jedes Detail im Griff haben konnte, doch er tat alles in seiner Macht Stehende, um möglichst nichts dem Zufall zu überlassen. Deshalb war er noch bis tief in der Nacht an den neuen Einsatzplänen für mehrere Großveranstaltungen gesessen. Er hatte sich schon vor Jahren auf die Ausbildung und Vermittlung von Security-Personal spezialisiert. Dank der inzwischen allgegenwärtigen Terrorangst boomte das Geschäft und Mehrings war gezwungen gewesen, reihenweise neue Leute einzustellen und auszubilden. Unter diesen Umständen war es schwer, das neu erarbeitete Konzept richtig zu implementieren. Im Grunde wuchs die Firma zu schnell. Beim Anfertigen der Einsatzpläne hatte er genau überlegen müssen, wem er was zutrauen, und welchen Neuen er welchem Alten zur Seite stellen konnte. Da galt es Konflikten aber auch unerwünschter Kumpanei vorzubeugen. Außerdem wollte er auf junge Familien Rücksicht nehmen, denn er sah sich als moderner, gewissenhafter Arbeitgeber dem Wohl seiner Leute verpflichtet. Diese umsichtige Personalführung, das Feintuning der Pläne, hatte ihn die halbe Nacht gekostet. Nach wenigen Stunden Schlaf war er aufgestanden, um seinem sechsjährigen Sohn André das Frühstück zu machen und ihn anschließend in die Schule zu fahren. Bei der Erinnerung an seinen Sohn blickte Mehrings stumm auf die doppelte Schwungtür, durch die ein Pfleger seinen Jungen geschoben hatte. Kurz wehte ihn ein Schuldgefühl an, so als würde sich sein Sohn nicht verletzt haben, wenn er einfach nur ausgeschlafen gewesen wäre. Aber das war natürlich Unsinn. Er wusste es, doch das schlechte Gewissen ließ sich von logischer Beweisführung leider gar nicht beeindrucken.
Nachdem er den Jungen in die Schule gefahren hatte, war er so müde gewesen, dass er sich nochmal hatte hinlegen müssen. Kurz nach zehn erst war er aufgewacht, geweckt vom Klingelton seines Handys. Da fluchte er innerlich, weil sein Wecker den Geist aufgegeben hatte und es schon so spät war. Er brauchte eine Weile, bis er kapierte, wer dran war. Die Schule in der Marsmannstraße? Frau Brunn? Dann war er auf einmal hellwach. Was denn passiert wäre? Nichts Schlimmes. Was sie damit meinen würde, nichts Schlimmes. Ja, es würde schon wieder werden. … Er hatte sich sehr zusammenreißen müssen um nicht loszubrüllen. Mein Gott, wie umständlich und tüttelig diese Lehrer labern konnten! Schließlich erfuhr er, dass sich André am Fuß verletzt hatte und er kommen sollte, um mit ihm zum Arzt zu fahren.
Was genau passiert war, erzählte man ihm dann in der Schule, wo Frau Brunn mit André bereits auf ihn wartete. Der Junge saß wimmernd im Sekretariat, den linken Fuß hochgelegt auf ein buntes Nilpferdkissen gebettet. Er hatte noch seinen Turnschuh dran, aus dem etwas oberhalb der Zehen die Spitze eines rostigen Nagels ragte. Mehrings hatte schlucken müssen. Zunächst erklärte die Lehrerin ihm ausführlich, dass sie am heutigen Tag nicht für die Pausenaufsicht eingeteilt, sie also selbst nicht draußen gewesen war, als es passierte. Himmel! Immer drängten diese Lehrer darauf, dass die Kinder lernten mehr Verantwortung für ihre Angelegenheiten zu übernehmen. Und dann scheuten sie sich selbst zu ihrer eigenen Verantwortung zu stehen.
Der Unfallhergang war schnell erzählt. In der Pause spielte André wie immer mit den anderen Jungen Fußball. In der Hitze des Gefechts schoss er den Ball über den Zaun einer angrenzenden Baustelle. Normalerweise endete damit das Spiel, denn es war den Schülern strengstens untersagt worden, die Baustelle zu betreten. André ignorierte jedoch das Verbot und zwängte sich unerlaubterweise zwischen zwei Bauzaunteilen hindurch. Da er den Ball nicht sehen konnte, kletterte er auf eine Palette Klinkersteine, um sich einen Überblick zu verschaffen. Dann erspähte er den Ball etwas weiter vorne nahe einem kleinen Bagger. Aufgeregt und ohne genau hinzusehen sprang er vom Steinstapel herunter. Dabei landete er mit dem linken Fuß auf einem Brett mit langen Nägeln. Durch die Wucht des Aufpralls durchbohrte ein Nagel Schuh und Fuß des Jungen. Sein Schrei alarmierte die Bauarbeiter.
Noch jetzt hier im Wartezimmer der Notaufnahme spürte Mehrings seine Verärgerung über die laxe Aufsicht an der Schule. So etwas durfte gar nicht passieren. Wieso ließ man die Kinder bloß so nah am Bauzaun Fußball spielen? Es war ja wohl abzusehen, dass das nicht gutgehen konnte. Überhaupt, sollten da nicht mehr Lehrkräfte zur Aufsicht eingesetzt werden? Wenn seine Versicherung nicht zahlte, weil der Unfall streng genommen außerhalb des Schulgeländes stattgefunden hatte, würde er die Rektorin zur Rechenschaft ziehen müssen.
„Herr Mehrings?“
Mehrings schreckte aus seinen Gedanken hoch und schaute auf. Vor ihm stand die behandelnde Ärztin. Wie war nochmal ihr Name? Er linste auf ihr Schildchen. Conradi, Jasmin Conradi. Er stand auf und stand ihr plötzlich ganz nahe, zu nah um ihr noch die Hand reichen zu können. Weder er noch sie wichen zurück. Merkwürdigerweise war die Situation aber keineswegs peinlich oder irgendwie erotisch. Es war vielmehr so, dass es ihm natürlich vorkam diesem Menschen nahe zu stehen. Ja, er war geradezu überwältigt von der Gewissheit, ihm schon immer nahe gestanden zu haben. Und noch indem er sich das klarmachte, wusste er, dass diese Ärztin das genauso empfand. Sie lächelte und ihre Augen schienen ihn trotz der Nähe ganz zu erfassen.
„Ihrem Sohn geht es gut“, sagte sie mit einer Lautstärke, die der geringen Distanz entsprach und fast einem Flüstern gleichkam. „Kommen Sie mit!“ Und damit drehte sie sich um und ging in Richtung Behandlungszimmer davon.
Mehrings ließ ihr ein paar Schritte Vorsprung, bevor er sich in Bewegung setzte. Er war nicht etwa schüchtern oder verwirrt. Ihm war vielmehr klar, dass er diesen Menschen nicht in Reichweite haben musste, um ihm nahe zu sein. Wenn ihn etwas verwirrte, dann war es die Feststellung, dass die Beglückung dieser unerwarteten Nähe seine Sorge um den verletzten Sohn gänzlich in den Hintergrund drängte.
André saß auf einer Liege, die am Kopfende hochgeklappt war. In seinem Schoß lagen verschiedene Playmobil-Figuren, Ritter und Indianer, wie Mehrings auf die Schnelle erkennen konnte. Sein Fuß war dick bandagiert, schien dem Jungen jedoch keine Probleme zu bereiten.
„Die Lokalanästhesie wird noch ein-zwei Stunden anhalten“, erklärte Dr. Conradi, die offenbar vom selben Gedanken erfasst war. „Ich gebe Ihnen noch ein Rezept für ein Schmerzmittel mit, aber seien Sie sparsam in der Anwendung!“
Mehrings zog einen Stuhl heran und setzte sich zu seinem Sohn, strich ihm durchs Haar, knuffte ihn liebevoll und tat sein Bestes den Jungen aufzumuntern. Als er festgestellt hatte, dass André gefasst war und tapfer seine Verletzung ertrug, stand er wieder auf und winkte die Ärztin mit einer leichten Kopfbewegung zur Seite. „Wie siehts aus? Wird alles wieder in Ordnung kommen?“
Dr. Conradi wand ihm ihr ebenmäßiges Gesicht zu. „So schnell verlässt man die Ordnung nicht, Herr Mehrings.“ Und noch bevor ihr Gegenüber seiner Verwunderung über diese Bemerkung Ausdruck verleihen konnte, setzte sie lächelnd hinzu: „So wie es ausschaut, wird der Fuß wieder voll funktionsfähig werden. Der Nagel hat weder Knochen noch Sehnen verletzt. Die Infektionsgefahr scheint gebannt zu sein. Aber wir würden ihn gerne noch ein-zwei Tage dabehalten um eine Sepsis völlig ausschließen zu können.“
„Uff! Dann hat er nochmal Glück gehabt!“, entfuhr es dem erleichterten Vater.
Statt sogleich darauf zu reagieren, ließ die Ärztin ihren Blick einen Moment lang auf dem verletzten Jungen ruhen. Schließlich hob sie ihr Haupt, so als ob sie die Situation als Ganzes erfassen wollte. Ohne den Blick abzuwenden ergriff sie endlich das Wort. „Das war zwar ein Unfall, aber kein Zufall. Glück und Unglück sind eine Frage des Glaubens.“
Franziska Dunker starrte auf den Bildschirm ihres Computers. Sie hatte gerade die E-Mail des Präses zum zweiten Mal gelesen und spürte, wie die Wut in ihr hochkochte. Hätte man sie gefragt, sie wäre nicht im Stande gewesen zu sagen, was sie mehr aufregte: das, was der Präses ihr mitteilte, oder die Art und Weise, wie er es tat. Dass ihr Vorgesetzter ihr einfach ein paar dünne Zeilen schrieb und nicht die persönliche Begegnung suchte oder sie zumindest anrief, enttäuschte und kränkte sie. So etwas machte man nicht, erst recht nicht bei uns, dachte sie verärgert. Und vor allem dann nicht, wenn man jemandem solche Vorhaltungen machte. Wie kam der Präses bloß dazu, so massiv in die Geschicke ihrer Propsteisynode einzugreifen, ohne sich vorher im vertraulichen Gespräch an sie zu wenden?
Das Neonlicht an der Decke ihres Büros ließ ihren ohnehin schon blassen Teint noch bleicher erscheinen. Die Schatten um ihre Augen waren aschfahl. Dass sie als Mittfünfzigerin immer noch knabenhaft schlank war, erfüllte sie mit Genugtuung, sah sie darin doch den Ausdruck eines dem Geistigen zugewandten Lebens. Doch jetzt wirkte ihre zarte Gestalt mit den schlohweißen Haaren verloren auf ihrem lächerlich modernen Arbeitshocker.
Wiederholt … wie schrieb der Präses nochmal? Sie beugte sich zum Monitor vor. Wiederholt haben mich Beschwerden aus Ihrer Synode erreicht, Beschwerden von engagierten Christen, also von jenen, die unsere lebendige Kirche maßgeblich mittragen und mitgestalten.
Beschwerden! Ha! Die Pröpstin konnte sich denken aus welcher Ecke die kamen. Da steckte bestimmt die Schneider dahinter. Diese fünffache Mutter und Musterchristin ging ihr mit ständigen Änderungswünschen und quasi-pädagogischen Rückmeldungen zu ihren Predigten schon lange auf den Geist. Das sähe dieser Natter gleich, dachte Dunker, immer säuseln, immer das Hohelied der Liebe und Barmherzigkeit singen, immer ein Bibelvers auf den Lippen. Und dann treibt sie einem hinterrücks das Opfermesser zwischen die Rippen. Vermutlich hatte sie noch den bigotten Bartels in ihrem Gefolge, diesen Trottel, und die dummdreiste Kramer. Mein Gott, kein Amt, kein Studium, keinen Verantwortungsbereich, aber klammheimlich mosern und stänkern! Pochen auf die Autorität der nicht Ordinierten, auf die Gleichheit aller Christen vor dem Herrn, ja. Aber letztlich suchen sie nur eine Rechtfertigung für ihre intriganten Machenschaften.
Mitgestalten? Klar, mitgestalten wollte die Schneider immer, aber mittragen? Von wegen! Die bürdete doch viel lieber anderen Leuten zusätzliche Lasten auf. Mehr Kindergottesdienste, bitte schön! Mehr Geld für die Familienfreizeit, eine aktivere Rolle der Synode in der Schwangerenberatung, einen größeren Raum für den spirituellen Singkreis, endlich mehr Interaktionsmöglichkeiten auf der Website der Propstei und überhaupt eine stärkere Präsenz der Kirche in den sozialen Medien. Die Liste ihrer Forderungen war schier endlos. Aber als neulich die von ihr angemahnte Einrichtung einer Abteilung christlicher Kinder- und Jugendlektüre in der Stadtbücherei beschlossen war und freiwillige Mitarbeiter benötigt wurden, tauchte sie ab. Sie war mehrere Wochen nicht zu erreichen gewesen. Schließlich hatte Dunker selbst noch mithelfen und stundenlang gespendete Bücher sichten und kategorisieren müssen.
Die Pröpstin rief sich selbst zur Ordnung. Sie wusste, sie sollte sich mäßigen. Schließlich wurde der Präses an keiner Stelle in seinem dürren Schreiben konkret. Aber über sie hatte er sein Urteil dennoch gefällt. Sie las erneut vom Bildschirm:
Der unglückliche Verlauf Ihrer bisherigen Mediationsversuche legt den Schluss nahe, dass Sie mit der wachsenden Dynamik des Konflikts am Rand Ihrer Belastbarkeit angelangt sind.
„Am Rand Ihrer Belastbarkeit“, dass ich nicht lache, dachte Dunker bitter. Der hält mich doch für unfähig, ist sich aber zu fein, das unmissverständlich zu sagen – oder auch nur in seine klägliche E-Mail reinzuschreiben!
Um Sie zu entlasten, liebe Frau Dunker, habe ich einen erfahrenen Unternehmensberater beauftragt gemeinsam mit Ihnen und den anderen Mitgliedern der Propsteisynode die Hintergründe der bestehenden Konflikte zu beleuchten in der wohlbegründeten Hoffnung, dass sie alle infolge größerer Klarheit künftig wieder uneingeschränkt Anteil am Frieden des Herrn haben werden.
Natürlich, dachte die Pröpstin grimmig, der Präses wollte keine Unruhe in seiner Landesgemeinde. Ihn interessierten die Gründe des Konflikts überhaupt nicht. Er wollte bloß friedliche Schäfchen, damit er als Landeshirte in der Öffentlichkeit punkten konnte.
Weltliche Belange, so fand die Pastorin, Macht und Ruhm, vertrügen sich nicht mit einem gottgeweihten Leben. Jesus, ihr Jesus, hatte es klar und deutlich gesagt: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ Es gibt nur eine Autorität, die die Vormacht im Leben eines Christen beanspruchen durfte, und das war, so Franziska Dunkers tiefste Überzeugung, die Autorität des Wortes. Für sie war es der Geist Christi allein, dem wir gehorsam folgen, auf den wir bauen sollten. Doch wie eine wahre Jüngerin des Herrn sah sie sich ständig von der Dominanz des Bösen, von Habgier und Dummheit bedrängt.
Dass sich der Präses gegen einen kircheninternen Supervisor entschieden hatte, war der Pröpstin nur im ersten Moment befremdlich vorgekommen. Dann war ihr aber schnell aufgegangen, was ihren Vorgesetzten dazu bewogen hatte. Es gab mehrere Pastoren, die sich zu Supervisoren hatten ausbilden lassen. Soweit Dunker wusste, arbeiteten diese Leute professionell. Aber der Präses wollte offensichtlich vermeiden, dass ordinierte Berater zu sehr im Untergrund seines Weinbergs herumwühlten und womöglich Missstände zutage förderten, die seine Amtsführung in ein schlechtes Licht rückten. Mit anderen Worten, schlussfolgerte Dunker, er konnte sich der Loyalität dieser supervidierenden Pastoren nicht sicher sein. Deshalb hatte er eine kirchenfremde Beratungsfirma engagiert.
Und doch war dieser Schritt für den Präses nicht ohne Risiko. Zum einen ging die eingekaufte Expertise für die Landessynode sicher mit erheblichen Kosten einher. Und vor allem wenn die Beratung fehlschlagen sollte, würde er die Mehrausgaben rechtfertigen müssen. Dann würde die Rechnungsstelle mit Sicherheit wissen wollen, warum er sich nicht für die kostenneutrale Lösung mit internen Beratern entschieden hätte. Zum anderen war ein Freiberufler für den Präses letztlich schwerer zu steuern. Natürlich, er würde ihm jederzeit den Geldhahn zudrehen können und Dunker wusste, ihr Vorgesetzter war ein Mann, der das Motto zu beherzigen wusste, nach dem anschafft, wer zahlt. Aber ein kirchenfremder Mediator brachte zwangsläufig glaubensferne Ansichten in seine Arbeit mit ein. Sein Menschenbild, davon musste man ausgehen, wäre bestenfalls halbwegs humanistisch geprägt, schlimmstenfalls jedoch hedonistisch oder – noch schlimmer – mit esoterischem Aberglauben durchsetzt.
Der Berater, so hatte der Präses ihr zuletzt mitgeteilt, würde sich in den nächsten Tagen bei ihr melden um einen Termin für ein erstes Treffen zu vereinbaren. Der Name des Mannes sagte ihr nichts: Joachim Schwan.
Für Bertram Vogel war die Redaktionssitzung gut gelaufen. Zwar hatte der Chef wie immer gemosert und über den „kostspieligen Luxus weitschweifiger Hintergrundberichte“ geklagt, ähnlich wie er sonst gern über die „horrenden Kosten des so genannten investigativen Journalismus“ lästerte, aber Vogels Konzept war am Ende im Großen und Ganzen gebilligt worden. Vielleicht war es sein Glück gewesen, dass Mattes kurz vorher die Kollegin vom Kulturresort abgebürstet hatte. Offenbar strebte das Gemüt des Chefredakteurs nach Ausgleich, denn Vogel hatte sogleich sein Wohlwollen ihm gegenüber gespürt:
„Das Thema ist gut, Vogel, schließlich haben die Leute ein Recht zu erfahren, auf wen sich der Staat verlässt, um ihre Sicherheit zu garantieren. Ich will alles zum Thema wissen: Wie werden diese Leute rekrutiert? Aus welchem Milieu kommen die? Was treibt sie in die Security-Branche? Ausbildung, Bezahlung, politische Gesinnung, Straffälligkeit – das ganze Register! Schauen Sie sich auch die Hintermänner an, die Firmen, die am Markt den großen Reibach machen! Ich will wissen, um wie viel Geld es geht. Ich will wissen, wie die Aufträge vergeben werden und wer die Entscheider sind. Ich will noch diese Woche einen ersten Beitrag.“
Vogel fuhr seinen Rechner hoch und loggte sich in das Intranet ein. Während er wartete, zog er sein Telefon heran. Dann ließ er seinen Blick durch das moderne Großraumbüro gleiten. Die Redaktion war erst vor zwei Jahren umgezogen. Vogel fand es früher besser. Er vermisste das Raucherzimmer.
Der Chef wusste natürlich, dass er sich auf ihn verlassen konnte. Er war keiner, den man mit geschmeidigen Marketingsprüchen einlullen konnte, keiner, der sich damit zufrieden gab eine Aussage bloß korrekt zu zitieren. Er ging der Sache nach und bezweifelte alles, bis er sich selbst von den Fakten überzeugt hatte. Zweimal schon war die Hartmann Medien Gruppe, Vogels Arbeitgeber, wegen seiner Unbeugsamkeit verklagt worden. Einmal hatte sich ein Landespolitiker aufgeregt, dass Vogel dessen zentrale Behauptung als nicht belegbare persönliche Meinung und den Mann selbst als populistischen Märchenerzähler hingestellt hatte. Das zweite Mal war ein wegen Insolvenzverschleppung angeklagter Manager eines börsennotierten Unternehmens ausgerastet, als Vogel dessen hanebüchene Rechtfertigung in einem ausführlichen Artikel zerpflückte und den Mann einen Taschentrickspieler nannte. In beiden Fällen hatten die Kläger ihre Klage schließlich wieder zurückgezogen. Ihre Anwälte waren wohl zu dem Schluss gekommen, dass dieser „Zeitungsfritze“ nichts falsch gemacht hatte – zumindest nicht in juristisch verwertbarem Sinne.
Bertram Vogel scrollte sich durch seine Ordner und klickte schließlich auf „Private Sicherheitsdienste – das Geschäft mit der Angst“. Zugegeben, dachte er selbstkritisch, der Arbeitstitel war noch ein bisschen zu reißerisch. Ist ja nur vorläufig, beruhigte er sich. Trotzdem wäre er zu diesem Zeitpunkt überrascht gewesen zu erfahren, wie sehr sich sein Thema in den nächsten Tagen noch wandeln würde. Er überflog seine bisherigen Notizen und die in den letzten Tagen gesammelten Links, bis er schließlich fand, was er suchte: die Kontaktdaten von Trust Security Service, einer der schnell wachsenden Sicherheitsdienstleister mit überregionalem Aktionsradius. Die Firma hatte nach eigenen Angaben mehrere Hundert Angestellte, von denen die meisten allerdings wohl eher geringfügig Beschäftigte waren, ein Heer von Reservisten, die man aktivieren konnte, wenn mal wieder eine Großveranstaltung abgesichert werden musste. Es handelte sich um ein Familienunternehmen, der Inhaber war ein gewisser Mehrings. Dieser wurde auf der Homepage von Trust Security Service als Selfmademan bezeichnet. Interessante Vita, grinste Vogel: erst Profiboxer in der Schwergewichtsklasse, dann Sanitäter bei den Gebirgsjägern mit Auslandseinsatz im Kosovo. Nach der ehrenvollen Entlassung arbeitete er als Krankenpfleger in der Geriatrie, eine Zeit, die er mit einem Bachelor in Krankenhausmanagement krönte. Danach war er zwei Jahre als Personenschützer tätig. Mitte dreißig gründete er seine eigene Firma, die – wie es hieß – dank ihres innovativen Konzepts rasch zu einem der landesweiten Marktführer wurde.
Vogel überging die übliche Selbstbeweihräucherung mit wachsender Ungeduld, blieb dann aber an einer Aussage hängen, die so gar nicht in die Selbstbeschreibung eines Sicherheitsunternehmens passen wollte: „Unser Name ist Programm, denn wir setzen auf Vertrauen. Vertrauen gewährt mehr Sicherheit als Schlösser und Scanner – wiewohl diese bei uns natürlich auch zum Einsatz kommen. Ohne Vertrauen kann es im Endeffekt keine Sicherheit geben!“
Damit waren für Bertram Vogel die letzten Zweifel beseitigt. Er würde seine kleine Artikelserie mit Trust Security Service anfangen. Irgendwie faszinierte ihn diese merkwürdige Mischung aus Chuzpe und Naivität, aus Kalkül und Idealismus. Er hatte die vage Hoffnung, dass dieses Unternehmen ihm einen aufschlussreichen, tieferen Einblick in die Branche gewähren würde als die ganz großen Namen. Im Grunde aber wusste er selbst nicht genau, was ihn dazu veranlasste sich näher mit dieser Firma zu befassen. Aber er hatte einen guten Riecher, der Trust Security Service würde in den kommenden Jahren die Sicherheitsdienstleistung revolutionieren.
Vogel griff zum Hörer und wählte.
„Trust Security Service, Büro Mehrings. Mein Name ist Ungerer. Was kann ich für Sie tun?“
Nun, diese kühle Frauenstimme ist schon mal sehr vertrauenerweckend, stellte Vogel zynisch fest. „Vogel, mein Name, von der Hartmann Medien Gruppe. Ich würde gern Herrn Mehrings sprechen.“
„Persönlich?“
„Höchstpersönlich!“ Vogel musste sich bremsen, um nicht mit der Vorzimmerdame seinen Spott zu treiben. Ob denn der Chef öfter unpersönliche Gespräche führe, wollte er schon fragen.
Eine kurze Pause. Dann war sie wieder da. „Darf ich fragen, in welcher Angelegenheit Sie …“
„Ich schreibe über innovative Sicherheitsdienstleister und möchte Herrn Mehrings porträtieren.“
„Dann sind Sie …
„Journalist, ja.“ Und um ihre folgende Frage vorwegzunehmen, ergänzte er: „Die Hartmann Medien Gruppe ist Herausgeber mehrerer regionaler und überregionaler Zeitungen, von denen sich einige inzwischen zu reinen online-Medien weiterentwickelt haben.“ Vogel beschloss ein wenig zu pokern. „Wenn Sie sich vorab über die Hartmann Medien Gruppe informieren wollen, kann ich gerne morgen nochmal anrufen.“
Wieder eine kurze Pause.
Vielleicht fragt sie sich jetzt, dachte Vogel leicht hämisch, ob ich sie wohl auf den Arm nehme.
Doch die Sekretärin blieb professionell. „Das wird nicht nötig sein, Herr Vogel. Herr Mehrings hätte morgen um fünfzehn Uhr eine Dreiviertelstunde Zeit für Sie, hier in seinem Büro. Wäre Ihnen das recht?“
Perfekt, dachte Vogel und sagte es auch. Er bedankte sich knapp und legte auf.
Sylvia Brunn hatte in letzter Zeit öfter Kopfschmerzen und Schweißausbrüche, manchmal auch Panikattacken. Sie fühlte sich ausgelaugt, auch wenn die letzten Schulferien erst zwei Wochen zurücklagen. Ihre Hausärztin hatte gemeint, Anzeichen für Burnout wahrzunehmen und ihr einen Psychotherapeuten empfohlen. Aber Sylvia Brunn hatte sich nie bei dem Seelenklempner gemeldet. Sie brauchte niemanden, der ihr sagte, was mit ihr nicht stimmte. Sie kannte die Ursache ihrer Beschwerden.
Es war Viertel vor zwei. Außer ihr hielt sich niemand im Lehrerzimmer auf. Die meisten Kolleginnen waren junge Mütter und mussten nach Unterrichtsende gleich los, um ihre Kinder abzuholen oder für sie da zu sein. Sylvia Brunn beobachtete den Stress dieser Frauen eher unbeteiligt. Sie selbst war nie in deren Lage gewesen. Ihre Ehe mit dem Steuerberater Franz Brunn war kinderlos geblieben. Ihr Mann hatte keinen Nachwuchs gewollt. Als die beiden sich schließlich trennten, war sie Anfang vierzig gewesen, zu alt für einen Neuanfang. Sylvia Brunn senkte ihren Kopf, umklammerte ihr Wasserglas und schloss die Augen, als eine neue Schmerzwelle durch ihren Kopf wogte.
Die Rektorin hatte sie zu einem Gespräch um zwei gebeten. Wahrscheinlich ging es um die dumme Sache mit André. Die Karetzky erwartete bestimmt, dass sie den Unfallbericht schrieb. Aber da würde sie sich resolut weigern. Das sollte gefälligst die Neue machen, die heute Pausenaufsicht hatte. Früher hätte sie solche Aufgaben letztendlich immer übernommen, wäre immer bereitwillig gewesen. Aber das Leben hatte sie verändert.
Wenn unversehens ein Besucher ins Lehrerzimmer gekommen wäre, hätte er Sylvia Brunn von hinten betrachtet leicht für einen Mann halten können: Sie war breitschultrig und ziemlich groß, ihre Gestalt wies kaum Rundungen auf und das glatte graubraune Haar trug sie kurz geschnitten. Ihr männliches Aussehen fand jedoch seinen absoluten Gegenpol in ihrem mütterlichen Verhalten als Lehrerin. Damit war sie bei Schülern und Eltern lange Zeit gut angekommen. Es waren ihre guten, erfüllenden Dienstjahre gewesen, als sie noch in Eins-Zwei arbeitete. Doch kurz nach der Trennung von ihrem Mann hatte sie die vierte Klasse einer schwerkranken Kollegin übernehmen müssen. Diese Kollegin war inzwischen frühpensioniert und soweit Brunn wusste, ging es ihr blendend. Sie selbst aber steckte seitdem in Drei-Vier fest. Sie hatte leidvoll erfahren müssen, dass sie bei den Viertklässlern mit ihrer Langmütigkeit und Toleranz schnell an ihre Grenzen stieß. Die Mädchen waren zickig ohne Ende und zeigten – wie sie verwundert registrierte – schon richtig pubertäres Verhalten. Die Jungen verhielten sich aggressiv und ziemlich rücksichtslos. Einige dieser Knaben waren – sie konnte es nicht anders bezeichnen – total gestört. Sie hatte bei diesen Schülern andere Saiten aufziehen müssen, war lauter geworden, strenger, misstrauischer. Seitdem kam es immer öfter vor, dass sie sich selbst Sätze zu ihren Schülern sagen hörte, die sie früher nie gesagt hätte.
Doch wenn sie ihre Situation ehrlich betrachtete, war es nicht der Wechsel in Drei-Vier gewesen, der ihr die Freude an der Arbeit geraubt hatte. Die Trennung von Franz und der Verlust ihrer sicheren Position als Klassenlehrerin in Eins-Zwei waren bloß Auslöser gewesen. Diese Schicksalsschläge hatten sie aus ihrem Wolkenkuckucksheim vertrieben. Gelandet war sie auf dem Boden der Tatsachen. Und die waren ziemlich ernüchternd.
Als junge Studentin hatte die Aussicht Kinder aktiv zu bilden, Geist und Gemüt der Jüngsten zu formen, sie regelrecht beflügelt. Sie hatte damals mit großen Erwartungen ihr Lehramtsstudium begonnen, erfüllt vom heiligen Ernst ihres pädagogischen Auftrags. Doch heute wusste sie, ihre Schüler wurden von anderen Vorbildern geformt, Vorbilder, gegen die sie nicht ankam. Der ästhetische Sinn ihrer Schüler zum Beispiel wurde von der Grafik ihrer Computerspiele entscheidend geprägt. Für die Bildung ihrer Wertvorstellungen war die allgegenwärtige Werbung zuständig. Die vorhersagbare Dramaturgie und die seichten Dialoge endloser Fernsehserien prägten ihren literarischen Sinn. Ihre Fantasie wurde mit perfekt durchgestylten Hollywoodbildern vergewaltigt, während ihre YouTube-Idole ihnen beibrachten in grammatikalisch schrägen Halbsätzen zu reden. Inzwischen waren auch die Eltern ihrer Schüler so jung, dass sie diese Entwicklung nicht weiter problematisch fanden. Sylvia Brunn hatte ihre Erwartungen jedes Jahr ein bisschen weiter runtergeschraubt.
„Frau Brunn?“
Sie öffnete die Augen. Vor ihr stand die Rektorin, lächelte knapp und machte eine einladende Geste in Richtung Rektorat.
„Kommen Sie bitte!“ Karetzky ging ihr voraus, überquerte den Flur zu ihrem Büro, dessen Tür aufstand und bat sie einzutreten.
Plötzlich unsicher blieb Brunn stehen, sobald sie den Raum betreten hatte.
„Bitte setzen Sie sich doch!“ Die Rektorin deutete auf das schlichte Ecksofa, das an der Wand hinter ihrem Schreibtisch stand, ein modernes Funktionsmöbel mit einem sachlich graublauen Bezug. „Wasser?“ Karetzky hatte die volle Glaskaraffe bereits angehoben.
Sylvia Brunn nickte und rutschte nervös auf ihrem Sitz nach vorne, was so aussah, als wollte sie aufspringen, um ihr Glas entgegenzunehmen.
Dann saß die Rektorin ihr gegenüber und eine eigentümliche Stille trat ein.
„Wie geht es Ihnen, Frau Brunn?“
„Geht so.“
Karetzky nahm einen Schluck Wasser und stellte das Glas etwas zu laut ab. „Das war ganz schön aufregend, mit diesem André Mehrings heute, oder?“
Sylvia Brunn nickte stumm.
„Der Vater hat nochmal im Sekretariat angerufen. Der Junge ist für die nächsten Tage krankgeschrieben. Offenbar bleibt er noch bis übermorgen in der Klinik.“
„Ach! Wie geht es ihm?“
Karetzky überging die Frage und deutete stattdessen mit dem Kinn auf die Kollegin ihr gegenüber. „Hatten Sie vor das Kind zu besuchen?“
„Ich, ähm …“ Sylvia Brunn fühlte sich überrumpelt. Sie hatte doch eben erst erfahren, dass André im Krankenhaus lag.
Die Rektorin beugte sich vor. „Hören Sie, Frau Brunn, ich will keinen Ärger. Herr Mehrings ist ein einflussreicher Unternehmer. Sie wissen, dass er uns die Finanzierung eines neuen Schulzauns zugesagt hat.“ Sie lächelte flüchtig. „Ja, ausgerechnet der Schulzaun! Ich weiß. Ironie der Geschichte, kann man da nur sagen. Aber können Sie sich vorstellen, wie viel es kostet unseren Schulhof einzuzäunen? Wenn das Projekt von einem privaten Unternehmen gesponsert wird, bleibt der Schule mehr Geld für pädagogisch wichtige Anschaffungen. Sie wissen, wie das ist.“
Sylvia Brunn blickte starr auf ihr Glas. Sie atmete bewusst langsam, ihr Schädel brummte. Ja, sie wusste, wie es war. Immerhin redete die Karetzky jede zweite Konferenz über diese – wie hieß das noch? – „Pauschalierung der Sach- und Personalkosten“ und darüber, dass die Schulen Instandhaltungsmaßnahmen inzwischen oft selbst finanzieren müssten. Klar, da war so ein Geldsegen von privater Seite höchst willkommen. Brunn war nicht blöd. Sie konnte sich auch denken, dass die Investition für den Mehrings bloß ein Mittel war, Steuern zu sparen. Stirnrunzelnd blickte sie hoch und stellte fest, dass die Rektorin sie musterte.
„Besuchen Sie den Jungen, reden Sie mit dem Vater! Sorgen Sie dafür, dass Herr Mehrings sich wieder beruhigt. Der Mann hat mich vorhin angerufen. Er klang verärgert und forderte mich auf, mehr Aufsichtspersonen für unsere…“ – Karetzky deutete Anführungsstriche in der Luft an – „Schutzbefohlenen abzustellen.“
Kirchenleute! Wie kam dieser Schwan darauf zu meinen, dass er etwas mit Kirchenleuten zu tun haben wollte. Der stattliche Unternehmensberater fiel Ernst Feig wieder ein, als er am Eingang zur Tiefgarage hielt und wartete, bis das Tor sich ganz geöffnet hatte. Er ließ seine Yamaha runterrollen und ärgerte sich im Nachhinein, dass er diesem Typen zugesagt hatte.
Zu behaupten, dass sich Ernst Feig selbst als nichtreligiöser Mensch sah, wäre gewiss eine Untertreibung. Er konnte mit dem ganzen Brimborium von Gebeten und Gesängen nichts anfangen, dieses süßliche Wir-haben-uns-alle-lieb-Theater. Für ihn waren religiöse Rituale entweder naives Gutmensch-Getue, Scheinheiligkeit oder schlichter Aberglaube. Am meisten aber regten ihn die Kirchenleute auf, wobei er keinen großen Unterschied zwischen Katholiken, Protestanten und anderen „Sekten“ machte. Hätte man ihn nach dem Grund für seine Abneigung gefragt, wären ihm sicherlich ein paar Erklärungen eingefallen. Er hätte vielleicht gesagt, dass er die Kirchenleute für verlogen hielte. Es wäre ihm möglicherweise auch in den Sinn gekommen zu sagen, dass diese Christen sich weigern würden die Realität anzuerkennen, wobei er natürlich jene Realität meinte, die er selbst für die einzig existente hielt. Es war durchaus so, dass sich Ernst Feig etwas auf seine Furchtlosigkeit einbildete. Er war stolz darauf, dass er sich traute, den harten Tatsachen dieser Welt kühn in die Augen zu schauen. Doch der wahre Grund seiner heftigen Ablehnung lag unterhalb seiner Bewusstseinsschwelle, blieb ihm also selbst verborgen.
Er war ein stolzer Mann, ein aufrechter Mann, der seine Würde maßgeblich davon ableitete, dass er sich vor nichts und niemandem verbeugte. Unterwürfigkeit war ihm nicht bloß ein Ausdruck von Schwäche; er sah darin vielmehr ein Zeichen von fehlendem Stolz, ja von Feigheit. Vor irgendeinem Menschen – und wäre er noch so „göttlich“ – auf die Knie zu fallen, verbot ihm seine Selbstachtung. Aber genau das tat der gläubige Christ. Er machte sich selbst klein und gering, erhöhte seinen Jesus zur himmlischen Gestalt und kroch vor ihm im Staub dieser Erde. Christen, das hatte er oft genug beobachtet, legten eine Sklavenmentalität an den Tag, liebten es zu gehorchen. „Dein Wille geschehe!“ war der Leitsatz von Kindern, Kriechern und Krämerseelen. Und weil Ernst Feig die Kirchenleute auf diese Weise wahrnahm, konnte er sie letztlich nur verachten, wenn auch der Ursprung seiner Verachtung für ihn, wie er sich kannte, im Dunkeln lag.
Im Grunde war Ernst Feigs Vorstellung von Religiosität zu eng und zu sehr von Traditionen, von historischen Fakten und biografischen Erfahrungen geprägt. Wäre es anders gewesen, hätte er erkennen können, dass das, was seine Verachtung auf sich zog, nur wenig mit Religiosität zu tun hatte. Was er ablehnte, waren Konventionen, erstarrte Strukturen, leere Hüllen, aber auch Ängstlichkeit, Einfalt und Hochmut. Wäre es ihm möglich gewesen, Religiosität als etwas zu betrachten, das Wahrheitsliebe, Kreativität, Lebensfreude und Selbstliebe umfasste, hätte er sie gewiss nicht bekämpfen wollen. Mehr noch, ihm wäre sogar aufgegangen, dass er selbst ein durch und durch religiöser Mensch war.
Er parkte seine XJR 1300, ein ganz in Schwarz gehaltenes Naked Bike Model, nahm seinen Helm ab und fuhr mit dem Fahrstuhl in sein Loft hoch. Es war fast halb eins, als er seine geräumige Wohnung betrat, die Teil einer alten, umgebauten Schuhfabrik war. Spät abends noch zu essen hatte er sich schon vor langer Zeit abgewöhnt. Stattdessen beendete er den Tag einer Vorstellung gern mit einem Glas Rotwein. Er öffnete eine neue Flasche, schenkte sich ein, löschte das Licht und stellte sich auf die nächtliche Dachterrasse. Da die alte Schuhfabrik am Hang errichtet worden war, blickte er vom oberen Stockwerk aus auf den Großteil der Stadt hinab.
Er liebte es hier zu stehen, ein Glas Barolo in der Hand, und seinen Blick über das weißgelbe Lichtermeer unter ihm schweifen zu lassen. Scherzhaft nannte er diesen Ort seinen Adlerhorst, eine Bezeichnung, die ihm nicht zuletzt deshalb gefiel, weil er sich selbst damit in die Nähe des Führers rückte. Dabei dachte er freilich nicht an das gleichnamige Führerhauptquartier im Taunusgebirge, von dem er gar nichts wusste, sondern an das atemberaubend hoch gelegene Kehlsteinhaus in Obersalzberg. Ernst Feig provozierte gern und er war ein Meister der Selbstironie.
Aber diese humorvolle Äußerung enthielt einen tieferen Sinn, der ihm selbst entging. Der Kabarettist war natürlich kein Diktator, aber sein Selbstgefühl entsprach durchaus dem eines Herrschenden. Von seinem „Adlerhorst“ blickte er auf die Welt ihm zu Füßen wie ein archaischer Fürst auf seine Untertanen. Als rationaler, nüchtern eingestellter Mensch konnte er derlei Imaginationen nur unter dem Aspekt künstlerischer Kreativität gelten lassen, eine Kreativität, die er nutzte, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dass er tatsächlich ein König war, ein thronender Fürst, ein Hüter der materiellen Welt – nicht in der Fantasie, sondern wirklich – das hätte er als Humbug weit von sich gewiesen.
Ernst Feig fühlte sich weder religiös, noch in irgendeiner Weise königlich – gerade heute Abend nicht. Ganz im Gegenteil! Er fühlte sich verraten. Es war eigenartig, dass er sein Gefühl mit diesem Wort umschrieb, aber es brachte seine momentane Lage auf den Punkt. Er fühlte sich von diesem Schwan verraten. Sicher, der Mann hatte ihn nicht gezwungen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Dennoch war es Feig unmöglich gewesen nein zu sagen. Warum bloß? Er war sich selbst unverständlich und versuchte sich sein Verhalten zu erklären. Aus purer Gewohnheit nahm er an, dass etwas von außerhalb seiner selbst ihn zu seiner Entscheidung bewogen hatte. Da lag natürlich Joachim Schwan als Ursache nahe. Immerhin hatte der umgängliche Unternehmensberater wortreich erklärt, dass er, Feig, genau der Richtige für diesen Auftrag wäre: „Gerade weil es dort verknöcherte Strukturen gibt, Herr Feig, gerade weil diese Kirchenleute so sind, wie sie sind, brauchen sie einen wie Sie, einen, der den Mut hat, ihre so genannten letzten Wahrheiten zu hinterfragen. Glauben Sie mir, diese Begegnung wäre nicht nur für die Kirchenleute, sondern auch für Sie inspirierend.“
Gewandt und – wie er widerwillig anerkennen musste – letztlich auch überzeugend hatte dieser Schwan geredet. Noch dort in der Garderobe des Theaters war der Mann ihm wie ein Mensch vorgekommen, der von einer Mission beseelt war. Was treibt den an, hatte er sich gefragt. Doch Schwans Beweggründe waren ihm verborgen geblieben. Und vielleicht fühlte sich Feig auch deshalb von ihm verraten. Es war ihm, als führte Joachim Schwan ihn auf einen Weg, den er nicht gehen wollte, als hätte der Berater ihn an ein böses Schicksal verraten, ein Schicksal, das ihn dem trügerischen Schoß der Kirche auslieferte.
Nun spielte Verrat als dramatische Figur eine zentrale Rolle in Feigs Leben, obwohl ihm das selten und auch dann nur ansatzweise bewusst wurde. In einem von ihm selbst inszenierten inneren Drama war er Verräter und Verratener zugleich, denn Ernst Feig hatte sich selbst verraten und an die Herrschaft des Leibes ausgeliefert. Er hatte sein inneres Licht unter den Scheffel gestellt und sich selbst unter das Joch einer Realität gezwungen, in der die Macht der Materie mit eiserner Hand herrschte. Damit leugnete er die Weiten und Tiefen seines Wesens, die die schmucke Insel seiner Sinnenwelt wie gewaltige Ozeane umgaben.
Obzwar er mit Bühnendarstellungen und Rollenspielen vertraut war, erkannte er doch nicht, dass es sich bei seinem so genannten privaten Leben im Grunde auch nur um ein Theaterspiel handelte. Er fasste seine Rolle als Kabarettist zu eng, war nicht in der Lage „Bühne“ größer zu denken als die Bretter, auf denen er nach seinem Drehbuch agierte. Es wäre ihm völlig abwegig erschienen, hätte ihm jemand gesagt, dass er jenseits der gewohnten Bühne in einem Stück spielte, dessen Dramaturgie und Plot ihm gar nicht bewusst wäre. Und doch machte sich ihm seine Verwicklung im uralten Drama des Verrats bemerkbar – nicht als klarer Gedanke, nicht als intuitive Einsicht, sondern als diffuses Gefühl des Unwohlseins und des Misstrauens. Es erinnerte ihn vage an Orte und Zeiten, in denen er zu wenig geliebt und zu wenig gelernt hatte.
Das und nur das war der Grund dafür gewesen, dass er dem Unternehmensberater nicht klar und entschieden hatte absagen können. Tief im Innern wollte er die Begegnung mit den Kirchenleuten sehr wohl. Seine Seele wusste, was sie brauchte, wusste, was ihm fehlte, und setzte alle Hebel in Bewegung ihr Ziel zu erreichen.
Ernst Feig stellte sein halbvolles Glas ab. Plötzlich fand er keinen Geschmack mehr am edlen Barolo. Er ging hinein, zog sich im Dunkeln aus und legte sich ins Bett.
Jasmin Conradi war erwacht. War sie geweckt worden? Oder erweckt? Hatte sie geschlafen, war ihr ganzes Leben eine einzige dunkle Nacht gewesen? Konnte es tatsächlich sein, dass der Mensch, der sie immer zu sein geglaubt hatte, bloß eine Traumgestalt war? Sollte am Ende alles, was sie je gedacht, gesagt und getan hatte, bloß eine Illusion gewesen sein? Die heutigen Geschehnisse ließen, wie es schien, kaum eine andere Schlussfolgerung zu.
Ihr fiel die Karte ein, die eine Freundin ihr aus dem Urlaub auf Kreta geschickt hatte. Die Karte zeigte das holografische Bild einer frisch geschlüpften Karettschildkröte. Wenn man den Karton leicht kippte, schien das Tierchen aus dem Bild zu kriechen. War sie selbst nichts anderes als ein Hologramm gewesen, ein Trugbild mit nur scheinbarer Tiefe? In all den Jahren hatte dieses oder jenes sie manchmal ein bisschen bewegt und dann war es ihr so erschienen, als ob sie lebte und es mit ihr vorwärtsging. Aber im Grunde war sie immer nur auf der Stelle getreten, ohne Woher und Wohin.
Sie nahm sich ein Glas aus einem der Hängeschränkchen, füllte es mit gefiltertem Leitungswasser und setzte sich wieder an den Küchentisch. Ferdinand war auf Geschäftsreise, die beiden Söhne besuchten Freunde am anderen Ende der Stadt. Sie war froh und dankbar, jetzt alleine zu sein und mit niemandem reden zu müssen. Was hätte sie sagen können? Wie war dein Tag? Gut! Und deiner?
Jasmin Conradi sah sich selbst bis in ihr tiefstes Selbstverständnis in Frage gestellt, herausgefordert und verwirrt durch die Ereignisse des heutigen Tages. Als Medizinerin hatte sie keine Erklärung für die Veränderung, die sie an sich erlebte. Als Mensch war sie irgendwie nie veranlasst worden, eigene Ansichten zu existenziellen Fragen zu entwickeln. Ihr Leben war in ruhigen Bahnen verlaufen und hatte sie noch kein einziges Mal genötigt, ihren Kurs zu ändern. Alles war ihr immer leicht gefallen, die Schule, das Studium, die Geburt ihrer Söhne. Ärztin wurde sie, weil schon ihr Vater Mediziner war. Eine eigene Entscheidung hatte sie nie fällen müssen, Alternativen zum Medizinstudium waren ihr nicht in den Sinn gekommen. Doch nun fühlte sie sich herausgefordert einen eigenen Weg zu gehen.
Sie trank einen kleinen Schluck und starrte auf den leeren Stuhl ihr gegenüber. Allerdings, dachte sie, kam dieses Schicksal nicht etwa wie eine freundliche Einladung, viel eher wie ein Dieb in der Nacht. Sie wunderte sich nicht über diesen Gedanken und auch nicht über das Gleichnis, in das sie ihn kleidete. Hätte man sie darauf aufmerksam gemacht, wäre ihr dazu wohl nicht viel eingefallen. Vielleicht wäre sie assoziativ auf den biblischen Ursprung gekommen, vielleicht aber auch nicht. Ihr schien nur dieses Bild eines plötzlich einbrechenden Fremden sehr treffend. Denn das, was da in ihr Leben einbrach, war so fremd, das sie es zunächst nicht mit vertrauten Begriffen und Bezugspunkten einordnen, es nicht einfangen konnte.
Vorausgegangen war diesem Durchbruch des Neuen ein Schmerz, ein stechender Schmerz in ihrem rechten Fuß. Er tauchte zum ersten Mal auf, als sie an die Liege dieses verletzten Jungen trat und zwar noch bevor sie dessen durchbohrten Fuß bemerkt hatte. Zunächst glaubte sie an eine Sinnestäuschung und meinte, sie würde sich den Schmerz bloß einbilden. Sie reagierte wie die meisten Menschen reagieren, wenn sie etwas gleichermaßen Ungewöhnliches wie Unerklärliches erfahren. Kann nicht sein, sagte sie sich, brauche jetzt mal eine Pause. Doch als die Empfindung stärker wurde, war es kaum noch möglich gewesen, sie als das Produkt ihrer Fantasie beiseite zu schieben. In kurzer Zeit wuchs der Schmerz so sehr an, dass sie sich an der Liege abstützen musste, um ihren Fuß zu entlasten. Wenn das Einbildung ist, dachte sie mit zusammengebissenen Zähnen, dann ist sie aber sehr überzeugend, und sie schloss kurz die Augen. Dann wich ihre Verwirrung einem Gefühl panischer Angst. Sie atmete tief ein, um dem wuchtigen Ansturm des Gefühls Herr zu werden. Die Situation drohte ihr zu entgleiten. Erst als sie verstand, dass sie tatsächlich die Furcht des verängstigten Knaben durchlebte, trat eine gewisse Beruhigung ein. Eine Welle des Mitgefühls erfasste sie, eine Herzenswärme, die sie auch als Mutter nie erlebt hatte. Denn dieses Gefühl war irgendwie größer, nicht bloß persönlich, sondern umfassender. Es galt nicht nur ihrem Patienten und ihr selbst; es schien sich auf alles, was um sie herum war, auszudehnen.