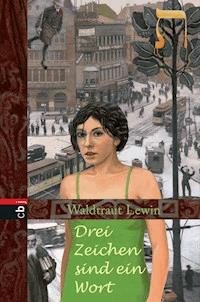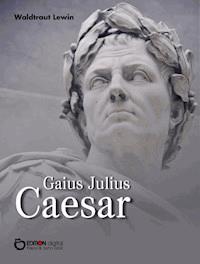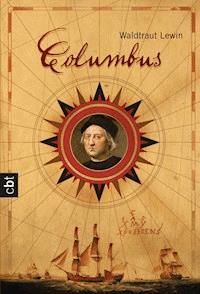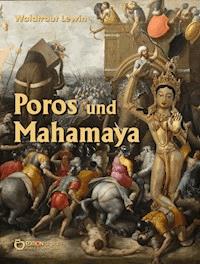23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: 175er Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
"Das Beiderwandkleid" von Waldtraut Lewin ist auch als kunstvoll gestaltetes Buch (die Druckversion) im Festeinband mit zusätzlichem durchsichtigem goldbedruckten Schutzeinband aus Pergamentpapier erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Buchcover
Danksagungen
Ich widme dieses Buchden tapferen Überlebenskünstlerneiner Familie.
Der 175er Verlaghat dieses Manuskript nach über zwanzig Jahren vergeblichen Suchensangenommen.
Für dieses Vertrauen möchte ich mich bedankenund wünsche dem Verlagder dieses Jahr 25 Jahre jung wirdund mir gute Fortune.
Waldtraut LewinBerlin, den 12.03.2015
Titelseite
Waldtraut Lewin
Das Beiderwandkleid
Roman
mit 22 Illustrationen vonLauri Elexsen
Impressum
Alle Rechte der Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung sind dem 175er Verlag vorbehalten. Kein Teil des Werkes (weder Text noch Abbildungen) darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, mechanische Druckverfahren, Mikrofilm oder ein anderes System) ohne schriftliche Genehmigung des 175er Verlag reproduziert oder unter Verwendung von Computersystemen (egal welcher Art) verwendet, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek (Leipzig/Frankfurt, ff. DNB): Die DNB verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet unter http://www.d-nb.de abrufbar.
Waldtraut LewinDas BeiderwandkleidRoman
mit 22 Illustrationen von Lauri Elexsen
Copyright in all countries:by 175er Verlag – Hartha-Stadt 2015Tag der Veröffentlichung:1. Auflage BUCHversion am 12.03.2015
Verlagsleitung:Rosa von Zehnle – Hartha-StadtLek- & Korrektorat:Burghard Heiland – ÜberlingenAbbildungen & Grafiken:Lauri Elexsen – Karvia (Finnland)Umschlagsidee & Buchsatz:Rosa von Zehnle – Hartha-Stadt
Weltweiter eBuch-Vertrieb:www.ePUBoo.comVertrieb: Grosso, Handel, Weltnetzseiten, Medien VVG…Kostenfreier Versand (DR): www.medien-vvg.de
ISBN 978-3-932429-09-5E-BOOK 978-3-932429-10-1
www.175er-verlag.de
Epigraph
Bemerkung zur „Rächtschreibung“ im Buch:Bücher, Texte und Weltnetzseiten des175er Verlag und seiner Partner erscheinenin alter, aber dafür – vernünftiger – deutscherRechtschreibung, wie sie bis 1996 galt.Und das so lange, bis der DUDENnicht mehr Empfehlungen gibt,sondern seiner eigentlichen „Pflicht“ nachkommt,klare, deutliche und „amtliche“ Vorgabenfür eine einheitliche Rechtschreibung definiert und für ALLE gültig erklärt.
Weitere Infos:www.jfsz.de/rechtschreibung.php
Zum 25-jährigen Bestehen seines 175er Verlag schenkte sich Verlagsinhaber Rosa von Zehnle zum 55. Geburtstag das 66. Buch von Waldtraut Lewin, welches er wiederum der Autorin zu ihrem 77. Geburtstag versprach und auf der Leipziger Frühjahrsbuchmesse 2015 präsentierte.
HERZlichen Dank Waldtraut Lewin!
Tuschezeichnung: Lauri Elexsen (Finnland)
Inhaltsverzeichnis
Abbildungen von Lauri Elexsen
10, 12, 36, 42, 48, 54, 74, 84, 98, 104, 118, 132, 152, 188, 200, 216, 232, 330, 344
dazu die Grafiken: goldener Schutzumschlag und Buchvakantseiten vorn und hinten
Erster Teil
I
I – 1
Mit Dir will ich reden, Dich will ich herausfordern, auch wenn ich weiß, daß Du siegen wirst. Du siegst immer.
Ich weiß, Du kommst nur, wenn man Dich nicht ruft. Aber manchmal weiß ich, daß Du da bist. Ich spüre die Kälte. Den Schauer, der einem die Eingeweide zusammenzieht. Etwas Fremdes ist im Raum. Etwas außer mir und außerhalb jedes lebendigen Wesens.
Ich lernte Dich kennen. Tod. Tod um mich her.
So. Nun habe ich Dich bei Namen genannt.
Ich habe Dich gesehen. Im Auge des Hundes wohntest Du, das sich mit einem grauen Schleier überzog, als man ihm die erlösende Spritze gab. Der nicht mehr hörte, daß ich ihm zuflüsterte, ich sei bei ihm. Nicht mehr. Nie mehr.
Im erkaltenden Hals des alten Mannes hattest Du Dich eingegraben und mich grausam geneckt, denn als ich nach seiner Schlagader faßte, glaubte ich es pulsieren zu spüren, und als ich mein Ohr auf seine Brust drückte, war mir, als höre ich seinen Herzschlag. Dabei war es nur mein eigener Puls, den ich vernahm, und das Rauschen meines eigenen Blutes. Du hattest ihn schon längst in Deinen Fängen, als ich noch hoffte.
Und getrennt durch die finale Glasscheibe, nahm ich Abschied von der Frau, die ich am meisten liebte. Du Monster hattest ihr bereits Gewalt angetan und sie nach Deinem Gusto zugerichtet. Hattest ihr den Mund aufgerissen zu einer klaffenden Höhle und hattest an ihren schönen Pianistinnenhänden im Nachhinein lange weiße Krallen wachsen lassen, als sie selbst es nicht mehr verhindern konnte. Das war nach Deinem Geschmack.
Unersättlicher, hat man Dich nicht genügend gefüttert, gerade vor kurzer Zeit, vor einem Atemzug der Ewigkeit, als sie sich alle gegenseitig umbrachten, Dir opferten auf ungeheure Weise?
Ich will nicht. Keiner will es.
Nicht einmal die Berge, die vor mir sind. Die Sonne scheint darauf. Abendsonne. So scharf und klar diese Berge, als wenn man die Augen des Adlers hätte. Jede einzelne Pflanze ist zu sehen, wie sie sich auf dem Hang festkrallt und dem Licht gierige Lippen zuwendet. Jeder rötliche Stein, schwebend zwischen Absturz und Verharren.
Sie alle wollen ewig da sein, obwohl es dafür keinerlei Versprechen gibt. Keine Zusage.
Und ich empfinde anders als die Pflanze, als der Stein?
Wie kann etwas weg sein, auf einmal? Wie kann ich verschwinden?
Der Teddy, den ich von der Brücke ins Wasser werfe. Als ich zurückkomme, ist er fort. Warum hat er nicht ausgeharrt, nicht gewartet auf mich? Warum ist nicht wenigstens der Teddy – ewig?
Ich rede zu DIR, DU Monster. Und DU wirst mir schon noch antworten müssen, wenn ich DICH anrufe.
Denn diesem Unsinn des Vergehens setze ich meinen Trotz entgegen.
Indem ich bewahre, was DU verschluckst, verschlingst, zerkaust und mit Erde überdeckst.
DU sollst nicht alles kriegen.
Jetzt, wo ich DICH durchschaue.
Freilich: Als ich IHM das erste Mal begegnete, erkannte ich IHN nicht.
Dann aber lernte ich IHN kennen. Im Feuer. Aber ich verleugnete IHN. Noch. Noch ging alles gut.
Das hölzerne Treppengeländer brannte lichterloh. Es knackte und knisterte wie die Scheite im Ofen, bevor sie sich wandeln und zu Asche werden.
Ich wollte nach oben, genau wie mein Haar. Meine Zöpfe flogen auf, der Sog riß sie mit.
„Du kannst da nicht hin!“, schrie der Großvater. „Es brennt! Alles verbrennt!“
Aber das glaubte ich nicht.
Dritter Stock rechts war die eichene Tür mit dem Messingschild und der glänzenden Klappe für die Briefe. Dort war ich gerettet. Immer war ich dort gerettet. Drinnen.
Mochte das Geländer brennen. Das da oben, das da drinnen war unversehrt.
Ich wurde nach draußen gezerrt.
Vorher waren wir im Keller gewesen. Wir taumelten hinaus, ich an der Hand des Großvaters, fort aus den Schreien und Gebeten, fort aus dem Staub und der Dunkelheit – denn nach den Glühbirnen waren auch die trüben kleinen Lichter in ihren Metallringen erloschen; ich wußte nicht, daß es daran lag, daß sie nicht mehr atmen konnten.
Der Keller war schlimm. Jetzt waren wir im Paradies der Flammen. Es war sehr heiß, aber man ließ mich nicht nach oben, ins Unversehrte, ins Bekannte, ins Sichere.
Für eine Nacht war es viel zu hell. Scheiben knallten berstend. Menschen brüllten.
ER war allgegenwärtig, aber ich kannte und erkannte IHN nicht.
Wie windig es war! Dem Großvater wurde der Hut vom Kopf geweht, er versuchte nicht, ihn zurückzuholen. Fest, fest hielt er meine Hand, damit ich nicht nach oben konnte zur Wohnung.
Die Großmutter rang nach Luft; ihr Herz! Das kannte ich schon.
Wo war die Mutter? Abhanden gekommen, vielleicht von diesem Wind, dem Feuersturm, fortgeweht.
Ja, sie fand sich wieder an.
Er gewann keine Gewalt über uns diesmal.
Wir gingen und gingen.
Da waren die Gärten, auch in ihnen waren die Brände. Eine Laube – oder war es ein kleines Haus? – brannte wie ein Freudenfeuer. Menschen tanzten rundum und schrieen, aber nicht vor Freude. Ich wußte nicht, daß Menschen so heulen können, wie das Vieh. Wenn Er zuschlägt.
Der Großvater ging zu ihnen, sagte Worte, die ich nicht verstand. Sie nickten und heulten weiter, rangen die Hände. Sie machten mir Angst. Auch, wenn ich nichts verstand.
Daß der Großvater uns alle gerettet hatte, sagten sie mir später.
Wie denn, gerettet?
Er hatte darauf bestanden, die vielfach verschlossene Stahltür zu öffnen, die uns, die im Keller, in der Höhle, von den freien Flammen schied.
Sonst wären wir alle erstickt und verschmort.
Das hörte sich schrecklich an, aber was sollte das sein? Du warst im Verborgenen, Freund.
(Freund? Freundin? Er, sie, es? Ach, weiter.)
Wir waren irgendwo, wo ich nicht sein wollte.
Nachts träumte ich.
Ich ging an der ersten und zweiten Etage an geschwärzten Höhlen vorbei. Kein Geländer. Verkohlte Streben.
Dann aber: Dritter Stock rechts. Die eichene Tür, das Messingschild, jene glänzende Klappe für die Briefe.
Es war da. Unzerstörbar. Natürlich war es da.
Hier war ich geborgen. Ich brauchte nur die Hand auf die Klinke zu legen, und die Pforte tat sich auf.
Meine Räume, meine Stimmen, meine Lichter.
Das Bett, in dem ich mich verstecken konnte. Die Decke bis zur Nasenspitze, der Kissenzipfel, an dem ich saugte.
Der Schwalbenschrei von draußen aus der Abendröte.
Die Sonnenstäubchen im Lichtstrahl.
Der Gesang.
Da konnte ich noch nicht wissen, daß ich einen Weg gefunden hatte – nein, nicht DICH zu besiegen. Das kann niemand. Aber DIR Paroli zu bieten. Ich weiß, man scherzt nicht mit DIR. Aber man kann DIR etwas aus den Händen winden. Indem man gegen das Vergessen angeht.
Erinnern ist Leben.
WENN DU MEINST, so sagst DU. ICH HABE NOCH ZU TUN. ENTSCHULDIGE MICH.
Und ich wußte noch gar nicht, daß ich bereits in einen Dialog mit DIR getreten war. Sage ich. Und versuche, mich nicht zu fürchten. DU hast mir also zugehört.
WEIL DU GESAGT HAST; MAN SCHERZT NICHT MIR. UND DU TUST ES GERADE:
Wer könnte das wohl?
VERSUCHT HABEN ES SCHON VIELE. MEIST AUF SEHR ERNSTHAFTE WEISE.
DU hältst mich für unernst?
IM MOMENT FÜR UNEHRERBIETIG
Ja, ich habe DICH schon mal einen Sauhund genannt.
DAGEGEN IST NICHTS EINZUWENDEN.
Aber? Was dann?
LEBE WOHL.
Was für ein merkwürdiger Gruß. Von diesem da. –
Sie fuhren dorthin. Schon öfters. Ich bekam es heraus.
Ich hatte es immer gewußt, daß es nicht fort war. Aber sie wollten mich nicht mitnehmen. Ich schrie so sehr, daß ich Fieber bekam. Schließlich mußten sie doch mit mir reisen. Mit der Bahn. Es war ganz natürlich, dorthin zu gelangen, keine Zaubersprüche waren nötig, keine Beschwörungen. Man stieg in den Zug, als wenn man die Sommerfrische fahren wollte. Auf der harten Bank des Abteils schlief ich ein, beglückt, beruhigt.
Die Straßen der Stadt freilich gab es nicht mehr. Wo vordem Häuser gewesen waren, hatte nun jemand Berge aus Steinbrocken aufgeschichtet. Hin und wieder gab es dazwischen ein Haus. Die Doppelstränge der Straßenbahngleise zogen sich dazwischen hin, wie Schlittenspuren im Schnee. Sie waren Wegweiser, sonst hätte man sich verlaufen.
Es war gut, daß sie mich bei den Händen genommen hatten, rechts der Großvater, warm, fest, links die Mutter, kühl und leicht wie ein Seidenblatt. Nur ihre Fingerkuppen waren rau; ich wußte, das kam vom Gitarrespielen. So gingen wir auf den Gleisen entlang immer tiefer in die Trümmerwelt hinein. Ich schloß die Augen und ließ mich führen.
Es war wie in den Nächten. Erst das Dunkel. Dann die Ankunft.
Wir standen davor.
Da war die Fassade. Die Toreinfahrt mit den Metallschienen für die Wagenräder, wenn jemand sein Fahrzeug auf den Hof bringen wollte. Der Hausflur, getäfelt mit meergrünen Kacheln, geziert mit Lilien, Blume und Blatt.
Und da die Treppe aus Stein. Kein Geländer, verkohlte Streben.
Angekommen.
Sie hatten mich losgelassen, waren beschäftigt. Ich machte mich auf.
Meine Mutter holte mich im zweiten Stock ein, auf dem Treppenabsatz ohne Geländer. Vor den leeren Höhlen der feuergeschwärzten rußigen Eingänge.
Sie weinte. Ich konnte mich nicht erinnern, sie zuvor jemals weinen gesehen zu haben.
Ich ging mit ihr zurück.
Hinaufzulaufen, war ein Leichtes gewesen. Zurück fürchtete ich mich, ging neben der Mutter an der Wand, stützte mich mit der freien Hand ab an der rissigen Mauer, bekam schmutzige, rußige Finger.
(Seitdem gehe ich keine Treppe ohne Geländer mehr, keinen Gebirgspfad, wo ich nicht Halt an einer Wand finde.)
An der Gartenmauer hatte früher der Fliederbusch gestanden, dessen Duft abends in unser Fenster strömte, wenn die Schwalben am rötlichen Abendhimmel jagten und vor Glück schrieen. Jetzt hatten sie dort ein hoher Schuttberg aufgetürmt. Nichts mehr mit Flieder.
Meine Mutter kletterte mit mir auf diesen Schuttberg; man knickte um zwischen den scharfkantigen Steinen.
„Sieh hin. Da oben ist nichts mehr.“
Wir hockten beide da, sie hatte den Arm um mich gelegt, ihr Körper bebte vor Schluchzen.
Ich legte den Kopf in den Nacken und sah nach oben.
Aber ich sah nicht, was ich sehen sollte.
Da war kein Dach mehr, nein. Da war kein vierter Stock mehr.
Aber den dritten Stock, den gab es.
Da war das Fenster des Berliner Zimmers. Es stand offen. Da das Küchenfenster. Gleich würde die Großmutter ihren Kopf herausstrecken und nach mir rufen, nicht, um mich wirklich zu holen. Nur um sicher zu gehen, daß ich gehorsam war und den Hof nicht verlassen hatte.
Warum sollte ich nicht hinaufgehen, jetzt wieder?
Aber meine Mutter weinte.
Den Tränen meiner Mutter verdanke ich, daß der dritte Stock rechts unversehrt blieb.
Ich war nicht oben. Ich habe das Nichts nicht gesehen.
Was taten sie dort, warum gingen sie dorthin?
Ich wollte nicht wieder mitgenommen werden. Fragte nicht nach.
Zufällig hörte ich ihre Gespräche; sie redeten in meiner Gegenwart mit fremden Leuten, als sei ich nicht vorhanden, ich war so weit entfernt von ihnen, wohnte so weit unter ihrer Größe, vielleicht vergaßen sie mich manchmal wirklich.
Sie hatten, so hörte ich, sich durchgewühlt bis zu jener Stahltür, die mein Großvater damals gegen den ausdrücklichen Befehl eines Mannes, den sie Blockwart nannten, geöffnet hatte, sonst wären alle „erstickt und verschmort“.
Erstickt und verschmort hörte ich immer wieder. Es war eine Art Motto, eine Devise, die auf einen Schild gemalt wurde.
Wer hatte diese Tür dann aber wieder verschlossen, nachdem sie alle draußen waren? Davon sprach keiner. Aber daß sie verschlossen war, das war eine Tatsache, sonst hätten sie sich die Arbeit nicht machen müssen: Zunächst mit Spitzhacken und Schaufeln die Trümmerbrocken beiseite räumen; mit abgerissenen Nägeln und zerschundenen Fingerknöcheln, die blassen Gesichter von Staub gepudert, kaum, daß sie die verkrümmten Rücken gerade zu richten vermochten danach.
Sie gruben den Weg frei durch den Schutt zum Eingang, die Trümmerberge ragten auf, größer als sie selbst.
Dann fanden sie die Stahltür. Die Verschlüsse von der Hitze verschweißt.
Wie es ihnen gelang, sie zu öffnen, erfuhr ich nicht. Ich hörte nur, daß sie einen Tag warten mußten, bis sie hinein konnten. Die Hitze.
Erstickt und verschmort.
Dann gingen sie mit ihren Taschenlampen und holten aus den Kellerräumen, was überdauert hatte. Die Dinge, die sie vorher dort hingebracht und geborgen hatten für einen Fall wie diesen: Kochtöpfe, Besteck, verbeulte Blechbüchsen mit Lebensmitteln, die nun zum zweiten Mal gegart waren. Sogar Glas und Porzellan war unzerbrochen da, und das Werkzeug des Großvaters, Lötkolben, Zangen und Pinzetten, auch das Gerät, mit dem man Radioröhren auf ihre Tauglichkeit prüfen konnte.
Sie hatten nichts. Sie brauchten alles.
Und was für ein Glück sie doch hatten, soviel vorzufinden.
Glück?
Das, was sie fanden, war mir gleichgültig. Der Verlust des dritten Stocks rechts war für mich schlimmer als alles – da ich ja noch nicht wußte, wie wirkliche Verluste aussahen. Und wie groß ihr „Glück“ wirklich war, davon ahnte ich damals nichts. Damals nicht und viele lange Jahre nichts.
Wie dem auch sei.
DU hattest damals Millionen und Abermillionen Hände voll zu tun. Da konnte es wohl schon einmal passieren, daß einer durchschlüpfte. Wenn der große Dreschflegel heruntersaust, da bleiben manchmal ein paar Ähren verschont auf der Tenne.
DU VERWECHSELST ETWAS. ICH BIN NUR FÜR DAS ERGEBNIS ZUSTÄNDIG, NICHT FÜR DIE UMSTÄNDE, DIE ES BEWIRKEN.
Das ist also allein unser Ding?
JA. ALLEIN EUER DING.
Worüber soll ich wohl streiten mit einer Naturgewalt? Mit DER Naturgewalt? –
I – 2
Sehr viel später bin ich wieder dorthin gefahren. Zweimal.
Beim ersten Mal ging ich zwischen neuen Häusern entlang, und die Bahnen fuhren; ob sie die Gleise, die damals unser Wegweiser waren, inzwischen erneuert hatten oder ob die neuen Räder in den alten Schienen liefen, wußte ich nicht.
Die Straßennamen waren unverändert, es gab hier keine Erinnerung an finstere Mächte zu tilgen, nichts Anrüchiges war daran, nach anderen Orten oder fremden Ländern zu heißen. Ohne diese Namen hätte ich mich wohl nicht zurechtgefunden.
Aber dann. Da war die Fassade. Aus den Fenstern im dritten Stock wuchsen Bäume, ich glaube, es waren Birken. Das Tor war mit gekreuzten Balken vernagelt. Es heißt, so hatten sie in Pestzeiten die Häuser verschlossen, in denen die Seuche gewütet hatte. Und mit roter Farbe schrieben sie an die Tür: „Herr, erbarme dich unser.“
Hier hingen am Torrahmen noch die verbogenen Klingelleisten mit den Namensschildern. Wenn man genau hinsah, ließ sich das unsere lesen.
Als niemand in der Nähe war, kratzte ich unseren Namen mit dem Daumennagel fort.
Ich trat zurück und sah mich um. Das große Versicherungsgebäude aus dunkelrotem Klinker zur Linken war unversehrt.
Rechts von unserem Haus stand das schmale Haus der Fleischerei. Ich erinnerte mich, wie sehr es mich gegraust hatte, das Geheul der großen Metzgerhunde aus ihrem Zwinger zu hören. (Tat ihnen jemand etwas an, oder waren sie nur unglücklich, eingesperrt zu sein, statt zu laufen, zu jagen und jemandem die Kehle durchzubeißen?)
Auch dieses Haus war noch da.
Warum?
Sie sagten mir, die Bewohner seien in jener Nacht nicht in ihren Keller gekrochen. Sie hatten oben auf dem Dach gestanden und die Brandsätze gelöscht oder sie durch eine Dachluke nach draußen geworfen, bevor sie explodierten.
Ihr Haus wurde gerettet.
Wir waren in den Keller gerannt mit fliegenden Zöpfen und wehenden Rockschößen, in der Hand, was uns gerade unterkam: Ein Radiogerät. Eine Tasche mit Papieren – vor allem dem „Arischen Nachweis“. Die Noten der Beethovenschen Klaviersonaten und der Lieder von Schumann.
Ein geflochtener Korb mit Spielzeug, Buntstiften und Papier.
Unser Haus verbrannte.
Als ich das nächste Mal kam, war nichts mehr da.
Ich stand vor einer Rasenfläche. Dort, wo einst der Hinterhof mit dem Fliederbusch gewesen war und dann die turmhohen Schuttberge, hatten sie Garagen aus Wellblech aufgestellt, eine neben der anderen.
Meine Zuflucht war fort. Fort für immer.
(Damals begriff ich nicht, daß es gleichgültig war, ob man es anfassen konnte.)
Ich begann sehr schlecht zu träumen. Kletterte über verwinkelte Stiegen, zwängte meinen Oberkörper durch Dachluken, die so eng waren, daß ich fast stecken blieb, balancierte schweißgebadet vor Furcht über Balken, hing verkeilt zwischen schrägen Wänden und kam nicht zum ersehnten Raum, den ich doch schon sehen konnte.
Denn meine Zuflucht war ausgebrannt.
Dann, Jahre später, verließ ich einen anderen Ort. Einen Ort, ein Wesen. Einen Menschen, den ich glaubte, zu lieben.
Und in der Traurigkeit des Abschieds war es plötzlich wieder gegenwärtig, das, wovon ich glaubte, es für immer verloren zu haben.
Ich brauchte nicht Nacht, nicht Schlaf.
Der Hausflur mit den Schienen und den meergrünen Kacheln, die Treppe, deren Geländer verbrannt war. Die Trümmerberge auf dem Hof, auf deren einem ich mit meiner Mutter hockte, den Kopf im Nacken und hinaufsah. Und oben der dritte Stock. Unzerstörbar die Tür, zu der ich nicht mehr gelangt war. Unzerstörbar das, was dahinter war und für immer meins. Die Räume, die Stimmen, das Licht.
Alles ist da. Das Tor, hinter dem sich die Wege dehnen, vor und zurück.
Und der Schlüssel dazu.
Oh Tod, wo ist DEIN Stachel? Oh Grab, wo DEINE Siegesmacht?
Ich weiß, daß DICH das gleichgültig läßt. Denn schließlich wirst DU siegen. Aber solange da Leben ist, sollst DU DEINE dunklen Schwingen nicht über mich und die Meinen breiten.
ICH HABE KEINE DUNKLEN SCHWINGEN. ICH HABE KEINE GESTALT. ICH BIN EINE ERFINDUNG VON EUCH.
Aber DU sprichst doch mit mir. Jetzt.
WEIL DU MICH GERUFEN HAST.
Aber auch DU hast eine Herrin. Die Zeit.
JA. SPIEL NUR MIT IHR.
I – 3
Corelli klingt wie Koralle, aber zärtlich und wie Klaviermusik, wie etwas Perlendes, obwohl der richtige Corelli wohl Geige spielte, Arcangelo, aber den Vornamen vergaß sie, es ging nur um den Klang. Niemand außer ihr wußte, daß sie so hieß, sie hatte den Namen als Geschenk empfangen und sogleich angenommen, aus dem Radio (es hatte viele Knöpfe, ein grünes magisches Auge und hieß Super); sie tanzte im Zimmer nach Musik, noch, als alle dachten, sie werde sich vielleicht nie wieder bewegen können. Es war keine Tücke von ihr, niemand hatte ihr gesagt, daß sie darauf warteten, ob sie wieder gehen könne nach dieser Krankheit; es war einfach sehr süß, so zu liegen, sich mit Orangensaft tränken zu lassen, getragen und gefahren zu werden, es gefiel ihr. Eines Tages, die Sonne warf die Bahn ins Zimmer, auf der der Staub tanzte, stand sie auf und ging zu dem dunklen Büfett, um anzuzeigen, wie sie gewachsen sei („So groß bin ich schon!“); Franziska brach in Tränen aus, Kind, du kannst ja gehen! Erst da erfuhr sie, daß sie daran gezweifelt hatten.
An die Krankheit hatte sie keine Erinnerung außer von etwas Heißem und Großem, das manchmal über sie kam; ein Wesen war zuviel im Zimmer, und ihre Hände wuchsen gewaltig.
Einmal nachts brannte die Stehlampe, daneben stand auf dem Tisch eine Babyflasche mit dem Orangensaft (sie trank auch Milch aus dieser Flasche bis in ihr zehntes Lebensjahr, es war bequem. Nahrung im allgemeinen war ihr gleichgültig oder verhaßt, da sie fast nie Hunger hatte); Franziska saß auf dem Sofa und las, ihre Haare mit Zuckerwasser zu den nächtlichen Zöpfchen geflochten, die sie am Tag löste, damit das Haar kraus wirkte. Sie trug die Brille und die Schürze, somit war alles gut. (Corelli verfiel in Panik, wenn Franziska an ihr Bett trat im Nachthemd und unbebrillt.) Das Licht hatte die Farbe des Orangensaftes.
Als sie wieder erwachte, war es Frühling, ihr Leib fühlte sich leicht an, und sie empfing die Taufe auf den Namen Corelli aus dem Radio. Der Name hatte den Klang, im übrigen nichts mit ihr zu tun, sie hatte kein Bewußtsein ihrer selbst, nur das von der Welt. Ihr Wissen führte zurück bis in die Regionen jener Zimmer, in denen nun andere wohnten; die Vorhänge waren von mattem Lavendelblau, Blumen an der Tapete, abends sang Hermine „Hündchen hat den Mann gebissen hat des Bettlers rockzerrissen“; der Korb hatte weiße Vorhänge. Man errechnete ihr später, daß sie da noch kein Jahr alt war. Dann, der rötliche Abendhimmel, durchdringend süß wie die Schreie der jagenden Vögel und der Name Corelli.
Ihr Wissen von sich selbst beschränkte sich auf Gefühle peinigender Unlust, Eingezwängt-Sein in etwas, Jacken, die unterm Arm kneifen, endloses Stillstehen bei der Anprobe, das Haar mit Kämmen eingerollt, der Kopf schmerzt dumpf. Essen, Hinunterschluckenmüssen. Kälte, die in die Nase zwickt, Halsschmerzen. Manchmal schrie sie und schlug um sich. Meist war sie geduldig, sie war sich selbst egal. Es war nur, daß sie nichts von sich weggeben wollte. Ihre abgeschnittenen Fingernägel wurden aufgehoben und in einer Zigarrenkiste aufbewahrt, weil sie es wollte; irgendwann hatte sie das vergessen.
Erst nach der Krankheit lernte sie die Lust kennen, atmen, schlafen, Wärme spüren. Tanzen. Sich zwischen den Beinen streicheln. All das geschah ohne die andern. Sie war zweimal, mit den anderen und, wie eine Wurzel, unbewußt, für sich.
Sie kam nicht darauf, sich mitzuteilen, so war es ihr selbstverständlich, daß niemand ihren wahren Namen wußte. Man nannte sie Friedchen, die Leute draußen dachten, von Elfriede, sie hieß aber Friederike Rosine, abgekürzt zu Friedesinchen, wie man sie drinnen rief. Der Name war aus einem Roman. Hermine und Franziska hatten schnell gemerkt, wie die Leute die Köpfe schüttelten, und waren ausgewichen, nach ihrer Art, auf das Unverbindliche.
Nach der Krankheit fuhr man sie im Wagen aus, die Fremden lachten oder hielten mitleidige Reden. Sie fand Gefahrenwerden schön, warum sollte sie laufen, sie war viel zu müde, wenn sie die Augen schloß, ging die Fahrt rückwärts, dann kam das Gefühl wie von der Krankheit, aber angenehm. Sie ließ sich fahren bis zu dem Sommer, nach dem man sie, dann doch, zur Schule schickte. Damals las sie schon, kannte die Uhr, rechnete und zählte. Am liebsten malte und zeichnete sie, man konnte dabei im Bett sitzen, auch darüber einschlafen. Am liebsten, überhaupt, stand sie nur zu den Mahlzeiten auf, für die Viertelkartoffel, das winzige Stück Fleisch, den Löffel Bohnen, zu denen man sie überredete, manchmal mochte sie einen warmen Pudding, aus dem Topf gekratzt, es ging ihr dabei mehr um die Farbe und das Muster, das ihr Löffel auf dem Topfboden hinterließ. Sie war (später sah sie's auf Fotos) auf eine rührende Weise häßlich, Arme und Beine wie Stöcke, ein dürrer Hals, die riesige Nase über dem weichen Mund, Unmengen Haar zu einer der gängigen Frisuren aufgekämmt und dann gezöpft, die Augen nach innen gekehrt. Nachts lutschte sie am Kissenzipfel. Sie schwamm im Fruchtwasser, umgeben von der schützenden Hülle des Uterus, bis das Haus dann brannte.
Die hohen Räume waren nie ganz hell. Meist waren an zwei der vier Fenster die Jalousien herabgelassen, im Winter, um die Wärme drinnen zu halten, im Sommer, um die Hitze auszusperren. Über alles liebte Corelli jene Sonnenstrahlen, die durch die Ritzen einfielen und in denen der Staub tanzte. Oft sah sie hinein, wenn sie dachten, sie schliefe schon. Für die Nacht gab es Verdunkelungsrollos aus schwarzem Papier.
Die Zimmer standen gedrängt voller Möbel aus jenen Teilen der Wohnung, die man hatte abgeben müssen, wie den Raum mit den lavendelblauen Vorhängen. Die anderen Mieter (ein Cellist des Städtischen Theaters und seine Frau; er übte niemals zu Haus) mußten, um in ihren Bereich zu gelangen, das sogenannte Berliner Zimmer durchqueren, so hatte die Familie die Möbel dort derart aufgestellt, daß die Rücken der Schränke, Spinde und Kommoden die Begrenzung eines Gangs an der Rückseite des Zimmers bildeten, einen Korridor, den die anderen passierten.
In der unbeheizbaren Möbelburg mit Blick in die verdüsterten nordwestlichen Gärten hauste und schlief Hermine, wenn sie allein sein wollte. Aber auch wenn sie sich in diese Höhle aus Mahagoni, Eiche matt und Kirschbaum zurückzog, war sie in Corellis Welt anwesend. Ihre Porträts hingen in den übrigen Räumen. Für Corelli bestand Hermine von Anfang an aus zwei Personen. Die eine war die Schöne der Bilder, in Pelz und Perlen, eine Rose in der Hand, stets erhobenen Kopfes, aus leicht gesenkten Lidern hochmütig auf den Beschauer herabsehend, die üppigen Lippen ohne die Spur eines Lächelns. Die andere war die alltägliche, mit dem streng gescheitelten Haar, den klappernden Holzsandaletten, dem Frauenschaftsabzeichen am Kleid. Nur wenn sie sang, schienen die beiden zu verschmelzen.
Aber auch Hubert und Franziska sahen von der Wand herab, wenn auch versteckt und verkleidet. Hubert stand als Gefolgsmann hinter König Heinrich dem Vogler, seine schmalen dunklen Augen, die lange Oberlippe, die große Nase waren unverkennbar trotz der Kappe, die er da trug. Franziska ging auf einer Straße im Hochsommer spazieren, statt der Brille ein Lorgnon vor den Augen, Puder auf den hohen Backenknochen, das blonde Haar gekraust wie immer, die Taille in glänzenden Atlas gezwängt.
Da man sich drinnen nicht mit den Verwandtschaftsbezeichnungen, sondern mit den Vornamen anredete, war sich Corelli lange nicht klar über die Familienverhältnisse. Draußen wurde sie angehalten, zu Hubert Vati, dem Großvater, zu Franziska Mutti, der Großmutter, und zu Hermine, der Mutter, Mama zu sagen, aber das bedeutete nichts. Draußen war sowieso alles anders. Draußen sagte man „Heillitler“ statt „Guten Morgen“. Erst in der Schule erfuhr sie, daß Hermine ihre Mutter, Hubert und Franziska hingegen ihre Großeltern seien. Nach Vätern fragte man dazumal nicht viel, die waren alle im Felde.
Hermine war auf eine nicht zu benennende Weise abgesondert, in ihrem Zimmer, in ihren Bildern, in ihrer Musik, sie war erhöht und verachtet, Prinzessin und Magd.
Manchmal am Sonntag, wenn man Mittagschlaf hielt, lag sie auf dem Diwan in der guten Stube und nahm Corelli zu sich unter die Decke. Das Kind fand es sehr warm, Hermine roch nach dem Eau de Cologne, das sie sich ins Waschwasser tat (während Franziska immer nach Kamille und Birkenhaarwasser duftete). Sobald die Mutter eingeschlafen war, kroch Corelli vorsichtig, um sie nicht zu wecken, aus der Umarmung heraus, ging zum Tisch und begann zu malen. Sehr gern malte sie all die Bilder ab, mit denen die Wände der Zimmer förmlich gepflastert waren, alle leuchtend farbig und in vergoldeten Rahmen; außer den Porträts von Hermine gab es große Blumensträuße, schimmernde Landschaften, Historien- und Märchenbilder. Überm türkisch gemusterten Diwan hing ein Triptychon von der „Gänsemagd“, das sie besonders gern zur Vorlage nahm, es wunderte sie nicht, daß die schwarzhaarige böse Kammerfrau die Züge Hermines trug, sie zeichnete sie wieder und wieder ab (alle erklärten, sie sei hochbegabt, was sie nicht verstand, sie zeigte doch nur, was schon da war).
In der Nische neben dem Ofen hing ein Bild, das ganz anders war, es hatte einen schwarzen Rahmen und war verglast, auch das Gesicht des Mannes mit dem Bart und dem gescheitelten Haar war farblos, sie wußte, daß man ihn meinte, draußen, wenn man „Heillitler“ sagte. Im Büfett ganz hinten lagen drei Flaschen Rheinwein, die trinken wir, wenn Frieden ist, sagte Hubert.
Es kam niemals Besuch. Manchmal allerdings empfing Hubert Geschäftsfreunde in der guten Stube. Man hörte dann die lauten und groben Männerstimmen hinter der weißlackierten Flügeltür, und durch die Ritzen drang Zigarrenrauch. Immer, wenn Fremde in der Wohnung waren, überkam Corelli ein durchdringendes Unlustgefühl, eine Mischung von Langeweile, Wut und verzweifelter Heimatlosigkeit. Sie lief dann in die Küche, Franziskas bevorzugtes Revier, zumindest Franziska mußte unveränderbar sein, sie durfte ihr nicht anders entgegenkommen, nicht ohne Brille, ohne Schürze, verhext und unvertraut.
Während Corelli den Kopf in ihre immer nach Wäschestärke und Spülwasser riechende Schürze drückte, erzählte sie; Märchen, vom Hündchen und vom Kätzchen, und von früher. Von früher mochte Corelli am liebsten hören.
Zu den Märchen, die sie langweilten, erfand sie anderes hinzu, ein Eichhörnchen mit einem Horn auf dem Kopf, das es einziehen oder ausfahren konnte im Zorn, ein dreibeiniges Geschöpf namens Batzel, das einen Goldreif um den Hals trug und feurige Kohlen fraß, und ein wildes Waldtier namens Nimrod, das sich keinem zeigte, so sehr man auch suchte. Wenn sie erzählte, war es ihr gleichgültig, ob Franziska ihr zuhörte, wenn sie nur da war.
Wenn Huberts Geschäftsfreunde fort waren, kam er in die Küche, stinkend nach Rauch, und schickte Corelli hinaus, um in den Emaille-Ausguß zu pissen. (Da die Toilette im abvermieteten Teil der Wohnung lag, hatte sich die Familie daran gewöhnt, Eimer und Nachttöpfe zu benutzen, um möglichst wenig nach hinten gehen zu müssen. Und weil die Kohlen nie mehr ausreichten, die hohen Räume zu erwärmen, hauste man meist nur in Küche und Schlafzimmer, in der guten Stube verstimmte sich das Klavier in der Kälte, winters mochte Hermine nicht singen.)
Hubert beredete alsdann mit Franziska die kleinen Geschäfte und Vorteile oder Nachteile, die er ausgehandelt hatte, saß rauchend am Küchentisch, Corelli auf dem Schoß. Sie hörte nicht zu, es genügte, die Stimmen um sich zu haben und die Körper. Huberts Hände waren behaart, kraftvoll und immer warm, sogar im eisigsten Winter konnte er Corellis im Muff halb erstarrte Finger mit seinen bloßen Händen wärmen.
Vor den Küchenfenstern hingen Gardinen aus Leinen, so sah man niemals hinaus, wie auch aus dem Fenster des Berliner Zimmers, vor dessen rötlichem Abendhimmelausschnitt die schreienden Schwalben vorbeijagten wie Boten aus einer anderen Welt. Aber an Sommernachmittagen zog sich Corelli einen Stuhl an das unverhängte Schlafzimmerfenster in die Sonne, kniete drauf und schaute.
Die runden Kuppen der Lindenbäume säumten die breiten Gehwege. Die Gesichter der Autos waren verschieden, manche lachten, manche sahen aus zornigen Augen in die Welt, andere fletschten die Zähne, wieder andere, die, die schon mit Holzvergaser arbeiteten, hatten einen Buckel. Die Kinder fuhren Tretroller oder trieben hölzerne Reifen mit einem Stöckchen; beides wünschte sich Corelli aus tiefster Seele auch zu tun.
Wahrscheinlich hätten sie es ihr nicht versagt, wenn sie den Wunsch jemals ausgesprochen hätte, was sie nicht tat – andererseits, sie war zaghaft und ungeschickt; auf den Schlitten mit den eisernen Kufen setzte sie sich nie wieder, seit sie einmal damit umgekippt war.
Vorsichtig bewegte sie ihr Dreirad auf dem Kiesweg des Gartens hin und her, bevor sie krank wurde.
Der Garten war die Welt.
Endlos wie ein Feld dehnte sich das Erdbeerbeet, riesig war das Rondell mit den drei Fichten, nicht zu ersteigen der Apfelbaum. Hinter der Laube gab es die Wildnis, Quecken und Kompost, und vorn am Zaun blühte im Schatten die lockenhäuptige Akelei zwischen Dill und Rosmarin.
Es gab eine Fliederlaube, in der man Kuchen aß, und den Steingarten, ein unwegsames Gebirge, gefährlich zu erklettern. (Als sie den Garten später wiedersah, war er zusammengeschrumpft wie ein Luftballon, von dem man das Band gelöst hatte; nur die Fichten, riesenhaft aufgeschossen, füllten den Blick, wehende Baumkronen an mannhaften Stämmen.)
Von dort führte der Weg zwischen anderen Schrebergärten hin ins vollends Unwegsame, man trat vor das Tor aus Maschendraht in eisernem Rahmen und war weit fort. Ein riesenhafter Hahn äugte unter Brennnesseln, Corelli sah ihn klopfenden Herzens an, ob er vielleicht unter dem Zaun durchkommen könne, er blickte zurück, einäugig, kollernd. Das mittägliche Legegeschrei der Hühner erregte das Kind fast zu Tränen.
Wie fremd war das alles! Rostig rot standen die buschigen Fuchsschwänze vor dem stumpfen Schwarz des Schotterwegs. Manchmal kam ein schmutziges Mädchen, um mit ihr zu spielen, Hermine sagte: Straßenkinder; aber Corelli erschien sie schön mit ihrem verschmierten Kleid, den dunklen Augen, den Ohrringen. Das Kind fragte sie Sachen, die sie nicht verstand, und lachte mit zurückgelegtem Kopf. Corelli lief mit, erhitzt, fiebrig, außer sich. Irgendwann stieg das Mädchen über einen fremden Zaun, brach alle Tulpen ab und warf sie auf den Komposthaufen, lachte dazu ihr Lachen. Corelli rannte in ihren Garten zurück, vor Schreck konnte sie kaum reden.
Noch bevor sie die Krankheit bekam, verliebte sie sich glühend in einen Mann mit weißen Haaren und schwarzen Augenbrauen, der mit sehr tiefer Stimme sprach. Sie nannte ihn Mozart, weil ihr Hermine gesagt hatte, Mozart habe eine weiße Perücke gehabt und einen Galarock mit goldnen Knöpfen, so habe er als Kind vor der Kaiserin gespielt. Den Rock (sie verstand darunter einen blauen Faltenrock, wie sie ihn gern gehabt hätte) dachte sie sich dazu.
Wenn sie Mozart auf der Treppe oder auf der Straße begegnete, grüßte sie ihn mit versagender Stimme und wurde rot. In ihrer Magengrube ging eine Sonne auf, und ihr Licht übergoß ihr Leib und Glieder mit brennender Hitze. Am Abend im Bett legte sie die Hand zwischen ihre Beine, um sich zu streicheln, und die apfelsinensüße Sonne verbreitete sich in Strömen durch ihren Körper, dabei sah sie Mozart im blauen Galafaltenrock die Treppe herunterkommen, er sprach mit tiefer Stimme, sie war wie mit Feuer übergossen, alles endete in Feuer.
Einmal schenkte er ihr einen kleinen Honigkuchen, der verziert war mit Streifen aus weißem Zuckerguß. Ihr blieb die Sprache weg, als sie sich bedanken wollte. Den Honigkuchen versteckte sie unter der Matratze, sie hätte ihn keinesfalls gegessen, auch nicht, wenn sie überhaupt Kuchen gemocht hätte.
Irgendwann beim Saubermachen fand Franziska das vertrocknete, zerkrümelte Quadrat und warf es weg, Corelli schrie, sie schrie sich atemlos, bis ihr Franziska einen Klaps gab; da sie nie geschlagen wurde, war das etwas Unerhörtes, er vermischte sich mit der Enttäuschung über die verlorene Reliquie und der Süße des inneren Sonnenaufgangs zu einem explosiven Gefühl gierigen Zorns und schmachvollen Genusses; sie schlief sofort ein.
Nach der Krankheit hatte sie den Mann vergessen, Mozart mit dem weißen Haar und den schwarzen Augenbrauen, er war nicht mehr da, es hieß, sie hätten ihn doch noch eingezogen; Corelli hörte das als „eingesogen“, irgendein großer, bärtiger Mund hatte sich geöffnet und Mozart schlürfend verschluckt wie der Strudel den Becher in dem Gedicht, das Franziska ihr mit vielen anderen aufsagte: „Verschlungen schon hat ihn der schwarze Schlund“; sie lagen bei Stromsperre miteinander unter der Bettdecke, sich zu wärmen.
Zu der Zeit, als man sie mehr fuhr oder trug, als daß sie lief, sah sie in der Straßenbahn auf der langen hölzernen Bank gegenüber das Mädchen mit dem spitzen Gesicht und den Ohrringen aus blauem Stein. Sie wußte, daß das Mädchen häßlich war; vielleicht fühlte sie sich an ihr eignes Spiegelbild erinnert, sie starrte verliebt hin auf das käsigbleiche Dreieck mit den Ohrringen. Kurz bevor sie aussteigen mußten, ging sie zu der Fremden, ergriff ihre Hand und sagte laut: „Ich mag Sie. Sie sind schön.“
Die Leute im Wagen lachten, die junge Frau, die sich verhöhnt fühlte, entriß ihr heftig die Finger, Hermine zerrte sie zum Ausstieg.
„Was ist in dich gefahren? Warum hast du das gemacht? Unser schüchternes Friedchen! Dabei war die nun wirklich nicht …“
Corelli schwieg, es stimmte, man durfte das Geheime nicht vorweisen, man mußte es bei sich behalten.
Sie war brav. Wenn man sie fragte, ob ihr etwas gefalle, sagte sie Ja, auch wenn es ihr gleichgültig war. Wenn man ihr verbot, sich selbst zu berühren, tat sie es, wenn niemand zusah. Was man ihr abverlangte, leistete sie. Achtete sorgfältig darauf, daß sich die Welten, ihre und die der anderen, nicht vermischten. Manchmal erschrak sie tödlich, weil „etwas herausgekommen war“; wie, daß sie für sich allein tanzte oder mit Leuten sprach, die gar nicht im Zimmer waren. Daß die anderen darüber lächelten, war Zufall, sie hätten auch schelten oder verbieten können. Ihr Reich gehörte verborgen.
Es war schon die Zeit, als sie zur Schule ging, als sie jene Leute entdeckte.
Im grimmigen Winter, in dem sie nur zitternd, gezwungen, an Huberts warmer Hand das Haus verließ („Das Kind braucht frische Luft!“), sah sie die Frauen in unförmigen Stiefeln und wattierten Jacken, die Köpfe bis zu den Augenbrauen in Tücher gehüllt, nur Nase, Mund und Augen sahen hervor. Corelli wünschte sich sehnlich solche dicken, wärmenden Tücher, um nicht mehr zu frieren. Indes, die Frauen sprachen unverständlich, sie standen für sich, ein Knäuel, andere machten einen Bogen.
„Das sind Russenweiber“, sagte Hubert, „die müssen hier arbeiten.“
Er zog sie fort, sie sah nicht zurück.