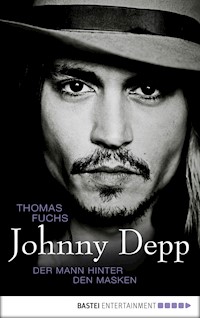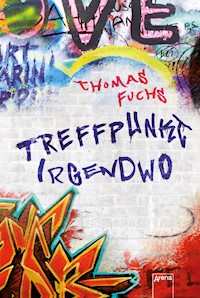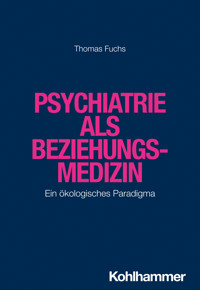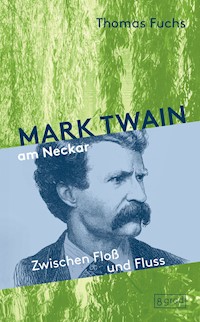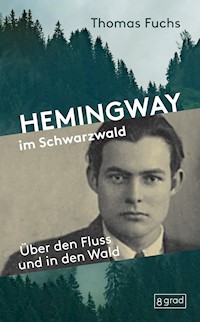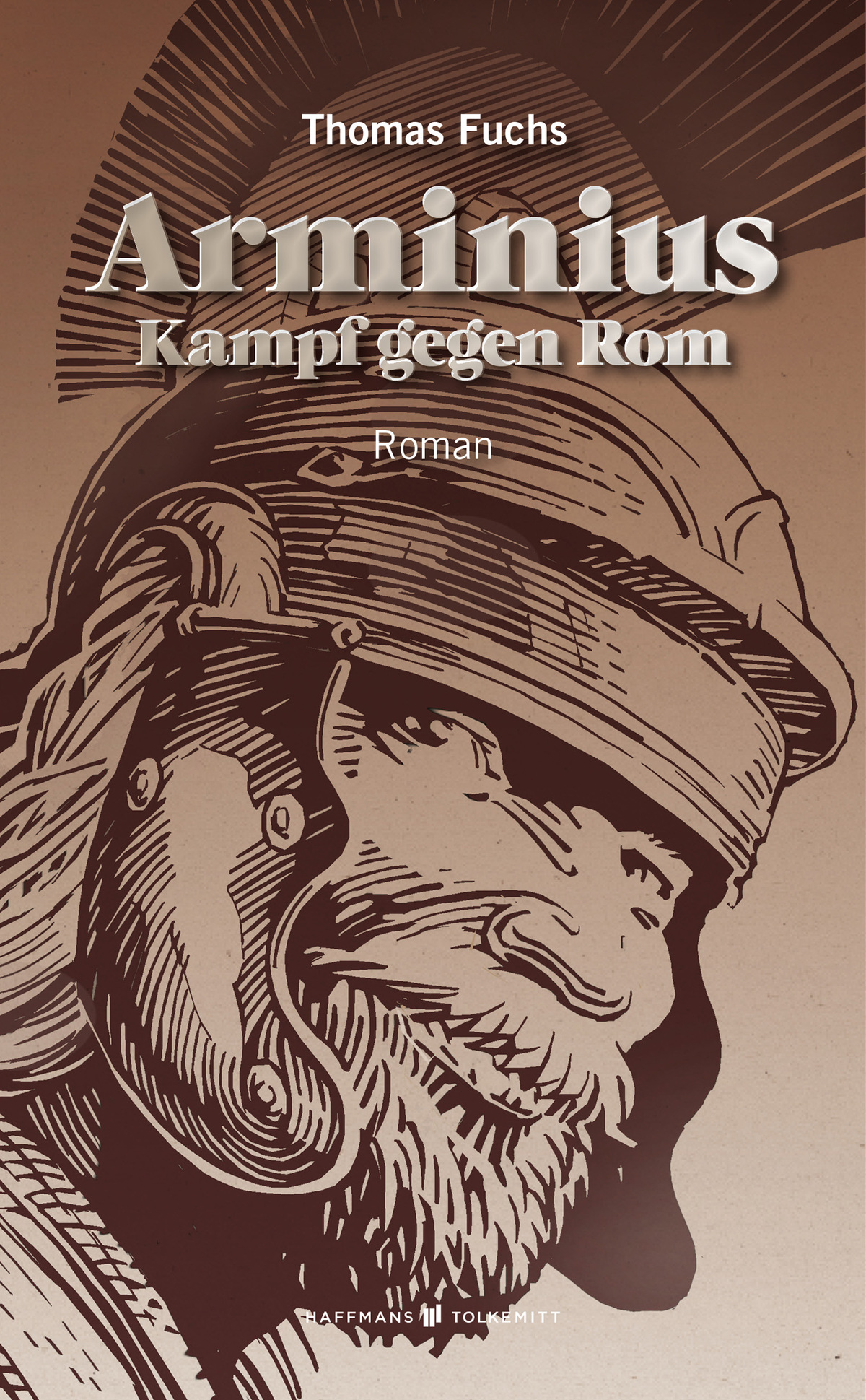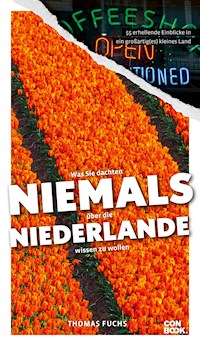38,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Denkt das Gehirn? Ist es der Schöpfer der erlebten Welt, der Konstrukteur des Subjekts? Dieser verbreiteten Deutung der Neurowissenschaften stellt das Buch eine verkörperte und ökologische Konzeption gegenüber: Das Gehirn ist vor allem ein Vermittlungsorgan für die Beziehungen des Organismus zur Umwelt und für unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Verkörperte Interaktionen verändern das Gehirn fortlaufend und machen es zu einem biographisch, sozial und kulturell geprägten Organ. Fazit: Es ist nicht das Gehirn für sich, sondern der lebendige Mensch, der fühlt, denkt und handelt. Mit der 7. Auflage legt der Autor eine erneut aktualisierte Fassung seines wegweisenden Werkes vor, das von der Fachwelt und Presse begeistert aufgenommen wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
Eingangsbild (keinKT)
Prolog
Einleitung
Umsturz der Lebenswelt
Kampf um die Zitadelle
Vom Kopf auf die Füße
Teil A Kritik des neurobiologischen Reduktionismus
1 Kosmos im Kopf?
1.1 Das idealistische Erbe der Hirnforschung
1.2 Erste Kritik: Verkörperte Wahrnehmung
1.2.1 Wahrnehmung und Selbstbewegung
1.2.2 Koextension von Leib und Körper
1.3 Zweite Kritik: Die Objektivität der phänomenalen Welt
1.3.1 Der Raum der Wahrnehmung
1.3.2 Die objektivierende Leistung der Wahrnehmung
1.4 Dritte Kritik: Die Realität der Farben
1.5 Zusammenfassung
2 Das Gehirn als Erbe des Subjekts?
2.1 Erste Kritik: Die Irreduzibilität von Subjektivität
2.1.1 Phänomenales Bewusstsein
2.1.2 Intentionalität
2.2 Zweite Kritik: Kategorienfehler
2.2.1 Mereologischer Fehlschluss
2.2.2 Lokalisatorischer Fehlschluss
2.3 Dritte Kritik: Ohnmächtiges Subjekt?
2.3.1 Die Einheit der Handlung
2.3.2 Die Rolle des Bewusstseins
2.4 Zusammenfassung: Der Primat der Lebenswelt
Teil B Gehirn – Leib – Person
3 Grundlagen: Subjektivität und Leben
3.1 Verkörperte Subjektivität
3.1.1 Der Leib als Subjekt
3.1.2 Der Doppelaspekt von Leib und Körper
3.1.3 Biologischer und personaler Doppelaspekt
3.2 Ökologische Biologie
3.2.1 Selbstorganisation und Autonomie
3.2.2 Austausch zwischen Organismus und Umwelt
3.2.3 Subjektivität
3.2.4 Zusammenfassung
3.3 Zirkuläre und integrale Kausalität von Lebewesen
3.3.1 Vertikale zirkuläre Kausalität
3.3.2 Horizontale zirkuläre Kausalität
3.3.3 Vermögen als Grundlage integraler Kausalität
3.3.4 Die Bildung von Vermögen durch das Leibgedächtnis
3.3.5 Zusammenfassung
4 Das Gehirn als Organ des Lebewesens
4.1 Das Gehirn im Organismus
4.1.1 Das innere Milieu
4.1.2 Das Lebensgefühl
4.1.3 Höhere Bewusstseinsstufen
4.1.4 Verkörperte Gefühle
4.1.5 Zusammenfassung
4.2 Die Einheit von Gehirn, Organismus und Umwelt
4.2.1 Lineare versus zirkuläre Organismus-Umwelt-Beziehung
4.2.2 Bewusstsein als Integral
4.2.3 Neuroplastizität und die Inkorporation von Erfahrung
4.2.4 Transformation und Transparenz: Das Gehirn als Resonanzorgan
4.2.5 Information, Repräsentation und Resonanz
4.2.6 Zusammenfassung: Vermittelte Unmittelbarkeit
5 Das Gehirn als Organ der Person
5.1 Primäre Intersubjektivität
5.1.1 Pränatale Entwicklung
5.1.2 Zwischenleiblichkeit und Interaffektivität
5.1.3 Zwischenleibliches Gedächtnis
5.2 Neurobiologische Grundlagen
5.2.1 Das Bindungssystem
5.2.2 Das soziale Resonanzsystem (»Spiegelneurone«)
5.3 Sekundäre Intersubjektivität
5.3.1 Die Neunmonatsrevolution
5.3.2 Der verkörperte Erwerb der Sprache
5.3.3 Ausblick: Sprache, Denken und Perspektivenübernahme
5.4 Zusammenfassung: Gehirn und Kultur
6 Der Doppelaspekt der Person
6.1 Mentales, Physisches und Lebendiges
6.2 Abgrenzung von Identitätstheorien
6.2.1 Das Problem der Einheit des Referenten
6.2.2 Diachrone Einheit der Subjektivität
6.3 Emergenz
6.3.1 Der Primat der Funktion
6.3.2 Zirkuläre Kausalität und Doppelaspekt
6.4 Schlussfolgerungen: Psychophysische Beziehungen
6.4.1 Intentionale und psychologische Bestimmung von physiologischen Prozessen
6.4.2 Verkörperte Freiheit
6.4.3 »Psychosomatische« und »somatopsychische« Zusammenhänge
6.5 Zusammenfassung
7 Konsequenzen für die psychologische Medizin
7.1 Neurobiologischer Reduktionismus in der Psychiatrie
7.2 Psychisches Kranksein als zirkuläres Geschehen
7.2.1 Vertikale Zirkularität
7.2.2 Horizontale Zirkularität
7.2.3 Zusammenfassung
7.3 Zirkuläre Kausalität in der Pathogenese
7.3.1 Ätiologie der Depression
7.3.2 Entwicklung von Vulnerabilität
7.3.3 Zusammenfassung
7.4 Zirkularität in der Therapie
7.4.1 Somatotherapie
7.4.2 Psychotherapie
7.4.3 Vergleich der Therapieansätze
7.5 Zusammenfassung: Die Rolle der Subjektivität
8 Schluss
8.1 Gehirn und Person
8.2 Die Reichweite neurobiologischer Erkenntnisse
8.3 Naturalistisches versus personalistisches Menschenbild
Teil C Verzeichnisse
Literatur
Sachwortverzeichnis
Personenverzeichnis
Seitenangaben der gedruckten Ausgabe
1
2
3
4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Der Autor
Thomas Fuchs, geb. 1958, Prof. Dr. med. Dr. phil., habilitiert in Psychiatrie und Philosophie, ist Karl-Jaspers-Professor für philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Heidelberg. Er ist Leiter der Sektion Phänomenologische Psychopathologie und Oberarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg, Präsident der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Anthropologie, Psychiatrie und Psychotherapie (DGAP) sowie Herausgeber der Zeitschrift »Psychopathology«. Seine Forschungsschwerpunkte bilden die phänomenologische Anthropologie, Psychologie und Psychopathologie, Theorien der Verkörperung und der Neurowissenschaften sowie zeit- und kulturdiagnostische Analysen.
Weitere Buchpublikationen sind u. a.:
♦
Leib, Raum, Person. Entwurf einer phänomenologischen Anthropologie. Klett-Cotta, Stuttgart, 2000.
♦
Psychopathologie von Leib und Raum. Phänomenologisch-empirische Untersuchungen zu depressiven und paranoiden Erkrankungen. Steinkopff, Darmstadt, 2000.
♦
Zeit-Diagnosen. Philosophisch-psychiatrische Essays. Graue Edition, Kusterdingen, 2002.
♦
Leib und Lebenswelt. Neue philosophisch-psychiatrische Essays. Graue Edition, Kusterdingen, 2008.
♦
(hrsg. mit Lukas Iwer und Stefano Micali) Das überforderte Subjekt. Zeitdiagnosen einer beschleunigten Gesellschaft. Suhrkamp, Frankfurt/M., 2018.
♦
Randzonen der Erfahrung. Beiträge zur phänomenologischen Psychopathologie. Alber, Freiburg, 2020.
♦
Verteidigung des Menschen. Grundfragen einer verkörperten Anthropologie. Suhrkamp, Frankfurt/M., 2020.
♦
Verkörperte Gefühle. Zur Phänomenologie von Affektivität und Interaffektivität. Suhrkamp, Frankfurt/M., 2024.
Adresse:Psychiatrische Universitätsklinik, Voßstr. 4, 69115 HeidelbergE-Mail: [email protected]
Thomas Fuchs
Das Gehirn –ein Beziehungsorgan
Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption
7., aktualisierte Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
Umschlagabbildung: imaginima/iStockphoto7., aktualisierte Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-045783-6
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-045784-3epub:ISBN 978-3-17-045785-0
Vorwort
Dieses Buch entstand aus dem Bestreben, die Fortschritte der Hirnforschung in einen anthropologischen Zusammenhang zu stellen, der das Gehirn als ein Vermittlungsorgan für unsere leiblichen, seelischen und geistigen Beziehungen mit der Welt zu begreifen erlaubt – als Beziehungsorgan. Notwendig erschien mir dies insbesondere, um für das Fachgebiet der Psychiatrie und der psychologischen Medizin insgesamt eine theoretische Basis zu schaffen, von der aus reduktionistische Deutungen des Gehirns abgewiesen und durch subjektorientierte und ökologische Sichtweisen von Gehirn, Psyche und Sozialität ersetzt werden können. Wird das Gehirn von der Rolle des Weltschöpfers befreit, mit der es zweifellos überfordert ist, dann können wir seine faszinierenden Vermittlungsleistungen würdigen, ohne uns selbst, unser Erleben und Handeln nur noch als Output einer informationsverarbeitenden neuronalen Apparatur begreifen zu müssen.
Voraussetzung dafür ist allerdings, das Gehirn primär als eingebettet in den Organismus in seiner Umwelt aufzufassen. Dies wiederum macht es erforderlich, einen eigenständigen Begriff des Lebendigen wiederzugewinnen. Dass das Gehirn zunächst das Organ eines Lebewesens und nicht primär das Organ des Geistes ist, hat bislang kaum die erforderliche Beachtung gefunden. Auch die Lebenswissenschaften sind gegenwärtig weit davon entfernt, Leben als eigenständiges Phänomen zu erfassen. Erst unter dieser Voraussetzung aber gelingt es, den »Kurzschluss« von Gehirn und Geist zu überwinden, der reduktionistische Sichtweisen in der Medizin ebenso wie in anderen Fächern begünstigen muss. Dann erst kann das Gehirn auch als sozial, kulturell und geschichtlich geprägtes Organ betrachtet und in einer Kooperation von Natur-, Kultur- und Geisteswissenschaften weiter erforscht werden.
Methodisch beruht die vorliegende Untersuchung auf der Verbindung phänomenologischen Denkens mit Ansätzen der ökologischen Biologie, der Philosophie des Lebendigen und aktuellen Konzeptionen der Verkörperung und des Enaktivismus. Damit wird ein theoretischer Rahmen entworfen, in den die Erkenntnisse der Neurobiologie, aber auch der Entwicklungspsychologie und Psychiatrie eingebettet werden können. Inwieweit die Synthese so verschiedenartiger Ansätze geglückt ist, mag der Leser selbst beurteilen. In jedem Fall erscheint mir diese interdisziplinäre Auseinandersetzung heute notwendiger denn je, denn sie ist in der Lage, zu einem besseren Verständnis unserer selbst als gleichermaßen verkörperter, lebendiger und geistiger Wesen beizutragen.
Mein Dank gebührt zunächst Ruprecht Poensgen, Verlagsleiter im Kohlhammer Verlag, auf dessen Anregung die Idee zu diesem Buch zurückgeht. Für wertvolle Hinweise zu philosophischen Problemkreisen danke ich besonders Boris Wandruszka, Ulrich Diehl, Thomas Buchheim und Christian Tewes. Auch die Teilnehmer unseres langjährigen Heidelberger Seminars zu Philosophie und Psychiatrie, insbesondere der leider verstorbene Reiner Wiehl, haben mir in vielen Diskussionen zur Klärung wichtiger Fragen dieses Buches verholfen. Für die Anregungen, die auf die Erfahrungen mit unserer Heidelberger Mutter-Kind-Behandlungseinheit zurückgehen, danke ich dem Team der Station ›Jaspers‹ der Psychiatrischen Klinik, insbesondere Corinna Reck, die gemeinsam mit mir diese Behandlungseinheit aufgebaut hat. Danken möchte ich schließlich Christoph Mundt, dem früheren Direktor der Klinik, der mir durch eine vorübergehende Freistellung von den klinischen Aufgaben die Gelegenheit gab, mich dieser Arbeit widmen zu können. Ich hoffe meinerseits, dass sie auch weiterhin ihre Wirkung in der Psychiatrie und psychologischen Medizin nicht verfehlen wird.
Der größte Dank gebührt nach wie vor meiner Frau und meinen Kindern, die einen zeitweise von den Rätseln des menschlichen Gehirns allzusehr in Beschlag genommenen Ehemann und Vater geduldig ertragen haben.
Das Buch hat in einer englischen Übersetzung (»Ecology of the Brain«, Oxford 2018) erfreulich weite Verbreitung gefunden. Für die nunmehr siebte Auflage wurde der Text erneut gründlich überarbeitet und aktualisiert.
Heidelberg, im Mai 2025
Thomas Fuchs
Abb.:Hans Baldung Grien, Holzschnittaus: Omnium partium descriptio seu ut vocatanatomia, 1541
Prolog
»Wüssten wir auch alles, was im Gehirn beiseiner Thätigkeit vorgeht, könnten wir allechemischen, electrischen etc. Prozesse bis inihr letztes Detail durchschauen – was nütztees? Alle Schwingungen und Vibrationen, allesElectrische und Mechanische ist doch immernoch kein Seelenzustand, kein Vorstellen.«
Wilhelm Griesinger1
In Gottfried Benns Erzählung »Gehirne« aus dem Jahr 1916 begegnen wir Dr. Rönne, einem jungen Arzt, der als Pathologe zwei Jahre lang Gehirne seziert hat. Diese Tätigkeit löst schließlich eine existenzielle Krise in ihm aus. Er verliert den Kontakt zur Wirklichkeit, und sein Grübeln kreist nur noch um die Objekte seiner Sektionen:
»Oft fing er etwas höhnisch an: er kenne diese fremden Gebilde, seine Hände hätten sie gehalten. Aber gleich verfiel er wieder: sie lebten in Gesetzen, die nicht von uns seien, und ihr Schicksal sei uns so fremd wie das eines Flusses, auf dem wir fahren. Und dann ganz erloschen, den Blick schon in der Nacht: um zwölf chemische Einheiten handele es sich, die zusammengetreten wären ohne sein Geheiß, und die sich trennen würden, ohne ihn zu fragen« (Benn 1950).
Die Erkenntnis, sich selbst einem solchen materiellen Gebilde zu verdanken, stürzt Rönne in eine radikale Selbstentfremdung: »Wo bin ich hingekommen? Wo bin ich? Ein kleines Flattern, ein Verwehen.« Er verliert den festen Boden seiner Existenz und verfällt am Ende in Wahnsinn:
»Was ist es denn mit den Gehirnen? Ich wollte immer auffliegen wie ein Vogel aus der Schlucht; nun lebe ich außen im Kristall. Aber nun geben Sie mir bitte den Weg frei, ich schwinge wieder – ich war so müde – auf Flügeln geht dieser Gang – mit meinem blauen Anemonenschwert – in Mittagsturz des Lichts – in Trümmern des Südens – in zerfallendem Gewölk – Zerstäubungen der Stirne – Entschweifungen der Schläfe«.
Die Krise des jungen Arztes resultiert aus einer existenziellen Paradoxie: Er selbst, der Beobachtende, Forschende und Denkende, scheint nichts weiter zu sein als das Objekt seiner Studien, nämlich ein Klumpen grauer Materie, die ihren eigenen Gesetzen folgt und mit der menschlichen Welt nichts zu tun hat. Und doch beruht Rönnes Krise letztlich nur auf einer Mystifikation, der er ebenso unterliegt wie viele Neurowissenschaftler heute: Denn es ist gar nicht das Gehirn, das denkt. Was Rönne in den Händen hält, oder was der Hirnforscher heute auf seinen Tomogrammen sieht, ist nicht der »Sitz der Seele«, nicht die Person selbst, ja nicht einmal ihr einziges Trägerorgan.
Diese Behauptung wird weithin auf Ungläubigkeit treffen. Ist denn nicht längst erwiesen, dass alles, was uns als Personen ausmacht, in den Strukturen und Funktionen des Gehirns besteht?2 – Nun, gewiss bestreitet niemand, dass das Gehirn inniger mit der Subjektivität und Personalität eines Menschen verknüpft ist als etwa seine Hand oder seine Milz – ohne diese wäre er immer noch die gleiche Person wie zuvor. Nach vollständigem Erlöschen aller Großhirnfunktionen jedoch würde er zwar noch leben, könnte aber nichts mehr erleben und sich in keiner Weise mehr zum Ausdruck bringen. Doch können wir deshalb eine Person mit ihrem Gehirn identifizieren?
Nun, was mich selbst betrifft, so habe ich mein Gehirn zwar noch nicht kennengelernt, aber jedenfalls ist es nicht 1,82 Meter groß, es ist kein Deutscher, kein Psychiater; es ist auch nicht verheiratet und hat keine Kinder. Das stellt meine Bereitschaft zur Identifikation mit diesem Organ bereits auf eine harte Probe.3 Aber es wird noch bedenklicher: Mein Gehirn sieht auch nichts und hört nichts, es kann nicht lesen, nicht schreiben, tanzen oder Klavier spielen – eigentlich kann es für sich allein überhaupt nur wenig. Es moduliert elektrophysiologische Prozesse, weiter nichts. Recht besehen, bin ich doch eher froh, nicht mein Gehirn zu sein.
Doch der Hirnforscher, dem ich dies darlege, würde nur nachsichtig den Kopf schütteln über meine Naivität und versuchen, mich aufzuklären: »Es erscheint Ihnen nur so, als wären Sie mehr oder etwas anderes als Ihr Gehirn. Alles, was Sie sind und tun, entsteht nur in ihm. Tatsächlich sehen Sie, wenn Sie mich jetzt ansehen, nur ein von Ihrem Gehirn erzeugtes Bild, nicht die Wirklichkeit. Und wenn Sie Klavier spielen, erzeugt Ihr Gehirn den Raum, in dem Sie zu spielen glauben, die Töne, die Sie zu hören meinen, und es steuert alle Ihre Bewegungen. Es bringt auch Ihren Entschluss hervor, Klavier zu spielen, ja sogar Ihr Gefühl, Sie selbst zu sein. All das können wir mit geeigneten Verfahren in Ihrem Gehirn feststellen. Deshalb ist es grundsätzlich richtig, wenn ich sage, Sie seien Ihr Gehirn.«
Von diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen belehrt, bin ich zunächst tief beeindruckt von den Fähigkeiten meines Gehirns. Sollte ich mich doch so getäuscht haben über die Welt und über mich selbst? All das wäre in Wahrheit nur das Erzeugnis eines knapp 2 Kubikdezimeter großen, blinden Organs, verborgen im Dunkel meines Schädels? – Wie den armen Rönne beginnt mich ein metaphysischer Schwindel zu erfassen. Nun, vorläufig kann ich mich damit beruhigen, dass, soweit mir bekannt, bislang noch kein Hirnforscher bei seiner Tätigkeit dem Wahnsinn verfallen ist. Doch vielleicht, so argwöhne ich, liegt dies ja nur an einer nicht genügenden Konsequenz des Denkens. Womöglich rettet sich der Hirnforscher ja nur im letzten Moment immer wieder in die Sicherheit der Lebenswelt zurück. Denn die Paradoxien, in die dieses neurowissenschaftliche Menschenbild uns stürzen könnte, sind tatsächlich schwindelerregend: Was ist Wirklichkeit, was Schein? Existiert die Welt nur in meinem Kopf? Bin ich nur ein Wachtraum meines Gehirns? Das zumindest ist die Auffassung von Gerhard Roth:
»Unser Ich, das wir als das unmittelbarste und konkreteste, nämlich als uns selbst, empfinden, ist – wenn man es etwas poetisch ausdrücken will – eine Fiktion, ein Traum des Gehirns, von dem wir, die Fiktion, der Traum nichts wissen können«
(Roth 1994, 253).
Das führt zu verwirrenden Konsequenzen. Nehmen wir an, ich würde bei Bewusstsein am offenen Gehirn operiert (was möglich ist, weil das Gehirn über keine Schmerzempfindung verfügt) und könnte während der Operation mittels eines Spiegels mein eigenes Gehirn sehen – würde dann mein Gehirn sich selbst sehen? Doch eigentlich träumt mein Gehirn ja nur eine Welt, und es träumt mich selbst. Ich aber, obgleich selbst ein Traum, träume nun auch mein Gehirn, das zugleich mich träumt ... Zerstäubungen der Stirne ... Entschweifungen der Schläfe ...
Es wird Zeit, aus solchen Albträumen zu erwachen.
Endnoten
1Griesinger 1861, 6.
2Als Beispiel für viele Autoren sei Gazzaniga zitiert: »Diese einfache Tatsache macht klar, dass Sie Ihr Gehirn sind. Die Neuronen, die in seinem gewaltigen Netzwerk verbunden sind (...) – das sind Sie. Und um Sie zu sein, müssen alle diese Systeme richtig arbeiten« (»This simple fact makes it clear that you are your brain. The neurons interconnecting in its vast network, discharging in certain patterns modulated by certain chemicals, controlled by thousands of feedback networks – that is you. And in order to be you, all of those systems have to work properly«) (Gazzaniga 2005, 31; Hvhbg. v. Vf.).
3Diese schöne Zuspitzung verdanke ich Kemmerling (2000).
Einleitung
Umsturz der Lebenswelt
Seit sich das Gehirn und seine Aktivität bei geistigen Prozessen immer detaillierter beobachten lässt, schicken die Neurowissenschaften sich an, Bewusstsein und Subjektivität zu »naturalisieren«, also neurobiologisch zu erklären. Psychisches scheint sich im Gehirn lokalisieren, ja mit neuen Techniken regelrecht abbilden zu lassen. An bestimmten Orten des Gehirns findet offenbar das Wahrnehmen, Fühlen, Denken oder Wollen statt und lässt sich im farbigen Aufleuchten von Hirnstrukturen scheinbar in vivo beobachten. Bücher mit Titeln wie »Kosmos im Kopf«, »Das Gehirn und sein Geist« oder »Das Gehirn und seine Wirklichkeit« zeichnen das Bild eines informationsverarbeitenden Apparates, der in seinen Windungen und Netzwerken eine monadische Innenwelt und ein in Täuschungen befangenes Subjekt konstruiert. Gleichzeitig belehrt uns eine Flut von populärwissenschaftlichen Artikeln über die tatsächlichen, neuronalen und hormonellen Ursachen unserer Gefühle, Wahrnehmungen, Gedanken und Handlungen.
Unbestreitbar hat die Neurobiologie eine Fülle revolutionierender Erkenntnisse über die biologischen Grundlagen des Geistes, des Erlebens und Verhaltens, aber auch psychischer Krankheiten erlangt, aus denen sich fruchtbare Anwendungsmöglichkeiten ableiten lassen. Andererseits hat sie auch eine »zerebrozentrische« Sicht des Menschen begünstigt, die sich vor allem in der Medizin, Psychologie und Pädagogik ausbreitet. So bringt das neurobiologische Paradigma in der Psychiatrie die Tendenz mit sich, Krankheiten primär als materielle Vorgänge im Gehirn anzusehen und damit von den Wechselbeziehungen der Person mit ihrer Umwelt zu isolieren. Ähnlich werden in der Pädagogik schulische Lern- und Aufmerksamkeitsstörungen zunehmend auf hirnorganische Ursachen zurückgeführt.
Das neurobiologisch geprägte Menschenbild breitet sich aber auch in der Lebenswelt aus und verändert unser alltägliches Selbstverständnis. In einer schleichenden Selbstverdinglichung betrachten wir uns immer weniger als Personen, die Gründe oder Motive haben und Entscheidungen treffen, sondern als Agenten unserer Gene, Hormone und Neuronen. Auch unsere Erfahrung, selbst Urheber von Handlungen zu sein und damit unser Leben bestimmen zu können, wird von Neurowissenschaftlern in Frage gestellt. Der Wille scheint immer zu spät zu kommen, nämlich wenn die neuronalen Prozesse, welche Entscheidungen zugrunde liegen, bereits abgelaufen sind. Die Erfahrung der Freiheit wäre dann nur eine biologisch sinnvolle Selbsttäuschung des Gehirns, die uns das Gefühl von Selbstmächtigkeit und Kontrolle vermittelt, wo in Wahrheit die Neuronen längst für uns entschieden haben.
Nicht anders verhält es sich nach Meinung vieler Hirnforscher mit unserem Bewusstsein selbst: Es spiegelt nur Prozesse neuronaler Informationsverarbeitung wider, die uns als solche prinzipiell nicht bewusst werden können. Die in unserem Rücken agierende neuronale Maschinerie erzeugt nur den Schein eines dauerhaften Selbst. Längst hat man die Suche nach einem Ich-Zentrum im Gehirn, nach einer »Eintrittspforte« des Geistes aufgegeben, die Descartes noch in der Zirbeldrüse zu finden glaubte. Das Gehirn scheint seine Rechenaufgaben sehr gut ohne Wirkung eines Subjekts bewältigen zu können. In den Worten des Neurophilosophen Thomas Metzinger: »Wir sind mentale Selbstmodelle informationsverarbeitender Biosysteme ... Werden wir nicht errechnet, so gibt es uns nicht« (Metzinger 1999, 284).
Wie sich zeigt, sind die Geltungsansprüche der Neurowissenschaften nicht unerheblich. Der Neurobiologe Gerhard Roth stellt ihre Erkenntnisse in eine Reihe mit den Kränkungen der Menschheit durch Darwin und Freud: »Zuerst wird durch die Evolutionstheorie dem Menschen der Status als Krone der Schöpfung abgesprochen, dann wird der Geist vom göttlichen Funken zu etwas Natürlich-Irdischem gemacht, und schließlich wird das Ich als nützliches Konstrukt entlarvt.«4 Zwar seien die Theorien der Neurobiologie streng genommen selbst nur Konstrukte des Gehirns; dennoch können sie, so Roth, mehr Plausibilität für sich beanspruchen als andere Welterklärungen wie diejenigen von »Religion, Philosophie oder Aberglaube.«5 Die Dominanz der Neurowissenschaften zeigt sich zumal in ihrer Ausbreitung als Präfix in fremden Territorien: Als »Neuro-Philosophie«, »Neuro-Ethik«, »Neuro-Pädagogik«, »Neuro-Psychotherapie«, »Neuro-Theologie«, »Neuro-Ökonomie« u. a. beanspruchen sie die Deutungshoheit über andere Wissenschaftszweige. Anstelle von subjektiven und intersubjektiven Erfahrungen setzen sie neurobiologische Termini in unsere Selbstbeschreibungen ein. Die Sprache der Lebenswelt, die immer noch von Selbstzuschreibungen und Anthropomorphismen geprägt ist, wird so Schritt für Schritt in eine objektivierende, naturwissenschaftliche Sprache umgeformt.
Kampf um die Zitadelle
Dieser Umsturz der lebensweltlichen Erfahrung liegt in der Logik des naturwissenschaftlichen Programms, das sich seit der Neuzeit etabliert hat. Dieses Programm ist seinem Prinzip nach reduktionistisch. Es zielt auf eine Konzeption der Natur, aus der alle qualitativen, ganzheitlichen, also nicht einzeln zählbaren Bestimmungen als bloß subjektive oder anthropomorphe Zutaten eliminiert sind.6 Diesem Ziel dient die Zerlegung ursprünglich lebensweltlicher Erfahrungen in eine physikalisch-quantitative und eine subjektiv-qualitative Komponente: Die eine wird der experimentellen Erforschung und Erklärung zugänglich, die andere in eine subjektive Innenwelt verlegt. So teilt man z. B. das Phänomen »Wärme« auf in eine subjektive Empfindung einerseits und in physikalische Teilchenbewegungen andererseits. Der Naturwissenschaftler definiert also den Begriff der Wärme neu, indem er das Phänomenale von ihm abtrennt und als »Wärmeempfindung« in das Subjekt verlagert. Gleiches gilt für Farbe, Klang, Geruch oder Geschmack: Sie sind fortan nur noch subjektive Zutaten zur eigentlichen Realität. Die ursprünglich zum Zweck der Messbarkeit und Vorhersagbarkeit mechanischer Vorgänge entwickelten wissenschaftlichen Konstrukte (Teilchen, Kräfte, Felder etc.) werden der Lebenswelt unterschoben und mehr und mehr zur »eigentlichen« Wirklichkeit hypostasiert. Damit sinkt die Sphäre der alltäglichen Lebenserfahrung zum Schein herab, und zum wahren Sein wird das, was die Physik erfasst.
Bereits Galilei und Descartes waren bemüht, den Glauben an die Wahrheit der Sinne zu unterminieren, um der neuen Physik Raum zu schaffen. Nach Descartes beruht die Wahrnehmung auf einer physikalischen Teilchenbewegung, die sich von den Dingen bis ins Gehirn fortpflanzt, sodass »... wir denken, wir sähen die Fackel selbst und wir hörten die Glocke selbst, während wir nur die Bewegungen empfinden, die von ihnen ausgehen.«7 Die naturwissenschaftliche Reduktion zielt somit auf die Trennung des Subjekts vom Erkannten. Sie schneidet uns damit in gewissem Sinn von der Welt ab. Denn das Phänomen der Wärme besteht ja gerade in der Beziehung unseres Leibes mit der Umwelt, etwa der Luft oder der Sonne. Farbe entsteht in der Beziehung von Auge und Gegenstand, Geschmack in der Beziehung von Zunge und Nahrung. All diese Beziehungen, die uns die Qualitäten der Dinge selbst vermitteln, werden gekappt und in innerpsychische Zustände umgedeutet. Tatsächlich gibt es nur noch Teilchenbewegungen, Lichtwellen, chemische Reaktionen. Die Reinigung der Welt von allen subjektiven, anthropomorphen Anteilen fördert ein Skelett der Natur zutage, das sich allerdings umso leichter zerlegen, manipulieren und technisch beherrschen lässt.
Nach und nach gelang es auf diese Weise, Subjektives und Qualitatives nahezu vollständig aus der wissenschaftlich umgedeuteten Welt zu verdrängen. Auch das Leben selbst ließ sich auf biochemische Molekularprozesse zurückführen, allerdings um einen hohen Preis: Was wir mit dem Sein von Lebewesen verbinden – das Empfinden, Fühlen, Sich-Bewegen, Nach-etwas-Streben – wurde aus der Erforschung des Lebendigen ausgeklammert oder wiederum in eine subjektive Innenwelt verlagert. Mit der Neurobiologie als neuer Leitwissenschaft gelangt dieses Programm nun an einen entscheidenden Punkt. Es begnügt sich nicht mehr mit der Reinigung der Natur durch Verschiebung von Qualitäten in das Subjekt. Auch das subjektive Erleben, das Bewusstsein selbst soll nun naturalisiert, auf physikalische Prozesse zurückgeführt werden. Gelänge die materialistische Aufklärung der Hirnfunktionen, dann wäre gleichsam die letzte Zitadelle des Subjektiven und Qualitativen in der physikalischen Wüste geschleift, die der Reduktionismus hinterlassen hat. Die »Entanthropomorphisierung« der Natur geht über in die Naturalisierung des Menschen.
Tatsächlich scheint die Zitadelle schon zu großen Teilen erobert. Immer mehr Plätze und Häuser sind unter Kontrolle, verborgene Gassen werden durch moderne Abbildungstechniken ausgeleuchtet. Kaum jemand zweifelt noch daran, dass das Gehirn psychische Phänomene aus rein materiellen Grundlagen erzeugt. Ein grundsätzlicher Dualismus von Körper und Geist gilt in den Neurowissenschaften ebenso wie in der analytischen Philosophie des Geistes weithin als überholt. Freilich ist der direkte Angriff auf das Subjekt, den vermeintlichen Bewohner der Zitadelle, vorläufig gescheitert. Der eliminative Materialismus, der die subjektive Erfahrung und die »mentalistische« Sprache zu vorwissenschaftlich-naiven Intuitionen erklärt, die wie der Glaube an Geister, Hexen, Äther oder Phlogiston schließlich verschwinden und einer neurologischen Sprache Platz machen würden – dieser radikale Materialismus hat sich nicht durchsetzen können.8 Die Mehrheit der analytischen Philosophen und Neurowissenschaftler vertritt heute einen eher gemäßigten Materialismus, der der Subjektivität noch ein Weiterleben gestattet – freilich nur in Identität mit den neuronalen Prozessen oder als ihre Begleiterscheinung, jedenfalls ohne eine kausale Rolle in der Welt. Daher die heftige Debatte um die Willensfreiheit: Bewusstsein ist dem Gehirn zwar nicht abzusprechen, soll aber sein Produkt und damit machtlos bleiben. Das Subjekt darf in der Zitadelle weiterleben, solange sie vom Physikalismus sicher beherrscht wird.
Vom Kopf auf die Füße
Freilich könnten sich gerade an diesem scheinbar letzten Refugium der Subjektivität die Fronten überraschend umkehren, und es könnte sich herausstellen, dass das Gehirn in Wahrheit die Achillesferse des naturwissenschaftlichen Weltbildes darstellt. Zum einen führt nämlich der bislang so erfolgreiche Weg der schrittweisen Elimination des Subjektiven an dieser Stelle in eine methodische Sackgasse. John Searle hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Abtrennung des jeweils Subjektiven von den Phänomenen nicht mehr anwendbar ist, wenn es um die Reduktion der Subjektivität selbst geht (Searle 1993, 141). Denn es gibt dann keinen Raum mehr, in den sie noch verschoben werden könnte. Man kann sie nur noch als Ganzes bestreiten, was kaum überzeugend ist, oder als Epiphänomen des Materiellen zu neutralisieren versuchen, was das Ärgernis gleichwohl bestehen lässt.
Zum anderen gerät der Reduktionismus im Falle des Gehirns in unlösbare erkenntnistheoretische Aporien. Denn erkennbar ist für uns der Voraussetzung nach nur, was bereits durch die neuronale Maschinerie hindurchgegangen ist, eine subjektive Wirklichkeit. Demnach wäre das Gehirn, das der Neurowissenschaftler erforscht, so wie alles, was er erlebt, nur das Produkt seines eigenen Gehirns. Doch wie soll das Gehirn sich selbst erkennen? Wie soll ein physikalisch beschreibbarer und lokalisierbarer Apparat in der Lage sein, die Welt der wissenschaftlichen Erfahrung hervorzubringen, in der er zugleich selbst vorkommt? – Die vermeintlich eroberte Zitadelle wäre dann selbst nur eine Fata Morgana der Eroberer, und sie können niemals mit Sicherheit wissen, ob es überhaupt eine wirkliche Zitadelle gibt, die ihr gleicht. Ebenso gut könnte es sich um ein Hirngespinst handeln.
Offenbar setzt bereits die Rede über Gehirne voraus, was angeblich von ihnen hervorgebracht werden soll: bewusste und sich miteinander verständigende Personen. Wenn es sich aber so verhält: Wenn die Hirnforschung der Abhängigkeit von der Subjektivität, der Intersubjektivität und der Lebenswelt nicht entkommt, dann können wir sie auch »vom Kopf auf die Füße« stellen. Die Neurobiologie erweist sich – ebenso wie die Naturwissenschaften insgesamt – als eine spezialisierte Form menschlicher Praxis, die der Lebenswelt entstammt, ohne jedoch einen Standpunkt außerhalb ihrer gewinnen zu können. Die alltäglich erlebte und vertraute Welt, in der wir gemeinsam leben, bleibt unsere primäre und eigentliche Wirklichkeit. Sie ist nicht das bloße Produkt einer anderen, nur wissenschaftlich erkennbaren Realität, kein Scheinbild oder Konstrukt des Gehirns, sondern die Grundlage aller wissenschaftlichen Erkenntnis. Konstrukte sind vielmehr die Entitäten der Physik oder der Neurobiologie – Elektronen, Atome, Moleküle, Aktionspotenziale, Magnetfelder oder Photonenemissionen. Ihr hoher praktischer Nutzen zur Erklärung und Prognose von Phänomenen soll nicht bestritten werden. Sie können jedoch niemals dazu dienen, die lebensweltlichen Phänomene und Erfahrungen als Illusionen zu entlarven.
Unter dieser Voraussetzung müssen wir aber auch das Gehirn ganz neu betrachten. Es bringt unsere Welt nicht wie ein geheimer Schöpfer hervor, es hat auch uns selbst weder erschaffen noch dirigiert es uns aus dem Verborgenen wie Marionetten. Das Subjekt ist in ihm gar nicht zu finden. Das Gehirn ist vielmehr das Organ, das unsere Beziehung zur Welt, zu anderen Menschen und zu uns selbst vermittelt. Es ist der Mediator, der uns den Zugang zur Welt ermöglicht, der Transformator, der Wahrnehmungen und Bewegungen miteinander verknüpft. Das Gehirn für sich wäre nur ein totes Organ. Lebendig wird es erst in Verbindung mit unseren Muskeln, Eingeweiden, Nerven und Sinnen, mit unserer Haut, unserer Umwelt und mit anderen Menschen. Sobald sich die Fata Morgana der Zitadelle auflöst und die Lebenswelt wieder in ihr Recht gesetzt wird, zeigt sich auch das Gehirn nicht mehr als isolierte Burg des Subjekts, sondern als ein weltoffener, lebendiger Handels- und Umschlagsplatz, an dem Waren und Nachrichten aller Art ausgetauscht werden, und der weitläufig mit anderen Orten vernetzt ist. Es zeigt sich als ein Beziehungsorgan.
Ein adäquates Verständnis des menschlichen Gehirns, wie es in diesem Buch in Grundzügen entwickelt werden soll, muss von der Phänomenologie unserer lebensweltlichen Selbsterfahrung ausgehen, in der wir keine Trennung von »Geist« und »Körper« erleben, sondern in einem leibliche, verkörperte und seelisch-geistige Wesen sind – also das, was wir auch als Personen bezeichnen. Erst dann können wir fragen, wie das Gehirn auf biologischer Ebene zu dieser Einheit der Person beiträgt. Die erste zentrale These der Untersuchung wird also lauten, dass alle seine Funktionen die Einheit des Menschen als Lebewesen voraussetzen und nur von ihr her zu verstehen sind. Dazu müssen wir zunächst einen adäquaten Begriff des Lebendigen entwickeln, der in den gegenwärtigen biomedizinischen Wissenschaften weitgehend fehlt. Die zweite These wird lauten, dass die höheren Gehirnfunktionen den Lebensvollzug des Menschen in der gemeinsamen sozialen Welt voraussetzen. Dazu bedarf es einer Konzeption menschlicher Entwicklung als kontinuierlicher Verankerung von Erfahrungen in den psychischen und zugleich zerebralen Strukturen des Individuums, im Sinne einer »kulturellen Biologie«.
Die Dimension des Lebendigen verankert das Gehirn im Organismus und seiner natürlichen Umwelt, die soziokulturelle Dimension verankert es in der gemeinsamen menschlichen Welt, von der es lebenslang geprägt wird, und ohne die seine spezifisch humanen Funktionen gar nicht begreiflich werden können. Beide Dimensionen vereinigen sich zu einer entwicklungs- und sozialökologischen Sicht des menschlichen Gehirns als Organ eines »zõon politikón«, eines Lebewesens, das bis in seine biologischen Strukturen hinein durch seine Sozialität geprägt ist. Das Gehirn erscheint darin zunächst als ein Organ der Vermittlung, das die vegetativen und sensomotorischen Beziehungen zwischen dem Organismus und seiner Umwelt ermöglicht, dabei aber auch so umwandelt und »verdichtet«, dass es für den Menschen zum Medium einer neuen, intentionalen Beziehung zur Welt werden kann. Damit steigern sich primäre Lebensprozesse zu seelischen und geistigen Lebensvollzügen mit zunehmenden Freiheitsgraden. Zugleich öffnet sich das menschliche Gehirn einer lebenslangen Prägung durch zwischenmenschliche und kulturelle Einflüsse: Es wird zu einem sozialen, kulturellen und geschichtlichen Organ – zum Organ der Person.
Bevor wir diese Konzeption in Angriff nehmen, soll eine Kritik verbreiteter reduktionistischer Konzeptionen des Verhältnisses von Gehirn und Subjektivität zunächst den Raum für die eigentliche Aufgabe freimachen. Ich werde diese Kritik in Teil A in zwei grundsätzlichen Schritten vornehmen: In ▸ Kap. 1 setze ich mich mit der neurokonstruktivistischen Erkenntnistheorie auseinander, wonach die phänomenale Wirklichkeit als interne Abbildung oder Repräsentation durch neuronale Prozesse zu begreifen sei. In ▸ Kap. 2 werde ich die Vorstellung eines »Gehirns als Subjekt« einer Kritik unterziehen und die Nicht-Reduzierbarkeit von subjektiver, insbesondere intentionaler Erfahrung darlegen.
Teil B entwickelt dann schrittweise und unter Einbeziehung verschiedener Denkansätze eine Theorie des Gehirns als Organ der menschlichen Person. Als ihre Grundlage wird in ▸ Kap. 3, ausgehend von einem phänomenologischen Begriff der leiblichen Subjektivität, zunächst eine aspektdualistische Konzeption der Person als Einheit von »Leib« und »Körper« entworfen. Daran knüpft sich eine ökologische Theorie des lebendigen Organismus, die insbesondere eine Analyse der spezifischen Kausalität des Lebendigen einschließt. – ▸ Kap. 4 entwickelt auf dieser Basis eine Konzeption des Gehirns als Organ eines Lebewesens in seiner Umwelt. ▸ Kap. 5 betrachtet dann, unter Einbeziehung entwicklungspsychologischer Forschungen, das Gehirn als soziales, kulturelles und geschichtliches Organ. ▸ Kap. 6 wird sich mit einigen Folgerungen dieser ökologischen und aspektdualistischen Konzeption für das Leib-Seele-Problem befassen. Abschließend untersucht ▸ Kap. 7 mögliche Konsequenzen der Konzeption für ätiologische und therapeutische Konzepte in der psychologischen Medizin.
Endnoten
4Roth 2000, 107. – Zum Motiv der Entlarvung in der Hirnforschung vgl. meinen Aufsatz »Neuromythologien« (Fuchs 2008, 206 – 327).
5Ebd.
6Man kann insofern auch von einem Programm der »Entanthropomorphisierung« sprechen.
7Les Passions de l'Ame, I, 23 (Descartes 1984, 41).
8Vgl. etwa Rorty 1993, Churchland 1997, Metzinger 1999.