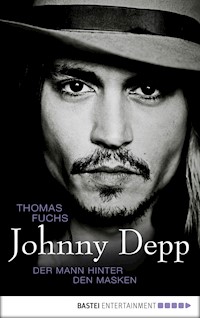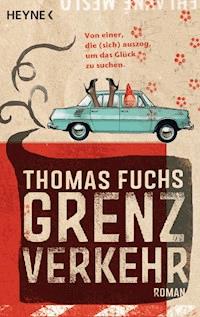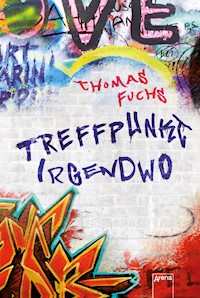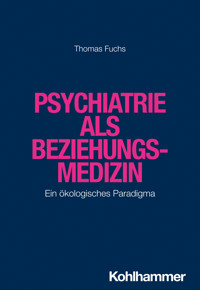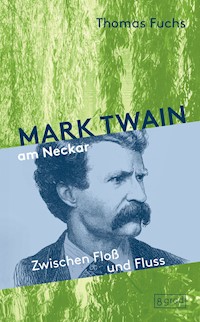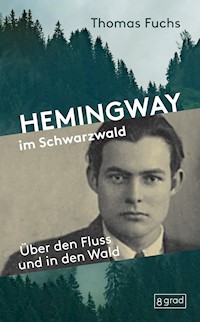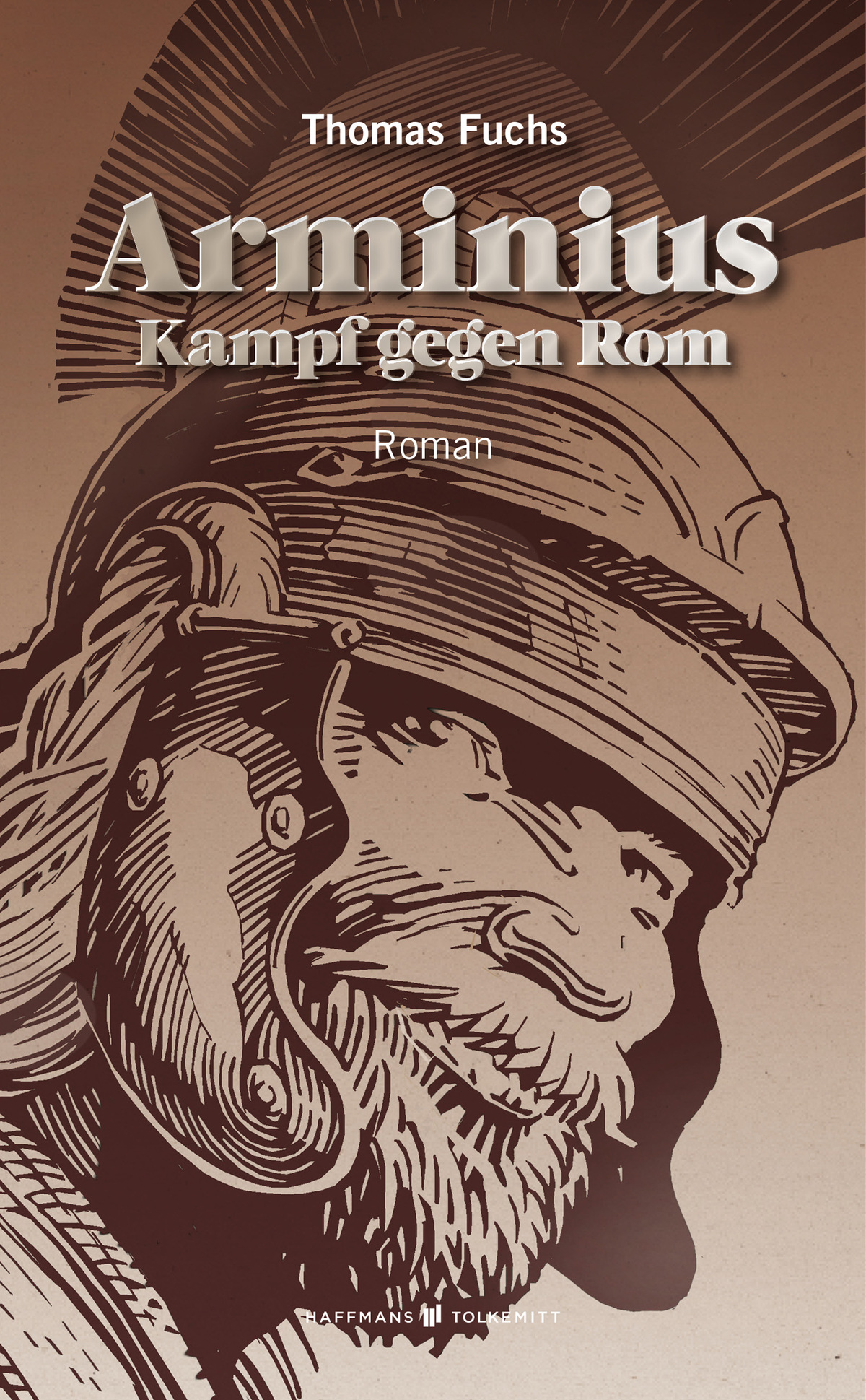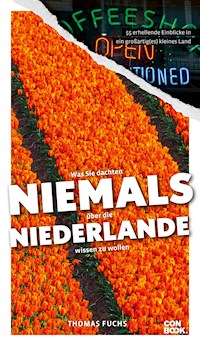Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mare Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Von allen Büchern über sich selbst hätte Hemingway dieses am besten gefallen, denn es ist so, wie er sich selbst gern gesehen hätte: unterhaltsam, charmant und nicht zu dick.« Oliver Maria Schmitt Ernest Hemingway war ein Mann, der die Gemüter durch Wort und Tat spaltete, Idol für seine Freunde, für seine Gegner eine Reizfigur. In was für eine Schublade sollte man einen Nobelpreisträger auch packen, der im Nebenberuf Großwildjäger, Kriegsreporter und Hochseefischer war (vom Trinker und Weiberhelden gar nicht zu reden)? Und was ist heute von ihm zu halten, was macht die Hemingway-Lektüre jetzt noch lohnend? Dieser Frage widmet sich Thomas Fuchs, selbst lange hin- und hergeworfen zwischen haltloser Bewunderung und kritischer Exegese, mit erfrischender Respektlosigkeit. Natürlich geht es auch um das innige Verhältnis des alten Mannes zum Meer. An Land zeigte sich Hemingway Wasser gegenüber bekanntermaßen skeptisch (da bevorzugte er hochprozentige Flüssigkeiten), doch auf See fühlte er sich ganz in seinem Element. Ob als Lebendköder für deutsche U-Boote vor Kuba, beim Wettangeln mit Fidel Castro oder in seinem wohl bekanntesten literarischen Werk "Der alte Mann und das Meer" - auf dem Wasser gelang es dem großen Abenteurer, seine Dämonen zu besiegen und seine Fabeln in eine zeitlose Form zu gießen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
mare
Thomas Fuchs
HEMINGWAY
Ein MannmitStil
mare
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diesePublikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internetunter http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2016 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Simone Hoschack, mareverlag, HamburgAbbildung: Earl Theisen / Getty Images
Typografie (Hardcover) Farnschläder & Mahlstedt, HamburgDatenkonvertierung eBook bookwire
ISBN eBook: 978-3-86648-325-5ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-208-1
www.mare.de
INHALT
Vorwort
Er spielte Cello
Die Walküre
Kansas City, Here I Come
Via Mala
Die Verwund(er)ung
Liebe zur Schwester
Hadley und Hemingway heiraten in Horton Bay
Paris ist Paris ist Paris
Literarische Odysseen
Der rastende Reporter
Eine schwere Geburt
Für alle Fälle Fitz
Der Durchbruch
Trophy Boy
Go West
Der Bestseller
Bullshit
The Importance of Being Ernest
Kubakrisen
Das Herz der Finsternis
Der Seebär
Aller guten Dinge sind drei?
Spaniens Himmel und Erde
Ein rauer Wind
Havanna Honeymoon
Der Schlachtenbummler
Wenn Gondeln Trauer tragen
Alter Ego
Die Hure Ruhm
Das Herz ist ein einsamer Jäger
Dressing für den Kopfsalat
High Fidelity
His Own Private Idaho
Happiness Is a Warm Gun
Nachwort
Quellenverzeichnis
»Da ist Mr. Hemingway. Er schreibtluzide und individuell und wohlklingend.Er hat seinen Mächten Grenzen gesetzt,die nur ein Meister überleben kann.«
Evelyn Waugh
VORWORT
Als sich im Juli 2011 Ernest Hemingways Todestag zum fünfzigsten Mal jährte, gab es das zu erwartende mediale Getöse. Auf dem Buchmarkt tat sich einiges. Zahlreiche Werke des Nobelpreisträgers wurden sorgfältig neu übersetzt; im angelsächsischen Raum kamen liebevoll gestaltete Reprints der Erstausgaben heraus.
Das Bild, welches die bislang publizierten Lebensbeschreibungen zeigen, wird durch drei Grund- und viele Zwischentöne geprägt. Die Grundierung besorgte A. E. Hotchner mit Papa Hemingway. Er hatte den Schriftsteller während seiner letzten Lebensjahre treu wie einst Eckermann seinen Goethe begleitet und trug durch seine Biografie dazu bei, ein äußerst vorteilhaftes Image zu prägen. Carlos Baker war Hemingway nie persönlich begegnet, hatte aber die Werke des Autors schon zu dessen Lebzeiten wohlwollend besprochen und mit seiner Biografie dafür gesorgt, dass der Schriftsteller seinen angemessenen Platz im literarischen Olymp erhielt. Kenneth S. Lynn schließlich liebte den Blick durchs Schlüsselloch. Auf der Suche nach unterschwelligen sexuellen Botschaften war keiner so emsig wie er. Diese investigative Energie zeigte er auch in anderen Texten, so zum Beispiel in einem Buch über Charlie Chaplin. Zum Glück für Mr Lynn fragte sich niemand, was denn wohl sein Motiv dafür gewesen sei, immer und überall nach subkutanem Sex zu forschen.
In den letzten Jahren ging man dazu über, einzelne Epochen aus dem Leben des Schriftstellers unter die Lupe zu nehmen. Egal ob Spanien, der Erste Weltkrieg oder das Hochseefischen – zu jedem Aspekt existiert inzwischen mindestens ein Buch. Publikationen zum Thema »Hemingway und die Frauen« gab es sowieso schon immer, bald kamen Digests wie »Hemingway übers Schreiben/Jagen/Paris/Fischen/Trinken« hinzu.
Bei den vielen posthumen Würdigungen fiel auf, dass offenbar auch Hätschelkinder des Literaturbetriebs – also jene, die sich zuverlässig von Preis zu Preis hangeln – in Hemingway einen Ahnen sehen. Das ist bemerkenswert, denn solange er noch kreativ war, hatte Ernest Hemingway sich vom Preisbetrieb fern gehalten. Und als es zum Ende seines Lebens dann Preise und Orden hagelte, hat er diese Ehrungen als das verstanden, was sie nur allzu häufig sind: Ausverkauf und Abstieg in den Ruhm.
Auch hat die Flut von Publikationen über die vielen verschiedenen Aspekte der Persönlichkeit Hemingways den Blick auf den Schriftsteller eher verstellt. Ähnlich wie bei dem Gemälde eines Impressionisten sieht man, wenn man zu dicht vor seinem Betrachtungsgegenstand steht, nur noch einzelne Punkte und nicht mehr das ganze Bild.
Letztlich stellt sich bei Hemingway (wie bei jedem anderen Schriftsteller) heute vor allem eine Frage: Sind seine Texte noch relevant? Und falls sie das sind – was der Schreiber dieser Zeilen für weite Teile des OEuvres bejaht –, was sollte man dann über den Autor wissen?
Dieses Buch soll einen kurzen Überblick über das Leben und Werk Hemingways geben, wobei es wichtig schien, historische Ereignisse auch Lesern nachvollziehbar zu machen, die nunmehr ganz Kinder des einundzwanzigsten Jahrhunderts sind.
Bevor es losgeht, noch eine Bemerkung. Mit seiner manchmal allzu breitbeinig inszenierten Männlichkeit hat sich Hemingway nicht nur Freunde gemacht, weshalb es mittlerweile einen erklecklichen Bestand von Publikationen gibt, in denen ausgiebig und durchaus ernsthaft untersucht wird, ob Personen, die in seinem Leben eine Rolle spielten, durch das Tragen von Frauenkleidern auffielen oder ob sie in einer homosexuellen Beziehung mit ihm standen. Ich weiß, es ist möglicherweise ein Schock für Leser dieser Zeilen, aber ich habe nicht vor, mich an diesen Spekulationen zu beteiligen. Sollte Sie dieser spezielle Aspekt des Hemingway’schen Daseins brennend interessieren, schlage ich vor, dass Sie, wann immer ein Name im Text auftaucht, im Geiste dahinter in Klammern »Frauenkleider? Homosexuell?« einfügen. Es findet sich bestimmt irgendwo ein Aufsatz, in dem diese These vertreten wird.
Zurückhaltung in diesem Punkt bedeutet aber keinesfalls, dass ich mich generell vor delikaten Aspekten drücke. Schließlich möchte auch ich einen Beitrag zu den intimeren Fragen der Hemingway-Forschung leisten. So konnte ich mich während meiner Recherchen zum Thema kaum des Eindrucks erwehren, dass die (aus für mich nicht immer nachvollziehbaren Gründen) bis zu seinem Lebensende einzig autorisierte deutsche Übersetzerin Annemarie Horschitz-Horst eine eindeutige Präferenz für – jawoll! – Frauenkleider hatte. Zu der Frage, inwieweit diese aufsehenerregende Erkenntnis das literaturkritische Hemingway-Bild verändern wird, wage ich keine Prognose abzugeben. Lassen wir dieses heiße Eisen jetzt also besser ruhen und wenden uns den belegten Fakten zu.
ER SPIELTE CELLO
Ernest Hemingway wurde am 21. Juli 1899 gegen acht Uhr morgens in einem Vorort von Chicago geboren. Das scheint auf den ersten Blick ein angemessener Geburtsort für einen Schriftsteller zu sein, der eine Schwäche für die Brutalitäten dieser Welt hatte. Chicago, das klingt nach Al Capone und Gangsterkriegen, brutalem Kapitalismus. Außerdem wurden in den riesigen Schlachthäusern der Stadt die ersten Lebensmittelskandale des Industriezeitalters aufgedeckt. Blut, Gewalt und Gier – könnte es für einen angehenden Abenteurer und Literaten ein besseres Ambiente geben? Allerdings hat Hemingways Heimatort Oak Park mit dem Kern von Chicago ungefähr so viel gemeinsam wie Berlin-Wannsee mit Neukölln.
Oak Park war nicht nur ein schmuckes Örtchen für die Oberschicht, es war darüber hinaus so weiß, angelsächsisch und protestantisch wie irgend möglich. Und man ist auch heute noch stolz darauf, dass alle Versuche Chicagos, das Örtchen einzugemeinden, abgewehrt werden konnten. Seit 1870 wurde hier kein Alkohol verkauft (was vielleicht erklärt, weshalb der Schriftsteller in seinem späteren Leben solch einen Nachholbedarf hatte). Neben dem Konsum von alkoholischen Getränken wurde auch öffentliches Fluchen geahndet, Tanzmusik war verpönt wie Schundliteratur. Und damals, um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert, galten eine Menge Bücher als Schundliteratur, die heutzutage zum Kanon des Bildungsbürgers gehören.
Schwarze wurden nicht geduldet, Juden waren nicht erwünscht; den lärmenden, trinkenden und katholischen Iren von der anderen Seite des Bahndamms begegnete man mit Misstrauen, brauchte sie jedoch für niedere Arbeiten.
All diejenigen, die Amerika als Hort der Freiheit und Liberalität schätzen, dürfen nicht vergessen, dass ein Großteil der Auswanderer damals die britischen Inseln verließ, weil ihnen die Religiosität in ihrer Heimat nicht rigoros genug war. Puritaner meinten, dass sich Gottes Gnade nicht zuletzt im geschäftlichen Erfolg zeigt. Grundlagen des Erfolges waren die Kardinaltugenden Mäßigung, Fleiß und Ausdauer, vor allem aber Willenskraft. Man wollte einfach glauben, mit dem nötigen Willen ließe sich letztlich alles erzwingen.
Ernests Eltern Grace und »Ed« Clarence Hemingway befanden sich voll auf der Linie ihrer Gemeinde. Auch sie taten am liebsten so, als wären sie an Bord der Mayflower nach Amerika gekommen. Ernests Mutter konnte immerhin für sich reklamieren, dass ihre Eltern noch in England zur Welt gekommen waren.
Hemingways Vorfahren waren Einwanderer und hatten es in der Neuen Welt zu Wohlstand gebracht. Der Großvater seiner Mutter war Kaufmann, der seines Vaters Immobilienmakler. Die Hemingways stimmten regelmäßig für die Republikaner, schließlich hatte Lincoln den Zusammenhalt der Union bewahrt und somit das Fundament für die zukünftige Großmacht der Vereinigten Staaten gelegt. Hemingways Großvater hatte im Bürgerkrieg auf Seiten der Yankees gekämpft und war dabei verwundet worden. Diese Schusswunde – obwohl ihre Natur und die Umstände des Erwerbs im Unklaren gelassen wurden (es könnte sich also um eine ähnlich ruhmlose Verletzung wie die des in der Leistengegend getroffenen Onkel Toby in Laurence Sternes Tristram Shandy handeln) – wurde in der Familie in hohen Ehren gehalten. Es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis Hemingway mit eigenen Schussverletzungen zu seiner Legendenbildung beitragen konnte – und noch ein paar Jahrzehnte, bis er in diesem Punkt alle Verwandten übertrumpfen sollte.
Als die republikanische Roosevelt-Variante – also Theodore – 1901 zum Präsidenten gewählt wurde, fühlten sich die Hemingways politisch auf der Siegerseite. Der als Raubein und Brillenträger berühmte Mann stand für vieles, an das auch die Hemingways glaubten: Gewinnstreben, Naturverbundenheit und die ständige Bereitschaft, jedem eine Lektion zu erteilen, der nicht akzeptierte, dass man im Recht sei. Und wie es sich für einen amerikanischen Friedensnobelpreisträger gehört – Roosevelt erhielt diese Auszeichnung 1906 –, war er auch militärischen Auseinandersetzungen durchaus nicht abhold.
Es gibt Fotografien aus Hemingways Kindheitstagen, auf denen es den Anschein macht, als posiere er für eine Verfilmung der Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn: auf dem Kopf einen Strohhut, in den Händen eine Angel, die Hosenbeine hochgekrempelt und bis zu den Knöcheln im Wasser. Aber für den kleinen Ernest – der sich damals auch »Huck Hemingstein« rufen ließ und später Huckleberry Finns Abenteuer als die Quelle aller amerikanischen Literatur feierte – waren die Ausflüge in die Natur keine Flucht aus der Welt der Zivilisation, sondern Teil des Curriculums. Sowohl Vater als auch Mutter legten Wert darauf, dass sich ihre Kinder in der Natur nicht nur bewegen, sondern auch behaupten konnten. Hemingway litt seit Kindertagen an einer Sehschwäche auf dem linken Auge, was ihn aber nicht daran hinderte, sich bald zu einem beachtlichen Schützen zu entwickeln. Trotz des schwachen Auges fing er erst mit knapp dreißig Jahren an, eine Brille zu tragen, was bei einem Schriftsteller, der sich für seine Beobachtungsgabe und seinen Blick fürs Detail rühmen ließ, bemerkenswert ist.
Die kleinen Hemingways wurden von ihrem Vater – für den die Ausflüge in die Natur eine Möglichkeit zur Flucht aus der Rolle des Gatten und Familienvaters boten – zu kundigen Waldläufern ausgebildet. Als Ernest zehn Jahre alt war, bekam er sein erstes Gewehr geschenkt. Die Kinder lernten, wie man ein Feuer macht und am Leben hält, sich ein Nachtlager bereitet und wie man Fallen stellt. Wichtiger noch: Sie lernten, wie man seine Beute zu Nahrung macht. Die Speisekarte der Natur war überraschend vielseitig, denn Papa Hemingways Lektion zu diesem Thema lautete: Wenn etwas vier Beine hat und es ist kein Tisch, dann kann man es vermutlich essen.
Wer – aus welchen Gründen auch immer – Vorbehalte gegen das Waidwerk hat und sich deshalb von den in Hemingways Publikationen vielfach auftauchenden Elogen aufs Jagen und das unsichtbare Band zwischen Jäger und Beutetier abgestoßen fühlt, sollte bedenken: Amerikanische Jagd findet nicht auf dem Hochsitz statt. Diese Form, das gestehen selbst ihre Befürworter ein, hat etwa den Spannungsgehalt eines Films von Wim Wenders. Man sitzt und sitzt und hofft und hofft, dass endlich etwas passiert. Irgendwann betritt dann vielleicht ein Reh die Lichtung, äugt und äst – und bumm, ist es auch schon vorbei.
Die amerikanische Pirsch verläuft ganz anders. Man kommt dem Wild nahe, etwa bis auf zwei Dutzend Schritte. Aus dieser Entfernung sieht sogar ein Wildschwein Respekt einflößend aus, von größeren Tieren ganz zu schweigen. Wenn man sich dann noch an den Kodex hält, dass das Wild nur in der Bewegung geschossen werden darf, wird die Begegnung zu einer Konfrontation, bei der das Tier nicht völlig chancenlos ist. Natürlich ist ein Jäger mit einer funktionierenden Waffe und ruhiger Hand immer noch klar im Vorteil – trotzdem fällt es um einiges leichter, dieser Jagdvariante eine gewisse Fairness zuzugestehen und ihren Reiz nachzuvollziehen.
Ebenso wichtig wie das Überlebenstraining in freier Natur war für die Hemingway’sche Erziehung das Training des Geistes. Bildung diente in Oak Park vor allem als Statussymbol: Man erwarb sie nicht aus Neugier auf die Welt, sondern weil man definieren wollte, woher man kam und wer man war. Nicht zuletzt deshalb galt amerikanische Literatur bei den Hemingways wenig – nicht mal James Fenimore Cooper mit seinen Lederstrumpf-Erzählungen hatte vor dem kritischen Auge der Naturfreunde Bestand. Sie waren von englischem Blut, also lasen sie englische Literatur. Auf den heimischen Regalen stapelten sich vor allem die Werke Shakespeares, aber auch diejenigen Chaucers, dessen Canterbury-Erzählungen zum Glück so verschlüsselt anzüglich waren, dass dies kaum einem Leser auffiel. Der literarische Hausgott war jedoch John Milton. Milton Jo war ein Ur-Puritaner aus dem 17. Jahrhundert, der ohne Pathos vermutlich nicht mal aufs Klo gehen konnte. Seine Themen waren Rache und Vergeltung, alles hatte groß und gewaltig zu sein. Als Chefideologe der puritanischen Partei hatte er in einem Gedicht die Hinrichtung des britischen Königs Jakob I. gerechtfertigt und war dafür mit einem Parlamentssitz belohnt worden. Nachdem er aus der Politik ausschied, machte er sich an sein Lebenswerk: Das verlorene Paradies, eine hochtönende Nacherzählung des Sündenfalls in zwölf umfangreichen Büchern. Der von Milton begründete »Grand Style« machte es möglich, die Welt als einen immerwährenden Kampf zwischen Gut und Böse, Satan und Gott zu sehen. Und was seine Willensstärke betrifft: Während der Arbeit am Verlorenen Paradies bemerkte Milton, dass seine Sehkraft nachließ. Er ahnte, dass er erblinden sollte, bevor er den Text beenden würde. Und was tat er? Er brachte seinen Töchtern das Lesen bei, damit sie ihm später aus den geliebten Quellen vortragen könnten. Allerdings – denn Milton wusste nicht nur, wo der Platz Gottes, sondern auch, wo der von Mann und Frau ist – lernten sie von ihm nur das Buchstabieren, denn er wollte zwar, dass sie ihm die Texte vortragen konnten, nicht jedoch, dass sie selbst verstünden, was sie da lasen. Eine Methode, die im Deutschen, wo die Aussprache mit der Buchstabenfolge weitgehend identisch ist, wenig gebracht hätte; im Englischen funktionierte sie jedoch. Die Töchter rächten sich für diese Diskriminierung übrigens schon zu Lebzeiten des Dichters, indem sie – als er nicht mehr richtig gucken konnte – einen Großteil seiner antiquarischen Schätze verhökerten.
Trotz der elterlichen Affinität zur Lektüre tat sich Hemingway während seiner Schulzeit literarisch nicht sonderlich hervor. Er war zwar Mitglied des Debattierclubs und veröffentlichte auch einige Beiträge in der Schülerzeitung Tabula. Aber wäre aus ihm kein Nobelpreisträger geworden, würde sich heute wohl niemand mehr an diese Versuche erinnern. Und doch hat ihn der Bücherschrank der Eltern geformt: Während Shakespeare in Hemingways Texten immer wieder mal zitiert wird, hat Milton ihn – wenn auch stellenweise ex negativo – viel stärker geprägt. Musste bei Milton vieles gigantisch und gewaltig sein, verwendete Hemingway einen Großteil seiner literarischen Energie darauf, gemeinhin pathetischen Themen den Glanz zu nehmen. Das wirkt manchmal wie eine Trotzreaktion gegen das klassische Vorbild. Dessen sprachliche Direktheit hingegen wurde gerne imitiert. Ein Satz von Milton wie »Better to reign in Hell than serve in Heaven« hätte auch Hemingway gut angestanden.
Amerikanische Literatur hatte auf den jungen Hemingway fast keinen Einfluss; er las neben Jack London und Ring Lardner vor allem Cowboyromane, und der ebenfalls in Oak Park residierende Tarzan-Autor Edgar Rice Burroughs dürfte bei seinen literarisch ambitionierten Nachbarn ungefähr so angesehen gewesen sein wie ein Pornograf. Auf den kleinen Ernest scheint er jedenfalls keinerlei Wirkung gehabt zu haben.
Ernest Hemingway war ein guter Schüler, besonders mochte er den Englischunterricht bei Fannie Biggs, einer alten Jungfer, die ihn an Miss Watson erinnert haben könnte, die in Huckleberry Finns Abenteuer den kleinen Halbwaisen piesackt. Im Sport probierte er vieles aus, aber er war keine große Leuchte. Weder beim American Football noch in der Leichtathletik oder beim Schwimmen tat er sich hervor. Seine Lehrer bemängelten seine miese Koordinationsfähigkeit und eine gewisse Langsamkeit. Eine Einschätzung, die sich später in seinem Leben bei einigen Unfällen bestätigen sollte. Einzig und allein beim Tauchen im Schwimmbecken – was aber keine reguläre Sportart war – fiel er positiv auf.
In Oak Park wurde Tanzmusik verachtet, jedoch nicht Musik an sich. Hemingways Mutter war musikalisch und versuchte, diese Liebe an ihren Sohn weiterzugeben. Das Tanzmusikverbot tangierte diesen auch nicht sonderlich; mit seinen großen Füßen machte er auf dem Tanzboden eine eher unglückliche Figur, aber seine Mutter konnte ihn dazu bewegen, Cello zu spielen.
Nun ist das Cello ein bemerkenswertes Instrument. Zum einen sind Cellisten – ähnlich wie Soldaten, die in ihrem Trupp das Maschinengewehr oder die Panzerfaust schleppen müssen – in ihren Quartetten die Dummen. Man braucht sie, aber man macht sie genauso gern zum Gespött. (Wer in der Pubertät ein Instrument bedienen musste, welches man zum Spielen zwischen die Beine klemmt, ahnt, wovon hier die Rede ist.) Was das Cello jedoch einzigartig macht: Es scheint nur düstere und traurige Stücke zu kennen. Die Aufführung einer lustigen Cello-Komposition ist so wahrscheinlich wie ein Hemingway-Text mit dem Titel Mutterliebe. Insofern war das Instrument – auch wenn es ihn nur in seinen Jugendtagen begleitete – durchaus passend für den Schriftsteller mit seiner Vorliebe für trübe Themen und eine gewisse unterschwellige Verzweiflung.
Später hat Hemingway Oak Park als einen Ort mit breiten Rasen und engen Hirnen verspottet. In seinem Werk taucht die Stätte seiner Kindheit nicht auf; wenn er Erzählungen über die Jugendzeit schrieb, spielten diese meist im Wald. Doch was hätte er auch über Oak Park schreiben sollen? Eine Art amerikanisches Buddenbrooks, mit dem er die Nachbarn zur Weißglut und die Eltern in die Scham getrieben hätte? Romane und Stücke über das kleinstädtische Amerika gibt es genug. Manchmal muss man Schriftstellern auch für die Werke dankbar sein, die sie nicht geschrieben haben.
DIE WALKÜRE
Hemingways Vater »Ed« Clarence war Arzt und ein stattlicher Mann, der vor niemandem Angst hatte – außer vor seiner Frau Grace. Zumindest galt das für die längste Zeit ihrer Ehe. Die Flirtphase der beiden Nachbarskinder verlief noch nach klassischem Muster: Ed warb um Grace, sie gab sich kokett. Als er um ihre Hand anhielt und gleichzeitig forderte, sie solle ihm zuliebe auf eine eigene Karriere verzichten, weigerte sie sich brüsk. Grace wollte Opernsängerin werden, auf den ganz großen Bühnen singen. Doch als sich abzeichnete, dass aufgrund von Spätfolgen einer Scharlacherkrankung aus ihren Träumen nichts werden würde, gab sie nach und ließ sich von Ed freien.
Doktor Hemingway war zufrieden mit sich, er hatte sich als Mann und Herr im Haus erwiesen – vermutlich zum letzten Mal in der Ehe. Im Alltag zeigte sich schnell, dass Mutter Grace die Hosen anhatte. Grace gehörte zu den ersten Feministinnen von Oak Park, sie kämpfte für das Frauenwahlrecht und trat in der Öffentlichkeit unter eigenem Namen – nicht als Mrs. Clarence Hemingway – auf. Auch zu Hause beanspruchte sie Freiräume, wozu unter anderem das Recht gehörte, Gesangsstunden zu geben. Da sie also beruflich eingespannt war, musste sich Clarence Hemingway im Ehevertrag verpflichten, im Haushalt zu helfen. Dieser Passus dürfte zur damaligen Zeit ein Novum gewesen sein. Es gibt Bilder von Hemingways Vater, die ihn mit umgebundener Schürze bei der Küchenarbeit zeigen, und andere, auf denen er als »Familienmutter« die Seinen zum Essen ruft. Aus Ernest Hemingways späterem Leben existieren keine solchen Bilder, und in seinen Eheverträgen wird man einen Paragrafen über die Hausarbeit vergeblich suchen. Dreimal dürfen Sie raten, warum.
Hemingways Mutter Grace war Altistin, was unter anderem bedeutet haben müsste, dass sie nicht mit dieser bei Amerikanerinnen so verbreiteten Piepsstimme sprach. Sie war als Gesangslehrerin recht populär, was wiederum dazu führte, dass sie bald zur Ernährerin der Familie wurde, während Vater Ed sich mit dem durch Arztpraxis und Geburtshelferei verdienten Einkommen lange Zeit auf dem Niveau eines Hobbyheilers bewegte.
Allerdings machte Grace diese finanzielle Überlegenheit schnell übermütig. Obwohl die Hemingways in der Mittelschicht von Oak Park verankert waren, wollte sie gern noch höher hinaus. Ferienhäuser, am besten zwei, und beide über den Möglichkeiten der Familie eingerichtet, standen ganz oben auf ihrer Wunschliste. Zudem war sie eine große Bewunderin der Entwürfe des Nachbarn Frank Lloyd Wright. Ein Haus im von dem Architekten kreierten »Prärie-Stil« hätte sie auch nicht verschmäht, doch dieser Traum lag weit jenseits der finanziellen Möglichkeiten der Hemingways, was dazu führte, dass bei ihnen zwar nie Armut herrschte, aber oft Geldmangel. Die Eltern mussten zeitlebens heftig strampeln, um den tatsächlichen Lebensstandard zu halten und den Nachbarn einen noch höheren vorzugaukeln.
Grace Miller Hemingway hätte mit ihrer Größe – um die 1,75 Meter – die Statur gehabt, um mit wogendem Busen in Wagner-Opern Walküren zu verkörpern. In den Augen des kleinen Ernest erinnerte sie wohl an eine Brunhilde, die ihren Gunther nach Belieben herumkommandierte und ihn – wenn ihr danach war – einfach an die Wand hängte und dort zappeln ließ. Und dabei war der Vater ein so großer, starker Mann, der schießen und sich in der Wildnis behaupten konnte. Doch der wahre und gefährlichere Feind eines Mannes – das war eine Erkenntnis, die sich Klein-Ernie recht bald aufdrängte –, das war die Zivilisation mit ihren Regeln, Gesangsstunden und Kirchgängen.
Auch wenn Grace niemals in großen Opernhäusern auftreten sollte, gab sie viele Gesangsabende und veröffentlichte sogar ein paar eigene Lieder, die ihr – allerdings überschaubare – Tantiemen einbrachten. Ihr Sohn Ernest dürfte dadurch en passant einige Grundbegriffe des Verlagswesens erlernt haben. Darüber hinaus trägt sein späterer Schreibstil tatsächlich musikalische Züge, wiewohl seine Behauptung, dass er Bachs Fugentechnik in die Literatur übertragen hätte, etwas gewagt erscheint, was die meisten seiner Texte betrifft. Manchmal scheint sie aber auch der Wahrheit zu entsprechen. Dazu später mehr.
Auf jeden Fall hatte Ernest diese Musikalität seiner Mutter zu verdanken. Ebenso seinen Kunstsinn, denn es war Grace, die mit den Kindern, so oft es ging, nach Chicago fuhr und dort die Gemäldegalerie besuchte. Es gibt Bilder, die sich tief in sein Bewusstsein eingruben; besonders Kreuzigungen und Marterszenen der alten Meister hatten es ihm angetan. Der durch seine Mutter geschulte künstlerische Blick dürfte mit dazu beigetragen haben, dass Hemingway schnell den Wert der modernen Kunst erkannte, die ihm in seiner Pariser Zeit in den Museen und dem Salon Gertrude Steins unter die Augen kam. Obwohl selbst nur mit einem bescheidenen Budget ausgestattet, wurde er dort bald zum Sammler.
Wenn die Ehe der alten Hemingways Bestand hatte, dann wohl vor allem, weil die Gatten wussten, wann sie sich aus dem Weg zu gehen hatten. Dennoch war ihre Beziehung alles andere als platonisch: Die Hemingways hatten insgesamt sechs Kinder. Ernest war nicht das erstgeborene, aber der erste Junge. 1898 kam seine Schwester Marcelline zur Welt, die Mutter Grace nach ihrem Ebenbilde zu formen versuchte, dann anderthalb Jahre später Ernest.
Aus seinen frühen Kindheitsjahren stammen jene Episoden, die für Hemingway-Kritiker auf immer mit dem Image des Schriftstellers verbunden sein sollten und die nach ihrer Auffassung sein weiteres Leben prägten. Ernest hatte drei Schwestern. Die älteste, Marcelline, und Klein-Ernie wurden von ihrer Mutter aus einer Laune heraus wie Zwillinge behandelt. Marcelline wurde erst mit Ernest zusammen eingeschult, damit er in der Schule eine »gleichaltrige« Schwester hatte. Aber Zwilling zu sein bedeutete auch, dass die beiden dieselben Haarschnitte bekamen und dieselbe Kleidung trugen. Es gab also, wie auf Fotos dokumentiert, den jungen Hemingway mit Mädchenhaarschnitten und in Mädchenkleidern. Und es gab Momente, in denen die beiden »Zwillinge« wie Jungen ausstaffiert wurden, aber in Anbetracht Hemingways späterer Reputation interessierten sich seine Kritiker natürlich vor allem für die Mädchenphase. Es gibt sogar Biografen, die sich nicht zu schade sind zu erforschen, wie viele Jungen zu Hemingways Kindheitszeiten Mädchenfrisuren trugen. (Wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, kommen sie auf Werte von um die fünfzehn Prozent. Welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen, habe ich vergessen.)
Hemingways Verhältnis zu seinen Schwestern ist da schon interessanter. Für Marcelline empfand er eine herzliche Ablehnung. Und sie fühlte sich von ihm in seinen Geschichten zur Staffage erniedrigt und benutzt, weshalb sie sich später mit einem Buch über ihre Kindheit rächte, durch das sie den Spekulationen über emotionale Irrungen und sexuelle Verwirrungen im Hemingway’schen Heim noch weiteren Auftrieb gab. Das Verhältnis zu seiner jüngeren Schwester Ursula war wiederum so eng, dass einige Biografen hier sogar eine Tendenz ins Inzestuöse vermuteten.
Am spannendsten für alle Skribenten blieb jedoch das Verhältnis von Hemingway zu seiner Mutter. Einigkeit herrscht bei der Feststellung, dass diese Beziehung schlecht war, die Frage ist jedoch: wie schlecht und seit wann und warum? Fakt ist, dass er bei der ersten Gelegenheit aus dem Elternhaus entfloh und nur notgedrungen zurückkehrte. Spätere Briefwechsel und Aussagen anderer Familienmitglieder lassen vermuten, dass Hemingways Hauptvorwurf gegen seine Mutter lautete, sie habe seinen Vater in den Tod getrieben, aber das kann ihn in der Kindheit noch nicht wirklich beschäftigt haben. Und dass die Verkleidung als Mädchen ihn ein Leben lang so gekränkt haben soll …? Nachtragend war er schon, aber das scheint mir doch ein bisschen weit zu gehen, selbst wenn man in Rechnung stellt, dass der junge Ernest bereits ahnte, wie sehr sein Vater in der Ehe litt.
Der mütterliche Einfluss war zwar nicht nur negativ: Grace ermunterte ihren Sohn zum Träumen und Fantasieren, während der alte Doktor solche »Aktivitäten« in streng puritanischer Manier für schlichte Faulenzerei und Zeitverschwendung hielt. Wenn man aber davon ausgeht, dass Hemingway Junior schon ein ausgeprägtes Ego hatte und auch bald von einigem Sendungsbewusstsein durchdrungen war, dann könnten die Bemühungen der Mutter, ihn unbedingt nach ihrem Bilde zu formen, bei ihm unter dem Strich eine heftige Gegenreaktion hervorgerufen haben. Auch wenn er vieles von seinen Erzeugern hatte, er wollte auf keinen Fall so werden wie sie. Und was das Kind anstrebte, erfüllte seine Eltern mit Grauen. Wenn er ihnen seine Ambitionen, Journalist oder gar Schriftsteller zu werden, andeutete, müssen sie sich des Öfteren gefühlt haben, als hätten sie einen nach Unrat gierenden Dämon in die Welt gesetzt. Selbst mit der Publikation seiner ersten Erzählungen konnte Hemingway bei Grace und Clarence nicht landen. Als ihnen der stolze Filius über den Verlag Belegexemplare zusenden ließ, schickten die empörten Eltern die Bändchen prompt an das Verlagshaus zurück. Solchen Schmutz würden sie in ihren vier Wänden nicht dulden! Und auch sein erster richtiger Roman, Fiesta, wirkte auf sie wie ein Sittenbericht aus Sodom und Gomorrha.
Wenn große Schriftsteller in die Pubertät kommen, benehmen sie sich dabei oft genauso unbeholfen wie der Rest der Menschheit. Da sie berufsbedingt schon in früher Jugend dazu neigen, ihre Gefühle, Träume und Ängste zu notieren und später literarisch zu verwerten, hängt ihnen das ihr Leben lang nach. Als Hemingways Teenagerzeit begann, durfte er mit seinen Schwestern nicht mehr nackt schwimmen gehen. Seine ersten sexuellen Erfahrungen machte er mit einem Indianermädchen, was er bald darauf in seinen Nick-Adams-Stories auch literarisch verarbeitete. Schon der Jungautor Hemingway bemühte sich um den Eindruck, dass seine Texte auf absolut authentischen Erlebnissen beruhten. Ob diese Erfahrungen wirklich so intensiv waren wie diejenigen, die er seine Figur Nick machen ließ, sei dahingestellt. Einige wollen ganz genau wissen, dass er hier stark übertrieben hat, andere insinuieren gar, Hemingway wäre noch als Jungfrau in seine erste Ehe gegangen. Aber dass die Spekulationen bei diesem Thema ins Kraut schießen, dürfte mittlerweile nicht mehr überraschen. Und generell gilt: Ein Schriftsteller, der seine erotischen Erlebnisse nicht ausschmückt, ist so selten wie ein Politiker, der Wahlversprechen hält. Man sollte dem Autor also gerade in diesem Punkt seine dichterische Freiheit lassen.
Hemingway taugte in seinem frauendominierten Haushalt nicht zum Hahn im Korb, und jenseits der Familie war er alles andere als ein Schürzenjäger. Am liebsten hielt er sich unter Jungs auf, und wenn die ihn bewunderten, umso besser. Dank seiner humanistischen Bildung und dem sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits geförderten Waldläuferleben wusste er über viele Dinge eine Menge. Hinzu kam seine schnelle Auffassungsgabe. All das hätte eine attraktive Mischung ergeben können, aber es war Fluch und Segen des Hemingway’schen Stils (sowohl was sein Schreiben als auch seine Gesprächskultur betraf), dass er oftmals so auftrat, als sei der Begriff des »allwissenden Erzählers« (omniscient narrator) speziell für ihn geschaffen worden. Er konnte sich zu Themen nur äußern, wenn er dabei vorgab, alles – aber auch alles – über das Thema zu wissen.
In seiner Jugendzeit lernte Hemingway eine weitere große Liebe kennen: das Boxen. Er trainierte hart und viel, wenn auch seine Behauptung, dass er mit den Boxlegenden seiner Zeit im Ring gesparrt hätte, wohl selbst nicht viel mehr als eine Legende ist. Seine Kämpfe fanden meist bei ihm zu Hause statt – bezeichnenderweise und nicht frei von Symbolik im Musikzimmer seiner Mutter, welches er zu einem improvisierten Boxring umfunktionieren durfte. Trotz des kunstsinnigen und femininen Ambientes kam es hier zu einigen harten Auseinandersetzungen; Knock-outs und Nasenbluten auf Seiten des Gegners wurden mit Befriedigung zur Kenntnis genommen. Wie spätere Kontrahenten und Zaungäste übereinstimmend berichteten, war Hemingway kein großer Techniker und wollte es wohl auch gar nicht sein. Er kämpfte nach den Regeln der Straße. Kniestöße, Ellenbogenchecks und Schläge auf den Hinterkopf gehörten zu seinem festen Repertoire. Das klingt plausibel. Seine Sehschwäche und nicht unbedingt vorhandene Begabung zu koordinierten Bewegungen dürften verhindert haben, dass er zum eleganten Techniker wurde, aber das bedeutete nicht zwangsläufig, dass er kein echter Kämpfer sein konnte.
Als Ernest Hemingway seine Heimat mit achtzehn Jahren 1917 in Richtung Kansas City verließ, nahm er vor allem zwei Dinge mit: eine Liebe zu englischer Literatur, die frei von Humor und reich an Pathos war, und ein verquastes Rollenbild – Hass auf die Mutter, Mitleid und Verachtung für den Vater.
Es wäre Hemingway nicht unmöglich gewesen, dieses letzte Thema – wenn es ihn wirklich so sehr gequält hätte – literarisch zu verarbeiten und zu formulieren. Ganz am anderen Ende des emotionalen Spektrums in Sachen Mutter-Sohn-Beziehung steht D. H. Lawrence, und der hat seine eigenen Probleme ziemlich unverblümt im Roman Söhne und Liebhaber beschrieben. (Hemingway mochte dieses Buch übrigens sehr.)
In Söhne und Liebhaber heiratet eine sensible Frau aus der Mittelschicht einen saufenden Bergarbeiter und bereut diese Ehe bald zutiefst. Nachdem sie zwei Kinder verloren hat, beschließt sie, all ihre Hoffnung und ihre Liebe auf das dritte Kind (hinter dem sich mehr als erkennbar D. H. Lawrence selbst verbirgt) zu konzentrieren. Zwischen Mutter und Sohn entsteht ein Band, welches viel enger ist als das der beiden zum Vater. Jedoch wird so dem Sohn die Abnabelung von zu Hause erschwert. Jede potenzielle Freundin des Jungen wird von der Mutter weggeekelt, und als sie schließlich stirbt, bricht der Sohn zusammen, weil er sich allein als kaum lebensfähig erweist und sich vor der Freiheit und der Welt fürchtet.
Diese gefühligen Verwicklungen werden sehr offen, sehr anrührend geschildert – und doch (oder gerade deshalb?) interessiert sich dieser Tage keine Sau mehr für sie. Wenn D. H. Lawrence dem heutigen Lesepublikum noch ein Begriff ist, dann höchstens als Autor der gepflegten Ferkelei um Lady Chatterley und ihren Liebhaber.
Dem Dramatiker Anton Tschechow, der seinen Vater so sehr hasste, dass er zeitlebens keine vernünftige Männergestalt auf die Bretter seiner Bühne stellte, wurde dieses Defizit nie zum Vorwurf gemacht. Im Gegenteil. Ihn feiert man als sensiblen Schöpfer komplexer Frauenfiguren.
Und dass Hemingway gar nicht erst versucht hat, sich als sensibler Frauenversteher zu geben, dürfte – was seine Leserschaft betrifft – eine weitsichtige Entscheidung gewesen sein.
KANSAS CITY, HERE I COME
Nach der Schule sollte Hemingway aufs College. Nach Oberlin, wo auch seine Schwester Marcelline war und wo schon viele Familienmitglieder ihre Ausbildung erhalten hatten. Doch der junge Ernest hatte keinen Bock auf ein Leben im Elfenbeinturm. Er wollte zur Zeitung, als Reporter das »wahre« Leben einfangen. Was aus heutiger Sicht folgerichtig wirkt, war damals noch ein kühner Schritt. Der Ernest Hemingway, den die Welt noch nicht kannte, hatte zwar seine Englischlehrerin vergöttert und ein paar Artikel für die Schülerzeitung geschrieben, aber ansonsten hatte er kaum ahnen lassen, was für literarische Talente in ihm schlummerten. Der Wunsch, Schriftsteller zu werden, war zunächst einmal seinem puren Willen entsprungen; Indizien, die für eine besondere Veranlagung sprachen, finden sich in der Frühzeit schwerlich.
Nun wäre von Oak Park aus Chicago die nächstgelegene Stadt gewesen, in der er sich um einen Reporterposten hätte bemühen können, doch da kannte seine Sippe niemanden, während sie in Kansas City mit einem Holzhändler befreundet waren, und der hatte – Zeitungen wurden schließlich auf Papier gedruckt – einen Draht zur Lokalpresse. Also kam Ernest durch Vermittlung zu einer Stelle beim Kansas City Star. Für fünfzehn Dollar pro Woche wurde er als Lokalreporter auf Probe eingestellt. In seinen eigenen biografischen Erzählungen schrieb er, der Star sei damals eine der besten Zeitungen des Landes gewesen und genau aus diesem Grund habe er zu dem Blatt gewollt. Hier findet sich eine Art reflexartig generierter Superlativ, der sich in Hemingways Biografie noch mehrfach wiederholen sollte: Wenn er irgendwo hinging, dann nicht durch Zufall, sondern weil an jenem Ort zu jener Zeit gerade irgendwelche Entwicklungen kulminierten. Wo Hemingway auftauchte, war das Drama nicht fern. Zumindest hatte er überhaupt nichts dagegen, wenn seine Leser diesen Eindruck gewannen.