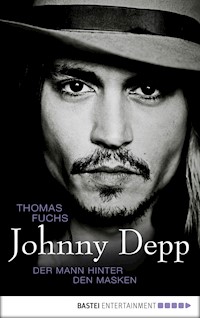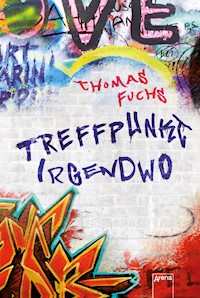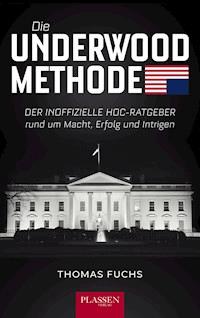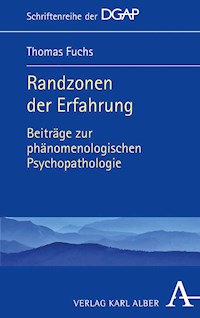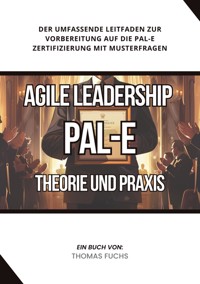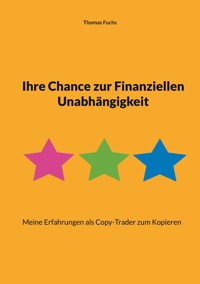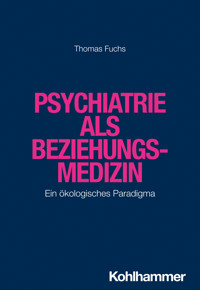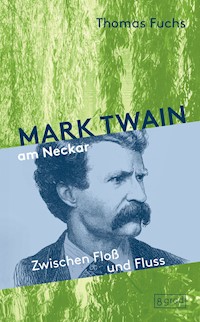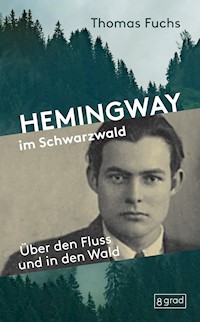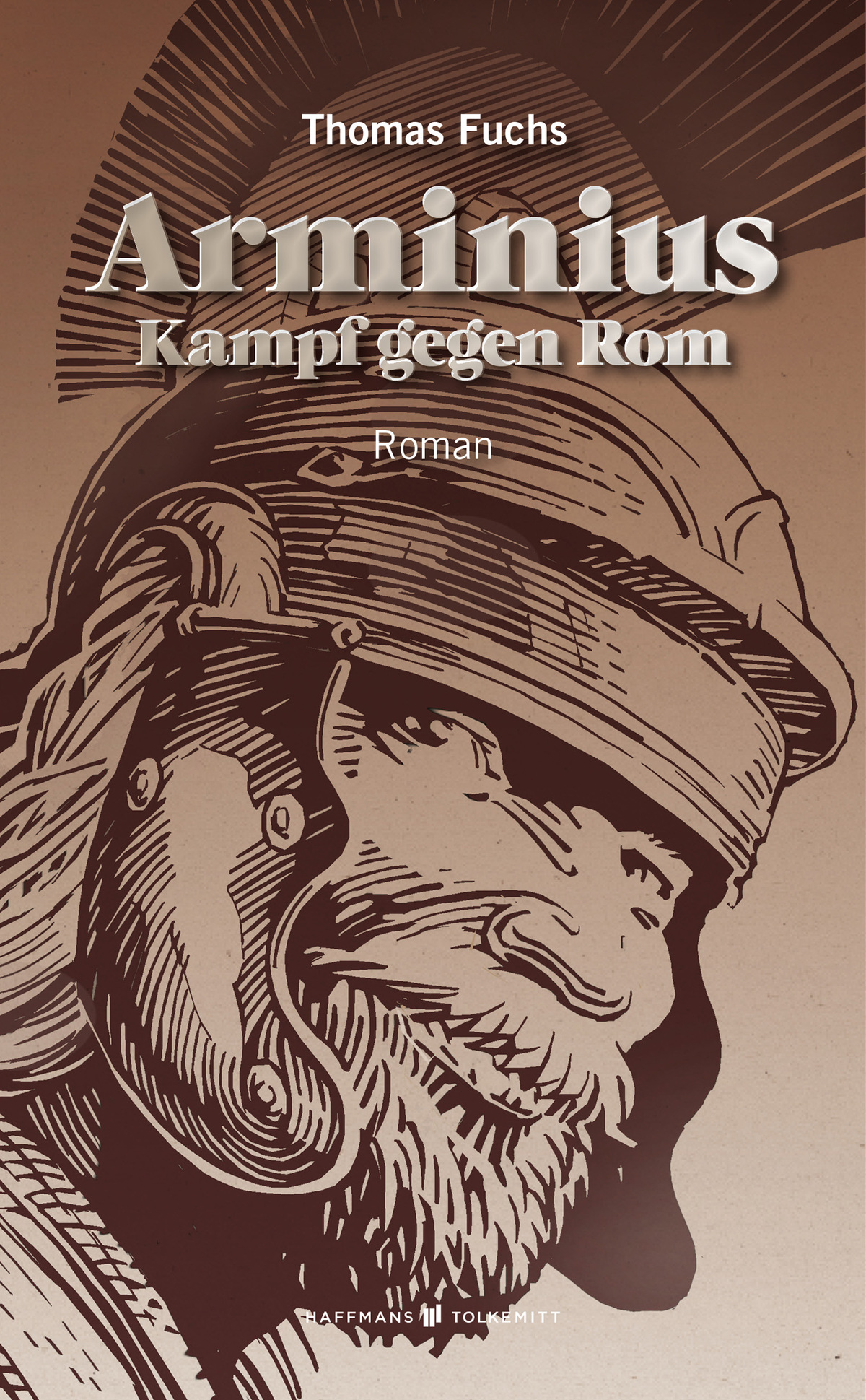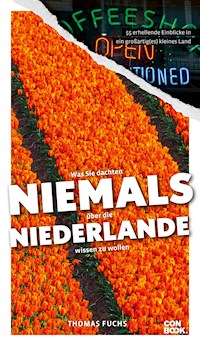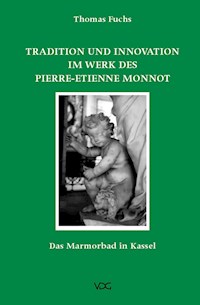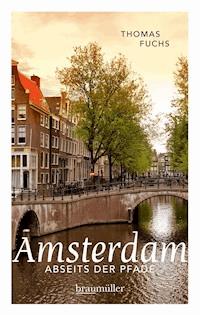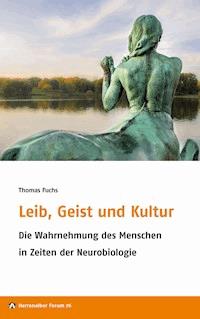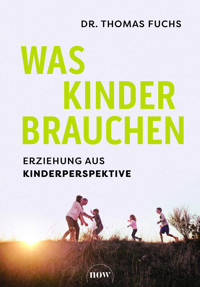
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Level Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch stellt alles auf den Kopf, was Sie als Erziehungsratgeber kennen: Es hilft uns, unsere Erziehung durch die Perspektive der Kinder zu betrachten, also der Menschen, für die sie ja bestimmt ist. Wenn wir wissen, wie sich unser Verhalten kurzfristig, aber auch mittel- und langfristig auswirkt, legt sich bei uns ein Schalter um, wir denken und leben den Umgang mit den Kindern anders. In diesem einzigartigen Buch begleitet uns Dr. Fuchs durch die gesamte Entwicklung unserer Kinder. In 9 Kapiteln mit zahlreichen Beispielen aus seiner jahrzehntelangen klinischen Erfahrung, schnürt Dr. Thomas Fuchs ein Care-Paket für Eltern und alle Erwachsenen, die mit Kindern leben oder arbeiten. Wie entwickeln wir Kinder, die in der Lage sind, allen Herausforderungen angstfrei und positiv zu begegnen, egal, ob es darum geht, alltägliche Hürden zu überwinden oder Planeten Erde zu einem besseren und menschlicheren Ort zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
DR. THOMAS FUCHS
WAS KINDER BRAUCHEN
ERZIEHUNG AUS KINDERPERSPEKTIVE
DR. THOMAS FUCHS
WAS KINDER BRAUCHEN
ERZIEHUNG AUS KINDERPERSPEKTIVE
Wichtiger Hinweis
Die im Buch veröffentlichten Empfehlungen wurden von Verfasser und Verlag erarbeitet und geprüft. Der Inhalt dieses Buches beruht ausschließlich auf den persönlichen Erfahrungen des Autors und erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Die benutzten Begrifflichkeiten sind wertfrei. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Ebenso ist die Haftung des Verfassers bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen. Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors nicht zulässig. Das gilt gleichermaßen für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Verfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Falls die Publikation Links zu externen Webseiten Dritter enthält, haben wir auf deren Inhalte keinen Einfluss; für diese fremden Inhalte können wir keine Gewähr übernehmen. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung nicht erkennbar.
Auch wenn eine gendergerechte Sprache wünschenswert ist, gibt es aus Sicht des Verlages bisher keine befriedigende, gut lesbare Lösung. Der leichten Lesbarkeit zuliebe haben wir des Öfteren von der Doppelung männlicher und weiblicher Formen Abstand genommen. Selbstverständlich liegt es uns fern, dadurch einen Teil der Bevölkerung zu diskriminieren.
1. Auflage
© 2025 NOW – ein Imprint des NEXT LEVEL Verlags,
NXT LVL GmbH, An der Dornwiese 2, 82166 Gräfelfing
www.next-level-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Redaktion: Bettina Birk
Redaktionelle Mitarbeit: Stephanie Ehrenschwendner
Satz: inpunkt[w]o, Wilnsdorf
Korrektorat: Christiane Geldmacher
Cover- und Umschlaggestaltung: buxdesign | Daniela Hofner
Bildnachweis: Stocksy.com (Rob und Julia Campbell)
Illustration S. 204: diceindustries
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print: 978-3-68969-036-6
ISBN E-Book (PDF): 978-3-68969-037-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi): 978-3-68969-038-0
Inhalt
VORWORT
BEVOR ES LOSGEHT
1 • BINDUNG
WARUM KINDER BEI DER WAHL IHRER ELTERN NICHT VORSICHTIG GENUG SEIN KÖNNEN
2 • JUNGEN UND MÄDCHEN
UNSERE GESELLSCHAFT BRAUCHT BEIDE FÜR DAS GANZE POTENZIAL
3 • NEURODIVERSITÄT
FAMILIE IST DER BEWEIS, DASS MAN AUCH MIT MENSCHEN AUSKOMMEN KANN, DIE MAN SELTSAM FINDET
4 • KONSEQUENZ
DEMOKRATIE DARF NICHT SO WEIT GEHEN, DASS IN DER FAMILIE ABGESTIMMT WIRD, WER DIE ELTERN SIND
5 • PUBERTÄT
ÜBER DIE KUNST, EINEN KAKTUS ZU UMARMEN
6 • RESILIENZ
WIR KÖNNEN NICHT VERHINDERN, DASS KINDER INS WASSER FALLEN, ABER WIR KÖNNEN IHNEN DAS SCHWIMMEN BEIBRINGEN
7 • MEDIENKONSUM
VON MIR AUS NENNT ES WAHNSINN
8 • NACHHALTIGKEIT UND SOLIDARITÄT
LEBEN WIE EIN BAUM, EINZELN UND FREI, ABER BRÜDERLICH WIE EIN WALD
9 • GLEICHGEWICHT UND LANGSAMKEIT
WEIL ES GESUND IST, HABE ICH BESCHLOSSEN, GLÜCKLICH ZU SEIN
NACHWORT
Für DAHAMAPA
VORWORT
Als Verhaltenstherapeut schätze ich das ganzheitliche Vorgehen meines Kollegen Dr. Thomas Fuchs. In seinem Buch »Was Kinder brauchen« bringt er Eltern die einzigartige Gedanken- und Gefühlswelt ihres Kindes näher, so dass sie ihm in ihrer Haltung wie in ihrem Verhalten verständnisvoller und förderlicher begegnen können. Gleichzeitig hilft er den Eltern, auf die Probleme und Sorgen ihrer Kinder einfühlsam einzugehen. Das Buch trägt also einerseits zu einem besseren Verständnis der Kinderwelt bei, andererseits bekommen Eltern ganz praktische Anleitung zu einer liebevollen und konsequenten Förderung ihres Nachwuchses.
Ich habe Thomas Fuchs nicht nur als einen Kinderflüsterer kennen gelernt, sondern auch als engagierten Anwalt der Kinder. Im Grundton seiner Arbeit schwingt immer ein tiefes Verständnis für die einzigartigen Kinderwelten mit. Seine sensiblen und einfühlenden therapeutischen Hilfen gründen auf einem reichhaltigen Erfahrungsschatz als Therapeut.
Vor einigen Jahren haben wir zusammen das Buch »Familienglück« geschrieben, in dem die Eltern auch im Kontext meines Selbstentwickler-Konzeptes im Fokus der Beratung standen. »Erziehung aus Kinderperspektive« bezieht sich nun darauf, wie sich Eltern auch in herausfordernden Zeiten tiefer in das Universum der Kinder einfühlen können und wie sie ihre Einzigartigkeit und ihren Umgang damit von einem Wissenden überzeugend vermittelt bekommen. Erziehung beginnt bei den Eltern, hört jedoch dort nicht auf. Diesem Leitsatz folgend versäumt es Thomas Fuchs auch nicht, aufzuzeigen, welchen Einfluss Eltern mit ihrer Haltung und ihrem Verhalten auf zukünftige Generationen, auf die Gesellschaft und auf die Welt nehmen können. Denn im gelungenen Umgang mit ihren Kindern legen sie den Samen, um unseren Planeten zu einem besseren Ort zu machen.
Ich wünsche dem Autor eine nachhaltige Wirkung mit seinem Werk. Und Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wünsche ich, dass es Ihnen gelingt, über eine neue Haltung die Beziehung zu Ihren Kindern zu festigen.
Herzlichst
Jens Corssen
BEVOR ES LOSGEHT
Es sind etwa 9,5 Millionen Minuten, bis ein Kind 18 Jahre alt ist. Meinem Eindruck nach sind einige dieser Minuten für Eltern nicht besonders angenehm.
Kürzlich las ich eine Umfrage, nach der 52 Prozent aller Mütter im ersten Jahr nach der Geburt ihres Kindes das Gefühl haben, mit ihrem Baby zu versagen. Das erinnerte mich an eine Untersuchung des Nobelpreisträgers Daniel Kahnemann, in der er tausend Amerikanerinnen nach jenen Alltagstätigkeiten befragte, die sie am glücklichsten stimmten. Auf Kinder aufpassen landete dabei abgeschlagen im hinteren Teil einer Liste von Tätigkeiten, noch hinter Verrichtungen wie Einkaufen, Kochen und Telefonieren. Das heißt, Mütter schälen lieber Zwiebeln und machen den Abwasch, als Zeit mit ihren vermeintlichen Glücksbringern zu verbringen.
Als klinischer Kinder- und Jugendpsychologe mit einer Zusatzausbildung in Verhaltenstherapie sowie systemischer Familientherapie beschäftige ich mich seit über 30 Jahren mit Kindern und Jugendlichen, zuerst in einer Großklinik und seit 25 Jahren nunmehr in eigener Praxis. In meiner täglichen Arbeit erlebe ich schlimme Geschichten: Missbrauchte und misshandelte Kinder, Sucht und Gewalt in Familien, Folgen schwerster Verletzungen nach Unfällen, Naturkatastrophen, Kriegen oder Amokläufen. Ich begleite Kinder und Jugendliche in emotionalen Krisen, bei Angst- und Panikstörungen, Depressionen und bei Problemen mit der Identitätsentwicklung. Scheidungskriege, Hass und Abwertung sind genauso Herausforderungen in meinem Alltag wie Essstörungen, Zwangsstörungen oder Störungen des Sozialverhaltens, oft begleitet von Aggression und Selbstzerstörung.
Trotzdem möchte ich mit niemandem tauschen, denn ich habe meine Berufung gefunden. Es fällt mir fast immer leicht, jeden Tag aufs Neue zu versuchen, die Welt der Kinder und Familien zu verbessern. Ich glaube an die Wissenschaft als beste Methode, der Wahrheit näher zu kommen. Aber in meinem Selbstverständnis bin ich Kinderversteher und Kinderflüsterer. Ich bin überzeugt: Nur wer die Welt aus den Augen eines Kindes sehen und verstehen kann, wird ihnen (besser) helfen können.
Der Planet Erde, die Gesellschaften und Kulturen befinden sich in einer Krise. Es hat sich bei Groß und Klein ein Ohnmachtsgefühl gegenüber den komplexen Herausforderungen, vor denen wir stehen, breit gemacht. Kinder werden dabei häufig übersehen. Bemerkenswert ist die norwegische Regierungschefin Erna Solberg, die am Anfang der Coronakrise im April 2020 bei einer Pressekonferenz eine halbe Stunde lang die Fragen der Kinder aus dem ganzen Land beantwortete. Und sich später bei den Kindern für ihre Mitwirkung bedankte, weil sie nicht allein auf das Land achtgeben könne. Politiker sieht man sonst eher bei der Eröffnung einer neuen Produktionsstätte eines Automobilkonzerns als in der Kita bei verzweifelten Erzieherinnen, die den Kindern nicht gerecht werden können, weil sie personell unterbesetzt sind. Dass der Staat eine gestörte Beziehung zu seinen Kindern hat, sieht man daran, dass die Menschenrechtskommissarin des Europarats, das Bundesverfassungsgericht und der Ethikrat alle die Kinderrechte in einem zivilisierten Land, mitten in Europa, nicht gewährleistet sehen. Kinder werden selten gefragt, Regelungen werden aus der Perspektive der Erwachsenen gedacht. Immer wenn ich das feststelle, würde ich am liebsten mit Erich Kästner antworten: »Lasst euch die Kindheit nicht austreiben! Schaut, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die es nicht mehr gibt. Ihr Leben kommt ihnen vor wie eine Dauerwurst, die sie allmählich aufessen, und was gegessen worden ist, existiert nicht mehr.«
In der Klimadebatte begegnet man oft der Frage, welche Welt wir den Kindern hinterlassen. Aber ist für die Zukunft von Familie, Gesellschaft, ja, der ganzen Welt nicht noch wichtiger zu fragen: Welche Kinder hinterlassen wir der Welt?
Astrid Lindgren, die bekannte und von mir verehrte schwedische Kinderbuchautorin, sagte 1978 in ihrer Dankesrede bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, dass auf der Welt alle Frieden wollten. Schon damals äußerte sie die tiefe Überzeugung, dass man dafür von Grund auf beginnen müsse: bei den Kindern. »Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen Menschen mit Sinn für das Gemeinwohl heranwächst«, heißt es in ihrer Rede, »oder aber zu einem gefühlskalten, destruktiven, egoistischen Menschen, das entscheiden die, denen das Kind in dieser Welt anvertraut ist, je nachdem, ob sie ihm zeigen, was Liebe ist, oder aber dies nicht tun (…) Sollte das Kind wider Erwarten eines Tages doch zu diesen Mächtigen gehören, dann ist es für uns alle ein Glück, wenn seine Grundhaltung durch Liebe geprägt worden ist und nicht durch Gewalt. Auch künftige Staatsmänner und Politiker werden zu Charakteren geformt, noch bevor sie das fünfte Lebensjahr erreicht haben – das ist erschreckend, aber es ist wahr.« Und Lindgren resümiert: »Ich glaube, dass Erziehung Liebe zum Ziel haben muss.«
Die Dankesrede, bald 50 Jahre alt, scheint in ihrem Inhalt wirkungslos verhallt, obwohl mir in meiner ganzen Berufslaufbahn keine klügeren Worte zum Thema Erziehung begegnet sind. Für eine positive Veränderung in der Welt wurde bisher nie bei den Kindern angesetzt.
Für mich ist Lindgrens Haltung so überzeugend, dass ich seit 30 Jahren versuche, sie zu leben – beruflich als Kinder- und Entwicklungspsychologe und privat als Vater von drei mittlerweile erwachsenen Töchtern. Bei meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen folge ich stets der Überzeugung: Wenn wir eine positive Welt schaffen wollen, geht das nur über die Erziehung unserer Kinder. Ein besseres menschliches Zusammenleben, eine positive Entwicklung der Welt funktionieren nur, wenn wir lernen, Kinder in ihrer Entwicklung so zu begleiten, dass diese die Welt als Bürgerinnen und Bürger der Zukunft eher verbessern als verschlechtern. Deshalb kann ich dem israelischen Historiker Yuval Noah Harari nur zustimmen, wenn er in seinem Buch »21 Lektionen für das 21. Jahrhundert« schreibt: »Möglicherweise müssen wir einen Schalter in unserem Kopf umlegen und anerkennen, dass Kindererziehung vermutlich die wichtigste und herausforderndste Tätigkeit dieser Welt ist.«
Ich bin ein Mensch mit Zuversicht und will mich nicht beschweren. Ich entscheide mich stets für Optimismus: Es geht uns besser, als wir denken. Wir sind gesund, gebildet und unsere Welt ist weniger arm als noch vor 100 Jahren. Wenn Sie es nicht glauben, schauen Sie auf der Online-Plattform »Our world in data« des deutschen Ökonomen und Statistikers Max Roser nach.
Denkt positiv und vom Kind her – das ist meine Botschaft und ein Vermächtnis meines kinderpsychologischen Berufslebens. Dieses Buch ist die Zusammenfassung meines Wissens und meiner Erfahrungen, aufbereitet in einem Carepaket aus neun Kapiteln für Eltern, die das Glück ihrer Kinder, ihrer Familie und letztendlich der Welt vermehren wollen. Dafür braucht es gar nicht so viel, wie die meisten annehmen: Interesse am und Verständnis für das Kind. Die Fähigkeit, in die Welt des Kindes einzutauchen. Die Bereitschaft, eine zuverlässige Bindung zum Kind aufzubauen, die alles in der weiteren Entwicklung und Erziehung leichter macht. Und vor allem die Entschlossenheit, eine gesunde Entwicklung des Kindes in den Mittelpunkt zu stellen.
Es ist eine völlig neue Art eines Erziehungsbuches: Es denkt die Welt vom Kind her. Mit erhellenden Stories von Levin, Sven, Sophia, Tom und vielen anderen, psychologischem Know-how, Tipps und Tricks aus meiner täglichen Praxis führe ich Sie an die Grundlagen einer gelingenden Eltern-Kind-Beziehung heran, die auch geprägt ist vom normalen Wahnsinn auf der Achterbahnfahrt des familiären Lebens. Die Zielsetzung dieses Buches sind nicht perfekte, sondern hinreichende Eltern und eine bessere Teamleistung in der Familie. Es geht darum, wie Sie Ihrem Kind helfen können, das passende Leben zu finden.
Sie können nachlesen, wie sich Jungs und Mädchen unterscheiden, warum jedes Kind neurodivers ist und wie Sie am besten mit den nicht mehr wegzudenkenden digitalen Medien in Ihrer Familie umgehen. Vielleicht fiel Ihnen lernen leicht, weil Sie hochbegabt sind. Falls es Ihr Kind nicht ist und Schulbücher hasst, können Sie herausfinden, warum die Statistik etwas dagegen hat, dass Ihr Kind wie Sie werden muss, und warum falsche Erwartungen im Umgang mit dem Nachwuchs bestraft werden. Erkunden Sie, wie Sie Solidarität und Autonomie Ihres Kindes fördern und zu einem Menschen erziehen, der zur Nachhaltigkeit in der Welt und zum Schutz des Planeten beiträgt. Wie Ihr Kind leistungsfähig wird, ohne Genussverhalten zu verlernen. Weil sich unsere Welt immer schneller dreht, sollten Kinder in ihrer Familie auch lernen, mal auf die Bremse zu treten, für ein unverkrampftes Leben. Denn es kommt am Ende nicht mehr Saft aus einer Zitrone, weil man mehr presst.
Und falls Ihre Kinder schon größer sind, erfahren Sie, dass es nie zu spät ist, Ihren Sohn oder Ihre Tochter besser zu verstehen und ihnen zu helfen, widerstandsfähig und belastbar zu werden, auch während der Pubertät. Niemand ist perfekt! Und alle Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind. Dennoch gibt es Erziehungsfehler, die das Glück der Kinder und Eltern schmälern und die sich leicht vermeiden lassen. Wenn man weiß, wie.
Durch das ganze Buch verteilt finden sich immer wieder Infokästen. Darin spricht ein Kind stellvertretend für alle Kinder direkt mit dem Leser und wird manchmal unterstützt von Dr. Fuchs, der Tipps zu den einzelnen Sachverhalten gibt. Mit den Kästen sollen Themen besonders anschaulich und klar beleuchtet und dem erwachsenen Leser die Kinderperspektive verdeutlicht werden. Diese Methode soll Erwachsene unterstützen, aus Kinderaugen auf ihr Erziehungsverhalten zu blicken und dasselbe zu überdenken.
Ich möchte Sie mit einem zuversichtlichen Buch unterstützen und ermutigen: Ihr Kind ist nicht Ihr letzter Sargnagel, sondern immer eine Entwicklungschance, auch für Sie selbst.
Kinder sind die Saat der Zukunft. Lassen Sie den Samen wachsen, bei allen Ihnen anvertrauten Kindern. Egal, ob Sie Eltern, Großeltern, Pädagoginnen und Pädagogen, Erzieherinnen und Erzieher oder Spielpartnerinnen und Spielpartner eines Kindes sind – haben Sie Spaß beim Lesen und im Leben mit Kindern. Wenn Sie es schaffen, einiges des Geschriebenen in Ihren Alltag mit Kindern einfließen zu lassen, hätte ich viel erreicht.
1
BINDUNG
WARUM KINDER BEI DER WAHL IHRER ELTERN NICHT VORSICHTIG GENUG SEIN KÖNNEN
Das Fundament von Erziehung
Vor Jahren kam einmal eine sympathische Mutter mit ihrer Dreijährigen in meine Praxis und sagte: »Meine Tochter folgt nicht. Was stimmt nicht mit ihr?« Im Gespräch stellte sich heraus, dass diese Mutter nach der Geburt unter einer länger anhaltenden postnatalen Depression gelitten hatte. Der sogenannte Babyblues, wie die Wochenbettdepression auch genannt wird, geht einher mit Stimmungstiefs und einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Die betroffenen Mütter können sich ein paar Wochen lang oder auch ein halbes Jahr nicht über ihr Baby freuen. Die Wissenschaft geht davon aus, dass das maximal 15 Prozent der Mütter passiert. Aus meiner praktischen Erfahrung als Kinder- und Entwicklungspsychologe weiß ich allerdings, dass das eher öfter vorkommt. Denn leider schämen sich die Mütter häufig für ihre dunklen Gefühle und lassen sich nicht helfen. Dabei wäre eine Unterstützung so wichtig, nicht nur, damit es der Mutter selbst besser geht, sondern damit sie die lebensnotwendige tiefe Bindungsbeziehung zu ihrem Neugeborenen aufbauen kann.
Im eingangs erwähnten Beispiel war kein Grundvertrauen entstanden. Das Kind hatte als Baby die Signale seiner Mutter nicht empfangen und weder gelernt, sich auf sie zu verlassen, noch zuverlässig auf sie zu hören. Für den Psychologen liegt demzufolge eine Bindungsstörung vor, entstanden in den ersten zwei Lebensjahren des Kindes, weil die Mutter nicht adäquat auf die Grundbedürfnisse des Säuglings eingehen konnte. Je gravierender diese Störung, desto schwerer ist sie behebbar. Das ist aber nur selten der Fall, etwa wenn ein drogensüchtiger Elternteil das Kind nächtelang allein gelassen hat.
Die gute Nachricht: Die Bindungsbeziehung zwischen Eltern und Kindern ist nie abgeschlossen. Die sogenannte Nachbeelterung funktioniert. Und es ist in jeder Phase der Erziehungszeit möglich, eine tiefere Bindung zum eigenen Kind aufzubauen.
NACHBEELTERUNG
»Liebe Eltern, ihr seid toll und ich hab euch lieb, aber ich fühle mich oft unverstanden und deswegen weit weg von euch. Das mit unserer Bindung hat nicht immer gut geklappt.«
Nachbeelterung beschreibt eine therapeutische Methode, die bindungsgeschädigte Kinder und Jugendliche gezielt die nachträgliche Fürsorge zukommen lässt, die in der Vergangenheit in der Eltern-Kind-Beziehung nicht gewährleistet war. Vergangene Beziehungserfahrungen sollen korrigiert werden, indem bedingungslose Annahme und Wertschätzung sowie Aufdeckung und Entwicklung von Ressourcen erfolgt. In Therapien erledigen dies Therapeutinnen und Therapeuten. Ein Elternteil kann genauso wahrnehmen, was ein Kind braucht und wonach es sich sehnt, und dieses Bedürfnis befriedigen oder das Kind unterstützen, dieses Bedürfnis selbst zu erkennen und zu befriedigen.
Wie ging es mit der Mutter weiter, deren postnatale Depression sich auf die Beziehung zu ihrem Kind ausgewirkt hatte? Ich erarbeitete mit ihr, was die Kleine braucht: Zuverlässigkeit, Sicherheit, Verbindlichkeit und die Bereitschaft, nicht aus der Beziehung zu gehen, sobald sie Probleme macht. Die Leitsätze lauten: Mein Kind darf schwierig sein, ich liebe es trotzdem. Das Verhalten meines Kindes ist ungünstig, aber als Person ist mein Kind völlig okay. Mit dieser Haltung gelang es der Mutter nach und nach, ein engeres Verhältnis zu ihrer Tochter aufzubauen. Sie lernte, adäquat auf sie zu reagieren, und bemerkte in nur wenigen Wochen einen Unterschied im Verhalten ihres Kindes.
Was ist Bindung eigentlich genau? Der Begriff steht für eine innige emotionale Beziehung zwischen zwei Menschen, in unserem Fall zwischen Eltern und Kind. Je verbundener sich ein Kind fühlt, desto eher sucht und findet es im Falle von Gefahr, Angst, Irritation oder Schmerz bei seinen wichtigsten Bezugspersonen Beruhigung und Schutz. Das Bedürfnis nach Zuwendung und Geborgenheit bewerten Entwicklungspsychologen als weitaus größer als das nach Nahrung. Die Liebe der Eltern trägt das Kind durchs Leben.
Hey, Eltern, Bindung zu euch ist für mich die Trainingsmatte, auf die ich falle, wenn ich das Leben übe.
Die ersten Bindungen geht das Neugeborene mit den Menschen ein, zu denen es den intensivsten Kontakt in den ersten Lebensmonaten hat – und das ist naturgegeben zumeist die Mutter. Sie trägt das Kind im Mutterleib aus und stillt es eine Zeit lang nach der Geburt. Das soll aber nicht heißen, dass Väter keine enge Bindung zu ihrem Neugeborenen aufbauen können. Darauf werde ich etwas später noch genauer eingehen. Wenn ich also zunächst häufiger von Müttern als von Vätern spreche, möchte ich nicht einen Elternteil ausnehmen, sondern eher auf die Mehrheit der Familien eingehen, in denen die Mutter aus genannten Gründen in den ersten Lebensmonaten die engste Bezugsperson ist.
Die Bindungsforschung lehrt uns, dass ein Säugling zum Überleben auf eine Beziehung angewiesen ist, die über die rein körperliche Versorgung hinausgeht. Es reicht nicht, dass sich die Eltern allein um die körperlichen Bedürfnisse des Kindes wie essen und trinken kümmern. Babys haben von Geburt auch elementare seelische Bedürfnisse, die von ihren Bezugspersonen gestillt werden müssen.
DIE VIER SÄULEN DER BINDUNGSBEZIEHUNG ZWISCHEN ELTERN UND KIND
Das sind die wichtigsten Stützpfeiler, die ich von meinen Eltern brauche:
Sicherheit: Entwicklung im geschützten Raum möglich machen
Zuwendung: Emotionale Wärme geben
Unterstützung: Entwicklungsfortschritte wohlwollend begleiten
Stressreduktion: Ruhe und Besonnenheit ausstrahlen
Anna war sechs Jahre alt, als man sie 1938 in Pennsylvania fand, wo sie ihre früheste Kindheit unter abscheulichen Umständen eingesperrt verbracht hatte. Sie war nahezu verhungert, völlig apathisch, ausdruckslos, bewegungs- und aufmerksamkeitsunfähig. Im Laufe des ersten Jahres nach ihrem Auffinden lernte sie nur mühsam, ein paar Schritte zu gehen, sich einigermaßen sauber zu halten und alleine an- und auszuziehen. Sie konnte den Sinn einfacher Aufforderungen verstehen und nach zwei weiteren Jahren fing sie an, wie ein Baby zu lallen. Ein weiteres Jahr später rief sie die Menschen, die sie betreuten, beim Namen. Dazwischen waren aber vier Jahre vergangen, während der sie gelernt hatte, diese Menschen überhaupt als Betreuungspersonen wahrzunehmen. Es dauerte noch ein weiteres Jahr, bis sie einfache Wünsche mit simplen Sätzen ausdrücken konnte. Im Alter von neun Jahren hatte Anna in ihrer Sprachentwicklung das Niveau eines zweijährigen Kindes erreicht. Sie starb 1942 im Alter von zehn Jahren.
Isabell aus Ohio machte nach ihrem Auffinden und ihrer Befreiung aus ihrem Kindheitsgefängnis eine etwas bessere Entwicklung durch. Schon nach einer Woche bildete sie Laute, nach zwei Monaten erste Sätze, nach neun Monaten erzählte sie Geschichten und hatte bald einen Wortschatz von etwa 2.000 Wörtern. Dies befähigte sie, kompliziertere Fragen zu stellen. Sie entwickelte Freude am Erkunden und schien ein normales Kind geworden zu sein: klug, fröhlich und unternehmungslustig. Isabell war aber, anders als Anna, nicht gänzlich ohne Sozialkontakte in ihrem Gefängnis gewesen. Man hatte sie nicht allein, sondern zusammen mit ihrer taubstummen Mutter eingesperrt. Die beiden hatten sich mit einer selbstentwickelten Zeichensprache verständigt, so dass Isabell zwar ohne Lautsprache, aber nicht ohne menschlichen Kontakt und soziale Kommunikation aufgewachsen war. Die emotionale Zuwendung durch die taubstumme Mutter war offenkundig entscheidend für Isabells weitere Entwicklung und ihre enormen Lernfortschritte in allen Entwicklungsbereichen nach ihrer Befreiung.
Solche Geschichten von sogenannten wilden Kindern gibt es seit dem 14. Jahrhundert in etwa fünfzig wissenschaftlich belegten Fällen. Sie wurden zumeist als Findelkinder ausgesetzt, einige von ihnen von Tieren adoptiert, wie beispielsweise Kamala und Amala, die man 1920 in einer Wolfshöhle in Indien im Alter von neun und zwei Jahren fand. Gemäß der wissenschaftlichen Entwicklungsdokumentation des deutschen Psychologen Arnold Gesell lief Kamala anfangs auf allen Vieren und lernte erst nach drei Jahren, ohne Hilfe auf zwei Beinen zu stehen. Sobald sie es eilig hatte, ließ sie sich immer wieder auf alle Viere hinab. Anfangs mochte sie sich nicht waschen, auch Hitze und Kälte spürte sie kaum. Ihre Nahrung schlürfte sie nur aus Schalen am Boden und am liebsten aß sie rohes Fleisch, auch Aas, das sie schon von weitem roch. Sie stürzte sich gern auf Vögel, um sie zu verschlingen. In der Dunkelheit sah sie vorzüglich, strich nachts furchtlos draußen umher und stieß dabei regelmäßig einen schrillen Warnruf aus. Tagsüber lag sie eher teilnahmslos in einer Ecke. Kamala war die erste Zeit nach ihrem Auffinden sehr menschenscheu, sie kratzte, biss und musste häufig gezähmt werden. Zunehmend ließ sie jedoch ihre Betreuerinnen an sich heran. Sie begann, Kontakte zu knüpfen. Nach zwei Jahren sagte sie schließlich ein einfaches Wort, wenn sie Durst hatte. Nach vier Jahren verstand sie den Sinn von Fragen und verwendete selbst sechs Wörter. Nach sechs Jahren verfügte sie über ein aktives Vokabular von dreißig Wörtern. Auch wenn dies einer massiven Sprachentwicklungsverzögerung entspricht, hatte es Kamala immerhin weiter als die meisten wilden Kinder gebracht.
Warum erzähle ich Ihnen das? Weil die grausamen Umstände, unter denen Kinder wie Anna oder Kamala die erste Zeit ihres Lebens fristeten, nicht nur Einschränkungen in der Sprachentwicklung nach sich zogen, sondern massivste Defizite im Sozialverhalten. Aufgrund der Entbehrung menschlichen Umgangs konnten sich diese Kinder nicht zu gebundenen und autonomen Wesen entwickeln, sondern blieben in vielerlei Hinsicht verhaltensgestört. Bindung ist also eine elementare Lebensvoraussetzung. Ohne soziale Kontakte zu Bezugspersonen, ohne deren Zuwendung, Wärme und Geborgenheit, kann aus einem Säugling keine selbstbestimmte Persönlichkeit werden. Im Gegenteil: Ein Kind stirbt im schlimmsten Fall, wenn es nur zu essen und trinken bekommt, weil es seelisch verhungert.
Glücklicherweise treffen in unserer heutigen Gesellschaft die seelischen Grundbedürfnisse eines Kindes in der Regel auf eine hohe Pflegebereitschaft der Eltern, die für das Wohlbefinden ihres Säuglings sorgen und seine Entwicklung fördern wollen.
MEINE WICHTIGSTEN SEELISCHEN GRUNDBEDÜRFNISSE, DIE IHR ALS ELTERN VERSTEHEN MÜSST
Selbstwert. Erfolgserlebnisse haben, etwas gut können und lernen, nicht überall der/die Beste sein zu müssen.
→ »Ich will auch was gut können.«
Bindung. Eine zuverlässige Beziehung zu den Eltern haben, später zu Freunden.
→ »Ich will mich angenommen fühlen, auch wenn ich mich mal nicht so toll verhalte.«
Kontrolle/Autonomie. Die Sicherheit entwickeln, dem Leben nicht ausgeliefert zu sein und etwas bewirken zu können.
→ »Ihr sollt mir auch was zutrauen, ich kann schon manches.«
Lustgewinn. Spaß haben dürfen und sich nicht immer nur anstrengen zu müssen.
→ »Ich mach schon, aber ich brauche auch mal Spaß.«
Das Phänomen einer fehlenden oder mangelnden Bindungsbeziehung lässt sich auch in manchen Patchwork-Familien beobachten. Zieht beispielsweise eine Frau mit ihrem Partner zusammen, der drei Kinder hat, die tageweise bei ihnen wohnen, kann es zu Konflikten kommen. Etwa, weil die Kinder einige der Regeln, die die neue Frau des Vaters in ihrem Zuhause aufgestellt hat, nicht befolgen. Sagen wir, die Kinder ziehen wiederholt die Schuhe nicht an der Tür aus, sondern laufen mit ihren dreckigen Sneakern über den hellen Teppich. Sie wiederholt die Regel und schimpft irgendwann.
»Die hat uns gar nichts zu sagen«, reagieren die Kinder. »Die ist doch nicht unsere Mutter.«
Meist ist in solchen Fällen nicht die Missachtung der Regel das wirkliche Problem, sondern eine fehlende oder gestörte Bindungsbasis. Ein Haus lässt sich ja auch nicht auf Sand bauen, es braucht ein Fundament. Gelingt es der Frau, eine echte und enge Beziehung zu den Kindern aufzubauen, was nicht von gestern auf heute passiert, fordern sie nach meiner Erfahrung sogar Ratschläge, Tipps und auch Grenzen von dem »neuen« Bezugsmenschen ein.
Eine Bindungskultur in der Familie anlegen
In meiner Arbeit suchen Eltern oft Rat, weil ihr Baby nicht richtig isst oder viel schreit. Sie sind regulationsgestört, wie die Entwicklungspsychologie das nennt. Ich mache dann meist als Erstes einen Hausbesuch zur Verhaltensbeobachtung. Nicht selten erlebe ich, dass die Mütter im Zusammensein mit dem Kind oder beim Stillen ihr Baby gar nicht mehr im Blick haben. Sie sitzen mit dem Kind im Arm auf dem Sofa, schauen fern oder checken ihre Social-Media-Kanäle auf dem Handy. Dabei merken sie oft gar nicht, dass das Kind den Kontakt sucht und plötzlich weint, weil es keine Reaktion bekommt. In dem Moment haben die Mütter eine engere Bindung zu dem genutzten Gerät als zu ihrem Kind. Allein ihre Körperhaltung zeigt, dass sie sich statt Nähe zu suchen, von dem Kind abwenden. »Absent presence«, die abwesende Anwesenheit – nennt die amerikanische Psychologin Sherry Turkle dieses Phänomen. Auf das Baby kann das wie Ablehnung wirken. Die abwesende Anwesenheit setzt sich im Kleinkindalter fort: Mütter oder Väter sitzen am Spielplatz mit dem Tablet, und ihr Kind muss mehrfach rufen, bis es bemerkt wird. Das ist doch nicht so schlimm, sagen Sie jetzt vielleicht. Für das Kind ist es das schon. Denn wiederholt ausbleibende Beachtung bedeutet Sicherheitsverlust. Keine Reaktion der Mutter vermittelt die Botschaft: Ich bin nicht wichtig. Bindung und Beziehung braucht körperliche, seelische und intellektuelle Zugewandtheit.
Wiederholt sich dieses Gefühl des Sicherheitsverlustes beim Heranwachsen immer wieder, lernt das Kind: Mich sieht keiner, wenn ich nicht Radau mache. Das Kind schreit, um sich der Mutter zu vergewissern. Besser negative Aufmerksamkeit als gar keine. So entstehen für das familiäre Miteinander ungünstige Verhaltensmuster, die eine viel tiefer liegende Ursache haben, als die Eltern oft vermuten. Mit der Zeit wird das Kind verhaltensgestört – es hört nicht auf die Eltern, verweigert das Essen am Tisch, reagiert pampig oder zieht sich zurück. Die Quelle solchen Verhaltens ist meist nicht im gegenwärtigen Moment zu suchen, sondern in der Vergangenheit, in einer von Geburt an gestörten Bindungsbeziehung. In der Seele des Kindes macht sein auffälliges Verhalten Sinn. Entwicklungspsychologisch betrachtet, handelt es sich bei einer Verhaltensstörung meist um ein Notsignal des Kindes, da es Symptomträger des familiären Systems ist. Ihr Kind lernt zuvorderst von Ihnen, den Eltern, wie die Welt tickt. Die neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaft bestätigen: Menschen sehen die Welt so, wie sie bereits als Kinder konditioniert wurden. Das, was zwei oder drei Monate alte Babys erleben, brennt sich gewissermaßen in ihrem Gehirn ein und bildet die Basis, wie sie sich selbst und die Welt wahrnehmen. Es ist also langfristig prägend, wie ein Kind das Verhältnis zu seiner Mutter und zu seinem Vater erlebt: sicher oder unsicher.
Ein Baby, das viel weint und schreit, weil seine seelischen Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, kann die Eltern an ihre emotionalen Grenzen bringen, so dass es schwierig wird, ihm immer wieder geduldig und liebevoll zu begegnen. Das Verhalten des Kindes lässt auch der Beziehung der Eltern weniger Spielraum, so dass es zu Konflikten zwischen Mann und Frau kommen kann.
SCHREIKINDER
»Bitte überseht mich nicht.
Ich funktionier noch nicht so nebenher, ich brauche dich ganz und deine volle Aufmerksamkeit, weil mein noch unreifes Gehirn dein schnelles Reagieren und noch ganz viel Sicherheit braucht. Sorry, noch kann ich das nicht alleine.«
Weint und schreit ein Baby laut und schrill über Stunden und das wochenlang, liegt oft eine frühkindliche Regulationsstörung vor und eher nicht die früher häufiger vermuteten Koliken. Frühkindliche Regulationsstörungen können hirnbedingt sein, weil aufgrund einer Hirnstoffwechsel-Störung die Kontrolle der Emotionen eingeschränkt ist. Es fehlt gewissermaßen die emotionale Bremse. Oft kommt es bei diesen sogenannten Schreikindern später zu einer ADHS-Diagnose. Übermäßiges Schreien kann aber auch die Folge einer Bindungsproblematik sein. Dies erfordert dann ein intensives Eltern-Kind-Interaktionstraining, das Kinderpsychologen teilweise auch videogestützt durchführen.
Ich will nicht sagen, dass Eltern sich den ganzen Tag intensiv um ihr Kind kümmern müssen. Ich will Müttern und Vätern auch nicht raten, sich im Beisein ihrer Kinder nie mit dem Computer oder dem Handy zu beschäftigen. Ich will auch nicht behaupten, dass eine Mutter, die ihr Kind nicht stillen kann, sondern mit der Flasche ernährt, damit eine Bindungsstörung verursacht. Mir geht es darum, bei Eltern ein Bewusstsein zu schaffen, dass ihr Verhalten dem Kind gegenüber mittel- bis langfristige Konsequenzen hat. Ich möchte Sie ermutigen, Ihrem Nachwuchs echte Aufmerksamkeit zu schenken. Damit signalisieren Sie: Du bist sicher und wichtig.
Mütter von Babys und Kleinkindern können sich zum Beispiel fragen: Wie oft muss mein Kind mit einem digitalen Medium konkurrieren? Wenn ein Säugling oder ein Kleinkind Verhaltensauffälligkeiten zeigt, empfehle ich deshalb als Erstes handyfreie Zeit für Mutter und Kind. Das gilt auch für ältere Kinder, die beispielsweise ihren Vater, sobald er von der Arbeit kommt, nur am PC sitzen sehen, wo er Computerspiele macht.
Aber das Handy gehört heutzutage doch dazu, sagen jetzt vielleicht einige Leserinnern oder Leser. Das ist richtig und gleichzeitig ein riskanter Gedanke. Denn wir wissen noch gar nicht genau, welche Auswirkungen wiederkehrende mangelnde Beachtung seitens der Eltern aufgrund von Ablenkung durch Handy- oder Computernutzung tatsächlich hat. Es gibt dazu keine Doppel-Blind-Studien mit Kindern, weil die Ethikkommission gar nicht erlauben würde, solche Versuche anzustellen. Im Grunde genommen befinden sich Familien heute in einem riesigen Feldversuch, und die Kinder sind die Versuchskaninchen.
WIE IHR DIE BEZIEHUNG ZU MIR VERTIEFEN KÖNNT
Es ist nie zu spät, die Bindung zu mir zu stärken. Als Eltern könnt ihr in jeder Lebensphase einen Unterschied machen. Wenn ich, egal, in welchem Alter, Verhaltensauffälligkeiten zeige, kannst du dich meiner Welt und meinen Bedürfnissen mit folgenden Fragen annähern:
Wie kann ich mehr Besonnenheit und Ruhe ausstrahlen?
Wie sorge ich für emotionale Wärme?
Woran erkennt mein Kind, dass es bei mir sicher ist?
Was braucht mein Sohn, meine Tochter, um sich ändern bzw. entwickeln zu können?
Darf mein Kind anders sein, als ich es erwarte, und wird es dann trotzdem geliebt?
Wie könnte ich es wohlwollend und unterstützend begleiten, ohne dass es den Eindruck bekommt, so sein zu müssen, wie ich es gerne hätte?
Es gehört zu den Aufgaben der Eltern, darauf zu achten, dass ihr Kind gesund und ausreichend isst, sich die Zähne putzt, saubere Kleidung trägt und pünktlich zur Schule kommt. Es ist aber genauso wichtig, sich die seelischen Grundbedürfnisse des Kindes immer wieder klar zu machen und dafür zu sorgen, dass sie im Gleichgewicht sind. Das haben Eltern aus meiner Erfahrung nicht immer auf dem Schirm. Kinder wollen in ihrer Welt- und Menschensicht bestätigt werden. Sie suchen wie Erwachsene weniger danach, was sinnvoll, sondern was ihnen vertraut ist. Fühlen sie sich nicht gesehen, inszenieren sie oft unbewusst etwas, um mehr Beachtung zu finden. Indem Sie liebevoll und geduldig versuchen herausfinden, wie es Ihrem Kind wirklich geht, öffnen Sie in der Eltern-Kind-Beziehung einen Möglichkeitsraum. Natürlich werden Sie den einen oder anderen Fehler in der Erziehung machen. Das ist normal und muss keine gravierenden Folgen haben, solange Sie gewillt sind, auch die Perspektive Ihres Kindes zu verstehen und darauf einzugehen.
Neugeborene und Säuglinge wirken auf uns Erwachsene oft hilflos, doch sie nutzen bereits Kommunikationstechniken. Vor allem über Blickkontakte versuchen unsere Kleinsten, im Gesicht der Mutter ihre Zuwendungs- und Betreuungsbereitschaft herauszulesen. Die Eltern sind meist überglücklich, wenn ihr Baby zurücklächelt, dabei drückt der Säugling damit anfänglich gar keine Freude aus. Das Lächeln wird noch unwillkürlich durch Hirnstammaktivitäten ausgelöst. Das Gehirn sorgt gewissermaßen für warme emotionale Zuwendung. Ein genialer Trick der Natur: Ein Lächeln sorgt für mehr positive Aufmerksamkeit und veranlasst die Bezugspersonen dazu, emotional warm und ebenfalls lächelnd auf das Kind einzugehen.
Verschiedene Forschungsergebnisse sind sich einig: Im frühen Säuglingsalter muss die Zeitspanne, in der die Mutter auf eine Äußerung oder das Verhalten des Kindes während des Dialogs reagieren sollte, weniger als eine Sekunde betragen. Erfolgt das Feedback später, ist das Baby nicht in der Lage, die Reaktionen der Mutter auf seine eigene Äußerung zu beziehen. Diese ersten Selbstwirksamkeitserfahrungen sind also für die kindliche Entwicklung von größter Wichtigkeit. Erwidert eine Mutter das Lächeln oder Lallen des Babys mit einem Lächeln und liebevollen Worten, lächelt und lallt das Kind umso häufiger.
Mutter und Vater zeigen in der Regel automatisch, also ohne viel nachzudenken, eine solche Reaktion und können sie auch ohne Ermüdung über längere Zeit aufrechterhalten. Die Wissenschaft nennt das intuitives Elternverhalten. All die angenehmen Bindungserfahrungen, die Eltern mit ihrem Kind teilen, stärken die Beziehung und helfen dabei, einander zu verstehen und lieben zu lernen.
In den ersten Lebensmonaten ist ein Kind noch nicht in der Lage, starke Emotionen wie Angst und Hilflosigkeit selbst zu bewältigen, deshalb hilft die sichere Mutter-Kind-Bindung, schwierige Momente durchzustehen. Sobald sich die motorischen Fähigkeiten des Babys entwickeln, sucht es auch in anderer Form Nähe. Es kann seine wesentlichen Grundbedürfnisse immer effektiver gestalten, indem es beispielsweise die Ärmchen nach der Mutter ausstreckt oder einen ihrer Finger festhält. Mit der Zeit traut sich das Baby zunehmend, die mütterliche Schutzbasis eine Zeit lang zu verlassen und das nähere Umfeld zu erkunden. Aber taucht beispielsweise jemand Fremdes zu Hause auf, sucht das Kind sofort wieder Schutz bei der Mutter.
Eine stabile Bindungsbeziehung ist nicht darauf ausgerichtet, das Kind dauerhaft am Rockzipfel der Eltern zu halten. Ab dem zweiten Lebensjahr können Sie das Kind behutsam anleiten, seine natürliche Neugier zu entfalten und es mit dem nötigen Mut ausstatten, die Welt kennenlernen zu wollen. Die mütterliche Sicherheitsbasis ist über die Bindung zu einer Art Schutzburg geworden, von der aus sich das Kind ins Leben aufmacht. Was es noch nicht allein schafft, begleiten Sie wohlwollend: Sie erkennen Gefahren und schützen Ihr Kind davor, irgendwo herunterzufallen. Sie ermutigen es, von Ihrem Arm zu wollen und die Umgebung zu erkunden. Es braucht immer zwei für eine sichere Bindung: die Mutter, die ermächtigt, und das Kind, das sich traut. Neben Sicherheit und Stressreduktion sind Zuwendung und Unterstützung zwei weitere wichtige Säulen der Mutter-Kind-Bindung, da sie für emotionale Wärme und Entwicklungsfortschritte sorgen. Beim Aufbau von Selbstwertgefühl sind gerade die frühkindlichen Aktionen der Eltern von zentraler Bedeutung, weil das Kind dadurch erfährt, ob es wert genug ist, dass sich jemand um seine seelischen Bedürfnisse und Nöte kümmert, und bereit ist, sich dafür einzusetzen. Mütter und Väter sind deshalb gut beraten, in ihrem Erziehungsverhalten bereits von Geburt an klare und liebevolle Signale der Sicherheit, Zuwendung, Unterstützung und Stressreduktion auszusenden. Damit ermöglichen sie ihrem Nachwuchs, sein Entwicklungspotential in vollem Umfang zu erschließen.
Als Eltern sollten Sie sich allerdings im Klaren sein, dass Sie zuerst Sicherheit vermitteln müssen, bevor Sie erwarten können, dass Ihr Kind sich in unbekannte Situationen begibt. Dave und Anja lernte ich als junge Eltern eines Schreibabys kennen. Die Beziehungsdiagnostik und Verhaltensbeobachtungen wiesen schnell auf fehlende Sicherheit ihres kleinen Sohnes hin. Die beiden hatten eine Beziehungskrise und stritten viel. Der Stress der Eltern und ihre lauten Auseinandersetzungen wirkten sich auf den kleinen Tom aus. In einer Paartherapie lernten Anja und Dave, ihre Beziehungsprobleme zu lösen und in einem Eltern-Kind-Interaktionstraining zeigte ich ihnen Methoden, ihrem Sohn Sicherheit zu vermitteln, damit er sich fallen lassen konnte. Nach einigen Wochen Therapie schrie Tom nicht mehr halb so viel und schlief in der Nacht durch.
Das Bedürfnis nach Sicherheit spielt dauerhaft eine wichtige Rolle in der sozialen und emotionalen Entwicklung des heranwachsenden Kindes, auch wenn sich die Art und Weise, wie Eltern Sicherheit vermitteln, im Laufe der Entwicklung verändert.
WIE DU MEINE EMOTIONALEN GRUNDBEDÜRFNISSE ERFÜLLST
Sicherheit
Sei da, wenn es darauf ankommt, bestehe aber nicht auf Nähe, nur weil du sie selbst so genießt.
Wenn keine Gefahr droht, ermutige mich, mir die Welt neugierig zu erschließen.
Zuwendung
Sorge für emotionale Wärme. Streicheln, knuddeln, alles ist erlaubt. Hauptsache, ungeteilte analoge Aufmerksamkeit ohne Smartphone-Ablenkung.
Liebe mich, auch wenn ich mich ungünstig verhalte, bleibe bitte unbedingt in Beziehung und werte mich nicht ab.
Unterstützung
Begleite liebevoll meine Neugier, hilf mir, wenn nötig.
Zeige dich geduldig und toleriere meine Fehler.
Stressreduktion
Handele überlegt und besonnen, vermeide emotionale Schnellschüsse, die du später bereust.
Besonders in unsicheren Zeiten sei mein sicherer Hafen.
Gib nicht jede Beunruhigung deinerseits an mich weiter. Ich bin noch klein und werde erst noch groß und stark.
Wie sich das kindliche Bindungsverhalten äußert
Wie stellen Entwicklungspsychologen eigentlich fest, wie eng die Bindung zwischen Mutter und Kind ist? Um das zu erklären, möchte ich Ihnen ein berühmtes Experiment der US-Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth vorstellen, deren Studien dazu beitrugen, die Beziehungsqualität zwischen Mutter und Kind zu messen. Zusammen mit Barbara Wittig entwickelte Mary Ainsworth an der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität in Baltimore eine Methode, die sich »Fremde Situation« nennt. Sie besteht aus einer Folge von acht Episoden, die das Bindungsverhalten des Kindes zunehmend herausfordern und aufzeigen, wie es in verunsichernden Momenten reagiert. Diese Episoden sind:
Kennenlernen
Ein Versuchsleiter führt Mutter und Kind in einen Raum. Die Mutter trägt das Kind herum und zeigt ihm das vorhandene Spielzeug.
Gewöhnung
Die Mutter setzt das Kind ab, nimmt selbst in einem Sessel Platz und gibt vor, etwas zu lesen, sich mit dem Handy zu beschäftigen oder Ähnliches. Sie ist angehalten, dem Kind nur Zuwendung zu geben, wenn sie das Gefühl hat, dass es das braucht.
Fremdkontakt
Eine fremde Frau erscheint, grüßt die Mutter kurz, setzt sich ebenfalls auf einen Stuhl und beginnt ein Gespräch mit ihr. Danach nimmt sie Kontakt mit dem Kind auf.
Erste Trennung
Die Mutter verlässt den Raum. Die fremde Frau bleibt sitzen und versucht, das Kind zu trösten, wenn es in Stress gerät. Sollte das Kind zu sehr in Stress geraten, wird die Episode verkürzt.
Erste Wiedervereinigung
Die Mutter spricht vor der Tür, so dass das Kind sie hören und spontan reagieren kann, dann betritt sie den Raum. Sie setzt sich auf den Boden und interessiert sich für die Spielsachen. Die fremde Frau verlässt unterdessen den Raum.
Zweite Trennung
Die Mutter verlässt erneut den Raum, nachdem sie dies angekündigt hat. Die Mutter lässt Ihre Handtasche zurück. Diesmal ist das Kind ganz alleine. Auch diese Szene wird gekürzt, falls das Kind die Situation nicht aushält.
Zweiter Fremdkontakt
Die fremde Frau wird wieder in den Raum geschickt, um Kontakt aufzunehmen und das Kind zu beruhigen.
Zweite Wiedervereinigung
Schließlich erscheint die Mutter, wartet an der geöffneten Tür und spricht mit dem Kind, damit es auf ihre Rückkehr abermals reagieren kann.
Bei meiner psychologischen Arbeit habe ich auf diese Weise eine Vielzahl von Kindern beobachtet und darüber Protokolle angefertigt. Ich war und bin noch heute immer wieder fasziniert und überrascht von der Vielfalt kindlichen Verhaltens in den unterschiedlichen Episoden. Nur in einem Punkt ähneln sich alle Kinder, wie Mary Ainsworth feststellte: Die Sicherheitsbasis der Mutter erweist sich immer als bestimmend für die Qualität der Bindung.
Die Analyse des Fremde-Situation-Tests, der übrigens in den unterschiedlichsten Gesellschaftsformen durchgeführt wurde, lieferte der Entwicklungspsychologie eine wichtige Grundlage zur Feststellung von vier Bindungstypen, mit denen sich das kindliche Bindungsverhalten beschreiben lässt.
DIE VIER BINDUNGSTYPEN
Sicher gebunden
Das Kind läuft bei der Rückkehr der Mutter zu ihr und streckt ihr die Arme entgegen. Es will hochgenommen und von ihr getröstet werden. Sobald der Kontakt zur Sicherheitsbasis Mutter wiederhergestellt ist, lässt es sich beruhigen und findet schnell zu emotionaler Balance und zu einem intensiven Spiel zurück.
Unsicher-ambivalent
Das Kind sucht einerseits den Kontakt zur Mutter, lehnt ihn jedoch sofort ab und zeigt Widerstand, wenn es ihn bekommen hat. Es ist nur schwer emotional zu regulieren, und sein Vertrauen in die Sicherheitsbasis erscheint wenig verlässlich.
Unsicher-vermeidend
Das Kind ignoriert die Mutter in der Wiedervereinigung schlichtweg, wendet sich von ihr ab und entfernt sich sogar manchmal räumlich von der Mutter.
Unsicher-desorganisiert
Das Kind reagiert auf die zurückkehrende Mutter widersprüchlich und für Erwachsene unverständlich. Es empfindet die Mutter nicht als sicherheitsgebend, sondern als beängstigend, so dass sich negative Gefühle verstärken.
Der sicher-gebundene, der unsicher-ambivalente sowie der unsicher-vermeidende Bindungstyp findet sich aus entwicklungspsychologischer Sicht in der ganz normalen Bandbreite der Bindungsbeziehungen, die ein Kind zu seiner Mutter entwickelt. Es sind eher die unsicher-desorganisierten Bindungen, die klinische Psychologen beschäftigen. Sie kommen jedoch vor allem bei psychisch kranken oder vernachlässigenden und misshandelnden Eltern vor.
Ich erinnere mich noch gut an die Arbeit mit dem sechsjährigen Jonas, dessen Vater freundlich-zugewandt war und mit seinem Sohn viel unternahm. Leider sprach er phasenweise sehr dem Alkohol zu, Drogenkonsum gehörte ebenso zu seinen Gewohnheiten. Dann war er ungeduldig, aggressiv, abwertend und schlug Jonas auch. Sobald er wieder nüchtern war, litt der Vater unter einem schlechten Gewissen und versuchte sein Fehlverhalten wieder gutzumachen, indem er viel mit Jonas unternahm und ihn dabei sehr verwöhnte. Doch schon bald folgte erneut ein Einbruch. Dieses emotionale Hin und Her wechselte sich jahrelang ab. Die Mutter von Jonas konnte das kaum kompensieren. Aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte hatte sie große Angst, verlassen zu werden. Sie schwankte zwischen Jonas und ihrem Mann hin und her, mal hielt sie zum Sohn, mal zum Vater, ohne dabei einem sinnvollen Prinzip zu folgen. Jonas Eltern waren keine Sicherheitsbasis, sondern eher zu einer Quelle kindlicher Furcht geworden. Die Unberechenbarkeit begünstigte die Verunsicherung noch.
In einem solchen Fall ist die therapeutische Arbeit ein komplexes Unterfangen, denn nicht nur Jonas brauchte Therapie, sondern auch beide Elternteile, um das eigene ungünstige Verhalten besser zu verstehen und ändern zu können. Zusätzlich erfolgte eine gemeinsame Familientherapie. Ich denke gern an Jonas, da die Therapie sehr erfolgreich verlief. Heute ist er ein stabiler und lebenslustiger junger Mann. Er liebt seinen Job als Schreinermeister und hat eine tolle Freundin, die er bald heiraten will. Die Eltern haben viel über sich gelernt, konnten ihre Lebensgeschichte aufräumen und sind noch immer zusammen.
Hinreichende Eltern sind besser als perfekte
Lange herrschte in Forscher- und Elternkreisen die Meinung vor, dass ein Säugling umso mehr weine, je mehr man darauf einginge. Man belohne gewissermaßen das Weinverhalten, infolgedessen trete es häufiger auf. Die bereits erwähnte amerikanische Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth machte mit ihrer Baltimore-Studie deutlich, dass das Gegenteil der Fall ist: Mütter, die schon in den ersten Lebenswochen prompt und einfühlsam auf das Weinen ihres Neugeborenen reagieren, haben in der Regel später Babys, die weniger weinen. Und genau an dem Punkt beginnt die Herausforderung für Eltern: Denn während in den ersten Monaten nach der Geburt die stete Verfügbarkeit einer Bezugsperson für die Entwicklung des Kindes von zentraler Bedeutung ist, geht es ab dem zweiten Lebenshalbjahr darum, zu einem für das Kind angemessenen und feinfühligem Verhältnis von Nähe und Distanz zu finden. Ich mache seit Jahrzehnten die Erfahrung, dass es in der Mutter-Kind- Beziehung zwar nie zu viel Liebe, dafür aber zu viel Kuscheln und Knuddeln geben kann. Die Forschung belegt: Babys, deren Mütter nur mit ihnen kuschelten und knuddelten, wenn auch die Kleinen das wollten, entwickelten nicht nur eine sichere Bindung, sondern sie zeigten in vielen Alltagssituationen, dass sie die Nähe und Distanz zur Mutter besser selbst bestimmen konnten. Sie genossen den Körperkontakt und ließen sich trösten, entfernten sich aber auch gern, um auf Entdeckungsreisen zu gehen. Dies stand im Kontrast zu Babys, die häufig gegen ihre Bedürfnisse geknuddelt wurden, nämlich dann, wenn lediglich der Mutter danach war. Diese Kinder erkundeten zwar ihr Umfeld neugierig, kehrten aber eher zur Mutter zurück, weil sie meinten, aufpassen zu müssen.
Eine Mutter erzählte mir einmal, dass sie ganz unglücklich sei, weil ihr Fünfjähriger sie auf dem Spielplatz ignoriere. »Wir haben doch immer so viel gekuschelt zu Hause. Mag er mich denn nicht mehr?«, fragte sie mich.
Ich versuchte ihr zu erklären, dass es völlig normal sei, wenn ihr Sohn sich mehr seinen Freunden zuwende. Sie habe sein Verhalten nur ungünstig interpretiert und persönlich genommen. »Das Spiel ist die Arbeit des Kindes. Darüber begreift es die Welt«, versuchte ich sie zu beruhigen. »Ihr Junge ist einfach nur voll bei der Sache.«
Eine Mutter, die mit ihrem Kind kuscheln möchte, auch wenn es das gar nicht will, kann sich fragen: Warum brauche ich gerade diese intensive Nähe, obwohl mein Kind das nicht möchte? Wieso zweifle ich deshalb an der Liebe meines Kindes? Körperliche Nähe einzufordern wäre kontraproduktiv, weil es dem Kind signalisieren kann: Ich bin für das Glück und Wohlbefinden meiner Mutter verantwortlich. Und diese Last wollen Sie Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn sicher nicht aufbürden.
»Der Papa ist immer böse, wenn er von der Arbeit heimkommt, weil Mama nicht aufgeräumt hat«, erzählte mir einmal einer meiner kleinen Patienten.
»Und was machen der Papa und die Mama dann?«, fragte ich.
»Der Papa geht wortlos in den Hobbyraum und die Mama kommt zu mir ins Zimmer, um mit mir zu spielen.«
Ein Kind kommt als weißes, unbeschriebenes Blatt auf die Welt und versucht, die Welt zu verstehen. Alles, was es nach der Geburt erlebt, ist prägend: Das weiße Blatt wird beschrieben. Die Verletzung von seelischen Grundbedürfnissen wird abgespeichert. Das Kind lernt bestimmte Gefühle zu vermeiden oder überzogen auszuleben. Langsam entwickelt es einen emotionalen Stil. Aus den Erfahrungen werden ungünstige Überzeugungen und Einstellungen, die im Lauf der Zeit das Verhalten des Kindes steuern: Ich muss aufpassen, sonst ist die Mama traurig. Ich muss dafür sorgen, die Mama zu trösten. Ich muss vorsichtig sein, sonst mag mich der Papa nicht mehr. Weil sich die Eltern nicht einig sind und keinen stabilen Hafen bilden, ist das Kind überfordert. Wenn Kinder auf die Gefühle der Eltern aufpassen müssen, nennt man das Parentifizierung, eine besonders schädliche Variante der emotionalen Überforderung. Weil sich ein Kind verantwortlich für die Eltern fühlt, fehlt das sichere Nest!
ANGEMESSEN UND FEINFÜHLIG AUF MICH REAGIEREN
Sei meinen Signalen gegenüber aufmerksam und bemerke sie.
Nimm sie ohne Bewertung wahr und deute sie richtig.
Versuche, dich in mich hineinzuversetzen.
Reagiere prompt auf meine Signale, solange ich noch sehr klein bin.
Versuche, mich bei Bedarf zu beruhigen.
In ihrem Buch »Wieviel Mutter braucht ein Kind« beschreibt die Entwicklungspsychologin Lieselotte Ahnert, dass feinfühlige Mütter in der Regel für ihre Kleinen zugänglich sind und auch deren subtile Mitteilungen, Signale, Bedürfnisse und Stimmungen bemerken. Sie deuten richtig, was sie wahrnehmen, und können ihr Verhalten mit dem Baby zeitlich gut abstimmen. Sie gehen mit dem Kind auf eine Weise um, die ihre Betreuung angemessen erscheinen lässt. Im Gegensatz dazu nehmen Mütter mit geringer Feinfühligkeit das Verhalten ihres Kindes weniger gut wahr, ignorieren es oder sind abweisend. Manchmal haben sie auch Schwierigkeiten, zu verstehen, was in ihrem Baby vorgeht. Mütter mit geringer Feinfühligkeit sind einfach nicht in der Lage, ihre Verhaltensweisen mit denen ihres Kindes in Einklang zu bringen. Im Umgang mit dem Baby sind sie zu langsam oder zu schnell. Auch kann ihr Betreuungsverhalten unangebracht sein und/oder verzettelt und unentschlossen wirken. Wichtig ist mir an dieser Stelle, dass diese fehlende Feinfühligkeit fast nie böse Absicht ist. Eltern sind auch nur das Ergebnis ihrer Lebensgeschichte. Welche Vorbilder haben die Eltern gehabt? Welche prägenden Erfahrungen und vor allem welche Bindungserfahrungen haben sie gemacht? Ja, manchmal ist das Leben eine einzige Psychokacke, aber gelassene Selbstreflexion kann helfen. Die Herausforderung für Eltern ist, das richtige Maß zu finden und einem Kind einerseits Geborgenheit zu geben und es andererseits selbstständig werden zu lassen. Das ist eine sehr komplexe Betreuungsaufgabe, die Mütter aus der konkreten Situation selbst ableiten müssen, ohne dabei das Kind zu überfordern.
Überfürsorgliche Helikopter-Mütter, die wie ein Hubschrauber ständig über ihrem Nachwuchs kreisen, um ihn zu behüten, zu überwachen und sich in das, was das Kind tut, einzumischen, sind mehr bei sich als bei ihrem Kind. Sie bemerken nicht, dass sie ihre eigenen Ängste reduzieren, indem sie das Kind überzogen überwachen und so die Autonomie- und die Selbstwirksamkeitsfähigkeiten ihres Kindes einschränken, die ebenfalls zu den vier wichtigsten seelischen Grundbedürfnissen in der frühen Kindheit gehören. Gute Bindung bedeutet nicht ständige Nähe und Engsein. Die feinfühlige Unterstützung der Selbstständigkeit des Kindes wird oft übersehen. Es braucht beides: Nähe und Ermutigung zur Entdeckung von Neuem und der Welt. Wenn das Kind sich wehtut, braucht es Trost und Nähe. Will das Kind etwas Neues lernen oder schaffen, braucht es Loslassen und Ermutigung: »Du schaffst das«. Eltern sollen so Erfolge möglich machen – als wichtiger Teil einer gelungenen Eltern-Kind-Beziehung. Sicher gebundene Kinder bewegen sich selbstverständlich zwischen diesen beiden Polen hin und her. Eltern sollten immer überlegen: Was braucht mein Kind, um sich gesund entwickeln zu können? Mir ist klar, dass es eine Herausforderung für Eltern ist, die Angst auszuhalten, wenn ihr Kind sich ausprobiert. Aber die Herausforderung ist für eine bessere Entwicklung des Kindes lohnenswert. Fakt ist: Kinder neigen noch viel stärker als Erwachsene dazu, alles auf sich zu beziehen, weil sie noch nicht abstrahieren können. Deshalb beeinflusst die Art und Weise, wie Sie dem Verhalten Ihres Kindes begegnen, wie es reagiert. Sie haben zwei Möglichkeiten: als Forscher oder als Richter in Erscheinung zu treten.
BIST DU FORSCHER- ODER RICHTER?
Forscher wollen sich in mich hineinversetzen. Sie sind offen und neugierig darauf, wie ich die Welt und eine Situation sehe, und sind in der Lage, die Welt aus meinen Augen zu betrachten.
Richter meinen zu wissen, was richtig und falsch ist. Sie kommentieren und bewerten alles, was ich tue oder lasse, nach ihren Maßstäben. Sie kritisieren, was schiefläuft. Das, was ich gut mache, bleibt oft unbeachtet.
Sie wären lieber Forscher als Richter, wissen aber nicht, wie Sie das anstellen sollen? Keine Sorge, das kann man üben. Machen Sie sich zuerst klar: Liebe beruht auf der Entscheidung, das Urteilen wegzulassen. Wie viel oder wenig Feinfühligkeit Ihnen als Kind von Ihren Eltern beigebracht wurde, können Sie nicht mehr ändern. Aber Sie können jeden Tag versuchen, Ihr Kind besser zu verstehen. Der erste Schritt dahin ist wie gesagt Selbstreflexion. Sie könnten sich fragen: Wieso sehe ich die Welt durch die Richterbrille? Wie bin ich so geworden, wie ich bin? Wer war in meiner Familie ein Richter, als ich klein war? Und was habe ich vielleicht von dieser Person übernommen? Der zweite Schritt ist, in Konfliktsituationen mit dem Kind bewusst innezuhalten und sich vor Augen zu führen, welche Brille Sie gerade aufhaben und wie Sie als Forscher reagieren könnten.
Auch wenn es von elementarer Bedeutung ist, dass Eltern die Bedürfnisse ihres Babys erfüllen und ihm Sicherheit geben, sollten sie mit der Zeit nur noch so gut wie nötig und nicht so gut wie möglich reagieren, damit die Kleinen auch eine eigene Bewältigungs- und Sicherheitsstrategie ausprobieren können. Das bedeutet, dass Sie als Mutter verständlicherweise mit Ihren eigenen Ängsten zu kämpfen haben, damit Ihr Kind in konkreten Situationen selbstständig agiert und lernt.
Vielleicht ist es beruhigend für Sie zu wissen: Eine hinreichend gute Mutter ist einer perfekten Mutter überlegen. Denn erstere unterstützt die Autonomieentwicklung ihres Kindes, während letztere sie blockiert, indem sie sich allen kindlichen Wünschen ohne Grenzen hingibt. Eine Mama darf auch mal müde, ein Papa mal traurig sein. Eltern dürfen Gefühle haben und Ängste zeigen. Eltern sollen ihren Kindern nicht als bedürfnislose Wesen erscheinen, die ausschließlich auf der Welt sind, um die Bedürfnisse der Kleinen zu erfüllen. Die hinreichend gute Mutter sorgt auch für sich selbst und achtet darauf, was sie braucht. Denn sie weiß, dass sie, einmal ausgebrannt, keine gute Mutter mehr sein kann. Der Vater ist keine Maschine, die immer alles kann. Vor diesem Hintergrund ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass es weitere Bezugspersonen gibt, die feinfühlig Sicherheit und Zuwendung in angemessener Weise vermitteln.
Die Bindungsrolle des Vaters
Wir haben bisher sehr viel über die Bindungsrolle der Mutter gesprochen, weil sie wie gesagt als Gebärende und Stillende in der Regel in den ersten Lebensmonaten die engste Beziehung zu dem Säugling hat. Aber natürlich ist es für die Entwicklung des Kindes genauso wichtig, eine enge Bindung zum Vater zu haben. Er ist in aller Regel die Bezugsperson, die nach der Mutter in die Welt des Kindes stößt. Danach folgen Großeltern, Erzieher, Freunde und Lehrer. Bindungserfahrungen werden vielfältiger.
Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen kurzen Exkurs: Gleichgeschlechtliche Eltern haben keinen Nachteil, was die Entwicklung ihres Kindes angeht. Die Kinder brauchen momentan nur Hilfe beim Verteidigen ihrer »besonderen Eltern«, bis die Welt in der Akzeptanz diverser Lebensformen noch offener geworden ist. Scheidungseltern sind im Vergleich zu früher normal, gleichgeschlechtliche Eltern werden in der Zukunft immer normaler. Dennoch sind Kinder keine kleinen Erwachsenen. Sie brauchen manchmal Hilfe, etwa in Situationen, die ihnen ungefragt vorgesetzt werden: Entscheiden die Eltern, sich zu trennen, werden die Kinder vor vollendete Tatsachen gestellt. Die getrennten Elternteile entscheiden sich für neue Partner, die Kinder werden nicht gefragt, müssen einfach aushalten, was kommt. Gleichgeschlechtliche Paare haben oft einen langen Identitätskampf bis zum Comingout mit sich geführt, sie haben sich befreit und sind heute glücklich. Das Kind aber lebt nicht nur im Familienkosmos, sondern wird spätestens in der Kita öffentlicher und ist anderen Welten ausgesetzt, die oft nicht nur positiv mit gleichgeschlechtlichen Paaren umgehen. Um damit zurecht zu kommen, brauchen diese Kinder eine geduldige und reflektierte Begleitung durch die Eltern.
Im Folgenden wird in erster Linie die Vaterrolle beleuchtet, wenngleich Großeltern und andere Verwandte ebenso wie Freunde wichtige Bezugspersonen für Kinder sein können. Je mehr es sind, desto bereichernder ist das für die Entwicklung.