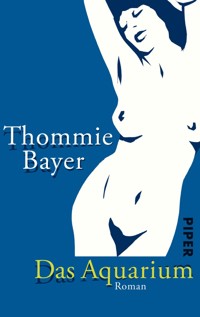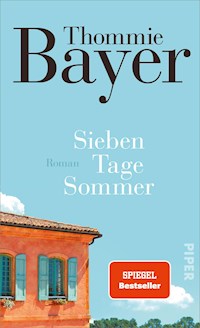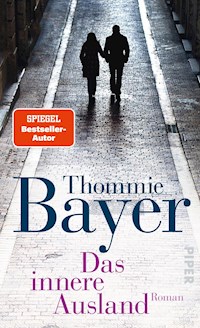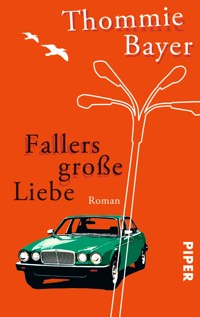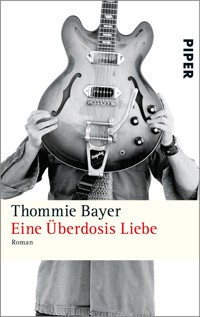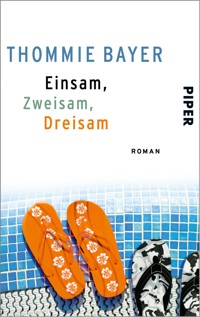9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei verrückte Typen und eine schöne Frau rudern ums Überleben durch die Brandungswellen der sechziger, den Seegang der siebziger und die stillen Wasser der achtziger Jahre. Die Geschichte einer großen Liebe, einer großen Freundschaft, von Träumen und Verwicklungen zwischen Menschen, die Phantasten, doch zugleich auch Realisten sind. Ein Buch, bei dessen Lektüre man auf dem schmalen Grat zwischen Lachen und Weinen die Balance verlieren kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Thommie Bayer
Das Herz ist eine miese Gegend
Roman
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Für Jone und Wolfgang Heer und Peter Cieslinski
«I once had a girl, or should I say, she once had me?»
Lennon/McCartney
EINS
Kennedy starb vor Winnetou. In einem Blaupunkt-Radio der eine und im Scala beim Bahnhof der andere. Ein Buch lag auf einer Kommode, es hieß «Der gelbe Stern». Ein Kind betrachtete die Bilder darin und bekam davon ein Siegel auf die Seele. Ein Bauplatz kostete achtzigtausend Mark und ein Fertighaus mit Fundament hundertzwanzigtausend. Eine Oma hatte so viel Geld gespart. Eine Sache, die einem gefiel, nannte man «prima».
Im Hochsommer neunzehnhundertsechsundsechzig stellte Giovanni fest, dass die Dinge zwei Seiten haben. Mindestens. Es war ein Tag im August, er ließ gerade einen Haufen trockener Erde von der Schippe rutschen, wischte sich den Schweiß von der Stirn und eine Dreckspur drauf, warf die Schippe aus dem Graben, in dem er arbeitete, und nahm einen Schluck Mineralwasser aus der Flasche. Lauwarm.
Das Mineralwasser hieß damals noch saurer Sprudel.
Giovanni war genau dreizehn Jahre, drei Monate und sechzehn Tage alt, die Sonne stand senkrecht am Himmel, sein Vater war eben im nahen Gebüsch verschwunden, für kleine Mädchen, wie er mit einem Augenzwinkern gesagt hatte; sein Bruder Norbert war mit seinem Bruder Arno fortgegangen, um eine neue Kiste sauren Sprudel zu holen, und irgendwas biss Giovanni in den Kopf.
«Au», schrie er und fasste sich an die schmerzende Stelle, aber da war nichts.
Er fuhr suchend mit der Hand herum in seinem dichten Haarschopf, fand kein Blut, fand keinen Vogel, keine Spinne, keinen Käfer, fand nichts, was ihn hätte gebissen haben können, und nichts, was überhaupt auf einen Biss oder sonst eine Verletzung hinwies. Komisch.
Er schippte weiter.
Beim nächsten Biss, in fast dieselbe Stelle, fiel ihm vor Schreck die Schippe aus der Hand. Diesmal tat es viel mehr weh. Wieder suchte er tastend den Hinterkopf ab, und wieder war da nichts.
Die Hand noch am Kopf, setzte er sich auf den Grabenrand und versuchte, aus den seltsamen Ereignissen schlau zu werden, da hörte er ein dünnes, aber scharfes Stimmchen sagen: «Kannst lange suchen, Depp.»
Er sah sich um, und da war nichts, was sprechen konnte. Jetzt kam die Stimme aus einer anderen Richtung und meinte: «Optisch erst recht.»
«Was ist denn jetzt los?», sagte Giovanni zu sich selber, denn an die Stimme glaubte er noch nicht. Er hielt sie für Einbildung.
«Los ist», antwortete die Stimme gut gelaunt, «dass du jetzt deine Strafe kriegst.»
«Was?» Giovanni begann sich zu fragen, ob die ganze Sache für eine Einbildung nicht etwas zu ausgefallen sei.
«Deine Strafe, Depp, Strafe. Das ist so was, wo dir auch weh tut. Dafür isses da.»
«Für was denn eine Strafe, wer bist du, was hab ich dir getan, wieso seh ich dich nicht?», haspelte Giovanni aufgeregt in alle Richtungen.
«Für was denn eine Strafe, für was denn eine Strafe», äffte die Stimme nach. «Dafür, dass du zu den Katzen hältst, vielleicht. Wer bin ich. Ich bin Zelko. Ich bin eine Maus. Ich bin tot, und du bist am Leben, und außerdem hast du die Augen am Arsch.»
Giovanni war völlig perplex. Er versuchte, hinter den Sinn der Worte zu kommen, aber wusste nicht, wie. Ein erneuter Biss schreckte ihn auf, und er schrie: «Wieso halt ich zu den Katzen, wieso bist du tot?» Diesmal tat es noch ein bisschen mehr weh.
Bisschen, dachte er, ist genau das richtige Wort. Die Stimme, jetzt wieder aus einer neuen Richtung, sprach: «Natürlich hast du keine Ahnung. Hattest du damals schon nicht. Jetzt hast du noch keinere, weil du mich nicht siehst. Aber ich hab Ahnung. Ich seh dich, und ich plag dich, bis du deine Strafe weghast.»
«Aber erklär mir doch, was los ist», bat Giovanni jämmerlich, und ihm wurde unheimlich, trotz des klaren Himmels und der Sonne, die senkrecht herabschien.
«Keine Lust», sagte die Stimme, «du hörst noch von mir», und, schon etwas weiter entfernt: «Tschau, Katzist.»
Giovanni ließ sich mit dem Rücken an der Grabenwand langsam hinunterrutschen und blieb nachdenklich sitzen, bis er die schweren Stiefel seines Vaters hörte.
«Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen», sagte der Vater und schickte ihn in den Schatten. Er glaubte, Giovanni habe einen Sonnenstich, und befreite ihn für diesen Nachmittag vom Graben.
Gespenst stimmt wohl, dachte Giovanni. Gesehen stimmt nicht, aber Gespenst stimmt. Ein Mäusegespenst. Ein stocksaurer Mäuserich mit einem bekloppten Namen, der mich triezt. Giovanni hieß übrigens damals noch nicht Giovanni, sondern Paul.
«Wo ist Paul?», fragten Arno und Norbert, als sie, zwischen sich den Kasten sauren Sprudel, keuchend zurückkamen. «Es geht ihm nicht gut», sagte der Vater. Man solle ihn ausruhen lassen. Das bisschen Graben schaffe man auch noch zu dritt. Norbert und Arno packten murrend an und dachten, der findet doch immer einen Dreh, sich zu drücken, denn sie hielten Paul sowieso für einen Waschlappen.
In dem Graben sollten Leitungen für Strom, Wasser und Telefon verlegt werden. Und ein dickes Abwasserrohr. Das Scheißerohr, wie Norbert und Arno es nannten, wenn der Vater außer Hörweite war.
Sie arbeiteten jetzt schon viereinhalb Wochen und näherten sich langsam der Vollendung. Ein Bagger wäre damit in zwei Tagen fertig gewesen, hätte aber sechzig Mark pro Stunde gekostet. Deshalb hatte sich der Vater entschieden, lieber die Sommerferien seiner Söhne zu opfern. Auf diese Weise sparte er doppelt Geld. Einmal die neunhundertsechzig Mark für den Bagger und dann noch die fünfzehnhundertsechs fürs Ferienlager.
Der Vater sparte gern.
Obwohl die Söhne lieber süßen Sprudel, der später Limonade heißen würde, getrunken hätten, bestand der Vater auf saurem. Der lösche den Durst im Gegensatz zum süßen, welcher ihn erst recht erzeuge. In der Mittagspause gab es Butterbrot und Studentenfutter, und nachts schliefen die vier im Rohbau des zukünftigen Hauses. Sie wuschen sich mit Wasser aus Eimern, verteilten Duftmarken im Gebüsch und pickelten und schippten den ganzen Tag, genau nach der Vorschrift des Bauamtes, um einen Graben von eins Komma vier Metern Tiefe in der Mitte, eins Komma eins links und rechts und einer Breite von zwei Komma null zu buddeln.
Schöne Ferien.
Zelko, eine Maus, was soll denn das sein, dachte Giovanni, das kann sich doch bloß um ein Hirngespinst handeln. Hirngespinste waren die Art Gedanken, die seinen Kopf am häufigsten besuchten. Fast die einzige Art überhaupt. Wenn sich die Realität in seine Welt wagte, dann meist in Form eines Hirngespinstes. Aber wann hatte je ein Hirngespinst gebissen? Das war neu.
In seinem schattigen Eckchen im Rohbau, neben den Rucksäcken mit Wäsche und Verpflegung, holte sich Giovanni sein Lieblingsgespinst vor das innere Auge. In der Stadt, aus der die Familie bald wegziehen würde, hatte seine Bande einen Keller, ein von amerikanischen Bomben unversehrt gebliebenes Fundament, in das man durch ein Loch kriechen konnte, wenn die Luft rein war. Die Luft war rein, wenn aus dem hundert Meter entfernt stehenden Nachbarhaus niemand herzusehen schien. In diesem Keller hatte die Bande, die sich «Die Zwölf» nannte, obwohl die Mitgliederzahl zwischen drei und sechs Personen schwankte, ein Geheimlager eingerichtet. Holzschwerter und ein Hammer, drei geklaute Dosen Thunfisch und ein Dosenöffner, acht Kerzen und ein französisches Buch mit unverständlich verformten und ineinander geschobenen Körperteilen waren der Bestand.
In diesem Keller hatte Giovanni noch vor einem Monat gesessen und so getan, als ignoriere er, dass Cornelia vor seinen Augen auf den Boden pinkelte. Seit einer Viertelstunde war sie unruhig auf ihrem Stein herumgerutscht, bis sie endlich sagte: «Ich muss mal.»
«Warte, ich schau nach, ob die Luft rein ist», hatte er, einer Eingebung folgend, gesagt und scheinbar misstrauisch die Nase durch das Ausstiegsloch gesteckt. «Unmöglich», lautete dann sein Bericht, den er mit autoritär nach hinten gestreckter Hand noch unterstrich, «alles voller Leute.»
Cornelia und er waren allein, weil Martin gerade unterwegs war, um Streichhölzer zu besorgen. Die Kerzen brannten, aber sie waren mit dem letzten Streichholz angezündet worden, und Martin sollte Nachschub holen.
«Aber ich muss unbedingt», quengelte Cornelia, worauf Giovanni mit lässiger Ironie sagte: «Und wenn schon, ich kuck dir doch nix weg.» Er hoffte, sie würde den Kloß in seinem Hals nicht bemerken, da sie doch andere Probleme hatte. Und so war es auch. Sie drehte sich von ihm weg und hockte sich in die Ecke des Kellers, die sie für die dunkelste hielt.
Das war in seinem Sinne. Sie konnte nicht sehen, dass er hinschaute, streckte den kleinen weißen Vollmond genau in seine Richtung und ließ es regnen. Dabei hatte er ein unerklärlich aufregendes Gefühl.
Die nachfolgende Peinlichkeit überspielte Giovanni, indem er sich an einer der Thunfischdosen zu schaffen machte, sobald sie die Hose hochzog. Mit den dazugehörenden Geräuschen hatte er vorher schon angefangen, sodass sie nicht auf Interesse von seiner Seite schließen konnte.
«Hab Hunger», sagte er und lud sie zu einer Portion ein. Als Martin unverrichteter Dinge zurückkam, war die Dose leer, und ihm fiel weder die feine Veränderung im Geruchsbild des Kellers noch in der Stimmung der beiden Zurückgebliebenen auf. Und dann trennten sich «Die Zwölf», denn Martin sollte in der Schreinerei seines Vaters helfen, und Cornelia schob Schularbeiten vor sich her.
Das war seit vier Wochen sein Lieblingshirngespinst. Leider begann es langsam an den Rändern auszufransen. So verlor das Bild, wie auch das Gefühl, dieser süße Krampf unter dem Bauch, an Deutlichkeit. Noch ein, zwei Wochen würde es halten. Höchstens.
«He, Katzist», schrillte das kleine Stimmchen ganz nah an seinem Ohr. Er schloss die Augen, um besser zu hören, denn jetzt wusste er, dass die Erscheinung unsichtbar war. Er wartete auf den Biss.
«Was hab ich dir denn getan?», fragte er, alle Nerven unter der Haut alarmiert. Doch es kam kein Biss.
«Weil du nämlich deine Scheiß-Katze gelobt hast, das hast du getan», sagte das Stimmchen, wieder aus einer ganz unerwarteten Richtung.
«Meine Katze gelobt?»
«Deine beschissene Scheiß-Katze gelobt. Fürs Totmachen von mir», sagte der unsichtbare Mäuserich jetzt direkt vor Giovannis Nase. Er schien also auch fliegen zu können. «Brave Katze, hast du gesagt, brave Katze, hat mir ein Geschenk gebracht. Das war ich, du Arschloch.»
Die Maus schien ihn zu umkreisen, ihre Stimme kam bei fast jedem Wort aus einer anderen Richtung. «Ich hab noch gelebt, und deine brave Katze hat mit mir gespielt, so war das, kapierst du’s jetzt?»
«Tut mir leid», sagte Giovanni betreten. Die Geschichte verwirrte ihn. Er schämte sich, denn an den Worten der Maus zu zweifeln kam ihm nicht mehr in den Sinn. «Tut mir wirklich leid, Zeppo.»
«Zelko», schrie das Stimmchen, und jetzt kam endlich der Biss. In die Mitte seines Bauches fuhr ein durchdringender Blitz, und er krümmte sich vor Schmerz und schrie.
«Das wird dir noch mehr leidtun», rief die Stimme jetzt aus weiterer Entfernung, «noch viel mehr.»
Schon kam der Vater hereingerannt, dicht gefolgt von den Brüdern, auf deren Gesichtern ein begeisterter Ausdruck von Sensationslust lag.
«Was ist los?»
Instinktiv wusste Giovanni, dass Ehrlichkeit das Falscheste wäre, und deutete nur auf die Stelle an seinem Bauch, wo der Schmerz gerade nachzulassen begann. Der Vater drückte dran herum, und ein-, zweimal sagte Giovanni «Au».
«Kannst du gehen?», fragte der Vater.
«Ja.»
Als feststand, dass keine Blinddarmreizung vorlag, diagnostizierte der Arzt nervöse Magenkrämpfe. Giovanni wurde in die andere Stadt zurückgeschickt, wo er den Rest der Ferien ein paradiesisches Leben führte. Allein mit seiner Mutter, ohne die Brüder, ohne die stumpfsinnige Graberei und vor allem ohne Zelko. Die Maus schien seinen neuen Aufenthaltsort nicht herausbekommen zu haben. Oder keine Reisemöglichkeit. Er lieh sich Bücher in der Stadtbücherei, die er bei Kerzenlicht im Keller der «Zwölf» las. Nur einmal kam Martin herein, um das französische Buch zu holen. Sie machten nichts miteinander aus, und Martin ging wieder, so schnell er konnte. Ob die Freundschaft nun gelitten hatte, weil Giovanni schon innerlich fortgezogen war oder weil Martin das Geheimnis von Cornelia wusste – es war jedenfalls nicht mehr wie vorher.
Das war Giovanni gerade recht, denn «Don Camillo und Peppone», das Buch, in dem er las, war viel zu spannend, als dass ein Ritterspiel oder ein kleiner Gartenhaus-Einbruch ihn hätten reizen können. Und andere Ideen hatte Martin nie. Als der Kerzenvorrat aufgebraucht war, las Giovanni zu Hause neben dem Vogelbad im Garten auf dem Bauch liegend weiter.
ZWEI
Das Blaupunkt-Radio sprach den Namen des indonesischen Staatschefs einmal als Sukarno und ein andermal als Suharto aus. Um diese Schlappe nicht zugeben zu müssen, tat es fortan so, als wären das zwei verschiedene. Das Amerika-Haus in Berlin wäre am liebsten im Erdboden versunken, konnte aber nicht. Eine Sache, die man prima fand, nannte man «klasse».
Das Hirngespinst war längst verbraucht, als Giovanni von Cornelias Tod erfuhr. Sie war an einer Blutvergiftung gestorben. Er fühlte sich schuldig, obwohl er wusste, dass man vom Pinkeln keine Blutvergiftung kriegt. Er weinte nachts im Bett um sie und beschwor ihr Bild, aber es kam nicht mehr deutlich vor seine Augen.
In der Schule waren er und seine Brüder nur noch Gäste, denn eigentlich hatte der Umzug schon am Ende der großen Ferien stattfinden sollen. Da bis dahin aber weder Fenster noch Türen im Haus waren, musste die Familie bis zu den Herbstferien warten. Auf einmal fühlte sich Giovanni allein. Inmitten seiner Klassenkameraden, mit denen er fast sechs Jahre seines Lebens zusammen gewesen war, hatte er dasselbe Gefühl wie mit Martin im Keller. Fast so, als sei er nicht mehr da. Wenn ein Lehrer seinen Namen sagte, hörte er nicht hin. Ich heiße Giovanni, dachte er, nicht mehr Paul. Giovanni, so hieß der Verfasser der Don-Camillo-Geschichten. Giovanni Guareschi. Und seit der Sache mit der Maus schien es Giovanni, als brauche er einen anderen Namen. Einen Decknamen. Bis jetzt war Zelko nicht nachgekommen, und obwohl die Erinnerung an die Bisse fast noch körperlich schmerzte, fing Giovanni an, mit freundschaftlichen Gefühlen an seinen Peiniger zu denken. Der Mäuserich war vielleicht auch einsam. So einsam wie er. Der einsame Mäuserächer. In einer Lücke zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten. Giovanni lebte in einer Lücke zwischen der Schule, die er bald verlassen würde, und der, in die er im Herbst käme.
Ob Zelko ihn suchte? Manchmal zuckte Giovanni innerlich zusammen, denn er hatte das Gefühl, jetzt, jetzt sofort müsse ein Biss in ihn fahren. Aber der Biss kam nie. Einmal schnitt er sich beim Schnitzen ins Bein und war sich so sicher, die Maus sei wieder da, dass er erst nach einigen Fragen ins Leere das warme Blut an seiner Haut spürte. Als er begriff, dass es nur ein Schnitt war, fühlte er so etwas wie Enttäuschung in sich aufsteigen. Er hatte sich, trotz des Schmerzes, gefreut.
Endlich zog die Familie um, und von dem Augenblick an, da er aus dem Lastwagen stieg, war Giovanni gespannt, voll Hoffnung und Angst zugleich. Jeden Millimeter seiner Haut fühlte er, wie er nie zuvor gefühlt hatte. Jedes Haar, jede Pore wusste er ausgeliefert. Unsichtbar und von überall konnte der Biss eintreffen. Doch nach einigen Tagen erlahmte die Anspannung, und die Maus, bei der Giovanni alles wiedergutmachen wollte, mit der er sich sogar insgeheim anzufreunden hoffte, auf deren Erscheinen er wartete, wie er noch auf nichts in seinem Leben gewartet hatte, diese Maus kam nie wieder.
Je mehr der Alarmzustand, in dem Giovanni sich befand, nachließ, desto mehr bekam er wieder Augen für die Welt um sich. Das neue Haus hatte zwei Klinkerwände an den Giebelseiten, eine Pergola hangaufwärts und hangabwärts einen Balkon, über den der Weg zur Eingangstür führte. Fließendes Wasser gab es noch nicht, denn das, was später einmal die Straße werden sollte, lag noch als gähnender Schlund unterhalb der Dreckhaufen, die dann der Garten sein würden. Noch baggerten die Arbeiter in dem Schlund und verlegten Rohre, Kabel und Gullys. Entlang der Straße abwärts war alles noch grün, und aufwärts standen schon fertige Häuser. In einem davon wusch sich die Familie, ging der Reihe nach aufs Klo und holte Wasser in Eimern, um Kaffee und Suppe zu kochen.
Aufregend Neues begann. Jeder hatte von jetzt an sein eigenes Zimmer, sodass Giovanni endlich nicht mehr bei Norbert schlafen musste, mit dem ihn nichts verband. Norbert war sechs Jahre älter, las Karl-May-Bücher zum dritten und vierten Mal und ignorierte Giovanni. Arno war nur ein Jahr älter, übersah ihn aber umso entschiedener. Ein geringeres Alter schien eine Schande zu sein. Man hatte nicht mitzureden, sich überhaupt nicht zu mucksen, und tat man es doch, dann war man lästig. Während Norbert ihm wenigstens manchmal noch ein Buch lieh oder einen Gummiflicken für den Fahrradschlauch, lehnte es Arno sogar ab, auf Fragen, wie die, ob er den Salat herüberreichen könne, auch nur zu reagieren. Früher hatte er Giovanni auf dem Schulweg abgehängt, indem er schneller ging, als dieser mithalten konnte. Das war jetzt, seit Giovanni sein eigenes Fahrrad besaß, kein Problem mehr. Er freute sich auf den ersten Schultag.
Als es endlich so weit war, hatte Giovanni schon drei Varianten des Schulwegs erforscht. Die Strecke mit nur einer Ampel wollte er jetzt freihändig fahren. Er rechnete sich eine fünfzigprozentige Chance aus, dass die Ampel grün sein würde. Sie stand aber auf Rot, und als er das Rad in den Ständer am Pausenhof stellte, bemerkte er, dass der Schlüssel zu dem alten Steckschloss fehlte. Das fing ja gut an.
Neben ihm tobten einige Jungs und warfen sich gegenseitig die Schultaschen an die Köpfe. «Hallo, Arschi, auch wieder da!», schrien sie einem Neuankommenden entgegen. Der schien sich an diesem Spitznamen nicht zu stören und reihte sich lachend in den fröhlichen Pulk.
Vorsichtig sah Giovanni seine neuen Mitschüler an. Er machte sich am Gepäckträger zu schaffen, damit ihre Aufmerksamkeit nicht auf ihn fiele. Nichts an ihnen war anders; es waren ebenso fremde, verschiedenaltrige Jungen wie dort, wo er herkam. Anders, ganz anders die Mädchen, denn seit Cornelia sah er sie mit neuen Augen. Von unter ihren Kleidern strahlte das Gefühl aus. Als er Arno um die Ecke biegen sah, ging er schnell ins Schulhaus.
Vor dem Raum der Sieben B stand noch ein Junge so vergessen herum. Alle anderen tollten lärmend hinein oder hängten ihre Jacken betont gleichmütig an die Garderobe, um dann betont gleichmütig an den beiden vorbei in die Klasse zu gehen. Trotz einer gewissen Lässigkeit, die er an den Tag legte, schien der andere das Ignoriertwerden ebenso gewohnt zu sein wie Giovanni. Die Schultasche hinter sich an die Wand gelehnt, schlenkerte er die Jacke am Aufhänger hin und her und hatte den Blick nach innen gewandt. Nichts um sich her schien er zu bemerken.
Giovanni hatte unbedingt allein gehen wollen. Da seine Mutter genauso schüchtern war wie er, hätte ihre Begleitung alles nur verschlimmert. Sein Vater war Lehrer an dieser Schule, und als Lehrerkind wollte Giovanni nicht den allerersten Auftritt bei seinen Mitschülern haben. Arno und Norbert hatten auch darauf bestanden, allein in die neuen Klassen zu gehen.
Als es klingelte, eilte ein Mann auf sie zu, sagte: «Ihr seid die Neuen?», und wies sie mit einer Geste in das lärmerfüllte Klassenzimmer. Er zeigte ihnen zwei freie Plätze, einen an der Fensterseite und einen an der Rückwand, und sie verabredeten stumm, wer welchen nähme. Der andere Junge bot Giovanni mit einem Blick den Fensterplatz an. Giovanni nickte und wünschte sich diesen stummen Jungen zum Freund.
«Guten Morgen, Sieben B», sagte der Lehrer.
«Guten Morgen, Herr Krüger», dröhnte die Klasse im Chor.
«Ich hoffe, ihr seid alle glücklich, endlich wieder in der Schule zu sein und die langweiligen Ferien hinter euch zu haben.»
Die Klasse stöhnte. Herr Krüger schien beliebt zu sein.
«Wir haben zwei neue Mitschüler, würdet ihr euch bitte vorstellen?»
«Giovanni Burgat», sagte Giovanni, der mit einem Seitenblick auf den anderen aufgestanden war.
«Giovanni?», fragte Herr Krüger. «Mir wurde gesagt, du heißt Paul.»
«Giovanni», sagte Giovanni. Die Klasse lachte.
«Bo Pletsky», sagte der andere.
Herr Krüger schüttelte den Kopf und schaute von Bo zu Giovanni und wieder zu Bo.
«Und du heißt auf meinem Zettel Bernward.»
«Das spricht sich als Bo», sagte Bo und grinste Giovanni direkt ins Gesicht.
«Von mir aus», lachte jetzt auch Herr Krüger, «Giovanni und Bo. Von mir aus. Aber dass ihr jetzt nicht alle auf die Idee kommt, euch neue Vornamen auszudenken. War schwer genug, die alten zu lernen.»
«Ich möchte Ilse heißen!», schrie ein rotblonder Junge, und Herr Krüger hatte Mühe, die Klasse zu beruhigen.
DREI
Ein Uniformierter zeigte stolz auf die Einschusslöcher in Che Guevara. Die Worte «Blitzkrieg» und «Sechstagekrieg» bekamen einen ganz ähnlichen Klang wie die Worte «prima» und «klasse». Das Wort «sogenannt» schrieb man am einfachsten in Form zweier Gänsefüßchen. Das Blaupunkt-Radio brauchte eine neue Röhre. Die aufzutreiben war nicht mehr leicht.
Ein Jahr später erinnerte sich Giovanni an diesen Tag als den ersten seiner Freundschaft mit Bo und letzten, an dem er ein Fahrrad besessen hatte. Schon in der großen Pause war es verschwunden gewesen, und schon die Tränen der Wut, die er darüber vergoss, trocknete ihm Bo mit seinem krausen Witz. Die beiden wurden unzertrennlich und von den Lehrern, denen an Abwechslung und Unterhaltung weniger lag, bald auch gefürchtet.
Arno, der als Austauschschüler in England gewesen war, hatte Platten mitgebracht, die Giovanni hörte, wenn er an den Plattenspieler kam. An den Plattenspieler zu kommen war schwierig. Der Vater hielt ihn verschlossen, und man musste eine Zeitlang im Garten arbeiten, Gestrüpp wegtragen, Laub verbrennen, Steine aus dem Boden klauben und Unkraut jäten, wenn man ihn haben wollte. Zwei Stunden Gartenarbeit ergaben den Gegenwert von einer Stunde Plattenspieler. Der Plattenspieler musste pünktlich zurückgegeben werden, da half kein «Nur dieses Stück noch». Wurde die Frist auch nur um Sekunden überschritten, dann merkte man spätestens an den überraschenden Würgelauten des Sängers, dass der Vater leise ins Zimmer geschlichen war und den Stecker gezogen hatte. Der Vater liebte Pünktlichkeit.
Und Giovanni liebte ein Lied. Es hatte ihn verzaubert, hatte schon beim ersten Hören sein Unterstes nach oben gekehrt und sofort den gehüteten Geheimplatz, der bislang für Hirngespinste reserviert gewesen war, in seinem Innern belegt. Es war von den Beatles und hieß «Norwegian Wood». Es war genau zwei Minuten und zwei Sekunden lang, also reichte eine Stunde Gartenarbeit für dreizehnmal Norwegian Wood. Wenn Giovanni den Tonarm immer wieder schnell genug aufsetzte. Und wenn nicht Arno überraschend zurückkam.
Bäuchlings lag Giovanni dann vor dem Plattenspieler, das Ohr möglichst dicht am kratzigen Bezug des Lautsprechers, und genoss dieses Gefühl von Raum, Bewegung und Glanz, das aus dem Lied kam. Es war wie Weinen, nur nicht mit den Augen. Und wie Fliegen, nur nicht in der Luft.
Seltsam: Immer wenn etwas sehr Schönes in sein Leben kam, verlor er ein Fahrrad. Als Arno in England gewesen war, hatte Giovanni dessen Fahrrad benutzen dürfen. Das hätte Arno zwar nie freiwillig zugelassen, aber die Mutter verlangte vom Vater, dass er Arno dazu zwang. Nun war das Fahrrad wieder passé, aber dafür war Norwegian Wood erschienen. Wollte das Schicksal jedes Mal ein Fahrrad von ihm haben? Als Preis? Eins für Bo, eins für das Weinen ohne Augen?
«Klau dir doch selber eins», hatte Bo ihm vorgeschlagen, aber das kam nicht in Frage. Zwar hätte sich Giovanni berechtigt gefühlt – die Welt war ihm ein Fahrrad schuldig –, aber wie hätte er seinen Eltern erklären sollen, woher es kam?
«Ich hab’s dir geschenkt, du Säftel», hatte Bo auf diesen Einwand geantwortet, aber Giovanni brachte einfach nicht den Mut auf.
Er verdiente sich lieber das Geld. Zwar hatten die Eltern zunächst Bedenken gehabt, den Vierzehnjährigen morgens um vier in einer Backstube arbeiten zu lassen, aber er war gut in der Schule, und dass er eigenes Geld verdienen würde, gab den Ausschlag für die Zustimmung. Der Vater liebte eigenes Geld.
Einsfünfzig bekam Giovanni in der Stunde, ein Frühstück und zwei Brötchen für die Pause. Noch einen Monat, dann würde das Gesparte für ein neues Fahrrad reichen. Wenn er nicht zu viele Schallplatten kaufte.
Es hatte nicht geklappt, im Musikunterricht die Beatles, Kinks und Rolling Stones durchzusetzen. Der Musiklehrer hielt sich für modern genug, wenn er das Golden Gate Quartet «Joshua hit the battle of Jericho» singen ließ oder den Christensong «Danke» kompositorisch analysierte. Aber in Englisch war es gelungen, der Lehrerin, die immer einen Blusenknopf zu viel geöffnet hatte, die Texte als Lehrmittel einzureden. Von «Yesterday» und «As Tears Go By» waren die Erwachsenen sowieso leicht zu überzeugen gewesen, denn da waren ja Geigen zu hören. Mit Hilfe von Geigen konnten die Erwachsenen gute Musik von schlechter unterscheiden. Das hatte sogar bei Giovannis Vater geklappt. Bei Bos allerdings nicht. Der liebte Zarah Leander und Marschmusik. Und die musste von Blechbläsern gespielt sein. Den einen oder anderen Wiener Walzer gönnte er sich wohl, aber nur im Hinblick auf dessen Funktion, beschwingtes Tanzen zu ermöglichen. Und etwas enthielten diese Walzer auch vom Abglanz der imposanten alten Welt vor neunzehnhundertvierzehn.
Leider währte die neue Errungenschaft im Englischunterricht nicht lange. Als nämlich «As Tears Go By» dran war und die Lehrerin nach der richtigen Übersetzung des Titels fragte, sagte Roger, der Rotblonde, den man seit einem Jahr nur noch Ilse nannte: «Wenn Tiere vorbeigehn».
Diese Albernheit allein hätte sicher nicht ausgereicht, die Beatmusik aus dem Klassenzimmer zu verbannen, hätte nicht Giovanni noch hinterhergeplappert: «Arschtiere gehn vorbei». Humor hatte man ja, aber Fäkalausdrücken musste mit Strenge begegnet werden. Frau Lohr holte den Schulpolizisten, einen durch und durch grauen, schlabbergesichtigen Lehrer namens Winkler, der Giovanni drei Stunden Schulhof-Fegen aufbrummte und mit drohendem Gesicht sagte: «Das kommt vor die Lehrerkonferenz.»
«Du bist wieder aufgefallen», würde der Vater dann am Mittagstisch sagen, und das bedeutete im Allgemeinen zwei bis drei Stunden Gartenarbeit ohne Plattenspieler. In diesem Fall wohl mindestens sechs.
Herr Winkler war ein Mensch, der den Kollegen, denen das Strafen nicht so großen Spaß machte, diese Arbeit freudig abnahm. Er wurde gerufen, wann immer sich jemand außerstande fühlte, auf eine besonders gelungene Missetat angemessen zu reagieren. Winkler reagierte immer angemessen. Er beherrschte den besonders schmerzhaften Griff in die Haare vor den Ohren und liebte es, weite Strecken mit einem straffälligen Schüler in diesem Griff zurückzulegen. Ebenso beherrschte er das besonders grimmige Gesicht, das normalerweise bis mindestens zur zehnten Klasse hinauf reichte, die Schüler wie hypnotisierte Kaninchen zu lähmen. Giovanni hatte Angst vor Winkler. Bo nicht.
So kam auch von Bo die Idee, Winkler eine Botschaft aus dem Jenseits zukommen zu lassen. Dem Jenseits stand Giovanni seit der Sache mit der Maus recht aufgeschlossen gegenüber, und am Nachmittag nach dem Schulhof-Fegen gingen sie zusammen durch das leere, dämmerige Schulhaus in Winklers Klasse, um dort mit Ölkreide «Winkler ist Pfusch von Gott» an die Tafel zu schreiben.
Bo hatte deshalb keine Angst, weil ihm früh aufgefallen war, dass sich niemand für ihn interessierte. Sein Vater nicht, seine Mutter nicht, sein großer Bruder nicht und die Lehrer nur, wenn er frech war. Er existierte nur, wenn er sich bemerkbar machte. Blieb er einfach ganz normal, ein Junge mit Spielen und Unsinn im Kopf, dann schien er seiner Umgebung derart unwichtig, dass man meinen konnte, es gäbe ihn nicht. Er beschloss, das Beste draus zu machen: Käme es zu einer brenzligen Situation, dann würde er nur einfach ganz normal sein, und schwupps wäre er weg. Er hatte die Wahl, sich bemerkbar zu machen und, wenn er wollte, wieder entmerkbar. Allerdings war es noch zu keiner Situation gekommen, die derart problematisch gewesen wäre, dass er es hätte ausprobieren müssen. Es war wie mit der atomaren Abschreckung. Man hat die Mittel, um sie nicht anzuwenden.
Sein Vater, ein begeisterter NPD-Wähler, liebte außer Zarah Leander, Bos großem Bruder und zünftiger Marschmusik nur noch das Theater. Wie er Theater und Nationalsozialismus miteinander vereinbarte, war zwar schwer zu verstehen, denn seine Begeisterung ging durchaus über Gustaf Gründgens und Hans Albers hinaus, aber irgendwie schaffte er es, Joachim Ringelnatz, dem die Nazis ein Ehrenbegräbnis verweigert hatten, zu vergöttern, und gleichzeitig Juden, Kommunisten, Zigeuner und Homosexuelle in einen Topf zu werfen. In dem sie selbstverständlich bei lebendigem Leibe kochen sollten.
Wenn Bo von seinem Vater bemerkt werden wollte, rezitierte er den «Fußballwahn» von Ringelnatz, den er fehlerlos auswendig konnte. Wollte er Ruhe haben, tat er einfach nichts.
Vor drei Jahren hatte er die Bestätigung erhalten, dass sich nicht einmal das Schicksal für ihn interessierte. Sein großer Bruder Dietrich, der Augapfel des Vaters, weil er aussah, als sei er aus dem Lebensborn hervorgegangen – groß, blond, blauäugig, mit ausgeprägtem Kinn und Schultern wie ein Denkmal –, dieser Bruder hatte ein Luftgewehr, mit dem er versuchte, Spatzen zu erschießen. Glücklicherweise waren die Spatzen talentierter im Wegfliegen als Dietrich im Hinterherschießen. Er erwischte niemals einen. Hierüber wohl verärgert, zielte er an jenem Tag zur Abwechslung auf seinen kleinen Bruder, der gerade von der Bushaltestelle kam. Zuerst spürte Bo einen Luftzug, dann stolperte er und hörte den Schrei des neben ihm ausgestiegenen Nachbarjungen. Der hielt sich die Hand an die Wange, und mit seinen Tränen mischte sich Blut, das zwischen den Fingern hervorrann.
Ein Blick, den Bo zum Dachfenster warf, zeigte ihm Dietrichs gerade verschwindendes Profil. Er wusste, dass dieser auf ihn gezielt hatte.
Später, am Mittagstisch, sagte er: «Dietrich hat geschossen, ich hab’s gesehen», und es war wie in diesen Träumen: Man spricht, aber niemand reagiert. Dietrich schaute in die Ferne, die Mutter musste etwas in der Küche nachsehen, und der Vater sprach weiter über den Skandal, dass einfach in der Nachbarschaft herumgeschossen werde, und davon, wie er sich die Bestrafung des Täters, der bestimmt aus der Ausländersiedlung am Hang komme, vorstelle. Am nächsten Tag war das Luftgewehr verschwunden.
Bis zum Tag nach der Konferenz musste Giovanni gar nicht warten, schon am Abend sagte der Vater: «Du bist wieder aufgefallen.»
Giovanni hielt den Blick auf die Tischdecke gesenkt und schwieg.
«Dein gespartes Geld bleibt einen Monat in meiner Verwahrung», entschied der Vater. Das traf sich gut, denn im nächsten Monat hätte es sowieso noch nicht für das Fahrrad gereicht.
«Kann Bo zwei Tage bei uns wohnen? Seine Eltern verreisen», fragte Giovanni gleich hinterher, denn der Zeitpunkt war günstig. Die Strafe war schon ausgesprochen, und noch eine weitere dranzuhängen wäre nicht gerecht gewesen. Der Vater liebte Gerechtigkeit.
Am nächsten Morgen ging Winkler durch die Klassen und war der Ansicht, derjenige, der seine Tafel beschmiert habe, solle sich stellen. Diese Tat sei feige, und wer immer sie begangen habe, könne jetzt, nachträglich noch, Mut beweisen. Dabei sah er scharf und länger als jedem andern Giovanni ins Gesicht.
Als zwei Tage später mit derselben Ölkreide an Winklers Klassentür geschrieben stand: «Irren ist göttlich. Winklerinem ausrutscherum est», Unterschrift: «Gott», da ging nicht mehr Winkler selbst durch alle Klassen, sondern der Schulleiter. Und das war inzwischen Giovannis Vater. Aber die Masche mit dem Mut zog nicht, und dass das Gotteslästerung sei, mochte ja sein, aber bevor nicht ein Blitz Giovanni träfe, würde er nicht wieder anfangen, an Gott zu glauben. Geschweige denn, ihn zu fürchten.
Die Ölkreide warfen sie auf dem Heimweg fort, klauten Äpfel aus Vorgärten und machten jeden Umweg, der ihnen einfiel, denn Giovannis Vater hatte Nachmittagsunterricht und aß in der Schulkantine.
Bo beschrieb das Gefühl, wenn man einem Mädchen unter den Pullover fasst, und wie sich dieses Gefühl steigern lässt, indem einem das Mädchen seinen Busen zeigt, und den nicht mehr steigerbaren Höhepunkt des Gefühls, wenn man danach, allein, Hand an sich selber legt. Diese letzte Etappe kannte Giovanni schon. Das andere nicht, denn er war mit Hilde, einer Klassenkameradin, nicht so weit gekommen. Und mit Hilde war außerdem Schluss.
Da Bo drei Jahre auf der französischen Schule gewesen war, sprach er nicht nur perfekt Französisch, sondern hatte es auch leicht, mit seiner Frechheit Kontakt zu den Töchtern der Garnisonssoldaten zu bekommen. Marie Claire war schon seit einem Vierteljahr seine Freundin. Sie hatte tiefschwarze Augen, tiefschwarze Haare und nichts dagegen, dass Bo ihren Körper erkunden wollte. Ihr Vater war General und durfte nichts von Bo wissen. Sie war sechzehn und hatte ihm versprochen, ihn da unten, «là bas», wie sie es nannte, zu berühren.
«Ich erzähl dir, wie’s war», versprach er Giovanni. Das Schicksal habe an ihm noch was gutzumachen, fand er, denn in den Sommerferien hatte ihn ein katholischer Pater unsittlich berührt. Er hatte zwar nicht gepetzt, denn allein die Tatsache, dass sein Vater Homosexuelle hasste, verschaffte diesem Mann einen Bonus, und außerdem wusste Bo, dass der Pater dafür ins Gefängnis kommen konnte. Aber als dieser ihn danach auch noch auf den Mund geküsst hatte, kotzte er vor Schreck und Ekel.
Er hatte diese Geschichte Marie Claire erzählt und gesagt, er fürchte nun, verdorben zu sein und schwul zu werden. Zwar lachte sie und sagte, das Schwulsein sei nicht ansteckend, aber sie versprach, ihn doch mit weiblicher Hand zu erlösen. Jetzt warteten sie nur noch auf die passende Gelegenheit.
Giovanni beneidete Bo um diese Aussicht.
VIER
Wer war Uschi Glas? Wusste sie, was damit gemeint war, wenn man sagte: «Unter den Talaren – der Muff von tausend Jahren»? Für einen Neger tat Martin Luther King den Leuten ganz schön leid. Anders Rudi Dutschke, der hatte sich das selber zuzuschreiben. Eine Sache, die man klasse fand, nannte man «dufte». Fahrpreiserhöhungen und Notstandsgesetze waren keine solche Sache. Aber die Erfolge der Tet-Offensive.
Ein halbes Jahr später, als endlich der Schnee geschmolzen war, holte Giovanni das blau glänzende Rixe-Fahrrad, das er sich zum Geburtstag geschenkt hatte, aus der Garage und hoffte, dass die Ampel diesmal Grün zeigen würde. Es war nicht direkt Grün, und zuerst spürte er gar nichts. Aber dann kam dieser Blut- und Staubgeschmack in seinen Mund, und er merkte, dass es ihm unmöglich war einzuatmen. Es war ihm auch unmöglich zu schreien, obwohl er so etwas wie einen Schrei in seinem Innern zu hören glaubte.
Erst als ihn der Mann auf den Rücksitz des Wagens legte, hörte er sich wimmern, spürte, dass er wieder atmete, und spürte auch die brennenden und pochenden Schmerzen an Kinn und Bein.
Giovannis Kopf lag im Schoß eines blonden Mädchens. Er sah ihr Gesicht falschherum, die Augen unten und den Schal oben.
«Hast du arge Schmerzen?», fragte das Mädchen.
«Nein», sagte Giovanni, «wie heißt du?»
«Laura», sagte das Mädchen und lächelte.
«Hat man dir nicht beigebracht, dass eine rote Ampel halt heißt?», fragte der Mann am Steuer, und man hörte seiner Stimme die ärgerliche Besorgnis über Giovannis Zustand und den eben ausgestandenen Schrecken an.
«War dunkelgrün», sagte Giovanni.
Das Mädchen lachte.
Ob der Mann auch lachte, konnte Giovanni nicht feststellen, aber da das Sprechen die Schmerzen zu lindern schien, fragte er, was mit seinem Fahrrad sei.
«Vergiss es», sagte der Mann, und das Mädchen schien empört, denn es sagte: «Papa.»
Jetzt lachte Giovanni. Allerdings etwas gequält, denn sein Kinn fühlte sich an, als wäre es zerfetzt.
Die Zeit im Krankenhaus war schön, trotz der Schmerzen, die nur allmählich nachließen. Bo kam fast jeden Nachmittag und erzählte von Janine. Noch genauso begierig wie vor einem halben Jahr sog Giovanni Bos Geschichten auf, denn seit Marie Claire war Janine schon die Vierte, und alles, was Giovanni an sexuellen Erlebnissen verwehrt blieb, tat Bo längst mit wachsender Kenntnis und Begeisterung.
Als Marie Claires Vater nach Frankreich zurückversetzt wurde, hatte sie es zum Abschied mit ihm getan. Bo hatte sich daraufhin eine Glatze schneiden lassen. Um seinen neuen Lebensabschnitt nachher im Fotoalbum jederzeit erkennen zu können. Noch mit der Glatze als Trumpf hatte er ein Mädchen auf der Straße angesprochen und ihre mit Abscheu gemischte Faszination für seinen blankrasierten Schädel zum Anbändeln genutzt. Schon in der folgenden Woche war er am Ziel gewesen, und wieder eine Woche später hatte er Schluss gemacht, um eine neue Französin einzufangen. Das Reservoir in den Garnisonswohnblocks schien unerschöpflich, und Bo wurde immer dreister. Er nahm Ohrfeigen als Zustimmung, Spott als Bestätigung und kopierte alle Draufgängerrollen, die er in Filmen gesehen hatte. Von Belmondo bis Charlton Heston war ihm jede Charge geläufig, denn da er älter aussah, ließ man ihn schon seit einiger Zeit in jeden nicht jugendfreien Film.
Haarklein hatte er seine Fortschritte erzählt, und Giovanni, der, so süchtig er nach diesen erregenden Berichten war, davon immer trauriger wurde, geriet nach und nach in eine immer größere Entfernung zu seinem zusehends erwachsener werdenden Freund.
Im Augenblick schrie Giovanni gerade vor Schmerzen und Lachen, denn Bo, der für ihn den Reisauflauf in den Abfluss des Waschbeckens spülte, hatte zuerst mit grandioser Gebärde auf den gefüllten Teller gezeigt, «Reisauflauf!» gesagt und dann die ungenießbare Pampe in die Kanalisation geschickt. Eine traurige Clownsgrimasse schneidend, deutete er nun in das Becken und sagte mit Grabesstimme: «Reisablauf!»
Das Lachen tat der Seele gut und dem Kinn weh. Gebrochen hatte Giovanni zwar nur Schlüssel- und Wadenbein, aber die Schürfwunde am Kinn war tief und schmerzte am meisten.
«Hör auf», rief er unter Tränen. «Es tut weh.»
Niemand außer ihnen beiden war im Zimmer, als sich die Tür öffnete und Laura, das Mädchen aus dem Auto, ihren Kopf hereinstreckte.
«Ich soll dich von meinem Vater fragen, wie’s dir geht», sagte sie und legte, ohne zur Seite auf Bo zu schauen, eine Schachtel Pralinen auf Giovannis Bett.
«Och», sagte er nur, denn es ging ihm doppelt. Gut und schlecht zugleich.
«Das ist Bo», fuhr er fort, da sie keine Antwort gab.
«Tag», sagte sie.
«Hallo», sagte Bo und schien wie verwandelt. Die ausgelassene Albernheit von eben war verschwunden, und er lehnte lässig am Nebenbett, stocherte mit dem Fingernagel in den Zähnen und sah Laura direkt an.
Giovanni, dem das peinlich war, sagte: «Glotz doch nicht so.» Und zu Laura, die dastand, als wolle sie gleich wieder gehen: «Setz dich doch.»
Er schob seine Beine zur Seite, damit sie sich aufs Bett setzen konnte, und sie tat es, ohne auf Bo zu achten, der sich jetzt verabschiedete und sagte, er müsse noch was erledigen.
«Bis morgen, Tschau.»
Giovanni legte Laura die Pralinen in den Schoß.
«Ich hab gelacht; ich kann nicht essen. Magst du?»
«Gern.» Sie riss die Folie von der Packung. «Hab mich unterwegs schon beherrscht, dass ich dir keine klaue.»
Sie aß eine Praline nach der anderen und sah sich in dem tristen Vierbettzimmer um. Die blonden Haare fielen ihr in die Stirn, und sie strich sie mit einer fahrigen Gebärde immer wieder in die Form, in der sie nicht bleiben wollten, zurück. Sie schmatzte und sah ihn mit ihren dunklen Augen an.
Jetzt, da nur sie beide im Zimmer waren, schien sie kein bisschen unsicher, saß bequem neben seinen Beinen. Ihre Wolljacke hatte sie ausgezogen und über das Bettgestell geworfen.
«Liegst du allein hier?»
«Einer ist noch da, aber der ist grad weg.»
Sie lachte, obwohl er gar nicht hatte witzig sein wollen. Sie erzählte, dass sie im August sechzehn werde, dass sie aufs Wildermuth-Gymnasium gehe, dass sie eine Schwester habe, mit der sie nichts anfange, dass ihre Eltern sich scheiden lassen wollten und sie bei ihrem Vater bleibe, dass sie in der Landhausstraße wohne und Giovanni sie besuchen kommen könne.
Sechzehn! Er fand es unglaublich, dass sie schon so alt war. Da er selbst erst fünfzehn war, schien ihm sechzehn unendlich weit entfernt und außerdem, was Mädchen anbetraf, eine magische Grenze darzustellen. Die Mädchen mit sechzehn mussten so sein wie Marie Claire. Die taten es.
Aber Laura sah gar nicht aus wie ein Mädchen, das es tut. Sie benahm sich so natürlich, dass Giovanni sie gar nicht richtig mädchenhaft finden konnte. Dazu war sie zu normal. Die in der Klasse wurden immer kicheriger. Sie schienen an der Tatsache, dass jemand kein Mädchen war, einen Heidenspaß zu haben, und es wurde zunehmend unerfreulich und seltsam, mit einer von ihnen zu reden.
Mit Laura war alles so einfach, dass es Giovanni nicht einfiel, verlegen zu sein. Als wären sie Freunde seit Jahren und hätten einander die geheimen Dinge schon verraten, redeten sie über Alltägliches wie die Schule, ihre Eltern und Geschwister, Bo und Musik.
«Ich hätte eigentlich gerade Turnen», sagte Laura, «aber ich schwänze. Hab keine Lust mehr.»
«Turnst du nicht gern?», fragte Giovanni.
«Doch, jedenfalls hab ich gute Noten. Aber die Jungs zielen mit den Bällen auf meine Brüste, und das stinkt mir.»
Und auf einmal war die ganze Normalität verflogen. Das Wort «Brüste» entrückte sie auf einen Schlag, machte sie fraulich und ihn schüchtern. Unter der Decke regte sich was, denn allein die Vorstellung von Brüsten direkt neben ihm genügte, um das Gefühl, das ihm nunmehr ein gewohnter Besuch war, zu wecken.