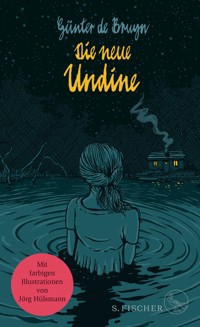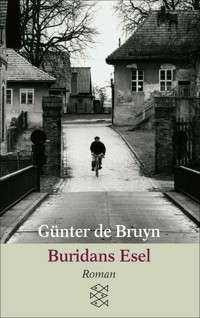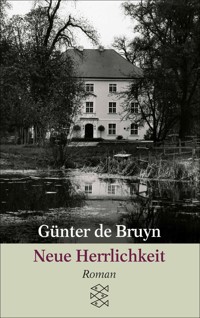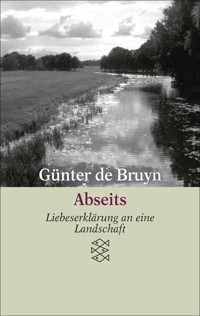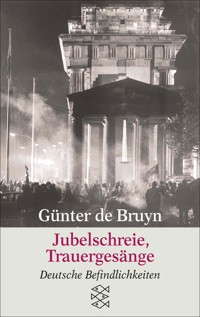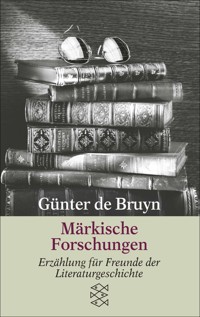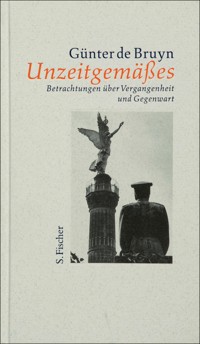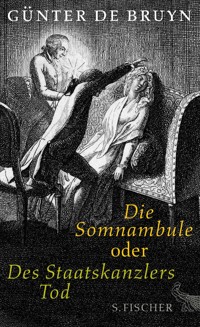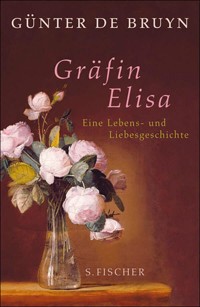9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein Kabinettstück biographischer Erzählkunst, eines der schönsten Bücher zur Goethezeit Jean Paul war der wildeste und witzigste Erzähler der Goethezeit. Sein gesamtes Werk steht im Zeichen einer poetischen Freiheit, die einmalig ist in der deutschen Literatur. Günter de Bruyn folgt dem prekären Leben des berühmten Dichters und verknüpft es mit den Strömungen seiner Zeit von der Französischen Revolution bis zur Restaurationsepoche, von der Aufklärung bis zur Romantik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Günter de Bruyn
Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter
Eine Biographie
Fischer e-books
Überarbeitete und vermehrte Neufassung
»Ich beschwöre dich (ich erscheine dir sonst),
dass du nach meinem Tode über mich derb
und frei schreibst, nicht verdammt kleinstädtisch-
zart und delikat über alles. O ich bitte dich; und
mache diese Stelle zum Motto deines Aufsatzes.«
(Jean Paul an Christian Otto, am 6. Februar 1802)
Vorrede zur Neufassung
Diese vor fast vier Jahrzehnten erstmalig erschienene Biographie, die dankenswerterweise vom S. Fischer Verlag immer greifbar gehalten wurde, wird hier anlässlich des 250. Geburtstages Jean Pauls in einer aktualisierten Neufassung vorgelegt. Ihr Verfasser, dem es im Alter noch vergönnt war, die Mängel seiner Arbeit selbst zu beheben, hat dabei weder seinen Blick auf Jean Paul wesentlich verändert, noch seine Absicht aufgegeben, Nichtleser Jean Pauls an dessen Werke heranzuführen; weshalb auch auf eine Auseinandersetzung mit der ständig anschwellenden Masse der spezielleren literaturwissenschaftlichen Untersuchungen verzichtet wird. Durch stilistische Änderungen, die teils auch Erweiterungen, teils Verknappungen zur Folge hatten, wurde, wie zu hoffen ist, die leichte Lesbarkeit der Biographie noch verstärkt. Auch wurde der Hauptmangel der alten Fassung, das Fehlen eines Zitatennachweises nämlich, behoben, die Bibliographie auf den neuesten Stand gebracht und die Anzahl der Abbildungen beträchtlich vermehrt.
Weder die alte noch die neue Fassung hätte ohne die Arbeit der vielen in Vergangenheit und Gegenwart um Jean Paul bemühten Wissenschaftler entstehen können, wobei ich besonders auch an jene denke, die sich heute um die Vervollständigung der von Eduard Berend begonnenen Historisch-kritischen Gesamtausgabe bemühen. Ihnen allen sowie auch den immer hilfsbereiten Bibliothekaren und Archivaren gilt des Verfassers herzlicher Dank.
Görsdorf, im Sommer 2012Günter de Bruyn
Frühlingsanfang
Nachts ein Uhr dreißig wurde das Kind geboren. Es lebte und war gesund, was damals nicht selbstverständlich war. Besonders in so abgelegenen Gegenden wie dem Fichtelgebirge waren die Hebammen wenig oder gar nicht ausgebildet, und ärztliche Geburtshilfe gab es in den unteren Bevölkerungsschichten kaum. Auch die falsche Pflege der Säuglinge führte oft zu ihrem Tode. Da man fürchtete, dass sie krumm, lahm oder bucklig werden oder sich beim Schreien Brüche zuziehen konnten, wickelte man sie so fest ein, dass sie kein Glied bewegen konnten. Viele gingen an einseitiger Überfütterung mit Mehlbrei zugrunde, und als Schlafmittel benutzte man bedenkenlos Branntwein oder ausgekochten Mohn. Von den sechs Kindern, die Rosine Richter nach diesem ersten noch zur Welt brachte, überlebten zwei die ersten Jahre nicht. Das entsprach etwa dem statistischen Durchschnitt der Kindersterblichkeit.
Abb.1: Wunsiedel 1798. Kupferstich von Johann Gottfried Koeppel
Es war die Nacht zum 21. März. Mit dem Kind zugleich kam also der Frühling, der immer sehnlich erwartet wurde, weil damals auch das Leben der Städter noch mehr dem Wechsel der Jahreszeiten unterworfen war. Im Winter waren die Straßen kaum passierbar, in den engen Wohnungen der Kleinbürger war meist nur eine Stube heizbar, und Kerzen, Kienspan oder Öllampen gaben nur schlechtes Licht. Das macht die Freude verständlich, mit der Jean Paul später gern betonte, dass der Beginn seines Lebens mit dem des Frühlings zusammengefallen war. Die Tagundnachtgleiche schien ihm in Beziehung zu stehen zu seinem Doppelstil, dem humoristisch-satirischen und dem pathetisch-sentimentalen. Er zählte die Zugvögel auf, die mit ihm zusammen ankamen, und er wusste die Pflanzen zu nennen, die man auf seine Wiege hätte streuen können: Scharbockskraut, Ackerehrenpreis oder Hühnerbissdarm – Namen, die sich anhören, als habe er sie erfunden.
Nachzulesen ist das im Fragment seiner Autobiographie, die erst nach seinem Tode erschien. Der nicht von ihm stammende Titel erregte Goethes Unmut. Nach »Dichtung und Wahrheit« musste ihm »Wahrheit aus Jean Pauls Leben« wie ein anmaßender Gegenentwurf erscheinen. »Aus Geist des Widerspruchs« habe Jean Paul das geschrieben, sagte er zu Eckermann. Während seine eigne Autobiographie »sich durch höhere Tendenzen aus der Region einer niedern Realität« erhebe, bleibe Jean Paul ihr verhaftet. »Als ob die Wahrheit eines solchen Mannes etwas anderes sein könnte, als dass der Autor ein Philister gewesen!« Ein hartes und falsches Urteil, das aber die Unterschiede zwischen den beiden Großen trefflich markiert.
Bezeichnend sind auch die Anfänge der beiden Autobiographien. Feierlich setzt Goethe seinen Lebensbeginn in Beziehung zum Kosmos. »Die Konstellation war glücklich: die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag; Jupiter und Venus blickten sie freundlich an.« Jean Paul aber, ganz der »niedern Realität« verhaftet, weist, bevor er zu Schnepfen, Bachstelzen, Löffelkraut und Zitterpappeln kommt, auf das politische Hauptereignis seines Geburtsjahres hin. »Es war im Jahre 1763, wo der Hubertusburger Friede zur Welt kam.«
Im Jagdschloss Hubertusburg bei Oschatz hatten seit dem Dezember des Vorjahres die Unterhändler Österreichs und Sachsens mit denen Preußens über den Abschluss des Siebenjährigen Krieges verhandelt, der durch die Zerrüttung der an ihm beteiligten Staaten bereits zum Erliegen gekommen war. Der verlustreichste Krieg des 18. Jahrhunderts, an dem sich fast alle europäischen Mächte beteiligt hatten, war am 15. Februar 1763 durch einen Friedensvertrag beendet worden, der vorsah, dass alles so blieb, wie es vor dem Kriege gewesen war. Als Friedrich II. von Preußen Ende März nach Berlin zurückkehrte, das er sechs Kriegsjahre hindurch nicht gesehen hatte, fühlte er sich nicht als Sieger und wich den Feierlichkeiten, die man für ihn vorbereitet hatte, aus. Ungesehen ließ er sich ins Stadtschloss fahren und trauerte möglicherweise den vielen Opfern seiner Kriege nach.
Abb.2: Kirche und Geburtshaus Jean Pauls in Wunsiedel. Stahlstich von Franz Hablitschek nach einer Zeichnung von G. Könitzer
Der wenige Wochen zuvor geborene Johann Paul Friedrich Richter, der zu Hause Fritz gerufen wurde und sich später als Autor Jean Paul nannte, gehörte zu dieser Zeit nicht zu des Königs Untertanen. Wunsiedel, sein Geburtsort, war Teil des Fürstentums Bayreuth, das seit dem späten Mittelalter zwar auch von Hohenzollern regiert wurde, aber von denen der weniger bedeutenden fränkischen Linie, deren letzter kinderloser Spross das inzwischen mit Ansbach vereinigte Ländchen 1791 an seine preußischen Verwandten für eine lebenslange Rente abgeben wird. Doch nur bis 1806 wird Ansbach-Bayreuth bei Preußen bleiben, dann wird es der siegreiche Napoleon an Bayern verschenken, wo es bis auf unsere Tage verblieb.
Wesentlichen Einfluss auf Jean Pauls Leben und Denken haben diese Staatsangehörigkeitswechsel nicht ausüben können, wohl aber die Tatsache, dass das Umfeld, in dem er aufwuchs, das armer Leute war.
Wohlgeruch der Kindheitsjahre
Jean Paul war Sohn und Enkel von Schulmeistern, und das hieß damals: von Hungerleidern. Sein Großvater verdiente als Rektor im oberpfälzischen Städtchen Neustadt am Kulm 150 Gulden im Jahr. »Sein Schulhaus war ein Gefängnis, zwar nicht bei Wasser und Brot, aber doch bei Bier und Brot; denn viel mehr als beides – und etwa frömmste Zufriedenheit dazu – warf ein Rektorat nicht ab.« Und an dieser »Hungerquelle für Schulleute stand der Mann 35 Jahre lang«.
Jean Pauls Vater war es anfangs nicht besser ergangen. Auf dem Gymnasium in Regensburg hatte er sich als Kostgänger der Kirche, Alumnus genannt, durchhungern müssen, hatte als Student der Theologie in Jena und Erlangen weiter gehungert und dann, da Stellen für Pfarrer und Lehrer rar waren, zehn Jahre irgendwo bei Bayreuth als Hauslehrer gedient. Als er sich 1760 endlich eine Stelle als Lehrer und Organist in Wunsiedel für geliehene fünf Gulden erkaufen und seine Braut Sophia Rosina Kuhn, die Tochter eines Tuchmachers aus Hof, heiraten konnte, war er schon 32 und noch ärmer dran als der Großvater, weil er nicht Rektor war, auch nicht Subrektor, sondern nur Tertius, also dritter Lehrer, dessen Jahresgehalt von 119 Gulden zum Erhalt einer Familie nur reichte, wenn Taufen, Hochzeiten und Leichenfeiern zusätzliches Kleingeld für das Orgelspiel brachten oder die Zahl der Schüler, die den Schulgroschen zahlten, wuchs. Nur für die Kinder der Ärmsten der Armen war der Schulbesuch kostenlos.
Die theologische Laufbahn hatte Jean Pauls Vater nur eingeschlagen, weil armen Studenten kein anderer Studienzweig offengestanden hatte, seine Liebe aber hatte der Musik gehört. Sein Talent dafür hatte sich schon in der Schulzeit gezeigt. Der Gymnasiast hatte in der Kapelle des Fürsten von Thurn und Taxis am Klavier mitwirken können, und später als Pfarrer hatte er selbst Kirchenmusik komponiert. Um aber den Schritt in die unsichere Existenz eines Künstlers zu wagen, hatte es ihm an Selbstverwirklichungswillen gemangelt, der seinem ältesten Sohn dann in starkem Maße zuteil geworden war. Unglücklich aber war er nicht darüber geworden, er hatte sich vielmehr als eindrucksvoller Prediger bewährt. Da er sich aber auch in Gesellschaften als unterhaltsamer Plauderer erwiesen hatte, war ihm die Gunst der Freifrau von Plotho auf Zedtwitz zuteil geworden, die ihm eine ihrem Patronat unterstehende Pfarrstelle verschafft hatte, von der seine Familie leichter als in der Wunsiedeler Lehrerstelle zu ernähren war.
Am 1. August 1765 bezogen also der Pfarrer Richter, seine Frau Rosina, der zweieinhalbjährige Friedrich und sein einjähriger Bruder Adam das Pfarrhaus des bei Hof gelegenen Dorfes Joditz, das Jean Paul in seiner späten Autobiographie sein »Erziehdörfchen« nannte, weil sich in ihm seine Weltsicht ausgebildet hatte, die für eine Seite seines doppelgesichtigen Werkes und für manche seiner Lebensentscheidungen ausschlaggebend war. Seine Herkunft von armen Leuten und sein Behagen an dörflicher oder kleinstädtischer Enge wollte und konnte er nie verleugnen, so dass er später in Weimar dem Patriziersohn Goethe als ein wunderliches Wesen erscheinen musste und Schiller von ihm sagte: »Fremd wie einer, der aus dem Mond gefallen ist«.
Abb.3: Joditz an der Saale. Aquarell von König. 1788
In seiner fragmentarischen Autobiographie hat der alte Jean Paul später seine Kindheit in Joditz als Idylle geschildert, die in den Einzelheiten aber oft wenig Idyllisches hat. Da dort erst sein bewusstes Leben begonnen hatte und er dort auch »das Wichtigste für den Dichter«, nämlich »das Lieben« erlernt hatte, schien ihm das Dorf sein wahrer, nämlich geistiger Geburtsort zu sein. Die Sächsische Saale, »gleich mir am Fichtelgebirge entsprungen, war mir bis dahin nachgelaufen« und schien ihm »das Schönste, wenigstens das Längste« des Dorfes zu sein. Sie »läuft um dasselbe an einer Berghöhe vorüber; das Örtchen selber aber durchschneidet ein kleiner Bach«. Er erwähnt an Gebäuden neben einem »gewöhnlichen Schloss« und der Kirche nur das Pfarrhaus, in dem er vom dritten bis zum 13. Lebensjahr wohnte, den Tod zweier jüngerer Schwestern erlebte und auch sein Schreib- und Leseleben begann. Später daran zurückdenkend, spürte er noch den »Wohlgeruch verwelkter Kindheitsjahre«, grüßte aus zeitlicher Ferne die Dorfleute, und da sein Leben lang immerfort irgendwo Kriege tobten, wünschte er ihnen: »Jede Schlacht ziehe weit von ihnen vorbei«.
Es war die sorgloseste Zeit seines Lebens, ärmlich, doch ohne Not. Zwar hatte die stets wachsende Familie nicht genug Betten, so dass der jüngere Bruder Gottlieb beim Adam und der Fritz beim Vater schlafen musste, aber das Einkommen des Vaters hatte sich fast verdoppelt, und man war zum Selbstversorger geworden, weil die Pfarre, zu der fünf Orte gehörten, auch Acker und Weiderechte besaß. In den zum Pfarrhaus gehörenden Ställen standen Rinder und Schweine, auf dem ummauerten Hof lärmten Hühner und Gänse, und zwei Mägde, die in der Gesindestube schliefen, gingen der Hausfrau zur Hand. Die Bauern des Dorfes, die nicht nur für den Gutsherrn, sondern auch für die Kirche zu fronen hatten, mussten die Feldarbeit machen, bei der der Pfarrer, der sie beaufsichtigte, ein wenig half. Dass auch der älteste Sohn manchmal mit anpacken musste, war selbstverständlich, änderte aber nichts an der Ausnahmestellung, die er unter den Kindern des Dorfes besaß.
Da der Pfarrer nicht nur geistliche Aufgaben zu erfüllen hatte, sondern als Standesbeamter wirkte, der Leumundszeugnisse auszustellen hatte und die Rekrutierungslisten führte, wurde ihm im Dorf mit Respekt begegnet, was in seinem Sohn schon früh das Bewusstsein weckte, anders als die anderen Dorfkinder, nämlich privilegiert zu sein. Das verschärfte einerseits die Isolierung, in der er von seinem Vater gehalten wurde, machte sie andererseits aber auch erträglich, weil es ein unerschütterliches Selbstvertrauen in ihm weckte, das als starkes Ich-Bewusstsein in Erscheinung trat. Dessen Erwachen beschrieb er später wie einen mystischen Vorgang, wie einen plötzlichen Akt der Emanzipation von allem, was ihn umgab. »An einem Vormittag stand ich als ein sehr junges Kind unter der Haustür und sah links nach der Holzlege, als auf einmal das innere Gesicht, ich bin ein Ich, wie ein Blitzstrahl vom Himmel vor mich fuhr und seitdem leuchtend stehen blieb: da hatte mein Ich zum ersten Male sich selber gesehen und auf ewig.«
Unbewusst war diese Selbstvergewisserung auch gegen den Vater gerichtet, dessen Erziehung auf Einordnung in die Hierarchie der Gesellschaft gerichtet war. Um den Jungen in die Rolle des Pfarrersohns einzuüben, ließ er ihn sonntags den »Fronbauern der Woche« das »gesetzmäßige Halbpfundbrot samt Geld« austragen und nahm ihn zu Besuchen bei seinen Amtsbrüdern in den benachbarten Pfarrdörfern mit. Aus nichtigem Anlass nahm er ihn aus der Dorfschule, die der Junge gern besucht hatte, um ihn zu Hause selbst zu unterrichten, rühmte sich oft seiner guten Beziehungen zur Gutsherrschaft und stärkte im Sohn das Bewusstsein, von deren Gnade abhängig zu sein.
Diese Abhängigkeit war tatsächlich vorhanden, da der grundbesitzende Adel, der keine Steuern zu zahlen hatte, nicht nur die von ihm abhängigen Bauern beherrschte, sondern im Gutsbezirk auch die Polizeigewalt ausübte, die niedere Gerichtsbarkeit innehatte und neben der Schulaufsicht auch das Patronat über die Kirche besaß. In Preußen, wo Friedrich Wilhelm I. im Interesse der Souveränität des Königs die politische Macht des Adels gebrochen hatte, blieb dessen Vorherrschaft doch innerhalb der Gutsbezirke bestehen. In Kleinstaaten wie Ansbach-Bayreuth hatte der Adel sich teilweise den Fürsten noch nicht völlig untergeordnet, so dass 1791, als das Fürstentum preußisch wurde, der Kabinettsminister von Hardenberg in einigen Fällen erst mit militärischer Gewalt drohen musste, ehe sich der Adel zur Huldigung des Preußenkönigs entschloss. Auch als verordnet wurde, dass in den Kirchen das Gebet für den König vor dem für den Gutsherrn zu stehen habe, stieß das beim Adel auf Widerstand.
Über die gutsherrliche Willkür bei der Berufung von Pastoren und Lehrern kann man viel Erschreckendes oder auch Lustiges in der Satirenliteratur der Zeit nachlesen, und auch in Jean Pauls Werken kommt dergleichen vor. Im »Wutz« hat das Schulmeisterlein seinen Posten nur dem Umstand zu danken, dass der Kirchenpatron für seinen Koch, dem er die Stelle eigentlich zugedacht hatte, keinen Ersatz finden konnte, und im »Quintus Fixlein« hängt die Vergabe der Pfarrstelle von einem Hundenamen ab.
Für Jean Pauls Vater war diese Abhängigkeit selbstverständlich, also kein Grund zur Kritik. »Gleich einem alten lutherischen Hofprediger erkannte er die unabsehliche Größe des Standes wie das Erscheinen der Gespenster an, ohne vor beiden zu beben«, und die Bewunderung, die er der Herrschaft zollte, übte auch in den Kindern das Sichabfinden mit den Gegebenheiten ein. Wenn der Vater von einer Abendmahlsfeier der Herrschaft aus Zedtwitz zurückkam, wurden bei seinen bewundernden Erzählungen über »hohe Personen und deren Hofzeremoniell und über die Hofspeisen und Eisgruben und Schweizerkühe« Frau und Kinder in »das größte ländliche Erstaunen« versetzt. Sie konnten in des Vaters Erzählungen miterleben, wie »er selber aus dem Domestikenzimmer sehr bald zu dem Herrn von Plotho« gebeten wurde, wie er das Fräulein am Klavier unterweisen durfte und »stets seiner Munterkeit wegen zur Tafel gezogen wurde«, wo er dann unter den »bedeutendsten Rittergutsbesitzern des Vogtlandes« saß.
Einmal aber wurde der Junge, der den ummauerten Pfarrhof nur in Begleitung verlassen durfte, von seinem Vater auf das Schloss mitgenommen, durfte dort, trunken von all der Schönheit, zwischen den Laubengängen und Springbrunnen des Parks umhergehen und vor der hohen Person der Freifrau niederfallen und ihr den Rock küssen – eine Szene, nach der man ermessen kann, welche Gefühle Jean Paul später bewegten, als ihm, dem Dichter, die Ehrfurcht adliger Damen galt.
So selbstverständlich wie die Abhängigkeit von der Herrschaft war für den Jungen auch die Existenz von Gespenstern. Wenn die Mägde abends beim Spinnen Schauergeschichten erzählt hatten, lag er danach zitternd im Bett, bis sein Vater kam und sich neben ihn legte, und wenn ihm befohlen wurde, am Abend vor einem Begräbnis die Bibel an der aufgebahrten Leiche vorbei durch die dunkle Kirche zu tragen, war der mit überreicher Phantasie begabte Knabe lange völlig verstört. Die Schauerballaden, die damals gedichtet wurden, beschworen nicht vergangene, sondern im Volk noch gegenwärtige Ängste, denn die Aufklärung hatte vorwiegend nur die gebildeten Schichten erreicht. In Berlin wurden zum Schutz bei Gewitter noch bis 1783 die Glocken geläutet, noch gab es Teufelsaustreiber, und als 1775 zum letzten Mal in Deutschland eine Hexe verbrannt wurde, war der Pastorensohn Fritz zwölf Jahre alt.
Die Dorfschulen, die im Laufe des 18. Jahrhunderts in fast allen deutschen Staaten entstanden waren, lehrten neben den Fähigkeiten des Lesens, Schreibens und Rechnens vor allem Katechismusgebote, Kirchenlieder und Bibelsprüche, denn ihre Aufgabe war nicht, die Schüler zu gebildeten Bürgern zu machen, sondern zu Untertanen, die sowohl nützlich als auch gehorsam sind. Auch die dem Pfarrhaus gegenüberliegende Dorfschule, die der kleine Fritz Richter nicht lange besuchen durfte, wird mehr nicht geboten haben, und doch sehnte sich der Junge, der nun mit seinem Bruder Adam zusammen im Pfarrhaus vom Vater unterrichtet wurde, in die Gemeinschaft der Dorfjugend zurück. Grund dafür war wohl vor allem des Vaters Lehrmethode, die weder kindgemäß noch anschaulich war. »Vier Stunden vor- und drei nachmittags gab unser Vater uns Unterricht, welcher darin bestand, dass er uns bloß auswendig lernen ließ, Sprüche, Katechismus, lateinische Wörter und [Joachim] Langes [lateinische] Grammatik. Wir mussten die langen Geschlechtsregeln der Deklination samt den Ausnahmen nebst der beigefügten lateinischen Beispiel-Zeile lernen, ohne sie zu verstehen.« Rechnen aber wie auch Geschichte, Geographie und Naturkunde kamen in dem Lehrplan des Vaters nicht vor.
Während Adam, dem geistige Neugier fehlte, sich dieser Tortur verweigerte und dafür verprügelt wurde, blieb Fritz, der vor dem geliebten Vater mit Lernerfolgen glänzen konnte, immer von Schlägen verschont. Seine Lernbegierde aber war so nicht zu stillen. An einer in Latein verfassten Grammatik des Griechischen lernte er für sich allein griechische Buchstaben zu schreiben, versuchte sich an lateinischen Übersetzungen und las alles, was ihm greifbar wurde, darunter auch die »Bayreuther Zeitung«, deren Vierteljahresbände sich der Vater von der Gutsherrschaft lieh. Aus dieser Lektüre zog Jean Paul die Erkenntnis, dass sich Wahrheiten nicht aus der täglichen, sondern nur aus der bandweisen Zeitungslektüre herauslesen lassen, weil erst ein Band von ihr »Blätter genug zum Widerruf ihrer anderen Blätter gewinnt«.
Unter den wenigen Büchern, die ihm in der »geistigen Sahara-Wüste« des Dorfes zu »frischen grünen Quellenplätzchen« wurden, fand er den damals bereits 120 Jahre alten »Orbis pictus« des Tschechen Amos Comenius, der eigentlich Komensky hieß, besonders erwähnenswert. Dieses klassische, den heutigen Bilderlexika ähnliche Latein-Lehrbuch, mit dem auch Goethe gelernt hatte, führte in der deutschen Version den umständlichen Titel »Orbis sensualium pictus. Die sichtbare Welt, das ist: aller vornehmsten Weltdinge und Lebensverrichtungen Vorbildung und Benamung« und wurde in zeitgemäßen Erneuerungen und Übersetzungen in vielen Ländern Europas noch bis ins 20. Jahrhundert hinein benutzt. In ihm hatte Comenius nach seinem Grundsatz, dass nichts im Verstande sei, das nicht vorher im Sinne gewesen, zum ersten Mal konsequent die Anschauung zur Grundlage des Unterrichts gemacht. Hier konnte der mit unverstandenen lateinischen Vokabeln und Regeln traktierte Junge im Holzschnitt die Bedeutung des Gepaukten anschauen und gleichzeitig auch erfahren, wie man es im Deutschen benennt. Hier lernte er nicht nur den Satz: Infans ejulat – Das Kind wimmert, sondern sah auch das Bild mit dem Wickelkind in der Wiege, und wenn es hieß: Ventus fiat – Der Wind wehet, so konnte er aus Wolken ein dickbackiges Gesicht blasen sehen. Hier lernte er die Gestalten des Mondes – Phases lunae – kennen, lernte das Hausgeflügel Aves domestica nennen, konnte in Latein die Arbeit des Müllers und des Bergmanns verfolgen und wurde auch darüber belehrt, dass Gottes Auge über allen Dingen und Geschehnissen wacht.
Weniger als der »Orbis pictus« waren für den lernbegierigen und lesehungrigen Knaben die »Gespräche im Reiche der Toten« von David Faßmann geeignet, von denen der Vater einige Bände besaß. Fritz las sie durch, verstand davon wenig, konnte abends aber doch der ganzen Familie die Liebesgeschichte des türkischen Kaisers mit Roxelane erzählen, und der Vater, der sehr wohl wusste, das sein häuslicher Unterricht dem lerneifrigen Sohn nicht genügte, missbilligte diese Lektüre nicht. Sein Vorsatz, Fritz auf eine bessere Schule zu schicken, war mit seinen geringen Einkünften nicht zu verwirklichen, da die Zahl seiner Söhne inzwischen auf vier angewachsen war. Besserung der familiären Misere konnte nur eine besser bezahlte Pfarrstelle bringen, auf die man dann wirklich hoffen konnte, als der Amtsbruder im benachbarten Schwarzenbach an der Saale starb. Fritz war im 13. Lebensjahr, als die Freifrau von Plotho, die sich das dortige Kirchenpatronat mit dem Fürsten von Schönburg-Waldenburg teilte, sich erneut als Gönnerin des Vaters zeigte, so dass die Familie im Januar 1776 das Dörfchen, in dem Fritz seine Kindheit verlebt hatte, verließ.
Es war das erste Mal, dass der Junge von einem Ort, den er lieb gewonnen hatte, Abschied nehmen musste. Aber für Kinder, so sagte er später, »gibt es kaum Abschiede, denn sie kennen keine Vergangenheit, sondern nur eine Gegenwart«, die voll Zukunft ist.
Das gelehrte Kind
Der damalige Marktflecken Schwarzenbach an der Saale, der erst 1844 die Stadtrechte erwerben konnte, hatte etwa anderthalb Tausend Einwohner, darunter auch solche, von denen Fritz Richter sich Bücher ausleihen konnte, die er dann manchmal auch auf der Kirchenempore während der Predigt des Vaters las. Damals fiel ihm auch Defoes spannende Geschichte des »Robinson Crusoe« in die Hände, in der er miterlebte, wie sich fern der europäischen Ständegesellschaft ein Bürgerlicher durch Selbsthilfe und Gottvertrauen eine eigne Welt des Besitzes schafft. Seine Leselust, die ihn nie loslassen sollte, galt neben der Dichtung aber auch der Theologie, der Philosophie und manch anderem Wissensgebiet. Die Weltschau, die ihm der »Orbis pictus« in Holzschnitten geboten hatte, wurde durch die Lektüre bedeutend erweitert, und viele der damals geernteten Lesefrüchte wurden später in seinen Werken zu teils witzigen und erhellenden, teils aber auch lästigen Abschweifungen und Metaphern verwendet, prägten also seine unnachahmliche Art des Erzählens mit.
Abb.4: Schwarzenbach an der Saale. Lithographie 1840
Das Lesen ließ aber auch den Wunsch nach eigenem Bücherbesitz in ihm wachsen, und da das Geld dazu fehlte, half er sich selbst. Leere Seiten wurden zu kleinen Bänden zusammengeheftet, mit Texten aus Luthers Bibel beschrieben und so eine Bibliothek erschaffen, die dann später in veränderter Form in sein »Schulmeisterlein Wutz« überging. In dieser Erzählung nämlich schreibt sich Wutz, der bitterarm ist wie sein Schöpfer, die für ihn unerschwinglichen Neuerscheinungen, die ihm durch den Leipziger Messkatalog bekannt werden, mit eignen Ideen und eigner Hand selbst. So werden dort Lavaters »Physiognomische Fragmente« in der Version des vergnügten Schulmeisters neu geschrieben, und ein philosophischer Traktat über Zeit und Raum wird durch Wutz zur Abhandlung über Schiffsräume und »die Zeit, die man bei Weibern Mensis nennt«.
Die Schule in Schwarzenbach war der Joditzer Dorfschule darin ähnlich, dass sie nur einen Klassenraum hatte, in dem ständig das »Schreien, Summen, Lesen und Prügeln« sowohl der Abc-Schützen als auch der Lateiner zu hören war. Ihr Rektor aber, der noch einen Kantor zur Seite hatte, schien dem Pfarrer Richter so vertrauenswürdig, dass er ihm seinen wissensdurstigen Sohn zum Schüler gab. Unterrichtsstoff waren an dieser Schule fast ausschließlich die alten Sprachen, die der Rektor, der Karl August Werner hieß, in einer Methode unterrichtete, die kurz zuvor vom Philanthropen Basedow entwickelt worden war. In ihr wurde das Pauken von Grammatikregeln möglichst bald durch den praktischen Gebrauch der Sprache ersetzt. Während Basedow aber das Lateinische und Griechische im Gespräch zwischen Lehrer und Schüler übte, ging Rektor Werner im Latein gleich zur schwierigen Lektüre des Cornelius Nepos über, ließ im Griechischen das Neue Testament lesen und nahm sich ein Jahr später das Alte Testament auf Hebräisch vor. Fritz, der so lernbegierig war, dass er sich mit »Freuden wie ein Prinz von einem Halbdutzend Lehrer auf einmal« hätte unterweisen lassen, konnte diese Schwierigkeiten freudig und erfolgreich meistern und hatte auch in seiner Freizeit noch Vergnügen daran.
Bald konnte er das griechische und hebräische Testament mündlich so fließend ins Lateinische übersetzen, dass ihm der Lehrer kaum folgen konnte, und seine Vorliebe für das »hebräische Sprach- und Analysier-Gerümpel und Kleinwesen« verführte ihn wieder dazu, sich selber ein zusammengeheftetes Buch zu schreiben, und zwar eines, das jedes Wort der Bibel, angefangen mit dem ersten »Am Anfang«, sprachwissenschaftlich erklärt. Zwar wurde das riesige Werk bald wieder fallengelassen, aber Spuren davon sind im »Quintus Fixlein« zu finden, wo dieser sich am Suchen nach falsch gedruckten hebräischen Buchstaben erfreut.
Wichtiger als die Schule aber wurden für den Heranwachsenden zwei junge Theologen, durch die er in Berührung mit modernen Denkrichtungen kam. Sie vertraten nämlich die rationalistische Theologie der Aufklärung, die sogenannte Heterodoxie, die von der offiziellen Kirchenlehre, der Orthodoxie, abwich und für Fritz, der sich bisher in Glaubensfragen nur an der Autorität des Vaters orientiert hatte, eine neue Erfahrung war.
Der Kaplan Johann Samuel Völkel, ein Amtsbruder des Vaters, fand Freude daran, dessen begabten Sohn zusätzlich zu unterrichten und opferte seine tägliche Mittagspause dafür. Sein Geographieunterricht erschöpfte sich darin, Landkarten aus dem Kopf zeichnen zu lassen, seine theologischen Unterweisungen aber wiesen das Denken des Schülers in die Richtung der Aufklärung, der Jean Paul dann treu blieb sein Leben lang. Er bekam Gottscheds schon etwas angestaubte »Ersten Gründe der gesamten Weltweisheit« zu lesen, in denen der später verspottete Literaturpapst der dreißiger Jahre sein vernunftbestimmtes Christentum ausgebreitet hatte, das für den Schüler »bei aller Trockenheit und Leerheit« doch erhellend war. Noch mehr aber galt das für modernere Theologen wie Jerusalem und Nösselt, die die kirchlichen Dogmen kritisierten und die Erbsündenlehre verdammten, weil die dem Glauben der Aufklärer an die Bildungsfähigkeiten des Menschen widersprach.
Der zweite für ihn wichtige Theologe, der sich im Laufe der Jahre vom Lehrer zum Freund wandeln sollte, hieß Erhard Friedrich Vogel und war Pfarrer in Rehau, einem benachbarten Dorf. Er war ein fröhlicher Mensch mit umfassender Bildung und besaß viele Bücher, die Fritz nun stapelweise von ihm entlieh. Damit begann für ihn eine Zeit des planlosen Viellesens, die auch eine des seitenlangen Abschreibens war. Der Grundstock für seine uferlos anschwellende Sammlung von Exzerpten, die er später für seine Prosawerke verwenden sollte, wurde hier schon gelegt. Er las Bücher aller Wissensgebiete, vorrangig aber Werke der Philosophie und der theologischen Aufklärung, deren erste Wirkung die Entfremdung vom Vater war.
Abb.5: Pfarrer Erhard Friedrich Vogel. Gemälde in der Friedhofskirche Wunsiedel
Zu einem Bruch aber kam es nicht mehr, da den Vater, kurz nachdem er dem Sechzehnjährigen den Besuch des Gymnasiums in Hof erlaubt hatte, im April 1779 der Tod ereilte und er seiner Witwe und den minderjährigen Söhnen nichts als Schulden hinterließ.
Übungen
Der in familiärer Isolation aufgewachsene, ins Lesen und Studieren vernarrte Junge, dessen Herkunft vom Lande schon seine Kleidung zeigte, hatte es im städtischen Gymnasium von Hof anfangs nicht leicht. Bereits in der ersten Französischstunde musste er das Hohngelächter der ganzen Klasse über sich ergehen lassen, weil er zu vertrauensselig gewesen war. Ihm war nämlich von einem Mitschüler namens Reinhart gesagt worden, dass es sich für einen Neuling gehöre, dem Lehrer zu Beginn der Stunde die Hand zu küssen, und da er diese veraltete Art der ehrerbietigen Begrüßung von seiner Familie her kannte, war er tatsächlich nach vorn gegangen und hatte dem verdutzten Lehrer die nur widerwillig gelassene Hand geküsst. Monsieur Janicaud, ein ehemaliger Tapetenwirker, der den Schülern mit Hilfe des einzigen vorhandenen Lehrbuches sein schlechtes Französisch beibrachte, hatte das für eine bewusste Frechheit gehalten, war zornig geworden und aus der Klasse gelaufen, während der Neue dem Gelächter der Schüler ausgesetzt war.
Abb.6: Hof. Radierung von Johann Christian Philipp Tretscher um 1790
Von der Stadt Hof, die damals etwa 4 000 Einwohner hatte, war als Heimat der Mutter schon in Joditz oft die Rede gewesen, und manchmal hatte Fritz auch den zweistündigen Fußweg dorthin machen müssen, um »Fleisch und Kaffee und alles zu holen, was im Dorfe« nicht zu haben gewesen war. Bei diesen gelegentlichen Besuchen war ihm die Stadt wunderbar und aufregend erschienen, jetzt, da er selbst darin lebte, bekam er auch ihre Schattenseite zu spüren, die vor allem im engen, konventionsverhafteten Denken ihrer Bewohner bestand. Seinen geistigen Bedürfnissen begegneten sie mit Unverständnis, und seine schulischen Erfolge, die ihn mit Stolz erfüllten, setzten ihn in ihren Augen, weil sie daran vor allem sein Anderssein erkannten, eher herab. Bei einer Übung im Diskutieren, die die Schüler zur Verteidigung der kirchlichen Dogmen befähigen sollte, hatte Fritz Richter den Opponenten zu spielen, und da er, der eine ganze Bibliothek heterodoxer Schriften im Kopfe hatte, sie so überzeugend spielte, dass die Unhaltbarkeit der orthodoxen Lehre bewiesen worden wäre, hätte der erschrockene Lehrer die Übung nicht vorzeitig abgebrochen, galt der Pastorensohn den Hofern fortan als Atheist.
Wenig später versuchte der zum jungen Mann Heranwachsende sich seinen Kummer in einem Roman von der Seele zu schreiben, dessen Unwert er selbst bald erkannte und ihn wieder verwarf. In ihm beklagt sich der Ich-Erzähler über seine Lehrer, die »ihrem Verstande nichts bedeutende Nahrung geben« und ihr »Herz verwelken« lassen, und er bezeichnet die Schüler als bloße Kopien von ihnen, die noch unerträglicher sind. »Man äft mich«, heißt es dann weiter, »denn ich bin fremd. Ich bin zu offenherzig, darum hält man mich für einen Einfältigen – darum werd’ ich so oft betrogen. … Ich leb’ unter den Leuten so hin. Ich befürchte gar, ihnen ähnlich und mir unähnlich zu werden«, – aber diese Befürchtung war unnötig, weil der junge Autor, der seine geistige Überlegenheit durchaus zu schätzen wusste, zur Anpassung ans Mittelmaß weder willens noch fähig war.
Das zeigten auch seine zwei öffentlich gehaltenen Schulreden, in denen er sich zwar dem konservativen Geist der Schule weitgehend annäherte, sein wahres Denken aber doch ein wenig verriet. Als der Sechzehneinhalbjährige im Oktober 1779 zur Geburtstagsfeier für die Mutter des regierenden Markgrafen die Festversammlung über »Den Nutzen des frühen Studiums der Philosophie« aufklärte, widerlegte er erst die gängigen Behauptungen, dass die Philosophie »vom Lernen der Sprachen abhalte, den Kopf mit unnötigen Grübeleien erfülle und den Körper durch Nachdenken schwäche«, warnte sowohl davor, alles besser wissen zu wollen, als auch allem Althergebrachten ohne Prüfung Glauben zu schenken, um zum Schluss den Hofer Mitbürgern weiszumachen, dass das Philosophieren ihnen auch Vorteile bringen könne. »Und gesetzt, es gäbe einen, dem das Erkennen der Wahrheit kein Ergötzen verschaffte, in dessen übereisten Herzen kein Funke Wahrheitsliebe mehr glimmte, – gesetzt, er wäre gegen dieses alles unempfindlich, so wird ihn doch sein eigner Vorteil und seine Eigenliebe bewegen, die Philosophie, die verehrungswürdigste der Wissenschaften, zu treiben«, lautet sein letzter Satz.
Die Philosophie, die sein Leben immer begleiten sollte, war auch Thema der Rede, die er 1780 zum Abschluss seiner Schulzeit hielt. »Über den Nutzen und Schaden der Erfindung neuer Wahrheiten« unterrichtete er nun seine Zuhörer, die er nach den Regeln der Ständegesellschaft mit »nach Stand und Würden allerseits höchst- hoch- und wertgeschätzte Anwesende!« anredete und ihnen mit aller gebotenen Vorsicht klarzumachen versuchte, dass auch in Philosophie und Theologie ein Fortschreiten möglich und nötig sei. Zwar seien einerseits »all die Voltaire’s, die Hume’s, die Lamettrie’s und ihre ganze Reih’« nur dazu nützlich, den wahren Denkern Anlass zur Verteidigung der Religion zu geben, doch müsse man andererseits auch jene verwerfen, die glaubten, dass alles Althergebrachte unwiderleglich sei. »Wenn nun alle so gedacht hätten, wären wir iezt noch auf dem Punkt, wo Noah und seine Söhne in den Wissenschaften standen.« Nur müsse man sich davor hüten, in der Begierde nach Neuerungen zu weit zu gehen.
Aus diesen Tagen des Schulabschlusses im Oktober 1780 ist auch der Schluss eines Briefes überliefert, der den altklugen Redner von seiner anderen, nämlich der gefühlvollen Seite zeigt. Da wird das Ende von Kindheit und Schulzeit betrauert, an Mondscheinnächte an der Saale erinnert, Abschiedsschmerzen vorweggenommen, Sterbegedanken erwogen, und bei der Anspielung auf Sternes »Empfindsame Reise« werden Tränen geweint. Es ist der erste von den etwa fünftausend Briefen und Briefkonzepten, die von Jean Paul erhalten geblieben sind. Gerichtet war dieser Brief an den Freund Adam Lorenz von Oerthel, den ältesten Sohn eines wohlhabenden und als geizig verschrienen Hofer Kaufmanns, der erst 1774 mit den nördlich von Hof gelegenen Gütern Töpen, Hohendorf und Tiefendorf zusammen den Adel erworben hatte und mit dem kränkelnden Sohn, der, statt Geschäftssinn zu entwickeln, für empfindsame Dichtungen schwärmte, höchst unzufrieden war. Während Fritz Richter bei den Großeltern wohnte, stand Oerthel, dessen Eltern auf der Besitzung in Töpen lebten, ein Gartenhaus an der Saale zur Verfügung, von dem aus ein Blick auf die Flussniederung zu genießen war. Hier saßen die Freunde oft bei Gesprächen, Gesang und Klavierspiel zusammen und schwelgten in Mondscheinnächten in ihren verworrenen Gefühlen, in denen sich Sehnsucht nach Liebe mit literarisch inspirierter Naturschwärmerei und Todesahnung verband. Oerthel hatte an der unglücklichen Liebe zu einer Amtmannstochter aus dem benachbarten Dorf Venska zu leiden, Richter dagegen war nur mit Büchern beschäftigt, schrieb in dieser Zeit aber eine Liebesgeschichte, die der Liebeskummer des Freundes vielleicht angeregt hatte, die mit Sicherheit aber Frucht seiner Lektüre war.
Der missglückte kleine Roman, der nur den Freunden bekannt wurde, gehörte zu der Flut von literarischen Ergüssen, die Deutschland überschwemmt hatte, nachdem 1774 Goethes Roman »Die Leiden des jungen Werthers« erschienen war. Dieses Buch hatte den bürgerlichen Lebensstil so nachhaltig beeinflusst, dass besonders die jungen Leute wie Werther zu fühlen und zu denken versuchten, in seinem Stil Briefe schrieben und sich auch kleideten wie er. Da auch Selbstmorde in Werthers Manier vorkamen, fühlten sich Pastoren zu Predigten gegen das Buch verpflichtet, der Berliner Aufklärer Friedrich Nicolai schrieb eine witzlose Parodie gegen das Werther-Fieber, und wie bei jeder literarischen Sensation gab es unter den Schriftstellern Nachahmer, deren erfolgreichster Johann Martin Miller hieß.
Der Schwabe Miller, der als Student in Göttingen die Dichtervereinigung »Hainbund« mitgegründet und zu Volksliedern gewordene Verse wie das noch heute lebendige »Was frag ich viel nach Geld und Gut,/Wenn ich zufrieden bin« gedichtet hatte, war später als Pfarrer und Gymnasiallehrer in Ulm zum Schreiber rührseliger Romane geworden, unter denen »Siegwart, eine Klostergeschichte« die meisten Leser fand. Die etwas verworrene Liebestragödie, die auch Richter und seine Hofer Freunde zu Tränen rührte, endet damit, dass der Titelheld auf dem Grab der Geliebten erfriert.
Sowohl Goethes »Werther« als auch Millers »Siegwart« führten dem achtzehnjährigen Richter die Feder, als er seine »Abelard und Heloise« betitelte Nachahmung verfasste, an dessen Ende der Versuch des Titelhelden, auch den Kältetod am Grabe der Geliebten zu erleiden, scheitert, und er nun wie Werther zur Pistole greifen muss. »Leb wol! Es schlägt zwölf aus! Lebwol! Oh Mordgewer! zerspalte dieses Gehirn – – – Got! im Himmel steh’ dem leidenden Geschöpf bei! Jesu! erbarme dich bald des Elenden, nim seine Sel’ in deine Hände! Und du, o Geist Heloises! steh mir bei! Bald seh ich! Hilf Vater! Mein Got! Oh! – oh! – – –!«
Originell ist in dieser ersten erzählenden Arbeit, die erst im 20. Jahrhundert vollständig gedruckt wurde, nur die eigenmächtige Rechtschreibung, die sich Jean Paul erst im 41. Lebensjahr wieder abgewöhnt hat. Nach ihren Regeln, die ihr Erfinder aber nicht immer befolgte, wurde zum Beispiel auf Doppelkonsonanten, Doppelvokale und das Dehnungs-h verzichtet und das j durch ein i ersetzt. Statt Gott schrieb er also Got, statt Gewehr Gewer, aus jetzt wurde iezt und vieles Schrullige mehr. (Zur Erleichterung der Lektüre werden aber auf den folgenden Seiten die Zitate behutsam modernisiert.)
Von der Orthographie abgesehen war aber alles an dem kleinen Roman den Vorbildern nachempfunden, die der Verfasser in seiner Nachrede auch benennt. Autobiographisches ist wenig in ihm zu finden, sieht man von den oben schon erwähnten Bemerkungen über Lehrer und Schüler ab. Für den Erzähler Jean Paul hatte dieser missglückte Erstling kaum eine Bedeutung. Schon sieben Monate nach seiner Fertigstellung fiel sein Urteil über ihn vernichtend aus. »Dieses ganze Romängen ist ohne Plan gemacht, die Verwicklung fehlt gänzlich und ist alltäglich und uninteressant. Die Charaktere sind nicht so wohl übel geschildert, als gar nicht geschildert. Man sieht von Abelard und von der Heloise nichts als das Herz: man weiss nichts von ihrem Verstande; es ist keine ihrer Neigungen ausgemalt; nicht einmal die Empfindung der Liebe ist wahr dargestellt. Überdies ist alles überspannt …«
Geschrieben wurde der »Abelard« für den Freund Oerthel im Januar 1781, als Richter für drei Monate zu Mutter und Brüdern nach Schwarzenbach zurückgekehrt war. Da er die Schulzeit beendet, das Studium aber noch nicht begonnen hatte, war er jetzt das, was man damals, nach dem lateinischen Wort für Maultier, einen Mulus nannte, also weder Pferd noch Esel, weder Schüler noch Student. Er hatte also ein Vierteljahr Ferien und nutzte sie zu seinem Vergnügen, was für ihn hieß: er las und schrieb. Seine Lektüre waren weiterhin vor allem philosophische und theologische Werke, die er aus der Bibliothek des Pfarrers Vogel in Rehau entleihen konnte, und neben Exzerpten, die er als Hilfen für künftige Arbeiten aufbewahrte, schrieb er Aufsätze über unterschiedliche Themen, wie den Gottesbegriff, die Religionen der Welt, das Perpetuum mobile oder Narren und Weise, die er dann zu Bänden zusammenfasste und ihnen den Titel »Übungen im Denken« gab. In einem Vorwort, Anzeige genannt, machte er deutlich, dass es sich dabei für ihn tatsächlich nur um Übungen handelte. »Diese Versuche sind nur für mich«, heißt es da. »Sie sind nicht gemacht, um andere etwas Neues zu lehren. Sie sollen mich bloß üben, um’s einmal zu können. Sie sind nicht Endzweck, sondern Mittel – nicht neue Wahrheit selbst, sondern der Weg, sie zu erfinden.«
Und diese »Übungen«, zu denen dann noch die »Rhapsodien« kamen, nahmen so schnell kein Ende. Ehe aus dem schreibfleißigen jungen Mann, der seine Stoffe nicht aus dem Leben, sondern aus Büchern schöpfte, der Meistererzähler Jean Paul wurde, sollten noch etwa zehn Jahre vergehen.
Reiterstück und Hungertuch
Falls der erste und letzte Ritt Fritz Richters sich so zugetragen haben sollte, wie es Jean Paul im Kapitel »Reiterstück« seiner »Flegeljahre« beschreibt, war es noch früh am Morgen, als der Mulus, in seinen besten Rock gekleidet, den Hut auf dem Kopf und die Reitgerte in der Hand, unter den Augen der Nachbarn dem alten Schimmel näher trat. Obwohl er sich am Vortag schon eingeprägt hatte, von welcher Seite er aufsteigen musste, um reitend nach vorn blicken zu können, misslangen mehrere Versuche hinaufzukommen, und als er endlich saß, die Rockschöße glattgestrichen, die Füße in die Steigbügel geschoben und den Zügel ergriffen hatte, war das Pferd nicht zu bewegen, auch nur einen Schritt vorwärtszugehen. Hiebe mit der Gerte halfen so wenig wie Handschläge der Mutter. Erst als einer der Brüder mit dem Stiel der Heugabel zuschlug, bequemte sich das Tier zu einigen Schritten, blieb aber unter dem Gelächter der Zuschauer am Bach wieder stehen.
Abb.7: Bayreuth, Ansicht von Westen 1809. Gezeichnet von Johann Gottfried Koeppel, gestochen von Paul Wolfgang Schwarz
Dieser Ritt, der Richter sauer wurde, hatte ihn von Schwarzenbach zum Konsistorium nach Bayreuth zu bringen, wo er sich die Erlaubnis erwirken wollte, statt sein Studium an der Landesuniversität in Erlangen zu beginnen, ins Ausland, nämlich nach Leipzig zu gehen. Alten feudalen Bräuchen entsprechend musste zum Konsistorium geritten werden, was für den lebenslang bürgerlich Denkenden, der danach nie wieder ein Pferd besteigen sollte, eine Zumutung war. Er wurde ein leidenschaftlicher Fußgänger, der die Anstrengungen tagelanger Märsche besser ertrug als die Strapazen des Reitens oder die der Postkutschen, in denen man den Tücken ungepflasterter Straßen ausgesetzt war. Mühsam mussten sich die Kutschenpferde durch tiefen Sand und aufgeweichten Lehm quälen oder Strecken von Geröll überwinden. Oft ging es so langsam, dass man nebenher gehen konnte. Auf den Poststationen, wo die Pferde gefüttert oder ausgewechselt wurden, musste oft stundenlang gewartet werden, bis die Fahrt in den ungefederten Wagen, die auch dem Lastentransport dienten, wieder weiterging. Auf den oft tagelangen Fahrten saß man eingequetscht zwischen Paketen und Briefsäcken und war dem Staub, der Kälte oder der Hitze ausgesetzt. War man wohlhabend genug, reiste man deshalb lieber mit Extrapost oder der Lohnkutsche – was aber für den Mulus Richter, als er im Mai 1781 zum Studium nach Leipzig reiste, nicht in Frage kam.
Fünfzehn Jahre vor ihm war Johann Wolfgang Goethe, einen ansehnlichen Wechsel in der Tasche, in einer bequemen Mietkutsche von Frankfurt am Main zum Studium nach Leipzig gefahren, hatte keine Studentenbude, sondern gleich mehrere Zimmer gemietet, sich der neuesten Mode entsprechend eingekleidet, durch Empfehlungsschreiben Zutritt zur besseren Gesellschaft gefunden und mehr als die Wissenschaften das Leben studiert. In der reichen Handelsstadt mit ihren modernen Gebäuden fühlte er sich schnell heimisch, Richter dagegen, der am Wohlstand der Stadt keinen Anteil hatte und in ihrer Umgebung die heimatlichen Berge vermisste, wurde unglücklich in ihr.
Er war arm und hatte das in Latein auch schriftlich. Das Testimonium Paupertatis, das Armutszeugnis, das ihm der Gymnasialdirektor in Hof ausgestellt hatte, lautete übersetzt so: