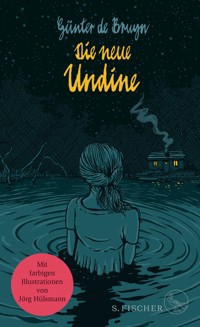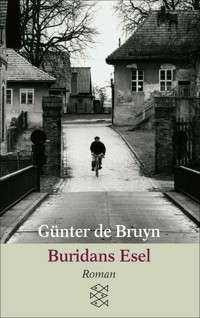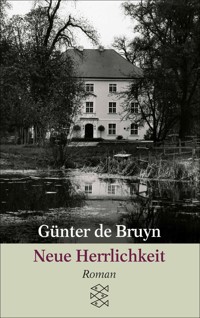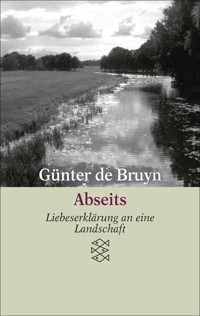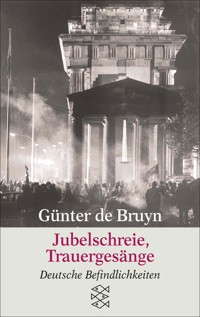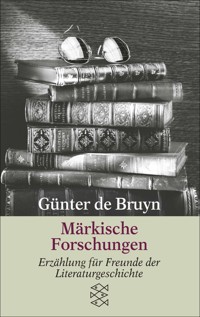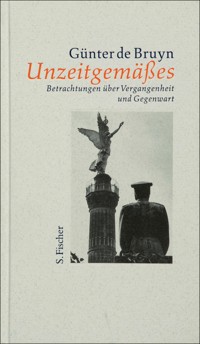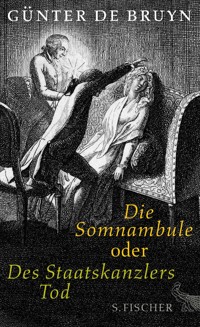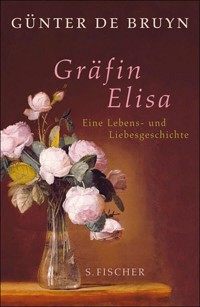9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte aus der deutschen Gegenwart Wittenhagen in Brandenburg: Hedwig Leydenfrost lebt zusammen mit ihrem Bruder Leonhardt, einem pensionierten Bibliothekar, im Dorf ihrer Kindheit. Die Familie will im kommenden Sommer Hedwigs neunzigsten Geburtstag feiern und das Fest mit einer Spendenaktion für Flüchtlinge verbinden. Es ist das Jahr, in dem die Kanzlerin sagt: »Wir schaffen das.« Die Monate vergehen, es wird Winter und bitterkalt in der märkischen Provinz. Auf Eis und Schnee folgt die Schlehen- und Apfelblüte. Die Jahreszeiten wechseln sich ab, das große Fest für Hedwig Leydenfrost rückt immer näher. Der letzte Frühling, der letzte Sommer vielleicht nach einem langen Leben ... Erstmals seit über dreißig Jahren, nach seinen hochgelobten autobiographischen und kulturgeschichtlichen Büchern über Brandenburg und Preußen, erzählt Günter de Bruyn wieder eine Geschichte aus der deutschen Gegenwart. Es ist eine bewegende Geschichte über das Leiden an der Politik, über den Wert unserer Erinnerung und eine fremd gewordene Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Günter de Bruyn
Der neunzigste Geburtstag
Ein ländliches Idyll
Über dieses Buch
Wittenhagen in Brandenburg: Hedwig Leydenfrost lebt zusammen mit ihrem Bruder Leonhardt, einem pensionierten Bibliothekar, im Dorf ihrer Kindheit. Die Familie will im kommenden Sommer Hedwigs neunzigsten Geburtstag feiern und das Fest mit einer Spendenaktion für Flüchtlinge verbinden. Es ist das Jahr, in dem die Kanzlerin sagt: »Wir schaffen das.« Die Monate vergehen, es wird Winter und bitterkalt in der märkischen Provinz. Auf Eis und Schnee folgt die Schlehen- und Apfelblüte. Die Jahreszeiten wechseln sich ab, das große Fest für Hedwig Leydenfrost rückt immer näher. Der letzte Frühling, der letzte Sommer vielleicht nach einem langen Leben …
Erstmals seit über dreißig Jahren, nach seinen hochgelobten autobiographischen und kulturgeschichtlichen Büchern über Brandenburg und Preußen, erzählt Günter de Bruyn wieder eine Geschichte aus der deutschen Gegenwart. Es ist eine bewegende Geschichte über das Leiden an der Politik, über den Wert unserer Erinnerung und eine fremd gewordene Zeit.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Büro KLASS, Hamburg
Coverabbildung: Steven Ritzer / EyeEm / Getty Images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490897-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
1.
Der Plan, Hedwig Leydenfrosts neunzigsten Geburtstag festlich zu gestalten, war erstmals erörtert worden, als man ihres neunundachtzigsten Geburtstages wegen bei ihr zusammensaß. Nur sie selbst war anfangs dagegen gewesen, weil ihr das Gefeiertwerden zeitlebens peinlich und lästig gewesen war. In ihren politisch aktiven Jahren, als es sich manchmal nicht hatte vermeiden lassen, war dieser Tag für sie ein verlorener gewesen, ein unnützer Aufwand an Zeit, Kraft und Geld. Dass ihr die feiernd vergeudeten Stunden auch im Alter noch fehlen werden, wagte sie auch jetzt gegen das Vorhaben einzuwenden, obwohl jeder das lächerlich finden musste, weil der im Ruhestand Lebenden doch Zeit im Überfluss zu Verfügung stand. Ihrer Befürchtung, ihr schwacher Körper könne im Trubel des Festes versagen, wurde mit der Versicherung begegnet, dass sie sich doch nur feiern zu lassen brauche, alles Praktische werde von den Jüngeren bewältigt werden, und das Organisatorische und Rhetorische liege zuverlässig in Leonhardts Hand.
Die kleine Runde, die sich da im Jahre 2015 bei Hedwig Leydenfrost versammelt hatte, wurde von ihr gern »meine Familie« genannt. Sie bestand aus Leonhardt Leydenfrost, ihrem ein Jahr und zwei Monate jüngeren Bruder, dessen Tochter Wilhelmine Kunze, die ein blasses Söhnchen namens Walter zur Seite hatte, und Fatima Müller, die im Dorf für Hedwig Leydenfrosts Tochter gehalten wurde, was aber nicht ganz der Wahrheit entsprach.
Fatima war als Kind mit ihrer kranken Mutter aus Bosnien nach Hamburg geflüchtet und hatte bei den Maltesern, die ihre Mutter gepflegt und schließlich beerdigt hatten, durch ihre herzzerreißende Hilflosigkeit den bisher nicht nur unterdrückten, sondern auch geleugneten Mutterinstinkt der Frau Dr. Leydenfrost freigesetzt. Bei ihr, die bald darauf pensioniert wurde, war die damals Achtjährige aufgewachsen und mit ihr nach Wittenhagen übergesiedelt, als die innerdeutsche Grenze beseitigt war. Ihre Verbundenheit mit der Pflegemutter war so innig, dass sie sich deren Heimatliebe zu eigen gemacht hatte, in Wittenhagen also auch gefühlsmäßig zu Hause war. Niemand hatte sich deshalb darüber gewundert, dass sie nach fünfjähriger Ehe mit einem redegewandten Herrn Müller aus Sachsen wieder zurückgekehrt war. Wie sie erzählte, hatte Herr Müller, der landespolitisch im Freistaat eine nicht unbedeutende Rolle gespielt und für Wahlveranstaltungen eine Vorzeige-Frau gebraucht hatte, ihr zu verstehen gegeben, dass sein Jawort der orientalischen Schönheit einer Neunzehnjährigen gegolten hatte, nach deren Verblühen aber nicht mehr galt.
»Sei froh, mit heiler Haut und gesunder Seele davongekommen zu sein«, hatte Leonhardt Leydenfrost bei ihrer Heimkehr verlauten lassen, ihr mehrmals versichert, dass von Verblühen keine Rede sein konnte, und ihr Folgendes eingeschärft: »Wer sich auf Politik einlässt, wird entweder charakterlich verbogen, oder er kommt, zumindest moralisch, in ihr um.«
Solche Weisheiten musste seine Schwester schon deshalb ärgerlich finden, weil sie sich selbst als Gegenbeweis dieser Behauptung empfand. In jungen Jahren nämlich war sie der Politik mit Haut und Haar und ganzer Seele ergeben gewesen, als radikale Wortführerin der außerparlamentarischen Opposition. Ihre damaligen Mitstreiter, die inzwischen altersmüde geworden oder gestorben waren, hatten aus ihrem Rufnamen Hedi, der ihnen zu treudeutsch geklungen hatte, eine Hedy gemacht. Unter diesem Namen war sie kurzzeitig berühmt gewesen, und mit ihm hatte sie auch die Parteigründungsurkunde unterschrieben, als die Sturm-und-Drang-Periode ihrer Bewegung zu Ende gegangen war.
Ihr Ruhm, der selbst in ihrer eignen Erinnerung langsam verblasste, war bis in ihre weit östlich gelegene Heimat vermutlich nie gedrungen, so dass sie jetzt in Wittenhagen ganz unbelästigt davon war. Hier war sie lediglich die Älteste des Dorfes, die nur auf Ämtern mit Frau Dr. Leydenfrost angeredet wurde, die Dorfbewohner nannten sie Oma, womit sich ihre Haltung dem hohen Alter gegenüber einfach und deutlich ausdrücken ließ.
»Da Senioren, wie die Greise neuerdings heißen, im Zeitalter der Elektronik nicht mehr die Weisheit, sondern die Unwissenheit verkörpern, muss man sich diese Unart gefallen lassen«, pflegte Leonhardt Leydenfrost zu bemerken, wenn von Klagen über derartige Unsitten die Rede war. Er hatte als Einziger aller Verwandten und Bekannten die Kurzform des Namens seiner Schwester, ob nun Hedi oder Hedy, immer vermieden. Für ihn hatte sie also lebenslang Hedwig geheißen. »Der Kleine musste immer aus der Reihe tanzen«, sagte die große Schwester dazu.
Dass sie sich am Ende der Debatte zu den Feierlichkeiten des nächsten Jahres doch noch bereiterklärte, war dem Einfall Fatimas zu danken, ihr am Ende ihres Lebens noch einmal Gelegenheit zu politischer Wirksamkeit zu geben, indem sie ihre Geburtstagsgäste um finanzielle Beiträge zur kürzlich von der Kanzlerin kreierten Willkommenskultur bitten sollte. Die dazu erforderliche Gründung eines Fördervereins versprach Fatima in die Wege zu leiten. Als Mitarbeiterin des Landratsamts war sie mit den dazu notwendigen bürokratischen Maßnahmen vertraut.
Überraschenderweise verhielt sich auch Hedwigs Bruder, der ihre Meinung nur selten teilte, zu dieser Politisierung nicht ablehnend, er schlug vielmehr eine Verbesserung vor. »Machen wir es doch wie die Pressefotografen, die sich aus den von der Kanzlerin eingeladenen Asylantenscharen nicht die vielen jungen Männer, sondern die wenigen Kleinkinder und Mütter als Fotoobjekte wählen, damit Mitleid erregt wird statt Angst.Wir sollten diesem Beispiel folgend nicht der Flüchtlinge, sondern der Flüchtlingskinder wegen die Gäste um Zahlung bitten, Mitleid öffnet die Konten eher als Unbehagen und Angst.«
2.
Er spreche aus Erfahrung, war von Leonhardt Leydenfrost oft zu hören, wenn er Urteile fällte oder Ratschläge gab. Auf Politik bezogen, war seine Berufung auf Erfahrung aber übertrieben, besonders wenn er sie achtzigjährig nannte und damit ein belustigtes Mundverziehen seiner Schwester provozierte, die ihn dann daran erinnerte, dass er vor achtzig Jahren ein naseweiser und weinerlicher Dreikäsehoch gewesen sei.
Hätte Leo, wie er schon als Kind genannt wurde, nicht von politischer Erfahrung, sondern von politischem Erleiden geredet, wäre er der Wahrheit näher gekommen, denn dass die Politik sein Leben häufig bestimmt hatte, stritt auch die politisch viel regsamere Schwester nicht ab. Mit einer Uniform, die schon der Zehnjährige ein- oder zweimal in der Woche gegen seinen Willen hatte tragen müssen, hatte das unselige Eingreifen in sein Leben begonnen und sich jahrelang mit Marschieren und Gehorchenmüssen fortgesetzt. Statt zu spielen, zu lesen oder seine stetig wachsende Büchersammlung zu ordnen, hatte er exerzieren, Latrinen säubern und Kanonen bedienen müssen, bis diese zu seiner Freude verschrottet wurden – sie wurden aber, wie er nach einer viel zu kurzen Pause, die ihm die Politik zum Aufatmen und Jubeln gönnte, durch andere, viel wirksamere Schießgeräte relativ rasch wieder ersetzt. Mit diesen hatte er dann glücklicherweise nichts mehr zu tun.
Der innere Jubel, der 1945 die ersten Stunden ungestörter Lektüre in eigner Behausung und ziviler Kleidung begleitet hatte, war stark gedämpft worden vom plötzlichen Tod seiner Mutter, der unter Umständen, die nie geklärt wurden, einige Wochen nach Ankunft der russischen Truppen in Wittenhagen erfolgt war. Der Verlust der Mutter hatte ihn tief getroffen, der des Familienbesitzes aber kaum. Da die Äcker und Wiesen, Pferde, Rinder und Schweine, die das Einkommen der Familie gesichert hatten, nie sein Interesse hatten erregen können, bedeutete ihm die Enteignung des Gutes wenig, ein Landwirt zu werden, hatte er nie vorgehabt. Sein Vater, der nach der formellen Enteignung des Betriebes die anfallenden Arbeiten noch bis zur Kartoffelernte geleitet hatte, dann aber des Ortes verwiesen wurde, hatte sich mit seiner Tochter Hedwig zusammen auf Schleichwegen nach dem deutschen Westen begeben, wo er mit seinem jüngeren Bruder Eckhardt, der den Krieg in britischer Gefangenschaft überlebt hatte, zusammengetroffen war. Obwohl Eckhardt ihm eine einträgliche Stellung in der Gummifabrikation hatte verschaffen können, ertrug er das Leben ohne seine Pferde und Äcker nicht. Schon zu Beginn des Wirtschaftswunders hatte er eigenhändig seinem von Heimweh zerfressenen Dasein ein Ende gemacht.
Leo, der Wittenhagen bald nach dem Tode der Mutter verlassen hatte, war so glücklich gewesen, in einer der großen Bibliotheken Ost-Berlins als Hilfskraft beschäftigt zu werden und später dort auch als Fachkraft arbeiten zu können, als sein Studium beendet war. Ein Aufstieg in der Bibliothekshierarchie war ihm nicht möglich gewesen, da er sich immer geweigert hatte, in die Staatspartei einzutreten, doch hatte die Gelegenheit, seine geliebte Maria hier kennenzulernen, diese Missachtung seiner Fähigkeiten weitaus ersetzt. Obwohl er ständig Kritik an der politischen Bevormundung geäußert hatte, war er in seiner Stellung noch lange geduldet worden, und selbst nachdem man ihn wegen privater Verbreitung verbotener Bücher zu einer halbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt hatte, durfte er in der geliebten Bibliothek wieder arbeiten, allerdings auf einem schlechter bezahlten Posten, auf dem sein Fachwissen zum Brachliegen verurteilt war.
Die von ihm freudig begrüßte deutsche Wiedervereinigung, an der er durch Unterstützung einer Oppositionsgruppe ein bisschen mitgewirkt hatte, brachte dem inzwischen Graugewordenen die nächste Enttäuschung, weil die West-Kollegen der neuen Leitung zwar seine Widerstandshaltung anerkannten und öffentlich ehrten, sein teilweise veraltetes Fachwissen aber nicht mehr brauchbar war. Da man ihn an der elektronischen Modernisierung, die auch im Osten begonnen hatte, nicht beteiligt hatte, wurde ihm unter Sympathiebekundungen bedeutet, dass er für den Modernisierungsschub, der nun erfolgen sollte, nicht geeignet war. Auf die Kenntnisse der ehemaligen Parteigenossen, die die wichtigsten Funktionen des großen Betriebes im Griff gehabt hatten, war die neue Leitung angewiesen, so bedauerlich ihr das auch war. Leo, der das einsehen musste, nutzte die erste Gelegenheit zur Frühverrentung, verabschiedete sich von den schweren Bänden des alten, handschriftlich geführten Sachkataloges, die ihm nach jahrelanger Betreuung doch ans Herz gewachsen waren, und zog sich, da seine drei Kinder schon aus dem Hause waren, mit seiner schwerkranken Frau, die er bald nach dem Umzug beerdigen musste, nach Wittenhagen zurück.
Wenn er später von seinem bescheidenen Schicksal erzählte, kam er oft auch auf die Mitläufer zu sprechen, die immer verachtet werden und doch für jede Regierung notwendig sind. Er erinnerte dann an Adenauer, »den alten Schlauberger, der mit den versierten Mitläufern von gestern das bessere Heute zuwege bringen konnte, und an die Siegermächte von 1945, die Hitlers Raketentechniker in ihre Dienste nahmen, obwohl das doch der Moral ihrer Festtagsreden so gar nicht entsprach«. Da die deutschen Wiedervereiniger, wie er meinte, »den Nutzen der Mitläufer aus Erfahrung kannten, wurde 1990 im deutschen Osten auf eine der früheren Entnazifizierung ähnliche Farce verzichtet, alle Schuld des Regimes der Stasi in die Schuhe geschoben und nach Parteigenossenschaft gar nicht gefragt«. Politik, so pflegte er seine Weisheiten zusammenzufassen, vertrage sich mit Anständigkeit und Gerechtigkeit nur in seltenen Glücksfällen. Sich darüber zu beklagen sei lächerlich.
Sich verordneten Denksystemen anzupassen, hatte Leo also vermieden. Ihm waren die Marxisten und Anarchisten nicht weniger fragwürdig als die Existentialisten und die Kapitalismus-Verehrer gewesen, und wenn damals schon von Islamisten die Rede gewesen wäre, hätte er diese schon ihrer Frauenverachtung und höchst unbequemen Lebensart wegen abgelehnt. Er hatte aber auch kein eignes System entwickelt oder sich angelesen und deshalb auch den Kindern keins aufgedrängt. Sie sollten sich für alles offenhalten und letzten Endes selbst entscheiden, welches die geeignete Denkrichtung für sie war.
Der Familientradition wegen hatte er seine Kinder evangelisch taufen lassen, seinen Neutralitätsprinzipien folgend aber keine Lebensführung im Sinne der Kirche verlangt. Bei seinen Töchtern Luise und Wilhelmine hatte diese Freizügigkeit zur Folge, dass sie sich um keine Glaubens- oder Denksysteme scherten, praktische Berufe erlernten und Männer heirateten, an deren Seite ihren Beruf auszuüben nicht mehr nötig war. Bei seinem Sohn aber, den er in früher Rilke-Begeisterung auf den Namen Rainer-Maria hatte taufen lassen, war die Entwicklung nicht so glatt verlaufen. Sein widerborstiges Wesen, das sich bereits bei seiner komplizierten Geburt bewiesen hatte, war später in hartnäckigen Widerstand gegen die häusliche Ordnung ausgeartet und hatte sich in der Schule durch schlechtes Betragen und gute Noten gezeigt. Mit achtzehn Jahren hatte der Abiturient schließlich die schon immer bewiesene Missachtung der väterlichen Autorität auf die Spitze getrieben, indem er eine Entscheidung getroffen hatte, die zu billigen seinem Vater nicht möglich war.
Für Leo war die Szene, in der Rainer ihm seinen Affront gestanden hatte, vor allem seines eignen unbedachten Verhaltens wegen in schlechter Erinnerung geblieben. In schlaflosen Nächten musste er sie mit allen Einzelheiten immer wieder durchleben, so dass die vernarbte Wunde auch Jahrzehnte später wieder zu schmerzen begann.
An einem Frühsommerabend, als vor der Mietwohnung der Familie in der Oranienburger Straße die Linden blühten, war Leo nach Dienstschluss besonders freudig gestimmt. Er hatte nämlich gerade erfahren können, dass es sich bei der Krebserkrankung seiner geliebten Frau Maria vermutlich um eine Fehldiagnose gehandelt hatte (was sich später leider als falsch erwies). Auch hatte er im Antiquariat in der Friedrichstraße das lange von ihm schon gesuchte »Buch der Zeit« erstanden, das er noch in den Händen hatte, als Rainer, der ihm sonst aus dem Wege zu gehen pflegte, in ungewöhnlich festlicher Kleidung bei ihm erschien. Sein schwarzer Anzug mit weißem Hemd und Krawatte machte ihn zu einem seriösen Erwachsenen, zu dem auch seine ernste Miene passte, in der von dem Trotz, den er sonst seinem Vater gegenüber zu zeigen pflegte, nichts mehr zu spüren war. Ernsthaftigkeit versuchte er auch in seine Stimme zu legen, als er, was noch ungewöhnlicher war, um Verzeihung für die Störung bat.
Leo hatte sich im ehemaligen Mädchenzimmer, das nach dem Auszug der Töchter als Bibliothek genutzt wurde, in den schmalen Gang zwischen den Regalen zurückgezogen, um in dem neuerstandenen Band noch ein wenig zu blättern und sich Jugenderinnerungen hinzugeben, die, obwohl sie bitter gewesen waren, gern von ihm wieder heraufbeschworen wurden, weil die Genugtuung, sie überstanden zu haben, ihnen eine gewisse Süße verlieh.
Das beste Mannesalter, in dem er damals gestanden hatte, war bei ihm seltsamerweise von starker Sentimentalität bestimmt gewesen, die dann im Alter wieder schwächer geworden war. Er war damals häufig mit der Suche nach der verlorenen Kindheit und Jugend beschäftigt gewesen, und zu Letzterer hatte auch seine Begeisterung für einige Gedichte des »Buches der Zeit« gehört. »Die letzten Sterne flimmerten noch matt …« hatte er damals so oft gelesen, dass er es später fast fehlerfrei vor sich hin murmeln konnte, vom Zyklus des »Phantasus« waren viele Reimpaare in ihm haftengeblieben, und die Zeilen: »Mein Herz schlägt laut, mein Gewissen schreit: / Ein blutiger Frevel ist diese Zeit«, hatte er damals zum Motto seiner Leiden gemacht. Der Band war ihm von einer Stadtbibliothek in die Kaserne ausgeliehen worden, und da er eines Nachts ohne Vorankündigung an die Front geschickt wurde, hatte er ihn im Rucksack mitnehmen müssen. Er war also, wie es sich für einen uniformierten Schöngeist gehörte, zwar nicht mit dem »Faust« oder dem »Cornett« im Tornister, aber doch mit einem Dichtwerk in die Schlacht gezogen, die er dann lädiert überlebt hatte, nicht aber das geliehene Buch.
Als er den Band nun nach Jahrzehnten wieder in Händen hatte, war er durch die Gedichte, die ihn damals aufgewühlt hatten, wieder in die Gefühlswelt seiner traurigen Jugend zurückversetzt worden, so dass das unerwartete Auftreten des Sohnes von ihm tatsächlich als störend empfunden wurde und er ärgerlich sagte, auch Wichtiges habe doch wohl bis zum Abendessen noch Zeit.
»Nein, Vater«, hatte ihm Rainer entgegnet, »du musst es sofort erfahren, dass ich heute Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands geworden bin. Vor zwei Stunden wurde mir in einer Feierstunde das Dokument überreicht.«
Leo, den schon die ungewöhnliche Anrede mit Vater, statt des üblichen Papa, erschreckt hatte, wusste nicht gleich etwas zu sagen, fragte deshalb ein wenig töricht, um welches Dokument es sich dabei gehandelt habe, und erst als ihm das Parteibuch vor Augen gehalten wurde, machte sich seine Empörung, die er später selbstkritisch als blinde Wut bezeichnete, in unbedachten Beschimpfungen Luft.
Statt, seinem Erziehungsliberalismus folgend, Rainers Entscheidung schweren Herzens zu billigen, fühlte er sich persönlich beleidigt und in seiner Autorität gekränkt. Statt zuzugeben, dass sein Sohn nur von der ihm angepriesenen Entscheidungsfreiheit Gebrauch gemacht hatte, bezichtigte er ihn des Verrats an der Familie und unterstellte ihm, um späteren Vorteils willen zu den Machthabern übergelaufen zu sein. Sein Zorn trieb ihn dazu, nicht nur Rainer in haarsträubender Weise zu beschimpfen, sondern auch, um ihn möglichst schmerzlich zu treffen, die Ablehnung von Staat und Partei maßlos zu übertreiben, sich also zu gebärden, als ob er wirklich ein bitterböser Feind der Herrschenden sei.
Je wütender aber der Vater wurde, desto gefasster wirkte der Sohn. Alle Vorwürfe ertrug er schweigend, und erst als der Vater die Erbauer der Mauer Lügner und Verbrecher nannte, brachte der Sohn sein wohlüberlegtes Schlusswort an:
»Deine Schmähungen kann und darf ich nicht länger ertragen. Als Genosse bin ich verpflichtet, staatsfeindliche Äußerungen wie diese zu melden. Dazu aber bin ich leider nicht fähig. Ich glaube deshalb, dass meine Trennung von der Familie für uns alle das Beste ist. Es wird eine ewige Trennung sein.«
Es war das letzte Gespräch mit dem abtrünnigen Sohn gewesen, nicht aber die letzte Begegnung, zu der es ein Jahr später gekommen war. Rainer, der seine im Sterben liegende Mutter besucht hatte, war seinem Vater auf einem der langen Flure der Charité entgegengekommen und war wortlos, ohne Zeichen des Erkennens zu geben, an ihm vorbeigegangen. Zur Bestattung seiner Mutter war er dann nicht erschienen, er hatte nur einen Kranz geschickt.
3.
Das Haus der Leydenfrosts, die Villa, wie die Dorfleute es nannten, war ein zweistöckiger Bau aus dem Jahre 1928, als die Familie noch wohlhabend gewesen war. Sein Satteldach und die grünen Fensterläden waren dem damals noch gängigen Heimatstil nachempfunden, die offene Veranda des oberen Stockwerks war der sogenannten Moderne verpflichtet, und die dorischen Säulen, die den Eingang flankierten, hatten den Bau nach Leonhardt Leydenfrosts Worten zu einer stilistischen Missgeburt werden lassen, zu einer Kreuzung aus bayerischem Bauernhaus und klassizistischem Schloss.
Als der Vater der jetzigen Bewohner es als notwendig erachtet hatte, einen Alterssitz für seine langlebige Mutter und zwei alte Tanten zu schaffen, war erst der Umbau einer Reithalle erwogen worden, die noch aus adligen Zeiten übrig geblieben war. Da aber dieses solide Gebäude, das den bürgerlichen Gutsbesitzern nur noch als Lagerhalle gedient hatte, zum Ensemble des Gutshofes gehörte, wo nie Ruhe herrschte, hatte man diesen Plan aufgegeben und sich zu einem Neubau entschlossen, der etwas abseits gelegen war. Ein Architekt aus der Kreisstadt, der eigentlich auf Stallbauten spezialisiert war, hatte das Haus auf ein unverwüstliches Fundament aus Feldsteinen setzen lassen, es aber vom Boden zu isolieren vergessen, so dass es der feuchten Wände wegen in der schon neunzig Jahre alten Villa noch immer wie im Neubau roch. Wenn sich im Frühjahr die Tapeten von den Wänden lösten, sah Leo, der mit seiner Tochter Wilhelmine im unteren, der Nässe stärker ausgesetzten Stockwerk wohnte, immer wieder die alte Weisheit bestätigt, nach der Kinder und Kindeskinder die Suppen auslöffeln müssen, die von den Eltern und Großeltern angerührt worden sind.
Da der Gutsherr schon beim Bau des Hauses beabsichtigt hatte, es nach dem Ableben der Alten selbst zu nutzen und das unbequeme, längst baufällig wirkende Herrenhaus aus adliger Zeit abzureißen, hatte man an der Modernisierung der Villa nicht gespart. Jedes Stockwerk war mit Bad und Toilette versehen worden, und modernste Apparaturen hatten alle Räume mit Wasser und Wärme versorgt.
Dieser Komfort aber war der Villa inzwischen abhandengekommen. Angeblich hatten die Russen, die das unbeschädigte Haus vorübergehend zur Kommandantur gemacht hatten, die Pumpen und Heizkessel in ihre Heimat entführt. Die aus der Neumark Vertriebenen, die nach den Russen hier untergekommen waren, hatten sich mit Kanonenöfen behelfen müssen, diese aber hatten die Geschwister bei ihrem Einzug durch Kachelöfen ersetzt. Die gemauerten Kochherde aus Nachkriegszeiten dagegen waren auf Anraten Leos erhalten geblieben, für Notfälle, wie er sagte, »weil der Staat unsere Sicherheit doch, statt auf verlässliche Mitmenschen, auf die Elektronik gründet, die bekanntlich, da auch Bösewichtern leicht zugänglich, hochgradig anfällig ist«.
Die Rückkehr der Geschwister nach Wittenhagen wurde von Leo als eine verspätete Auswirkung des bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders betrachtet, das Hedwig einst zur außerparlamentarischen Oppositionellen gemacht hatte, ihren Onkel Eckhardt aber zum reichen Mann. Ihm war es nämlich möglich gewesen, sich bald nach seinem Einstieg in die Gummiverarbeitung einen eignen Betrieb aufzubauen, mit dessen Produkten ihm die Stillung des damals starken Bedürfnisses nach Wärmflaschen gelang. Das Kapital, das er dabei erworben hatte, konnte er so günstig anlegen, dass er dessen Vermehrung von der spanischen Mittelmeerküste aus beobachten konnte, wo er seinen früh begonnenen Lebensabend genoss. Seine Verbundenheit mit der alten Heimat hatte er kurz vor seinem Tode anlässlich der deutschen Wiedervereinigung durch Überweisung eines ansehnlichen Geldbetrages bekundet, mit dem seine Nichte Hedwig zwar nicht das enteignete Gut, aber doch das Altenteil zurückkaufen konnte, das die Dorfleute immer noch Villa nannten, obwohl es durch vier häufig wechselnde Mietparteien, die es abgewohnt, aber nie repariert hatten, sehr heruntergekommen war.
Onkel Eckhardts großzügige Finanzhilfe, die von ihm aber, wie Leo meinte, vermutlich nur als Pappenstiel angesehen wurde, hatte auch noch zur Finanzierung der Dachdeckung, der Beseitigung der von den Flüchtlingen aus Spanplatten errichteten Trennwände und der Überführung des toten Spenders von den warmen Gestaden des Südens in das kalte Wittenhagen gereicht.
In heimatlicher Erde ruhen zu können war des Onkels mehrfach geäußerter Wunsch gewesen, den Henry, sein Sohn und Erbe, der sich zu aller Erstaunen des Begräbnisses wegen zum ersten Mal so weit nach Osten gewagt hatte, nicht begreifen konnte. »Immer dort, wo ich Geld mache, bin ich ganz zu Hause, sei das nun in München, Rom oder Santiago«, hatte er an der dem Begräbnis folgenden Kaffeetafel verkündet. »Als Manager war Papa tüchtig, als Mensch aber von gestern. Seine Familien- und Heimatsentimentalitäten, die mir zu sehr nach Blut und Boden riechen, kann ich nicht nachvollziehen.«
Leo, der seinen weltbewanderten Vetter Heinrich boshaft immer Heini statt Henry nannte, hatte sich daraufhin zu der Ansicht verstiegen: »Die Welt wird erst zur Ruhe kommen, wenn jeder zu Hause bleibt.«
4.
Onkel Eckhardts Begräbnis war ein hervorstechendes Ereignis im ruhigen Leben der Leydenfrosts gewesen, von dem Hedwig aber nie sagen konnte, wann es stattgefunden hatte, und wenn sie sich bei Fragen danach aufs Raten verlegte und drei, vier oder fünf Jahre mutmaßte, griff sie regelmäßig zu kurz. Zu schnell waren ihr die gleichförmigen, aber nie langweiligen Jahre in Wittenhagen vergangen, und obwohl sie sich vornahm, jeden Lebenstag, der ihr vergönnt war, bewusst zu genießen, war jeder Tag und jedes Jahr im Nu wieder vorbei. Wenn sie auf ihren Spaziergängen, die der schwindenden Kräfte wegen immer kürzer wurden, die Gräber aufsuchte, deren Pflege sie schon lange Fatima und Wilhelmine überlassen hatte, war sie immer wieder darüber verwundert, dass der Onkel, wie der Grabstein auswies, schon im vorigen Jahrhundert gestorben war. Die wenigen Kleinkinder der Dorfleute wurden für ihr Empfinden im Handumdrehen zu Erwachsenen. Bald nach den Schneeglöckchen und Veilchen, die in den kümmerlichen Resten des ehemaligen Gartens ihrer Eltern an Vorfrühlingstagen den Boden bedeckten, wirbelte der Herbstwind schon wieder die welken Blätter umher. Die drei Birken, die sie bald nach ihrer Heimkehr dort gepflanzt hatte, wo einst ihr Elternhaus gestanden hatte, waren schon grau und borkig geworden, und eine von ihnen, der ein Sturm die Krone abgerissen hatte, starb bereits ab.
So alt wie sie war im Dorf keiner. Mit ihren weit zurückreichenden Kindheitserinnerungen, in die sie sich immer häufiger versenkte, war sie allein. Von den Kindern der Bauern und Landarbeiter, mit denen sie auf den Bänken der Dorfschule gesessen hatte, bevor man sie gegen ihren Willen aufs Gymnasium der Kreisstadt beordert hatte, waren viele im Krieg umgekommen, andere zu Städtern geworden, und die sesshaft Gebliebenen waren tot. Ihre Versuche, mit dem Bruder über die gemeinsame Kindheit zu reden, waren meist vergeblich, und wenn sie zustande kamen, führten sie zu Verstimmungen, weil Leo ihre Erinnerungen nicht nur nicht teilte, sondern ihren Wahrheitsgehalt oft auch bezweifelte, denn er hatte anderes im Gedächtnis behalten als sie.
Für Hedwig, die sich als tatkräftiges Mädchen häufig an den Unternehmungen der älteren Jungen beteiligt und die Spielerei mit Puppen verachtet hatte, war ihr kleiner Bruder ein Muttersöhnchen und Stubenhocker gewesen, der die Abenteuer, die sie in Wäldern, auf Hausböden und in Scheunen erlebte, nur in Büchern fand. Sie war als Reiterin waghalsig gewesen, der Bruder aber hatte Angst vor Pferden gehabt. Die mit Garben hochbeladenen Erntewagen waren von ihr kutschiert worden, er aber hatte sich auch in Erntezeiten, wenn jede Hand gebraucht worden war, vor harter Arbeit gedrückt. Vor Ausmärschen des Jungvolks war er regelmäßig krank geworden, sie dagegen wäre gern schon vor dem vorgeschriebenen Alter von zehn Jahren den Jungmädels beigetreten, hatte dann deren Uniform, Kluft genannt, stolz getragen und war bald, obwohl sie Heimabende mit Handarbeiten und Anweisungen zur Säuglingspflege nicht ausstehen konnte, zur Führerin avanciert.
Wenn sie sich an die damalige Hochstimmung erinnerte, in der sie an Heldengedenktagen und Führergeburtstagen an der Spitze ihrer Jungmädelgruppe, laut das »Links-zwei-drei« kommandierend, auf den mit Fahnen geschmückten Marktplatz der Kreisstadt marschiert war, konnte sie noch heute unter den obligatorischen Scham- und Reuegefühlen auch ein wenig Stolz darüber empfinden, damals schon die Tatkraft bewiesen zu haben, die ihr später für bessere Ziele einzusetzen möglich geworden war. Hatten sich später doch ihre damals erworbenen Führungsqualitäten in der Umwelt-, Friedens- und Studentenbewegung glänzend bewährt. Auch als sie später die neue Ausrichtung ihrer Partei nicht mehr hatte billigen können und, ohne die Mitgliedschaft aufzugeben, alle politischen Posten niedergelegt hatte, um ihr abgebrochenes Studium zu beenden, hatte sie ihre Willenskraft genauso bewiesen wie danach als Kinderärztin auf der Unfallstation.
Ihr Bruder, mit dem sie nun seit vielen Jahren unter einem Dache lebte, war für sie der noch immer unterlegene Kleine, doch war sie froh darüber, dass es ihn gab. Sein ewiges Kritisieren, das sie Quengeln nannte, war ihr einerseits lästig, andererseits zwang es sie zum Mitdenken oder Widersprechen, das ihrer Hirntätigkeit, die manchmal schon erhebliche Mängel zeigte, sehr gut bekam. Andere Alte trainierten ihr Hirn mit dem Raten von Kreuzworträtseln, sie hatte dazu ihren Bruder, dessen Ansichten zu widerlegen ihr Denkanstrengungen abverlangten, durch die sie vielleicht der gefürchteten Demenz, die Leo Verblödung nannte, entkam.
Zur Verbündeten hatte sie dabei Leos Tochter Wilhelmine, die nach einer langen, soliden Ehe mit einem Herrn Professor Kunze mit ihrem noch schulpflichtigen Jüngsten zu ihrem Vater geflüchtet war. Ihr Ex, wie Wilhelmine ihren Mann nun nannte, hatte nach der deutschen Vereinigung, als seine Partei die Ehemoral nicht mehr überwachte, in überreifem Alter viele Liebschaften genossen, seine Ehefrau, nachdem er sie noch einmal in gesegnete Umstände versetzt hatte, sitzenlassen und sich einer jüngeren Intellektuellen zugewandt. Ihren Vater hatte Wilhelmine nicht lange belästigen, sich nur bei ihm ausweinen wollen, war dann aber geblieben, angeblich weil sie sich zu seiner Betreuung verpflichtet fühlte, in Wahrheit aber eines Herrn Hoffmann wegen, der Geschäftsführer der Wittenhagener Agrargenossenschaft war. Sie war eine perfekte Hausfrau und insofern für ihren Vater ein Segen, als geistige Verbündete ihrer Tante aber konnte sie gelten, weil alle ihre Ansichten und Meinungen die ihres ehemaligen Gatten waren und dieser als Leiter einer Bildungseinrichtung für Parteisekretäre nach Wilhelmines Worten so fortschrittlich wie Tante Hedwig gesinnt war.
Leo aber war gegen den Begriff Fortschritt allergisch, weil er für ihn vor allem mit dem Gedanken an Atombomben, Drohnen und totale Überwachung verbunden war. Seiner Schwester gegenüber konnte er ihn für die Klimakatastrophe und das Artensterben verantwortlich machen und ebenso für die Technisierung der Landwirtschaft. »Dass wir auf unseren rainlosen Feldern keine Rebhühner mehr haben und das Tirili der Lerchen vermissen, haben wir allein dem Fortschritt zu danken, den zu fördern du dich immer befleißigt hast.«
5.
Für die Vorbereitung von Hedwigs Geburtstagsfeier war in den folgenden Monaten lediglich Fatima tätig gewesen, sie hatte die Wege zur Gründung des Willkommensvereins geebnet und sich auch schon um die Einrichtung des Spendenkontos bemüht. Unterstützung hatte sie dabei vor allem bei Leo gefunden, der zwar zu den Kritikern der Flüchtlingspolitik gehörte, aber für »die armen Verführten, die den sonnigen Süden verlassen hatten, um im kalten Wohlstandsland zu Hunderten in Kasernen und Turnhallen vegetieren zu müssen«, Mitleid empfand. Dass die Spendenidee von ihm befürwortet wurde, hatte aber auch mit einem von ihm erwarteten angenehmen Nebeneffekt zu tun. Durch die Geldspende nämlich konnte die Ansammlung unnützer Geschenke vermieden werden, von der man nach dem Fest nicht wissen würde: wohin damit.