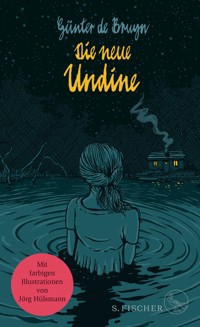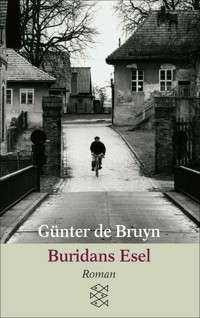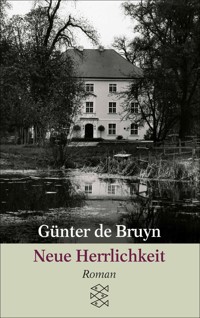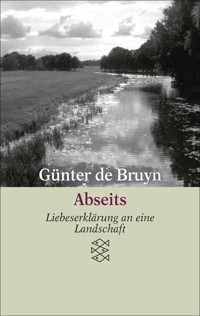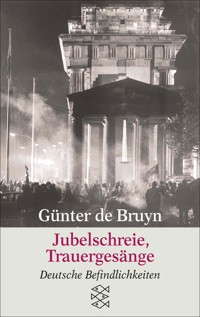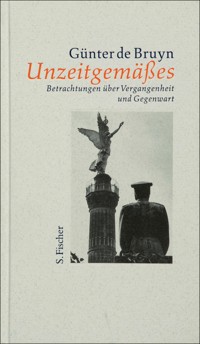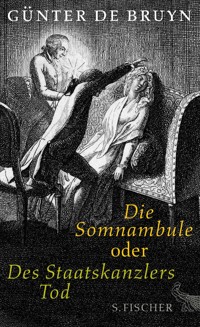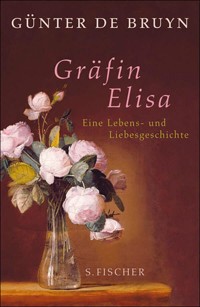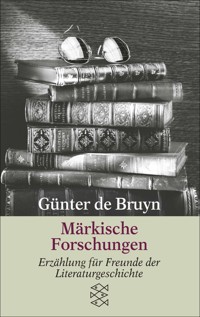
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Günter de Bruyns brillante Satire auf den Wissenschaftsbetrieb Professor Winfried Menzel hat den 1813 gestorbenen Max Schwedenow wiederentdeckt, ihn als fortschrittlichen Historiker und revolutionären Dichter eingestuft und zur Zentralfigur des märkischen Jakobinertums gemacht. Zufällig trifft er bei einer Ortsbesichtigung den Lehrer Ernst Pötsch, der aus literarischem und persönlichem Interesse seine Privatstudien vorantreibt. Menzel versucht, Pötsch für sein Institut zu gewinnen. Pötsch zögert allerdings, da er in Menzels Buch über Schwedenow eine Vielzahl von Unstimmigkeiten entdeckt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Günter de Bruyn
Märkische Forschungen
Erzählung für Freunde der Literaturgeschichte
FISCHER E-Books
Inhalt
Vorspiel im Theater
Das Theater ist bis auf den letzten Platz besetzt, was aber wenig besagt, denn es ist das kleinste der Hauptstadt, mehr Theaterzimmer als -saal. Kein Stück wird gespielt, es wird ein Vortrag gehalten, der erste der Reihe »Vergessene Dichter – neu entdeckt«.
Der Referent müht sich mit den Schlußfloskeln ab. Der zweite Mann auf der Bühne, der einleitende Worte sprach, macht sich bereit, Dank- und Abschiedsworte zu sprechen. Schon löst er den Rücken von der Sessellehne, richtet sich sitzend auf, wendet sein Gesicht vom Referenten ab und dem Publikum zu, lächelt – und erhebt sich, um, schnell und witzig, mit seinen Schlußsätzen dem Beifall zuvorzukommen, der dann heftig losbricht.
Man klatscht lange. Auch die eiligen Zuschauer, die ihre Garderobenmarken schon in der Hand haben, wagen noch nicht zu gehen. Der Referent lächelt einige Sekunden krampfhaft ins Publikum, deutet sitzend eine Verbeugung an und beginnt mit nervösen Bewegungen seine Papiere zu ordnen. Aber der andere, der, dem Referenten zugewandt, mit weit ausholenden Armbewegungen mitgeklatscht hat, eilt jetzt zu ihm hin, nimmt mit beiden Händen seinen Arm und zieht ihn nach vorn bis zur Rampe, wo er ihn stehen läßt, um von der Bühnenecke her, immer wieder mit ausgestrecktem Arm auf ihn deutend, sein Klatschen fortzusetzen. Der Referent verbeugt sich einmal, zweimal, sucht dann nach Fluchtmöglichkeiten, wird von dem anderen aber wieder gefaßt. Arm in Arm mit ihm steigt er in den Zuschauerraum hinunter. Auf der Bühne stehen nur noch die beiden Sessel, Empire, rot und golden. Requisit jener Zeit, von der zwei Stunden lang die Rede war. Der Beifall schwillt an, als auf die Rückwand des Bühnenraums das Bild des einst vergessenen und nun wiederentdeckten Dichters projiziert wird, das Porträt, das einmal die Lesebücher unserer Enkel schmücken wird: das lange, schmale Gesicht über dem Spitzenjabot, die hohe Stirn, die sich fast bis zur Mitte des Hauptes weitet, das spärliche Blondhaar, der kleine Mund, von dessen Ecken sich strenge Linien zu den Nasenflügeln ziehen, die großen Augen.
Was geschieht, wenn der Beifall verebbt, meint jeder, der Vortrags-, Rezitations- oder Dichterlesungsabschlüsse kennt, zu wissen: Die Masse der Besucher verläßt mehr oder weniger eilig den Raum und drängelt sich an der Garderobe, einige besonders Interessierte oder Prominentensüchtige aber gehen nach vorn, um dem Referenten noch Fragen zu stellen, Meinungen anzubringen oder Lobsprüche zu spenden. So erwartet man das auch hier – und irrt sich. Zwar staut die Menge sich wirklich an den Ausgängen, eilt zur Garderobe, zwar streben zwölf bis fünfzehn Leute tatsächlich der Bühne zu, aber ihr Ziel ist nicht der Referent mit den tiefliegenden Augen im schmalen Grüblergesicht (ihn lassen sie vielmehr unbeachtet zwischen der Bühne und der ersten Stuhlreihe stehen), sondern der andere Herr, der den Abend auf der Bühne verbrachte, vorwiegend schweigend, aufmerksam lauschend, der nur einige wenige, allerdings geistreiche, Worte sprach, und dessen Gesicht nicht schmal ist, sondern rund und gesund.
Diesem also strebt man zielbewußt zu, erwartungsvoll oder beflissen lächelnd die einen, ernst, ehrfürchtig oder schüchtern die anderen. Ihm strecken sich Hände entgegen, er wird beglückwünscht, für seine Ohren sind die Worte des Lobs, des Danks, der Überraschung, des Entzückens bestimmt, ihm stellt man die Fragen, seiner Meinung wird die eigne entgegengesetzt.
Er antwortet jedem, dankt, wehrt ab, widerspricht, erklärt, alles mit der lauten, volltönenden Stimme des Mannes, der Öffentlichkeit liebt und gewohnt ist. Man schart sich um ihn. Auch die Schüchternen wagen nun ihre Bemerkung. Man lacht. Ein Bildreporter erklimmt die Bühne und fotografiert die Gruppe von oben. Als der Gefeierte dessen gewahr wird, winkt er ab, hebt sich auf Zehenspitzen, sieht umher, bahnt sich einen Weg durch den Kreis der Verehrer. Er sucht den Referenten, findet ihn noch an der Garderobe, holt ihn zurück.
Jetzt werden beide fotografiert, vor der Bühne und auf ihr, stehend und sitzend. In der Funk- und Fernsehzeitung der kommenden Woche wird aber nur das Bild des einen zu sehen sein: Der durch seine Sendereihe »Unsere Geschichte und wir«, bekannte Professor Dr. Menzel stellt sich den Fragen seiner Zuschauer. So oder so ähnlich wird die Bildunterschrift lauten.
Erstes Kapitel Begegnung im Walde
An einem Januartag begegneten sich Winfried Menzel und Ernst Pötsch auf dem wenig befahrenen Weg zwischen Liepros und Schwedenow zum ersten Mal. Die bewaldeten Höhen, von deren Sandboden der seit den Weihnachtstagen andauernde Regen willig aufgesogen worden war, hatte Menzel ohne Schwierigkeiten passiert, in der in den Torfsee auslaufenden Niederung aber, wo die Abflußgräben über die Ufer getreten waren, die Wiesen überschwemmt und auch den Weg überflutet hatten, war die Autotour zu einem vorläufigen Ende gekommen. Trotz der Warnungen seiner Frau, der Umkehr angebracht erschienen war, hatte Menzel, unter Ausnutzung des linken, erhöhten Wiesenrains, die ausgedehnte Pfütze zu durchfahren versucht, war aber links in dem schwarzen, von Forstfahrzeugen in Morast verwandelten Boden steckengeblieben. Versuche, durch Rückwärtsfahrt wieder festen Boden zu gewinnen, hatten die Räder noch tiefer in den Schlamm getrieben, bis schließlich der Wagenboden auf dem Rain aufgelegen hatte und jede weitere Bemühung sinnlos geworden war. Der Ironie, mit der Frau Menzel das fahrtechnische Können des Mannes gelobt hatte, hätte es nicht bedurft, um die Stimmung zwischen den Eheleuten gereizt zu machen. Da aber beide auf Situationen dieser Art trainiert waren, hatte sich die Aggressivität in dem schrägliegenden Auto nur indirekt entladen, bei der Behandlung der Frage nämlich, wer mit seinem städtisch-feinen Schuhwerk den Wagen verlassen und durch Wasser und Schlamm nach dem drei Kilometer entfernten Schwedenow zurückgehen und Hilfe holen sollte. Scheinobjektive Gründe hatte es für beide Varianten gegeben, und da, wenn es um Menge und Güte von Argumenten ging, Menzel immer der Findigere war, wären wohl eher ihre als seine Füße naß geworden, wenn nicht in diesem Moment die Begegnung erfolgt wäre, auf die es hier ankommt: Pötsch radelte heran.
Was eine Freundschaft werden sollte, begann mit hastigem Herabdrehen des Autofensters, mit Hallo-Ruf, mit schwerfälligem Abstieg vom Rad, vorsichtigem Nähertreten in Gummistiefeln, mit Nicken zu den Redeschwällen der Frau, mit Gutachterblick zwischen die Autoräder hindurch – dann schob Pötsch, des Wassers nicht achtend, sein Rad weiter, über die Brücke, die Anhöhe hinauf, das Ehepaar aber blieb im Warmen, rauchte, wartete, beobachtete besorgt die Verringerung des Abstands zwischen rechter Wagentür und Wasserspiegel und stritt darüber, ob das Tiefersinken des Autos oder das Steigen des Hochwassers Ursache dafür war. Es regnete ohne Unterbrechung.
Als die Dämmerung sich zur Dunkelheit zu verdichten begann und das Wasser die Türöffnung erreichte, lärmte ein Trecker heran, auf dem, hinter dem mißmutigen Fahrer, Pötsch stand, der dann auch das Zugseil einhakte und, als das Auto wieder festen Boden unter sich hatte, die Geldforderung des Traktoristen vorbrachte, die Menzel mäßig fand, den dreifachen Betrag aus dem Fenster reichte und dazu sagte, Pötsch möge sich das mit dem Fahrer teilen – was ihn später beschämte. Denn Pötsch reichte die Scheine, ohne sie anzusehen, dem Traktoristen (der übrigens sein Bruder war) hinauf, hob zur Andeutung eines Abschiedsgrußes die Hand und wollte wieder das Treckergestänge erklettern, als ein erneutes Hallo ihn zurückrief.
Menzel hatte noch eine Frage, und die Antwort darauf enthielt das Stichwort, das die beiden zusammenführte. Ob, bevor er in Liepros die Chaussee erreichte, noch weitere Gefahrenstellen zu passieren wären, wollte Menzel wissen, und Pötsch antwortete darauf, ja, kurz vor dem Dorf, wo der Wald sich zur Spreeniederung senke und die Kreuzung dreier Wege vor dem verschilften Flußarm eine Art Platz, Dreiulmen genannt, bilde, müsse er sich dicht am Wald halten, um erneutem Schlammbad zu entgehen.
»Dreiulmen?« fragte Menzel darauf. »So heißt das noch immer? Steht auch vielleicht das Armenhaus noch?«
»Sie kennen die Gegend?«
»Nur aus Büchern.«
»Aus Büchern?«
»Aus denen Max Schwedenows.«
Da öffnete Pötsch, dessen Gesichtsbildung und Gebaren ihn als einen Menschen auswiesen, der dreimal gebeten werden muß, ehe er es wagt, eine Bequemlichkeit für sich in Anspruch zu nehmen, ohne Aufforderung die hintere Wagentür, setzte (Frau Menzel stockte der Atem) seine schlammverschmierten Gummistiefel auf den Teppichboden, ließ sich, vor Nässe triefend, in die Polster fallen und sagte, fassungslos vor Überraschung: »Sie kennen Max von Schwedenow? Dann sind Sie vielleicht Professor Menzel?«
Zweites Kapitel Der Vergessene
Daß diese Frage nur zustimmend beantwortet werden konnte, ist dem Leser klar. Ja, es war Professor Menzel, der sich da, mit Frau, durch märkischen Sumpf und Sand bewegte und fast ein Opfer unbewältigter Naturkräfte geworden war. Auch der Fahrradbenutzer, der das Ehepaar aus der feuchten Bewegungslosigkeit befreite, ist schon bekannt. Wer aber, wird der Leser fragen, ist der Dritte, der hier zwar mit Namen genannt, aber nie in Person vorgeführt werden kann, dieser Bücherschreiber von, wie es scheint, etwas unsicherem Adel, dieser Max von (oder auch nicht von) Schwedenow?
Beste (für Zwecke dieses Berichts sicher zu ausführliche) Auskunft über ihn könnten die beiden geben, die ihren Freundschaftsbund in seinem Namen schlossen und die nie müde wurden, über ihn zu reden. Doch nutzt es wenig, ihren Gesprächen über ihn zu lauschen, weil sie, jeder beim anderen (mit Recht), das Wissen voraussetzen, das dem Leser fehlt, das primitivste und fundamentalste, das Schulwissen, die Lexikonweisheit, die aber vorläufig schwer zu finden ist, weil nämlich gängige Konversations-, Schriftsteller- und Gelehrtenlexika, Handbücher der Geschichtswissenschaft und Literaturgeschichten seinen Namen nicht verzeichnen und auch die Allgemeine Deutsche Biographie von ihm nichts weiß – weshalb es also sich empfiehlt, die kurze Autofahrt der drei vom Torfsee bis nach Liepros (auf der sich nichts ereignete als Gespräche, die Uneingeweihte nicht verstehen) zu einer Kurzinformation zu nutzen, die nachgeborene Leser nicht mehr nötig haben werden, weil schon die Elementarschule sie ihnen geliefert haben wird, mit Bild im Lese- oder im Geschichtsbuch: ein Porträt in Öl von unbekannter Hand, aus dem ein schlecht genährter junger Mann mit Kinderaugen ernst und streng auf den Betrachter blickt.
Max Schwedenow, geboren 1770, gestorben 1813, fortschrittlicher Historiker und revolutionärer Dichter, wird aller Voraussicht nach darunter stehen und damit schon alles liefern, was vorläufig gebraucht wird, um zu begreifen, worauf sich die Freundschaft, die sich auf dunklem Waldweg anbahnte, gründete: auf einen Gegenstand der Forschung und der Interpretation, zu dem die zwei auf sehr verschiedenen Wegen gelangt waren.
In einem Radio-Interview danach befragt, hatte sich Professor Menzel kürzlich erst dazu geäußert. Das bekannte, die kulturelle Erbschaft betreffende Goethe-Zitat (das er sicher deklamieren konnte) hatte er zum Ausgangspunkt genommen, es erst bedeutungsvoll, wegweisend, gültig über seine Zeit hinaus genannt, sich aber dann gefragt, ob es denn alles zu diesem Problemkreis gehörige auch erfasse, und diese Frage, sich selbst antwortend, kühn verneint. Das Erbe der Kultur, das zu erwerben uns aufgegeben, sei mehr als das, was wir von unseren Vätern erbten: das von ihnen verschmähte, verschleuderte oder vergessene nämlich auch. Denn was bei Goethe hier umschreibend Väter hieße, das sei für uns doch wohl die Bourgeoisie, die zwar ihre Profitmacherei kulturell zu drapieren, nicht aber progressive Traditionen zu pflegen willens gewesen sei. Früh, schon als Student, sei die Erkenntnis, daß die Landkarte der Vergangenheit noch weiße Flecken habe, die zu entdecken nötig sei, in ihm gereift und habe ihn befähigt, systematisch und konsequent auf seinem Fachgebiet (er sei, wie allgemein bekannt, Historiker) nach zu Unrecht, aber nicht zufällig, Vergessenen zu forschen. Durch einen versteckten Hinweis Mehrings sei er auf Schwedenow gestoßen. Daß dieser sich auch als exorbitant bedeutender Dichter erwiesen habe, sei seinen individuellen Neigungen entgegengekommen. Bald würde er, Menzel, sein Buch über diesen Vertreter deutschen revolutionären Demokratismus, Produkt jahrelanger Studien, der Öffentlichkeit präsentieren. Der von ihm gewählte Titel »Ein märkischer Jakobiner« mache die Bemerkung eigentlich überflüssig, daß durch diese Neuentdeckung dem reichen Schatz revolutionärer Traditionen ein Edelstein von besonderer Leuchtkraft hinzugefügt würde. »Denn in Max Schwedenows historischem und literarischem Werk«, so hatte Professor Menzel seine Ausführungen geschlossen, »wurde die fulminanteste Antwort gegeben auf die Frage, die der Sturm auf die Bastille auch an Deutschland gestellt hatte.«
Von dieser Systematik, dieser Konsequenz, von diesem Blick aufs Allgemeine auch, mit dem man große Aufgaben sieht, um sie in seinem Einzelgebiet zu erfüllen, war bei Ernst Pötsch die Rede nicht, als Menzel ihn (wir greifen damit vor in eine Zeit, in der die beiden Freunde schon auf du und du verkehrten) nach seinem Weg zu Schwedenow mal fragte. Da war, nach langem Zögern, langem Überlegen, nach dem Versuch, die Frage mit der Bemerkung: Durch Zufall! abzutun, schließlich von nichts als von ihm selbst die Rede, von seinen Gefühlen, seinen Vorlieben, seinen Interessen, von einer Liebschaft auch, aus der nichts wurde, von seinem Unterricht, den durch Ortsgeschichtliches aufzulockern er bestrebt war oder dies zumindest vorgab, um Grund zu haben, das Studium der Kirchenbücher dem seiner Lehrbücher vorzuziehen, wenn beispielsweise eine in Schwedenow-Briefen erwähnte Lieproserin namens Dorette dokumentarisch zu belegen ihm wichtig schien.
Wie immer, wenn Pötsch von sich selbst reden sollte, geriet ihm alles durcheinander, und Menzel hatte nicht Geduld genug zu folgen, entschied also: »Du kamst zu M.S. durch das Lokale«, und hatte, in Teilen wenigstens, damit durchaus Richtiges getroffen.
Denn Pötsch liebte, was ihm nah war, und nahm es dadurch in Besitz, daß er es so genau wie möglich kennenlernte. Stand Menzel gleichsam auf einem Aussichtsturm und schaute durch ein Fernrohr in die Weite, so Pötsch, mit Lupe auf platter Erde, wo jede Hecke ihm den Blick verstellte. Sein Wissen war begrenzt, doch innerhalb der Grenzen universal. Er hatte kein ausgeprägtes Interesse für Botanik, doch die Kiefern, die das Dorf umstanden, interessierten ihn bis hin zu der Struktur des Holzes. Bautechnik war sein Fach nicht, aber wie man vor 150 Jahren, als das Haus, in dem er wohnte, gebaut wurde, die Feldsteine gespalten hatte, um glatte Außenwände zu bekommen, wollte er wissen. Das Ausheben einer Baumgrube regte ihn zu geologischen Studien an, ein Gespräch mit Landvermessern zu mathematischen. Jede Fahrt in eine andere Gegend wurde eine des Vergleichs, und der schönste Teil der Reise war die Heimkehr. Er war kein kühner Denker, aber ein genauer, Fanatiker des Details, Polyhistor des Vertrauten. Daß Max von Schwedenow in Schwedenow geboren war, war Grund genug, sich mit ihm zu beschäftigen. Daß Liepros Handlungsort seiner Romane war, genügte, um sie ihm lieb und wert zu machen.
Menzel hatte recht: Lokalgeschichtliches war durchaus eine Quelle des Stroms der Schwedenow-Besessenheit, die nie versiegte, aber doch nur eine. Die andere war: Pötsch fühlte sich dem Mann verwandt. In Schwedenows Dichtung fand er sich selbst. Seine Gefühle waren dort formuliert, seine Sehnsüchte beschrieben, seine Gedanken vorgedacht. Pötsch sah in Schwedenows Romane und Gedichte wie in einen Spiegel – und war von sich entzückt.
Man sollte ihm das gönnen, es aber nicht, wie er es tat, ein Wunder nennen, schon deshalb nicht, weil sicher manches, was er in der Dichtung von sich zu finden meinte, erst durch sie in ihn hineingekommen war. Wer will entscheiden, ob wir lieben, was uns ähnlich ist, oder ob wir dem ähnlich werden, was wir lieben?
Menzel hegte lange den Verdacht, daß, wäre der berühmte Ludwig Leichhardt nicht im zehn Kilometer entfernten Trebatsch sondern in Liepros oder Schwedenow geboren, Pötsch sich auf Australien-Forschung spezialisiert hätte. Er nahm die Frage ernst, als Menzel sie ihm stellte, und überlegte lange, ehe er verneinte: Er nahm es Leichhardt übel, daß weder in den »Beiträgen zur Geologie Australiens« noch im »Journal der Expedition von der Moreton-Bay nach Port Essington« von Trebatsch oder der Oberspree die Rede ist.
Drittes Kapitel Die Prüfung
An der Dreiulmen genannten Stelle wo die von Arndtsdorf, Schwedenow und Görtz herkommenden Waldwege sich zu einem vereinigen, stand, wie alte Meßtischblätter ausweisen, noch zu Anfang unseres Jahrhunderts das Lieproser Armenhaus, in dem (als es noch keines war) von 1804 bis 1810 der dem Leser schon bekannte Historiker, Romancier und Lyriker gelebt und dort seine wichtigsten Spätwerke verfaßt hatte: die dreibändigen »Denkwürdigkeiten der Koalitionsfeldzüge bis zum Baseler Frieden«, die Kampfschrift »Der Friedensbund«, den Gedichtband »Verwelkter Frühlingskranz« und die Romane »Barfus«, »Rusticus« und die »Geschichte Emils des Deutschen«. Die Ulmen (»fröhlich drängt ihr, ihr Starken, aus kräftigen Wurzeln hinauf in die Freiheit des Äthers«, heißt es in dem Gedicht »Mein Heim« über sie) hatten schon zu Zeiten Franz Roberts, des ersten Schwedenow-Forschers nicht mehr gestanden, das Haus, das nie eine Gedenktafel geziert hatte, war nach dem Ersten Weltkrieg, als das Dorf sich bis an den Spreearm ausgedehnt hatte, zu Bauzwecken abgerissen worden. Um das Fundament zu finden, hatte Pötsch graben müssen.
Im Dunkeln stand er mit Menzel zwischen den Kiefern und erklärte die Aussicht, die man vor 170 Jahren, als die Hänge noch waldfrei gewesen waren, gehabt haben mußte, wenn man aus der Tür trat: in der Mitte das Dorf, unter Linden versteckt, links der Krautsee, zu dem der damals noch schiffbare Flußarm sich erweiterte, rechts das Schloß auf der von Spree, Spreearm und Burggraben gebildeten Insel. Das Armenhaus übrigens (der Ziegelform nach zu urteilen vor 1730 gebaut) entsprach in Maßen und vermutlichem Äußeren genau dem im »Emil« beschriebenen. Sogar Reste der Geißblattlaube, in der das entscheidende Gespräch Emils mit seinem Vater stattfand, glaubte Pötsch entdeckt zu haben.
Er konnte fließend und anschaulich reden, wenn es um Details ging, und er vollbrachte das Wunder (ohne freilich zu wissen, daß es eins war), den Professor zum schweigenden Zuhörer zu machen.
Menzels Interesse war groß, größer allerdings seine Angst vor Erkältung. Schon spürte er auf den Schultern die Nässe, und da seine Frau, die im Auto geblieben war, in Minutenabständen die Hupe betätigte, drängte er bald zum Aufbruch.
Minuten später hielten sie auf der breiten Allee inmitten des Dorfes, wo im Schein spärlicher Straßenbeleuchtung die Umrisse von Pfarrhaus, Kirche und altem Herrenhaus durch beschlagene Scheiben bewundert werden konnten. Genau an dieser Stelle, so erläuterte Pötsch, sprang der junge Graf Barfus aus der Kutsche, als er aus Frankreich heimkehrte und das Schloß in Flammen stand. Und an dieser Linde dort rechts mußte der 20jährige Max im Finstern gelehnt haben, wenn er von Schwedenow herübergeschlichen war, um wenigstens den Schatten Dorettes am Fenster des Pfarrhauses sehen zu können. Den Fußpfad aber zum Trebatscher Wäldchen, wo Dorette sich ihm mit den Worten »Nun bin ich ganz dein und auf ewig« anverlobt hatte, gab es nicht mehr; dort vorn, wo der neue Laden jetzt stand, mußte er abgezweigt sein. Das Wäldchen war erst kürzlich dem Bau eines Silos gewichen.
Nach jahrelangen Studien auf einen Menschen getroffen zu sein, der deren Gegenstände so genau wie man selbst kannte, war für Menzel und Pötsch gleichermaßen ein denkwürdiges Ereignis, vergleichbar der Freude des Reisenden, der, sprachunkundig, in der Fremde einem Landsmann begegnet, der ihn versteht, mit dem er reden kann, als sei er zu Hause, der auch Untertöne begreift, bei dem jeder Witz, jede Anspielung ankommt.
Sie redeten über Max und Dorette, über Graf Barfus, über Emil und den Obristen wie über gemeinsame intime Bekannte, beschworen (in Andeutungen nur, mehr war nicht nötig) Gespräche, Abenteuer, Gesten und Mienenspiele in einem Ton herauf, als tauschten sie eigne bewahrenswerte Erinnerungen aus. Gedichtzeilen wurden von einem begonnen, vom andern triumphierend beendet. Der Forschung offengebliebene Fragen wurden gestellt, und die Meinungen dazu kurz umrissen. War Schwedenow, wie die Pariser Tagebuchnotiz vermuten ließ, Robespierre tatsächlich begegnet? War mit der »Hohen Frau« die Gräfin Liepros oder vielleicht die Königin Luise gemeint? Wo waren die letzten Tagebücher geblieben? Wer war der Freund, der die Briefe des Nachlasses herausgab? Wann genau war der Verehrte gestorben, wo begraben?
Die Freude an diesen Gesprächen war beiden gemeinsam, verschiedenartig aber waren die Antriebe dazu. Während sich bei Pötsch nur angestautes Mitteilungsbedürfnis frei machte, waren bei Menzel vom ersten Moment an Zwecke wirksam. Das scheinbare Redechaos wurde von ihm unauffällig gelenkt. Die Fragen, die er aufwarf, ohne sie direkt an Pötsch zu stellen, waren Prüfungsfragen. Er testete den potentiellen Bundesgenossen. Und dieser bestand, wenn auch nicht auf allen Gebieten gleichmäßig, so doch im Ganzen glänzend. Die Erwähnung selbst drittrangiger Nebenfiguren machte keine Erklärung nötig, jede Jahreszahl, jeder Handlungsort wurde richtig zugeordnet, auch sozialgeschichtliches und politisches Wissen war immer parat. Schwächen zeigten sich bei Pötsch nur, wenn es um Geschichtsschreibung, Philosophie und außerdeutsche Literatur ging. Biographische Details dagegen und deren Widerspiegelung im Werk beherrschte der Prüfling besser als der Prüfer. Doch das übersah der Professor.