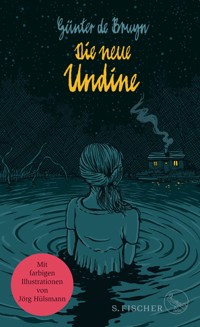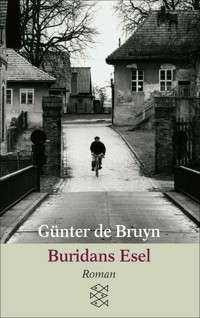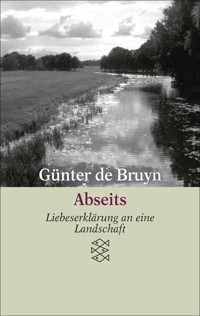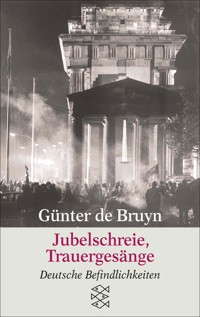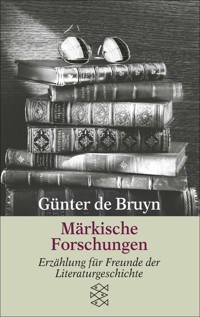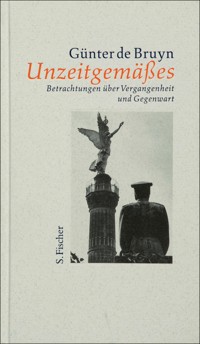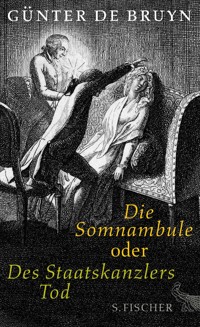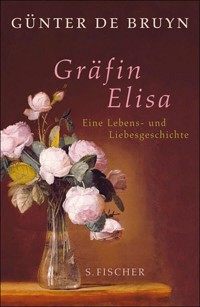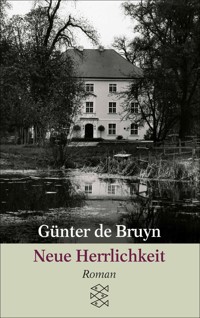
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Günter de Bruyns kunstvoll komponierter Roman über Anpassung und Karriere Viktor Kösling »ist gewöhnt, der zu sein, der gewünscht wird.« Wie aber steht es um die eigenen Wünsche? Biegsam bis zur Selbstaufgabe, verzichtet Günter de Bruyns Anti-Held auf eine geliebte Frau und den Doktorgrad und begibt sich geradewegs ins Establishment der DDR. Am Anfang seiner Diplomatenlaufbahn steht die endgültige Anpassung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Günter de Bruyn
Neue Herrlichkeit
Roman
Biografie
Günter de Bruyn, 1926 in Berlin geboren, lebt im brandenburgischen Görsdorf als freier Schriftsteller. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Heinrich-Böll-Preis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Johann-Heinrich-Merck-Preis. Zu seinen wichtigsten Werken gehören u.a. die beiden kulturgeschichtlichen Essays ›Als Poesie gut‹ und ›Die Zeit der schweren Not‹, die autobiographischen Bände ›Zwischenbilanz‹ und ›Vierzig Jahre‹ sowie die Romane ›Buridans Esel‹ und ›Neue Herrlichkeit‹.
Impressum
Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hensinger
Coverabbildung: Barbara Klemm
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403241-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Die große Familie
Des Vaters Sohn
Thilde, noch gesichtslos
Ein Dauergast
Der Mutter Sohn
Arbeitsbeginn
Titas Tour
Schnee und Grog
Von der Allmacht der Wünsche
Ein Brief, unvollendet
Die Spielerin
Vorteile der Ofenheizung
Der Seelen Harmonien
Pfefferminzlikör
Arbeit und Liebe, dialektisch gesehen
Plauderei am Kamin
Betrogene Betrüger
Fröhlicher Notstand
Neue Traurigkeit
Blickwechsel
Das Duell
Übrigens
Der Antrag
Die Gesegnete
Das Ja-Wort
Nachtfahrt
Schlösser und Gärten
Abwasch
Lerchengesang
Hoher Besuch
Sonntagsausflug
Abschiedsqualen
Amtliches
Maiental
Genesung
Die große Familie
Bevor Viktor selbst den Lesern vorgestellt wird, hören sie über ihn reden. Olga will von seiner Natürlichkeit wissen, kann aber diesen vieldeutigen Begriff nicht näher erläutern, da Max, der dem Drang, ihr zu widersprechen stets nachgibt, in diesem Fall aber nichts Widersprüchliches weiß, weil auch er Viktor nur aus Erzählungen anderer kennt, zumindest im Ton des Widerspruchs sagt: »Warten wirs lieber ab«, worauf Olga entgegnet: »Eingebildet jedenfalls ist er nicht.«
Am Küchentisch wird das gesagt, wenige Stunden bevor Viktor ankommt. Über Gäste kann hier geredet werden, weil die zur Mittagszeit keinen Zutritt haben. Obwohl das nirgends geschrieben steht, weiß es jeder, und Neulinge, die es nicht wissen, versuchen eine Störung nur einmal, weil sie vor den eisigen Gesichtern, die sie zu sehen bekommen, erschrecken.
Man könnte die neun Leute, die dort versammelt sind, für eine große Familie halten, und weil sie zusammen wohnen und zusammen essen, sind sie das in gewissem Sinne auch, in verwandtschaftlichem aber nicht oder nur teilweise: eine Familie, die aus Bruchstücken mehrerer Familien besteht. Miteinander verwandt sind erstens: Tita und Thilde, zweitens: Max und Püppi, und drittens: Olga, Püppi, Gabi, Thomas und Manuela. Verwandtschaftslos ist nur einer, Sebastian, der Gärtner, der Haupt- und Barthaar wachsen läßt wie es will, obwohl es ihn manchmal stört, beim Essen der Tomatensuppe zum Beispiel, die mundnahe Bartteile rötlich färbt.
An der Stirnseite des Tisches sitzt Max, der Chef, dem später zu Viktor doch noch Abwertendes einfällt: Der ist einer, der Bedingungen stellt. Zweimal hat Viktors Mutter telefonisch um ein stilles Zimmer für ihren Sohn gebeten, und das ist für Max zweimal zuviel. »Der wird von mir noch verlangen, den Kühen das Maul zuzubinden, damit er Ruhe zum Schreiben hat«, sagt Max, während er Püppi, die auf seinen Knien sitzt, zu füttern versucht.
Püppi hat selten Lust zum Essen, und auch wenn es heißt: Noch einen Löffel für Pappi! preßt sie die Lippen zusammen und schlägt nach dem Löffel, so daß Gabi die Suppe vom Fußboden aufwischen muß, während Max über sein drolliges Mädchen lacht. Mit seinen himmelblauen Augen blickt er auffordernd umher, doch findet sich keiner, der mitlachen will.
Besonders Fleisch, das Max für die Grundlage der Kindernahrung hält, ist Püppi zuwider. Erst wenn Max es vorgekaut und auf den Löffel zurückgespuckt hat, ißt sie es, ohne Wohlbehagen zu zeigen. Aber das zeigt sie nie, höchstens zufriedenen Gleichmut. Ihr Heulen dagegen ist laut und wild. Es setzt sofort ein, wenn Max sich drei Schritte von ihr entfernt. Denn Püppi ist ganz Pappis Kind. Nur wenn sie schläft, sieht man ihn ohne sie. Er ist stolz auf diese Anhänglichkeit, die aber wohl mehr Schutzbedürfnis ist. Olga, die Mutter, hat wenig Zeit für sie, und Gabi und Thomas benutzen jede Gelegenheit, sie zu quälen. Kaum dreht Max sich um, reißt Gabi ihr schon ein blondes Kräuselhärchen aus, oder Thomas bedroht sie mit einer Nadel. Schreien kann die dreijährige Püppi gellend, nur sprechen nicht. Olga führt das auf Verwöhnung und Faulheit zurück. Wenn Thilde Max rät, mit der Kleinen zum Arzt zu gehn, sagt er: »Warum soll sie reden, wenn sie nicht will; ich versteh sie auch so.«
Rechts und links von Max, auf den ersten Plätzen der Längsseiten also, sitzen Gabi und Thomas. Sie sind Zwillinge, sehen aber nicht so aus, was Max dazu veranlaßt, ihre Herkunft von nur einem Vater immer mal wieder zu bezweifeln. Auch das Witzwort, daß einer allein so frech gar nicht sein könne, fällt ihm oft ein, obwohl es unpassend ist, da Gabi niemals frech ist. Sie bemüht sich ständig darum, Maxens Zuneigung zu gewinnen, hat aber keinen Erfolg damit. Da sie freiwillig jede Schmutzarbeit übernimmt, denkt Max, daß sie sie gern macht und hält Dank für überflüssig. Auch Olga kommt nie der Gedanke, Gabis Fleiß zu loben. Das pummlige Mädchen gern zu haben, ist aber auch schwer. Sie ist albern und schmuddelig. Wenn Sebastian, der Gärtner, ihr mal aus Mitleid über das Haar streicheln will, schmiegt sie sich unter babyhaftem Getue an ihn, so daß es ihm peinlich wird und er die gute Absicht vergißt. Da sie nicht wie ihr Bruder Thomas fähig ist, in der Schule ihre Unwissenheit zu verbergen, muß sie die sechste Klasse noch einmal machen.
Thomas hat in seinem ständigen Krieg mit Max Wendigkeit lernen müssen – um zu überleben, kann sagen, wer Max über ihn reden hört. Denn Max spricht oft von seiner Angst, den Jungen mal totzuschlagen, wenn der ihm Wasser in den Autotank gießt oder die Heubodenleiter ansägt. »Der Himmelhund«, sagt er, wenn Schnapsgenuß ihm Tränen des Selbstmitleids in die Augen treibt, »wird mich zugrunde richten.«
Thomas gibt zu, daß er das vorhat. Er prahlt mit der Grausamkeit seiner Wünsche. Genußvoll malt er Unglücksfälle aus, bei denen Max qualvoll ums Leben kommt. Dabei führt er vor, wie lässig er zu rauchen versteht. Angeblich schmecken ihm die Zigaretten am besten, die er nicht im Laden, sondern aus Maxens Tasche stiehlt. Erst einmal hat Max ihn ertappt. Stolz zeigt Thomas seine Rückennarben. Tränen sind auf seinem sommersprossigen Gesicht nie zu sehen.
Sein Tischnachbar ist der bärtige Sebastian, der bei jeder Mahlzeit vergeblich versucht, die ihm gegenüber sitzende Manuela zu einem Gespräch zu verführen. Im Gegensatz zu ihrer Halbschwester Püppi kann sie zwar sprechen, macht aber in der Küche keinen Gebrauch davon. Sie kommt mit Kopfschütteln und -nicken aus und hat für Spötter ein verächtliches Phh! parat. Ob sie so hübsch ist, wie Olga behauptet, kann man nicht feststellen, da sie ihr Gesicht immer hinter einer dicken Schminkschicht verbirgt. Ihre Körperformen dagegen zeigt sie gern unter engen Hosen und Blusen, und anerkennende Kommentare dazu können sie zu einem flüchtigen Lächeln bewegen. Daß sie im Sommer, wenn sie die Schule verläßt, Stewardeß bei der Interflug werden will, weiß jeder, da Olga oft genug davon spricht. »Auf dem Strich wird sie landen«, sagt Max dazu und verweist auf die Görtzer, Prötzer und Schwedenower Burschen, die auf knatternden Mopeds das Haus umkreisen, wenn Manuela es nicht verlassen darf.
»So streng wie ich als Tochter gehalten wurde, halte auch ich meine Tochter«, sagt Olga, die, am weitesten von Max entfernt, an der linken Stirnseite sitzt. »Als Mutter bin ich so streng, wie meine Mutter zu mir war.«
Alles, was Olga sagt, gerät ihr durch Wiederholung zu lang, besonders dann, wenn Alkohol sie beflügelt. Das ist oft der Fall, wird aber nicht immer bemerkt, weil sie heimlich trinkt und sich in der größten Trunkenheit noch beherrschen kann. So gut kann sie das, daß man sich fragt, was sie von ihrem Rausch eigentlich hat, wenn sie ihren Hemmungen nie gestattet, sich zu lösen. Alle Mitarbeiter (aber nicht die Gäste) wissen natürlich von ihrem Alkoholverbrauch, und sie weiß, daß sie es wissen, läßt aber trotzdem die Bremsen in sich niemals los. Wenn sie befürchtet, daß ihre Schritte torkelig werden, macht sie eben keine, und wenn die Zunge Lähmungserscheinungen zeigt, kann sie auch schweigen. Sie raucht sehr viel. Eine Zigarette zündet sie an der anderen an. Erstaunlich ist, wie gut ihr schmaler Körper das verträgt. Trotz der vier Kinder sieht sie noch wohlerhalten aus. Alt wirken nur ihre Lippen, die dünn wie Striche sind.
Verheiratet sind Max und Olga nicht. Sie heißt Frau Kranz und er Herr Brüggemann. In wilder Ehe leben sie, sagt man im Dorf. »Heiraten?« sagt Max, »die? mit ihrer Brut? Dann lieber gleich ’nen Strick.«
Das sagt er aber nicht bei Tisch. Da weiß er, wenn nicht gerade Wut ihn packt, sich zu benehmen, Titas und Thildes wegen, die rechts und links von Olga sitzen, Tita neben Sebastian, Thilde auf der anderen Seite.
Der Name Tita heißt soviel wie Oma. Thilde hat ihn als Kind erfunden, warum weiß niemand mehr. Jeder im Haus nennt sie nur so. Mancheiner weiß gar nicht, daß sie Frau Lüderitz heißt. Vierundachtzig Jahre ist sie alt. Bevor Max kam, hat sie das Regiment im Haus geführt. Unbestrittene Autorität besitzt sie immer noch. Die Pünktlichkeit zum Beispiel ist ihr Werk. Ihren Blick zur Küchenuhr fürchtet jeder Bummelant und fühlt sich zu Entschuldigungen verpflichtet. Veränderungen an Gebäuden wagt Max ohne ihre Zustimmung nicht vorzunehmen. Er fragt sie auch sonst um Rat, obwohl er oft nur wirres Zeug zur Antwort kriegt, weil sie ihn nicht versteht. Sie hört schwer. Darauf verlassen kann man sich aber nicht. Juristisch gesehen gehören Haus und Hof noch immer ihr. Sie hat fast ihr ganzes Leben hier verbracht; ihre Enkelin, die Thilde, auch.
Die will an Viktors Ankunftstag noch wissen, welches Zimmer sie dem neuen Gast herrichten soll. Max hat die Giebelstube vorgesehen. Nächtlicher Schreibmaschinenlärm von dort, sagt er, könnte nur Tita stören, doch die hört ja nichts.
Des Vaters Sohn
Um etwa dieselbe Zeit hat Viktor den ersten Abschied von seiner Mutter (der in der Wohnung stattfand) schon hinter sich; der zweite (der auf der Straße) steht ihm noch bevor. Er hätte ihn gern verhindert, fand aber den Mut nicht dazu. Dieses Abschieds wegen versäumt seine Mutter den Dienst, was ein Opfer für sie bedeutet. Ein ausführliches Zeremoniell hat sie sich damit verdient.
Aus dem dreizehnten Stock befördert der Lift sie nach unten. Viktor blickt, wie es sich im Fahrstuhl gehört, auf den Etagenanzeiger über der Tür; die Mutter aber sieht ihren Sohn an: ein wenig verliebt, ein wenig besorgt und nicht ohne Spott. Viktor kennt diesen Blick und weiß ihn zu deuten. Nur Verliebt- und Besorgtheit sind echt; das Spöttische ist darübergelegt, um Distanz zu bekunden. Eine moderne Frau, wie sie sie versteht, hat zwar Gefühle, darf sie auch zeigen, muß aber deutlich machen, daß sie beherrschbar sind. Tränen werden also von einem Witzwort begleitet, Depressionen fachmännisch erklärt, und wenn sie ihrem Äußeren Jugendlichkeit zu geben versucht, fehlt nie der Hinweis auf die Eitelkeit alter Frauen.
Wie Viktor befürchtet hat, hängt sich Agnola (so heißt sie und so läßt sie sich von ihrem Sohn auch nennen) auf der Straße an seinen Arm. Da sie kleiner ist als er, ihr Haar kurz trägt und ihre Lebhaftigkeit für ein sichtbares Zeichen des nicht alternden Herzens hält, bildet sie sich ein, daß alle Leute Mutter und Sohn für Schwester und Bruder halten. Ihre Verehrer bestätigen ihr das; doch nimmt Viktor an, daß sie ihnen das vorher suggerierte. Sie braucht Bewunderung und weiß sie, wenn nötig, zu provozieren. Auch ihren Sohn hat sie zu diesem Dienst angelernt. Besonders in Gesellschaft besteht seine Aufgabe darin, die Gemeinde der Agnola-Schwärmer zu verstärken. Schwerer als diese Pflicht zu erfüllen, fällt ihm, an die Ahnungslosigkeit seiner Mutter zu glauben. Weiß sie denn wirklich nicht, fragt er sich oft, daß die Verehrung, die sie genießt, nicht ihrer Schönheit und ihrem Charme gilt, sondern der Tatsache, daß sie mit Kösling verheiratet war?
An Agnolas diesbezüglicher Naivität muß Viktor schon deshalb zweifeln, weil es für ihn von Kindheit an ein Problem war, ein Kösling zu sein. Nie hat er sich darüber klar werden können, ob einen bedeutenden Vater zu haben, begrüßens- oder beklagenswert ist. Es erleichtert teilweise sein Leben, kompliziert es aber auch – zum Beispiel dadurch, daß man ihm Antriebe andichtet, die er nicht hat. Freunde und Kollegen, denen sein Vater als Vorbild gerühmt wurde, nehmen natürlich an, daß er für Viktor eins ist. Sie bedenken dabei nicht, daß sich dazu nur eignet, wer hoch und fern genug steht, und sie können nicht wissen, daß Viktor ehrgeizlos ist. Das nämlich hält er, durch schlechte Erfahrung mit Vater und Mutter gewitzigt, geheim. Er will sich nicht lenkend und leitend über andere erheben; ihm genügt es, mit ihnen auskommen zu können.
Das bereitet ihm immer Schwierigkeiten, die für ihn stets mit seinem Vater zu tun haben, ob sie nun ursächlich mit ihm zusammenhängen oder nicht. Denn er muß sich immer fragen, ob Leute wissen, wessen Sohn er ist, und wenn sie es wissen, ob sie ihn trotz oder wegen des Vaters freundlich oder eklig behandeln. Nicht daß der Schatten des Vaters Viktors Eigenlicht verdunkelt, ist sein Problem, sondern die Ungewißheit darüber, ob der Schatten ihm Schutz gewährt oder nicht.
Natürlich wachsen die Schwierigkeiten, wenn er, was selten geschieht, vertraute Kreise verläßt und sich unter Menschen begibt, die, wenn er seinen Namen sagt, »Kösling? Wie Kösling?« fragen, ohne an Verwandtschaft dabei zu denken. Erklärt er dann, wie er zu dem Namen kommt, gilt das als Angeberei, verschweigt er es aber, als Heimtücke.
Solange er (nicht seiner Natur, sondern konventionellen Vorstellungen über das Jungsein folgend) das Leben noch für ein Abenteuer hielt, das zu bestehen um so ehrenvoller ist, je schwieriger es in ihm zugeht, redete er sich noch ein, gern unter Leuten zu sein, die von seiner Herkunft nichts ahnten und ihn nur nach dem beurteilten, was sie von ihm hörten und sahen. Da ihm das manchmal Nichtbeachtung einbrachte, wurde ihm früh schon klar, daß es gegen Vernunft zu handeln heißt, sich unnötigerweise Situationen auszusetzen, denen man nicht gewachsen ist. Er bewegt sich also lieber auf vertrautem Terrain, wo man weiß, wer er ist, und verläßt sich darauf, der Gefahr, nicht um seiner selbst willen geachtet zu werden, mit Liebenswürdigkeit begegnen zu können.
Dem Vorschlag seiner Mutter, den ihm vom Ministerium gewährten Arbeitsurlaub im Friedrich-Schulze-Decker-Heim zu verbringen, hat er deshalb sofort zugestimmt. Denn dieses Heim ist eine, wenn auch uralte, Einrichtung des Hauses (das heißt des Ministeriums) und bietet also die Gewähr, daß man dort weiß, wen man mit ihm empfängt. Seine Mutter freilich hatte andere Gründe, aus den vielen Möglichkeiten, die ihm offenstanden, gerade diese auszuwählen. Ihr geht es um die Fertigstellung seiner Doktorarbeit (der er diesen Urlaub verdankt), und folglich um Ausschaltung ablenkender Faktoren. Das Heim liegt in einem abgelegenen Landstrich, der im Winter vor sich hin zu dämmern scheint. Die benachbarten Kleinstädte, die ohne Auto schwer erreichbar sind, bieten bestenfalls ein Kino, und die Bezirksstadt ist weit weg. Weil nur wenige, meist ältere Leute, Ruhe so sehr schätzen, daß sie bereit sind, Komfortlosigkeit dafür in Kauf zu nehmen, steht um diese Jahreszeit das Heim fast leer. Geselligkeiten werden also zur Schreibtischflucht nicht verführen.
Auf dem kurzen Weg vom Hochhaus zum Parkplatz bekommt Viktor noch einmal alle Ermahnungen zu hören, die er schon kennt. Der Fahrer zeigt, daß er weiß, wen er fährt, indem er den Wagen verläßt, die Tür öffnet und ein paar freundliche Worte über das schon verstaute Gepäck sagt. Obwohl er der einzige Zuschauer ist, wird Agnola durch ihn zur Schaustellung intensivster Mütterlichkeit animiert. Küsse, Umarmungen, Warnungen, scherzhafte Drohungen finden erst ein Ende, als Viktor sich losmacht und in das Auto steigt. In einer Haltung, die Melancholie ausdrücken soll, bleibt Agnola zurück.
Als Viktor sein Winken beendet, stößt er einen für den Fahrer bestimmten Erleichterungsseufzer aus. Als Erwiderung kommt, wie erwartet, ein Lachen, dem aber vorsichtshalber eine Bemerkung über das erstaunlich Junge der Frau Kösling folgt. Viktor hat aber keine Lust, über seine Mutter zu reden. Er erkundigt sich nach der Gegend, in die er fährt. Der Fahrer findet sie öde; sie liegt, sagt er, Verzeihung, am Arsch der Welt. Agnola hat sie als preußisch-nüchtern bezeichnet und gehofft, daß sie des Sohnes Arbeit stimuliert. Denn die hat mit Preußen zu tun. Viktors Lebensweg, der schließlich in die Diplomatenlaufbahn einmündete, hatte ihn auch durch ein Geschichtsstudium geführt, das ihn durch die längst überfällige Dissertation noch immer beschwert. »Die Außenpolitik der preußischen Regierung während der Französischen Revolution – unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Handwerker- und Bauernunruhen in den Provinzen« lautet ihr Thema, und viel mehr als diese Überschrift weiß Viktor darüber noch nicht. Aber das steht alles in Büchern. Er muß sie nur lesen. Vorgenommen hat er es sich. Durch strenge Disziplin in ländlicher Einsamkeit will er in Wochen nachholen, was er in Jahren versäumte. Der Gedanke an ein asketisches Arbeitsleben, das nur durch Mahlzeiten und einsame Spaziergänge voll schöpferischer Gedanken unterbrochen wird, begeisterte ihn so, daß der Vorschlag, das Fluchtmittel Auto zu Hause zu lassen, nicht von der Mutter, sondern von ihm kam. Er reist also in einem Wagen des Ministeriums, der außer ihm und dem Fahrer noch zwei Wäschekoffer, eine Schreibmaschine und viele Bücherpakete transportiert.
Sie verlassen Berlin in östlicher Richtung, benutzen die Autobahn, biegen von dieser nach Süden ab, und erst nachdem sie mehrere Orte passiert haben, meldet der Fahrer die baldige Ankunft. Die durch einen Sommerweg verbreiterte bucklige Chaussee ist von Apfelbäumen flankiert. Rechts und links breiten sich kahle Felder; dann beginnt Kiefernwald. Da wo ein Sandweg kreuzt und Wegweiser nach Prötz und Schwedenow zeigen, reichen sumpfige Ausläufer eines Sees bis an die Straße. Vereinzelt wächst Schilf unter den Bäumen. Am Waldrand weist der Fahrer nach links. Inmitten der Felder erhebt sich, in einem Kilometer Entfernung etwa, ein Gebäudekomplex aus rotem Backstein. Abweisend kehrt er der Straße die tür- und fensterlose Rückwand zu.
Am Ortseingang von Görtz macht die Chaussee eine Kurve, hinter der bald ein Feldweg abzweigt, der, wie der Fahrer erklärt, Totenweg heißt, weil er zum Friedhof von Prötz führt, auf dem auch die Görtzer begraben. Die Wegränder sind mit Pflaumenbüschen bewachsen. Tiefe Fahrspuren werden Personenwagen gefährlich. Glasscherben und alte Matratzen zwingen zu Ausweichmanövern. Der Weg zum Friedhof scheint auch der zum Müllplatz zu sein. In Windungen schlängelt er sich den Hügel hinauf. Erst wenn man das rote Gebäude erreicht, wird klar, was es ist: ein Gehöft, Scheunen und Ställe sind von drei Seiten um den Hof herum gebaut, auf der vierten steht, die schöne Seite dem Weg zugewandt, das Wohnhaus, einstöckig, mit rundbogigen Fenstern und rosettenverzierter Fassade. Erbaut 1895, ist über der Tür zu lesen. Auch das mit glasierten Steinen gedeckte Dach zeigt, gelb auf dunkelrot, eine Inschrift: NEUE HERRLICHKEIT.
Die Einfahrt links neben dem Wohnhaus ist offen. Das Auto fährt auf den Hof. Max, der, Püppi im Arm, zum Empfang schon bereitsteht, öffnet die Wagentür. »Willkommen, Genosse Kösling«, sagt er. »Gut, daß Sie da sind. Stürme, Kälte, Glatteisregen und Schnee sind angesagt.«
Thilde, noch gesichtslos
Noch ehe Viktor den Fuß auf den Boden der Neuen Herrlichkeit setzt, kann sich das, was Olga später seine Gutherzigkeit nennen wird, glänzend bewähren.
Er sitzt noch im Auto, reicht Max Pakete hinaus und erklärt, warum die so schwer sind: Bücher sind drin, die braucht er für seine Arbeit, deren Anfertigung wegen er hier ist. Er hat mit der Hand zu schreiben so gut wie verlernt, er braucht die Maschine, die leider Lärm macht, weshalb er die Bitte um ein abgelegenes Zimmer wiederholt; er will niemanden stören.
»Selbstverständlich geht das in Ordnung, Genosse Kösling«, sagt Max, nimmt zwei Pakete unter die Arme, zwei in die Hände und geht auf das Haus zu, aus dem Tita, in Mantel und Kopftuch, herauskommt. Eilenden Schritts geht sie auf das Auto zu, schlägt mit dem Krückstock auf Blech und sagt: »Zeit, daß ihr kommt!« Dann drängt sie sich in den Wagen hinein.
Tita ist eine stattliche Frau, groß, nicht dick, aber füllig, gut beieinander, wie sie das nennt. Sie ächzt beim Einsteigen, hat Schwierigkeiten, ihren Stock unterzubringen, und als sie sitzt, sagt sie erleichtert: »So!« Ihr von Falten durchzogenes Gesicht wird bestimmt vom Kinn, das zu spitz und zu lang ist, und auf dem vereinzelt Barthaare wachsen, vielleicht acht bis zehn. Mit ihren kleinen grau-grünen Augen sieht sie Viktor an und sagt streng, aber gutgelaunt: »Es kann losgehen!«
Viktor blickt sich nach Hilfe um, kann aber auf keine hoffen, da auch der Fahrer (mit dem Gepäck aus dem Kofferraum) schon im Haus ist. Püppi, die auf dem Hof zurückgeblieben ist, setzt sich auf den Beton und beginnt zu schreien. Tita knallt die Wagentür zu.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagt Viktor, »ich glaube, Sie sind hier falsch.«
»Wohin, wohin!« entgegnet Tita in einem Ton, als äffe sie jemanden nach. »Wohin wohl? Nach Klein-Kietz natürlich. «
Obwohl Viktor es noch nie mit Schwerhörigen zu tun gehabt hat, begreift er sofort, worum es sich handelt, schreit Tita seinen Satz noch einmal ins Ohr und setzt, als er so etwas wie Verständnis auf ihrem Gesicht sieht, hinzu, daß dies kein Taxi, sondern ein Dienstwagen sei, worauf Tita »Na, wenn schon!« sagt und wie ein trotziges Kind aussieht.
Viktor sieht hilflos aus, und er ist es auch: ein Zustand, in den er oft gerät (weshalb diese Szene, die gleich wieder zu Ende ist, hier auch erzählt wird). Er weiß nicht, wer Tita ist und wo Klein-Kietz liegt, klar ist ihm aber, daß er energischen Menschen, ob jung oder alt, nicht gewachsen ist. Denn die haben Absichten, die sie durchsetzen wollen, und da seine eignen nur darin bestehen, in Frieden mit andern zu leben, muß er nachgiebig sein. Er kann nicht vertragen, wenn man ihm böse ist.
Er schreit also Tita ins Ohr, daß er sehen will, was sich machen läßt, und hat auch den gewünschten Erfolg damit. Sie sagt, milder gestimmt: »Was sein muß, muß sein«, lächelt sogar, und für ihn ist die Welt wieder in Ordnung, allerdings kurzzeitig nur. Denn als er den Fahrer bittet, die Oma noch auf der Heimfahrt in ihr, wer weiß wo gelegenes, Dorf zu fahren, trifft ihn, des drohenden Glatteises wegen, natürlich dessen Zorn, der zwar stumm ist, aber sich mimisch kundtut. Während Viktor noch beruhigend auf den Fahrer einredet: weit kann es nicht sein, da die Alte doch ganz ohne Gepäck ist! wird er der Sorgen schon wieder ledig durch Thildes Intervention. Die öffnet nämlich die Autotür und sagt, nicht sehr laut, aber deutlich artikuliert: »Komm Tita, du bist hier falsch!«
Die Tatsache, daß Thilde zufällig fast die gleichen Worte wie Viktor benutzt, wird später natürlich mit tieferer Bedeutung versehen, jetzt aber fallen Viktor dabei andere Dinge auf: Erstens, daß Thilde das S nicht richtig sprechen kann (sie lispelt nämlich); zweitens, daß ihre durchaus erwachsene Stimme im Gegensatz steht zu ihrem kindhaft-schmalen Körper, den er vom Knie bis zu den Schultern in der geöffneten Autotür sehen kann; und schließlich, daß sie mit ihren Worten erfolgreicher ist als er. Denn Tita sagt »O jemine!« und quält sich aus dem Auto wieder heraus. Thilde nimmt ihren Arm und geht mit ihr ins Haus zurück. Viktor kann die beiden noch ein paar Sekunden sehen, von hinten allerdings nur. Das Gesicht, das sich seinem Blick bisher noch entzogen hat, versucht er sich vorzustellen. Dergleichen kann er gut.
Ein Dauergast
Agnola hat recht gehabt: das Heim ist tatsächlich fast leer. Außer Viktor beherbergt es momentan nur zwei Gäste. Auf dem Rundgang, den Max mit ihm macht, lernt Viktor sie kennen.
Im Obergeschoß des linken Seitengebäudes, das früher Stall war und wo sich jetzt Küche und Speiseraum befinden, wohnt, neben den Zimmern von Max und Olga, Herr Köpke, ein rundlicher Glatzkopf, der im Urlaub immer in Grün geht. Viktor glaubt, ihn im Ministerium schon manchmal gesehen zu haben, hat aber dienstlich mit ihm nichts zu tun. Ohne seine Familie verlebt Herr Köpke, wie Viktor erfährt, jeden Jahresurlaub in diesem Heim, immer im Winter, wenn wenig Betrieb ist, auf keinen Fall in den Ferien, wenn seine Kinder ihm folgen könnten. »Wenn Urlaub Sinn haben soll, muß er vor allem Urlaub von der Familie sein«, sagt er, »denn die ist doch anstrengender als der Dienst.« Herr Köpke ist Jäger, seit Jahren Mitglied des Görtzer Jagdkollektivs, an dessen Treibjagden und Festlichkeiten er aber niemals teilnimmt, da Jagen für ihn nur Reiz hat, wenn er allein ist dabei. Im Morgen- oder im Abenddämmern ohne Gesellschaft auf dem Hochstand, sagt er, Schöneres gebe es für ihn nicht. Wenn Herr Köpke nicht ißt, schläft oder jagt, sieht er fern: denn auch das isoliert. Viktor lächelt verwundert, aber nicht ohne Hochachtung, und zeigt für Herrn Köpkes Urlaubseigenarten Verständnis, indem er Fragen nach Hirsch und Reh unterdrückt und den Grünrock bald wieder allein läßt.
Die ehemalige Scheune, die dem Wohnhaus gegenüber steht, dient als Garage und Werkstatt. Zwischen ausgebauten Motoren und Karosserieteilen stehen zweieinhalb Autos. Das eine gehört Max und die anderthalb auch, aber nur vorläufig. Bekannte haben sie zuschanden gefahren, und Max, dumm wie er ist, hat sie ihnen abgekauft, für viel zu viel Geld. Wenn er sie repariert und wieder verkauft, wird der Verlust enorm sein, selbst wenn man die Arbeitsstunden nicht rechnet. Immer wieder, sagt er und verzieht wie vor Schmerz das Gesicht, nutzen sie seine Gutmütigkeit aus, die Halunken (die er aber nicht näher benennt). Auch die Kühe, die im rechten Stall, unter dem Heuboden, stehen, machen ihm Kummer. Milch, sagt er, richtige fette gelbe, wie es sie zu kaufen nicht gibt, wollen sie alle von ihm, aber helfen will keiner.
Versprechungen in dieser Hinsicht macht Viktor nicht, aber daß er die Schwere der Arbeit anzuerkennen weiß, bringt er zum Ausdruck. Er lobt auch den Stallduft und, später auf dem Hof, die tierische Wärme, die er anheimelnd nennt. »Wie gesund du hier aufwächst!« sagte er zu Püppi, die, im Vaterarm geborgen, die Männer begleitet. Das Kind reagiert nicht darauf, der Pappi aber strahlt, und Viktor weiß nun den Weg, der in Maxens Herz führt.
Durch kalten Wind, der Nieselregen mitbringt, eilen sie ins Wohnhaus zurück. Dessen Parterre wird in der Mitte durch einen Flur geteilt. Nach Prötz zu liegen die Zimmer von Tita und Thilde, auf der Seite nach Görtz Büro und Aufenthaltsraum, wo auch Telefon- und Fernsehapparat stehen. Ganz oben unter dem Dach wohnt Sebastian, der Gärtner, im ersten Stock sind die Gästezimmer, die, bis auf zwei, jetzt leerstehen. In einer der Giebelstuben, genau über Titas Zimmer, wohnt Viktor. Das Zimmer, das der Treppe am nächsten liegt, gehört Frau Erika, die Max »unser Dauergast« nennt, als er sie, die in der offenen Tür schon gewartet hat, Viktor vorstellt.
Frau Erika kennt den neuen Gast bereits aus früheren Zeiten. Drei oder vier Jahre alt wird er gewesen sein, als sie ihn zum letztenmal sah, damals, als ihr Gatte noch lebte und Jan (das ist Viktors Vater) mit Agnola noch verheiratet war. Ein putziges Männlein ist Viktor gewesen, und jetzt ist er schon groß, so stattlich und hübsch, mit einem Bärtchen, das ihm gut steht, nur so blaß ist er, dünn und blaß wie ein Prinz, wie Prinz Hamlet vielleicht. Nein, wie die Zeit vergeht! Man kommt mit dem Altern gar nicht recht nach, sagt sie und lacht, weil sie weiß, wie frisch sie noch aussieht mit ihrem sorgfältig blondierten Haar, das freilich ein bißchen dünn schon ist.
An beiden Händen zieht sie den jungen Mann in ihr Zimmer. Er und Max müssen sich setzen. Milch bietet sie an (die Max aber verschmäht) und Kekse aus einer Kristall-Bonbonniere. »Nun erzählen Sie mal«, sagt sie zu Viktor, »wie es Ihnen in all den Jahren ergangen ist, und was die arme Agnola macht, und ob sie noch immer so schön ist.« Aber Zeit zum Erzählen läßt sie Viktor dann nicht, weil ihr Mitteilungsdrang mit ihr durchgeht und sie immerfort selbst erzählt, so daß Viktor nach zwei Glas Milch alles Wissenswerte über sie weiß.
›Alle im Haus reden sie, auf ihren Wunsch hin, nur mit Frau Erika an. Mit ihrem langen Nachnamen fühlt sie sich als Individuum nicht genügend bezeichnet. Wer Schulze-Decker hört, denkt an den antifaschistischen Helden und späteren Minister, nach dem das Heim heißt, nicht aber an sie, die nichts war als des Ministers Gemahlin. Mit fremden Federn will sie sich nicht schmücken. In ihren Reden kommt deshalb ihr Mann auch nur selten vor – was Max, wie er später mal sagt, empört, weil sie doch des Helden Rente verzehrt, die Olga beträchtlich nennt, Max aber riesig. Er schlußfolgert das aus der Höhe der Trinkgelder, die sie den Kindern zusteckt, wenn sie ihr Leinöl und Hefe aus dem Dorf-Konsum holen, und aus dem überhöhten Milchpreis, den sie Max freiwillig täglich zahlt, wobei sie, wenn er zum Schein protestiert, Geld immer wieder abwertend als irdisch Gut bezeichnet.
Die Hefe ißt sie ohne Zutaten, das Leinöl mit Quark, den sie selbst herstellt. Die Instrumente dazu (Krüge, Leintücher und eine Kochplatte) führt sie Viktor, den das sehr interessiert, vor. Mehr Nahrungsmittel als diese braucht Frau Erika nicht. Ihr Körper würde verschlacken, äße sie mehr; so aber bleibt er inwendig geschmeidig. Dem Tabak, dem sie früher verfallen war, hat sie entsagt. Das einzige Gift, von dem sie nicht lassen kann, ist der Kaffee. Den kocht sie sich alle zwei bis drei Stunden. Das Helgalein sorgt für den Nachschub, den es aus Berlin mitbringt, wenn es, an jedem Wochenende, die ältere Schwester besucht. Das Helgalein hütet auch die große Berliner Wohnung, die Frau Erika nur zum Übernachten dient, wenn Staatsfeiertage ihre Anwesenheit in der Hauptstadt erfordern. Von ihrem Tribünenplatz herab macht sie sich durch heftiges Winken bemerkbar, weil sie weiß, daß die Bewohner von Görtz, Prötz und Neue Herrlichkeit vor dem Fernseher sitzen und aufpassen, ob sie sie sehen können. Lange aber hält es sie in Berlin nie, weil die Menschen dort keine Zeit füreinander haben.
Ihr Heim ist das Heim. Hier hat sie Kontakt zu Natur, Mensch und Tier. Ihr Heim-Zimmer hat ihr das Helgalein eingerichtet, ganz nach ihren Bedürfnissen und nach ihrem Geschmack. Kühlschrank, Kaffeemaschine und Kochplatte sind hinter einem Vorhang versteckt. Neben der Bett-Couch steht ein Plattenspieler, aus dem gedämpft Operettenmelodien erklingen. Ein Regal ist gefüllt mit Puppen aus allen Ländern der Welt. Die brachte sie mit, wenn sie ihren Mann früher auf Reisen begleitete. Aus dem Ausland stammt auch der elektrische Ofen, der wie ein Kamin aussieht; schaltet man ihn ein, glühen erstaunlich echt flackernde Holzscheite auf. Die Wände sind mit Fotos geschmückt, die alle eine jüngere Erika in verschiedenen Verkleidungen zeigen. Schauspielerin ist sie gewesen, bevor sie Ministersgattin wurde. Dem bewundernden Viktor kann sie noch alle ihre Rollen erläutern. Nur die Texte weiß sie nicht mehr. So schnell sie sie lernte, so schnell hat sie sie wieder vergessen. »Das Wesen des Lebens, mein Prinz«, sagt sie, »ist seine Vergänglichkeit, die aber anders betrachtet auch seine Unvergänglichkeit ist.«
Krank ist Frau Erika nicht, aber gesund auch nicht. Sie ist leidend. Sie leidet an kalten Füßen und kalten Händen, an Herzklopfen, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. Wenn sie nachts wach liegt, denkt sie über die Seele nach, die sie meint, wenn sie von Unvergänglichkeit redet. Denn Seelen sterben nicht, sie nehmen nur Ortswechsel vor. Wenn unser Leib dahin ist, wie Frau Erika das nennt, wandert die Seele aus in andere Körper, die gerade geboren werden, seien sie Mensch oder Tier. Die Umsiedlung erfolgt nach Verdienst. Die Seele eines Menschen zum Beispiel, der, wenn er wütend ist, Kühe schlägt, wie Max das tut, kann auf keine bessere Behausung als den Körper einer Kellerassel hoffen. Wo Frau Erikas Seele vorher gewesen ist, weiß sie zwar nicht, doch sind dunkle Erinnerungen an ein Vorleben in ihr vorhanden. Deutlichere Ahnungen noch als sie sie bisher hat, kann jeder haben, nur tief genug in sich hineinschauen muß er können. Doch das kann man lernen, davon ist sie überzeugt, man braucht nur Geduld.
Püppi hat nicht einmal genug Geduld, Frau Erika zuzuhören. Sie gibt Laute von sich, aus denen Max schließt, daß sie nach Aufbruch verlangt. In höflicherer Form gibt Viktor dasselbe zu verstehen: Er muß noch auspacken, sich einrichten und dann sofort mit der Arbeit beginnen, denn zehn Wochen hat er doch nur. In den Pausen aber, verspricht er abgehend, wird auch er in sich nach der Vorgeschichte seiner Seele forschen – was Frau Erika freut.
Als er allein in seinem Zimmer ist, probiert er die Innenschau tatsächlich aus, aber ohne Erfolg. Obwohl er die Augen schließt, um sich ganz auf Seelisches konzentrieren zu können, sieht er sich nur von außen: wie er da traurig am Ofen lehnt, in einem engen, schäbigen Zimmer, in das er für Monate verbannt ist, freudlos, mutterseelenallein, und auf den Sturm draußen hört, der trotz des geschlossenen Fensters die Gardine bewegt und mit kaltem Hauch auch seinen Bauch noch trifft, während sein an die Kacheln gepreßtes Hinterteil bald zu glühen scheint. Erinnerungen kommen ihm zwar auch, doch nicht solche, die Frau Erika meint; seine haben mit der Berliner Wohnung, mit Essen, Geselligkeit, warmen Getränken, warmen Bädern und warmen Stuben zu tun.