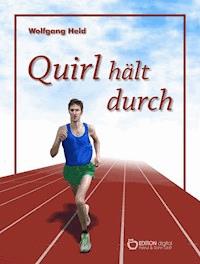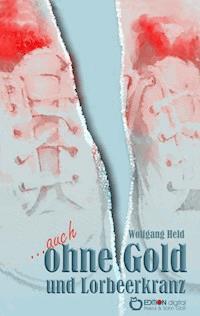6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im westlichen Teil der Sahara liegt die Oase El paraiso. Aber kein Karawanenführer lenkt seine Kamele dorthin. El paraiso - das ist kein Paradies, sondern die Hölle. Dort leben Männer, für die es keine Rückkehr in die Freiheit gibt. Nur einem einzigen Menschen, dem Sträfling Fred Laurenz, gelingt die Flucht. Krank und fast wahnsinnig vor Durst, schleppt er sich durch die Wüste. Die Schergen des spanischen Generals Franco jagen ihn auf seinem Weg zum Mittelmeer. Dort wartet schon einer der fähigsten Mitarbeiter der deutschen Geheimpolizei, um ihn für immer zum Schweigen zu bringen. Doch Laurenz weiß, dass er durchhalten muss, denn er hat Kenntnis bekommen von einem ungeheuerlichen militärischen Geheimnis - und wenn er versagt, droht der Menschheit tödliche Gefahr. Buch zu dem Dreiteiler für das Fernsehen der DDR (1973 Premiere)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Held
Das Licht der schwarzen Kerze
ISBN 978-3-95655-803-0 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1980 als Heft 194 der Reihe „Das Taschenbuch“ im Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2020 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
I
Ein Stakkato von schrillen Pfeiftönen stach in die salbungsvolle Rede des Monsignore Piadosa, der über Radio Madrid seine allwöchentliche Erbauungspredigt in den Äther schickte. Mehr als zweitausend Kilometer trennten ihn von einem Mann namens Menuda, der zu den anhänglichsten Hörern der Sendungen zählte. Ärgerlich schnaufend wälzte sich dieser Mann jetzt auf dem Diwan, streckte den Arm aus und fingerte an den Knöpfen des Kurzwellenempfängers, bis die Worte des fernen Geistlichen wieder klar und gewichtig aus dem Lautsprecher tropften.
Juan Menuda rollte zurück in die bequeme Rückenlage. Er kratzte seine nackte, behaarte Brust und lauschte andächtig. Monsignore Piadosa sprach von den stillen Taten der Nächstenliebe. Er nannte sie den Schlüssel zum Paradies. Obwohl Menuda es von Kindheit an gegenüber einem kirchlichen Würdenträger nie an Ehrfurcht und Bewunderung hatte fehlen lassen, überzog jetzt ein breites Grinsen sein braunes Gesicht. Er fand, dass sich der fromme Mann in Madrid, was das Paradies anging, recht ungenau ausdrückte.
El paraiso – das Paradies – hieß eine in nur wenige Landkarten eingezeichnete Oase der spanischen Kolonie Rio de Oro an der Westküste Afrikas zwischen dem zwanzigsten und dreißigsten Grad nördlicher Breite. In einem Umkreis von fünfhundert Kilometern, eingeschlossen von Wüste und Steppe, schien der Name für diese kleine grüne Insel im heißen Sandmeer beim ersten Anblick durchaus nicht übertrieben zu sein. Einen nie versiegenden Brunnen gab es hier, schattenspendende Dattelpalmen, ein paar kreideweiße Häuser mit Gärten voller Blumen und Früchte und sogar ein Dieselaggregat zur Stromerzeugung. Ausgestattet mit diesen Vorzügen, hätte El paraiso eigentlich für alle Karawanen und nomadisierenden Beduinenstämme zwischen Fort Gouraud weit im Süden und Tindout hoch im Norden so etwas wie ein Magnet sein müssen.
Aber es war nicht so.
Weder Durst noch Hitze konnten einen Scheik oder Karawanenführer bewegen, den Schritt der Kamele zu dieser Oase zu lenken. Nur selten fand der Name des Ortes den Weg über die Lippen eines Moslems, und wenn das wirklich einmal geschah, dann nur hinter vorgehaltener Hand. Wer immer unter der stechenden Sonne der Westsahara von El paraiso hörte, der erfuhr auch, dass es eine Hölle war, in der Juan Menuda herrschte.
Die Sendezeit des Monsignore ging zu Ende. Wie stets, so schloss der Geistliche auch heute seinen Vortrag mit der Aufforderung zum gemeinsamen Gebet. Gehorsam faltete Juan Menuda seine Hände über dem Bauch und murmelte das Vaterunser mit. Als er bei der dritten von den sieben Bitten des Matthäus war, wurde er gestört. Ein hagerer Mann in Korporalsuniform trat durch den Glasperlenvorhang ins Zimmer, erstarrte vorschriftsmäßig und schnarrte: „Perdón, Kommandant, aber unsere Nummer sechshundertzwei …“
Weiter kam er nicht.
„Halt’s Maul!“, fauchte Menuda. „Mitbeten!“
Verblüfft hob der Korporal die Brauen. Er setzte zu einer Erwiderung an, besann sich aber schnell unter dem drohenden Blick Menudas und verschränkte widerwillig die Finger vor seiner Brust. Reglos und mit stummer Empörung wartete er das Amen des Monsignore ab.
„Du wirst mir noch mal dankbar sein, dass ich mich um dein Seelenheil kümmere, Korporal“, sagte der Kommandant heiter, nachdem er das Radio ausgeschaltet hatte. Er wusste genau, warum sein Untergebener jetzt ein mürrisches Gesicht zeigte. Der Korporal, einer der wenigen die spanische Oberhoheit anerkennenden Rifkabylen, war der einzige Mohammedaner unter Menudas Leuten. „Also, was ist mit Nummer sechshundertzwei? Meine Lieblinge haben ihn weichgemacht, nicht wahr?“
„Nein!“
Der Blick des Korporals folgte dem Kommandanten, der zum Waschbecken ging und sich aus einem Tonkrug Wasser über den Kopf goss. Prustend tastete er nach dem Handtuch.
„Sondern?“, fragte er und frottierte eifrig Gesicht und Nacken. Von einem beinahe lebensgroßen Bild an der Wand schaute wohlwollend der Caudillo Franco auf ihn hernieder.
„Es geht mit ihm zu Ende, glaubt der Doktor. Er hat mich hergeschickt.“
Menuda zog vor dem Spiegel sorgfältig seinen Scheitel. „Der Doktor war im Zwinger? So besoffen ist er doch sonst um diese Tageszeit noch nicht.“
„Er brauchte nicht hinein zu den Tieren. Nummer sechshundertzwei steckte die Schnauze in den Sand. Sollen wir das Schutzgitter wegnehmen?“
„Ich komme!“
Der Kommandant knöpfte sein Kakihemd zu, zog das Koppel zurecht und stülpte den Tropenhelm auf das tiefschwarze, wie lackiert glänzende Haar. Nach einem prüfenden Blick in den Spiegel nickte er zufrieden und winkte dem Korporal, ihm zu folgen.
Sie verließen das weiße, kastenförmige Haus des Kommandanten, durchquerten einen schattigen Garten, in dem sogar ein kleiner Springbrunnen plätscherte, und wandten sich einem Bauwerk zu, das offenbar schon seit einigen hundert Jahren als Festung diente. Anstelle von Fenstern hatten die schräg aufragenden Außenmauern nur schießschartenähnliche Öffnungen, die alle vergittert waren. Im Sand der zu dem breiten Eingangstunnel führenden Straße zeichneten sich Spuren von Autoreifen ab.
Die beiden eisernen Torflügel waren weit geöffnet. Ein bewaffneter Posten salutierte, als der Kommandant und der Korporal an ihm vorbeigingen. Ein großer, quadratischer Innenhof empfing sie. Kein Baum und kein Strauch boten hier Schutz gegen die stechende Sonne. Die Luft flimmerte über festgestampftem gelbem Sand. Nur ringsum unter dem Säulengang lag ein Streifen Schatten. Zur Hofseite hatte das Gebäudegeviert zwar Fenster, aber auch sie waren ohne Ausnahme mit daumendicken Eisenstäben versehen. Einige kopfgroße, bewegliche Scheinwerfer waren so auf den flachen Dächern angeordnet, dass man damit zur Nachtzeit jeden Meter des Hofes beleuchten konnte. Alles verriet unverkennbar den Zweck, dem dieser Bau diente.
El paraiso war ein Gefängnis!
„Hallo, Kommandant! Höchste Zeit, dass Sie sich blicken lassen.“
Ein Mann in weißem Leinenanzug trat hinter einer Säule hervor und kam auf die beiden zu. Auch er trug einen Tropenhelm. Unter den Achseln zeichneten sich auf seiner Jacke dunkle Schweißflecken ab. Durchgeschwitzt klebte ihm die verwaschene Hose an den Oberschenkeln. Gegen die beiden Uniformierten wirkte er ungepflegt und liederlich. Mit einer Kopfbewegung wies er zu einem Winkel des Hofes hin, vor dem sich ein gut zwei Meter hoher Maschenzaun befand. „Sie schulden mir fünf Flaschen Roten. – Er hat in den vierundzwanzig Stunden seinen Mund nicht mal zum Fluchen aufgemacht, von Gnadengewinsel ganz zu schweigen.“
„Alle Achtung!“ Der Doktor und der Korporal folgten dem Kommandanten zum Zaun. Menuda hakte seine Finger in die Drahtmaschen und schaute mit beinahe kindlicher Bewunderung den Mann an, von dem unter einem glockenförmigen Drahtgeflecht nur der Kopf zu sehen war. „Wie ein reinblütiger Hidalgo, nicht wahr, Doktor? Aber er ist noch nicht tot. Beobachten Sie mal die Tiere. Meine Süßen sind zuverlässig mit ihrer Diagnose, bei der Madonna!“
Vier ausgewachsene, dunkelgefleckte Hyänen umlauerten den bis zum Kinn in den Sand eingegrabenen Mann. Immer wieder näherten sie sich mit vorgeschobenen, tiefgeschlitzten Nasen dem Drahtgeflecht und zuckten gleich darauf erschrocken knurrend wieder zurück.
Eine ganze Nacht hatten die Tiere mit lüsternem Kichern den Mann umkreist, hatten ihm ihren heißen Atem ins Gesicht gestoßen und aufgeheult, wenn sie von ihm mit einer heftigen Kinnbewegung oder mit einem bösen Zischen zurückgescheucht wurden. Anfangs war es für sie nur ein neues Spiel gewesen, als aber seit Tagesanbruch die Kraft des Mannes von Stunde zu Stunde mehr erlahmte, wuchs ihre Gier, zumal die sonst allmorgendlich übliche Fütterung nicht stattgefunden hatte. Noch zügelte sie die ihnen angeborene Unsicherheit und Vorsicht, doch sie witterten bereits die Wehrlosigkeit des Opfers.
Die drei Männer am Zaun konnten beobachten, wie die kräftigste der Hyänen die großen Ohrmuscheln aufrichtete, den gefleckten Hals weit vorstreckte und ihre Fresslust gegen den Boden brüllte. Ungeduldig begann das Tier mit seinen scharfkralligen Vorderpfoten den Sand aufzureißen.
Der Doktor musterte von der Seite das verzückte Gesicht des Kommandanten. Er rümpfte die Nase und meinte angewidert: ,,Wenn es Ihnen Spaß macht, wie Ihre Bestien dem Kerl das Eingeweide aus dem Leib zerren – ich danke!“ Er wandte sich zum Gehen.
„Bleiben Sie!“, befahl Menuda. „Sie bekommen Ihre fünf Flaschen, aber ich glaube nicht, dass der Mann jetzt noch eine Chance ausschlagen wird. Auch ein Selbstmörder greift zu, wenn man ihm noch in letzter Minute einen Strohhalm hinhält …“
Er wies den Korporal an, die Nummer 602 sofort ausgraben und Futter für die Hyänen bringen zu lassen.
Der Korporal warf einen scheuen Blick in den Zwinger, dann entfernte er sich eilig. Wenig später kam er mit drei Soldaten zurück, die einen nackten Hammelkadaver schleppten. An dem roten, bereits stinkenden Fleisch hatte sich ein Schwarm schillernder Fliegen festgesaugt. Augenblicklich ließen die Hyänen von dem bewusstlosen Mann in ihrem Zwinger ab. Vom Aasgeruch aufgestachelt, sprangen sie gegen den Maschenzaun, stießen heisere Schreie aus, bis sie schließlich ihre Schnauzen reißend und würgend in den vorgeworfenen Fraß wühlen konnten.
Menuda trat als Erster durch die schmale Tür im Zaun. Die Tiere erstarrten, als er sich ihnen näherte. Geduckt und scheu schielten sie ihm entgegen. Er lächelte und gab den Soldaten einen Wink, hinter seinem Rücken mit dem Ausgraben zu beginnen. Sanft wie zu Kindern redete er indessen auf seine Lieblinge ein und lenkte sie ab. Ihre buschigen Schwänze fegten den Boden.
Der Kommandant besaß diese Hyänen schon zwei Jahre. Ein Tierfänger, der mit einem großen, für europäische zoologische Gärten bestimmten Transport nach Villa Cisneros verschlagen worden war, hatte ihm nach mehrstündigem Feilschen ein junges, tragendes Muttertier überlassen. In El paraiso warf die Hyäne zwei Wochen später drei schwarzbraune Junge, die unter Menudas liebevoller Pflege schnell heranwuchsen. Alle vier Tiere gehorchten ihm aufs Wort. Er verhätschelte sie, und in der Wachstube witzelten die Soldaten, dass der Kommandant täglich für das Wohl seiner Bestien bete und nur deshalb noch ledig sei, weil er bisher noch keine Frau mit gefleckter Haut gefunden habe.
„Fertig, Kommandant!“, meldete der Korporal, der selbst keinen Fuß in den Zwinger gesetzt hatte.
Auch der Doktor war außerhalb der Umzäunung geblieben. Er kümmerte sich um den Bewusstlosen, den die Soldaten eilig aus der Nähe der jetzt die Hammelknochen zerknackenden Tiere geschleift hatten, mehr auf die eigene Haut als auf das Leben des Mannes mit der Gefangenennummer 602 bedacht.
„Erstaunlich!“, meinte der Arzt, nachdem er den Puls des Mannes geprüft hatte. Er befahl den Soldaten, den Gefangenen ins Krankenrevier zu bringen, dann wandte er sich an Menuda, der inzwischen ebenfalls den Zwinger verlassen hatte. „Wenn Sie mich fragen: Es ist vertane Mühe, diesem Burschen wieder auf die Beine zu helfen. Das ist die Sorte, an der sich schon im Mittelalter unsere Inquisitoren die Zähne ausgebrochen haben: Narren!“
Menuda schmunzelte nachsichtig. Er war überzeugt, dass seine Hyänen wirkungsvoller waren als Daumenschrauben und spanische Stiefel. Vor ihnen würde auch der trotzige Stolz der Nummer 602 erloschen sein, daran zweifelte er keine Sekunde. In den letzten sechs Monaten hatten ihm die übrigen vierhundertelf Sträflinge in El paraiso nicht so viel Kopfzerbrechen gemacht wie dieser hellhäutige Nordeuropäer.
Nicht, dass Nummer 602 widerspenstig gewesen wäre oder sogar aufsässig. Ob er in der Kolonne für die Bewässerungsarbeiten oder zur Dattelernte eingesetzt worden war, niemals hatte er Anlass zu einer Beschwerde gegeben. Und doch: Jeder Aufseher war heilfroh, wenn dieser Mann einem anderen Arbeitskommando zugeteilt wurde. Mit dem ist es wie mit einer Zeitzünderbombe, sagten sie, man weiß genau, dass sie einmal hochgehen wird, aber keiner kennt den Zeitpunkt.
Sogar die anderen Sträflinge schienen diese Ansicht zu teilen. Das lag nicht allein daran, dass Nummer 602 nur gebrochen Spanisch sprach und sehr wortkarg war. Ein Mann, der sich immer abseits hielt und nie mit der Geschichte prahlte, die ihn lebenslänglich nach El paraiso gebracht hatte, einer, der nicht einmal dem Kommandanten Ergebenheit und Demut vorspielte, ein solcher Mann war ihnen, trotz aller stillen Bewunderung für seinen Mut und seine Willenskraft, unheimlich. Dieses Gefühl wurde noch bestärkt, als Nummer 602 nach knapp zwei Monaten seinen ersten Fluchtversuch unternahm.
Nur ein einziges Mal, seit El paraiso Lager für lebenslänglich Verurteilte geworden war, hatte bisher ein Verzweifelter den Versuch unternommen, aus der Gluthölle zu entkommen. Die Verfolger hatten seine Spur nicht gefunden, aber am dritten Tag war er von allein zurückgekehrt, ausgezehrt und halb wahnsinnig vor Durst. Ein gnädiges Schicksal hatte ihn die Oase wiederfinden lassen und ihn damit vor einem elenden Tod im Sandmeer der Sahara bewahrt.
Nummer 602 war besser auf den mörderischen Weg durch die Wüste vorbereitet gewesen. Er hatte einen selbstgefertigten Kompass besessen, einen gefüllten Wassersack und Proviant für eine Woche, als er eines Nachts das in tagelanger Arbeit gelockerte Gitter vor dem schmalen Fensterspalt seiner Zelle aushob und sich an dem aus zerschnittenen Reissäcken geflochtenen Seil an der Außenwand hinabließ. Fünf Tage hatten die Kamelreiter des Kommandanten gebraucht, um den Geflohenen wieder einzufangen. Für jeden Tag bestrafte ihn Menuda mit zehn Peitschenhieben, doch der Kommandant wartete vergeblich auf Schmerzensschreie. Nummer 602 war noch stumm geblieben, als ihm schon das Blut aus dem zerfetzten Rücken floss. Nach einem erneuten Fluchtversuch, der bereits von einer um die Oase patrouillierenden Streife vereitelt worden war, hatte Menuda angestrengt über eine wirkungsvollere Züchtigung nachgedacht. Seine Hyänen waren ihm eingefallen. Er zweifelte nicht am Erfolg seiner Idee, als er jetzt den Doktor zum Krankenrevier begleitete.
Der Mann, der im Sträflingsverzeichnis von El paraiso als Gunnar Jörensen die Nummer 602 trug, lag ausgestreckt und reglos wie ein Gestorbener auf der harten Pritsche. Er sah über sich ein ungeheuer hohes, grünes Gewölbe, aus dessen gläsernem Glanz zwei runde grellrote Punkte wie Augen auf ihn herabstarrten. Sie verfolgten ihn, sosehr er sich auch mühte, ihnen zu entgehen. Als er schließlich versuchte, sich an das Bild zu gewöhnen, veränderten die Punkte plötzlich ihre Form. Sie dehnten sich zu Ovalen, wurden von einem unsichtbaren Messer aufgeschlitzt und zu zwei grinsenden Lippenpaaren, die mit verschiedenartigen Stimmen gleichzeitig zu sprechen begannen.
„Gunnar Jörensen, du bist schuldig des Mordes an sechs Soldaten der regulären Armee unseres Landes!“, zischten sie, und: „Schuldig des Aufruhrs …, schuldig der Kirchenschändung …; schuldig der Sabotage …; schuldig des Raubes …; schuldig! – Schuldig! – SCHULDIG!“ Sie kamen immer näher. Er sah spitze Zähne blinken, schwarze Lefzen zucken, Geifer aus Hyänenrachen triefen …
Verzweifelt bäumte er sich auf, doch eine größere Kraft packte seine Schultern und stieß ihn wieder zurück. Der grüne, gläserne Himmel stürzte auf ihn herab. Die beiden Punkte verblassten zu Schemen. Eine erfrischende Kühle überströmte sein Gesicht, rann über Brust und Nacken. Die Spannungen in seinen Muskeln wurden davon fortgespült. Er fühlte Erleichterung. Sein Atem wurde tiefer und gleichmäßiger.
„Er kommt zu sich!“, hörte er ganz nahe und klar eine Männerstimme sagen. Langsam hob er die Lider und starrte gegen eine weiß getünchte Zimmerdecke. Es dauerte einige Sekunden, bis er seine Gedanken wieder geordnet hatte. Ich bin noch einmal davongekommen, dachte er. Im Jenseits gibt es keine Schlämmkreide …
„Na, Sechshundertzwei, immer noch zu stolz, um mir bedingungslos zu gehorchen?“, fragte Menuda und lächelte. „Oder haben dir meine gefleckten Freunde so gut gefallen, dass du sie nicht um eine Extraration bringen möchtest? Zähes Fleisch mögen sie nämlich besonders gern.“
Der Mann auf der Pritsche antwortete nicht, aber es war kein Trotz in ihm. Die Zunge lag wie ein dürres Blatt in seinem Mund, und jeder Atemzug ätzte die ausgedörrte Kehle. Er ließ seinen Blick durch den dürftig eingerichteten Raum wandern. Kahle weiße Wände, zwei vergitterte Fenster, in einer Ecke der Dornengekrönte am Holzkreuz. Zwei weitere Pritschen waren unbelegt. Es gab wenig Kranke in El paraiso, und gestorben wurde in den Zellen.
Die Augen des Mannes starrten auf die Blechkanne, mit deren Inhalt ihn der Doktor aus der Bewusstlosigkeit geholt hatte. Wie Feuer brannte es in seiner Gurgel, als er schluckte. „Wasser!“
Fragend sah der Doktor den Kommandanten an. Menuda senkte zustimmend die Lider und wartete, bis der Arzt mit der Kanne den Raum verlassen hatte. Dann trat er an das Fußende der Pritsche, hielt seinen Kopf ein wenig schief und versenkte die Hände in die Hosentaschen.
„Hör gut zu“, sagte er leise. „Du hast Glück … Es steht geschrieben, wir sollen Gutes tun. Also: Du wirst nicht ausgepeitscht, ich lasse dich nicht von den Hyänen zerreißen, obwohl die ihren Spaß daran hätten, wir setzen dich auch nicht mit einem Sack voll Salzwasser in den Sanddünen aus – solange ich dich nur auf den Knien sehe! Hast du verstanden? Auf den Knien! Beim Appell, beim Arbeitskommando, in deinem Loch. Wenn ich erscheine, knickst du um, klar? Und wenn du dein Scheißleben mal satt hast, brauchst du nur vor mir aufzustehen. Ich verspreche dir, dass es für dich dann bloß noch ein paar Schritte bis in die Ewigkeit sind. Etwas unbequem vielleicht, aber einmalig. – Los, probier es. Runter vom Bett!“
Ihre Blicke trafen sich. Wie ein Kräftemessen war es, wie eine Zerreißprobe. In den Augen des Mannes auf der Pritsche flackerte Angst. Er deutete Menudas Blick richtig.
Der Tod schaute Sechshundertzwei an.
Lange genug kannte der Gefangene den Kommandanten, um zu wissen, dass es kein Ausweichen mehr gab. Dreckskerl, verdammter, dachte er und presste die rissigen Lippen zusammen. Sein Verstand sagte ihm klar, dass ihm nur der Weg der Erniedrigung blieb, wenn er den nächsten Tag noch erleben wollte. Aber du kannst dein Dasein nicht fristen wie ein Hund, beschwor ihn sein Gefühl. Seine Vernunft widersprach: Und wem nutzt dein Sterben? Schlecht bestellt wäre es um die Menschheit, wenn jeder Getretene sein Leben wegwürfe wie ein zerschlissenes Hemd.
Langsam richtete sich Nummer 602 auf. Zangen bissen in seine Muskeln und Gelenke, aber es waren nicht allein die schmerzenden Bewegungen, die ihm die Kehle zuschnürten.
Der Doktor kam mit der gefüllten Wasserkanne zurück. Verblüfft blieb er in der Tür stehen und betrachtete den vor Menuda knienden Mann wie eine überirdische Erscheinung.
„Gießen Sie die Schüssel voll!“, befahl der Kommandant. Er sonnte sich in dem Erstaunen des Doktors, und es gelang ihm schlecht, den Gelassenen zu spielen.
Der Arzt füllte die Schüssel und setzte sie vor dem Knienden ab.
Menuda wurde beinahe väterlich. „Nun sauf dich satt, Däne!“
Die Hände links und rechts auf den Schüsselrand gestützt, beugte sich der Mann vornüber. Die ersten fünf, sechs Schlucke trank er hastig und überwältigt vom Anblick des klaren Wassers, dann stockte er, blickte zu den beiden auf und hob beherrscht die Schüssel zum Mund. Seine Arme zitterten.
Der Arzt beobachtete jede Regung, jede Veränderung im Ausdruck des Sträflings und wurde nachdenklich. Der ist nicht zerbrochen, sagte er sich. Der ist nur gerissener als unser Señor Kommandant. Wenn so einer sich zum Köter erniedrigen lässt, steckt todsicher eine Teufelei dahinter. – Ich würde verdammt vorsichtig sein an deiner Stelle, du Paradies-Caudillo!
„Wie gesagt, die fünf Flaschen können Sie trotzdem bei mir abholen.“ Menuda schreckte den Doktor aus seinen Überlegungen.
Der Arzt nickte. Er behielt seine Gedanken für sich. Es gab wenig Unterhaltung in El paraiso, und es reizte ihn, neutraler Beobachter zu sein. Er konnte nicht wissen, dass der Kommandant Juan Menuda nur noch knapp achtundvierzig Stunden zu leben hatte.
II
Josef Krakmeyer mit Ypsilon – darauf legte er außerordentlichen Wert – gehörte zu den Leuten, die getrost mit zwei verschiedenfarbigen Schuhen durch den Alltag promenieren könnten, ohne dass ihnen jemand ein Lächeln nachschicken würde. Sein farbloses Dutzendgesicht mit den trübsinnig blickenden, blassblauen Augen, seine immer eine halbe Nummer zu groß wirkenden Konfektionsanzüge und die Schüchternheit, die in jeder seiner Bewegungen lag, das alles machte ihn im Menschenmeer der Stadt Berlin zu einem unscheinbaren Tröpfchen. Für die Mitbewohner des Mietshauses in Steglitz war Krakmeyer ein langweiliger Buchhaltertyp, ein vertrockneter Junggeselle, über den zu reden sich nicht lohnte. Guten Tag, guten Weg – aus.
Jeden Morgen auf die Minute genau um sieben Uhr zehn trat Josef Krakmeyer aus der Haustür. Er schickte einen Blick zum Himmel und registrierte sonniges Blau ebenso wie einen bleiernen Wolkenvorhang mit säuerlicher Miene. Sieben Uhr vierzehn kaufte er am Kiosk an der Ecke die „Morgenpost“ und einmal wöchentlich die „Koralle“. Sieben Uhr dreiundzwanzig nahm er seinen Stammplatz im vorletzten Wagen des S-Bahn-Zuges Richtung Anhalter Bahnhof ein. Bis zum Tempelhofer Ufer widmete er sich seiner Zeitung, faltete sie dann mit peinlicher Genauigkeit zusammen, steckte sie ein und erhob sich, weil der Zug stets in dieser Minute die Station am Askanischen Platz erreichte. Er stieg aus und blieb auch auf seinem Weg durch die Saarlandstraße noch ein von niemandem beachtetes, namenloses Rädchen im Getriebe irgendeines Büros.
Wenig später jedoch betrat Josef Krakmeyer ein Gebäude, in dem ihn seine Nachbarn und der Zeitungshändler aus dem Kiosk mit Sicherheit nicht vermutet hätten. Allein der Verdacht, dass Krakmeyer dort einen Schreibtisch und sogar ein eigenes Arbeitszimmer haben könnte, hätte ihr Verhalten ihm gegenüber wesentlich verändert. Niemals mehr wäre es geschehen, dass er im Treppenhaus seinen Hut als Erster lüften musste, der Hausbesitzer hätte seine Herablassung gegenüber diesem Mieter schleunigst in devote Freundlichkeit verwandelt, und dem Kioskmann wäre bei dem Gedanken an seine auch vor Krakmeyer zum besten gegebenen Göring-Witze der kalte Angstschweiß aus allen Poren getreten.
Das Gebäude, in dem dieser so unscheinbar wirkende Mann sein Arbeitszimmer hatte, stand in der Prinz-Albrecht-Straße. Früher waren Kunststudenten hier ein und aus gegangen, hatten Vorträge bekannter Professoren gehört und in den winkligen Gängen Fragen der Ästhetik diskutiert. Nun aber diente es einem ganz anderen Zweck. Die Musen waren vertrieben. Ein hohläugiger Totenschädel hatte den Platz des Apollo eingenommen. Neben dem prächtigen Portal hing ein gusseisernes Schild, schmucklos und von den gemeißelten Steinquadern abstechend wie ein Fremdkörper, gegen den sich die alten Mauern zur Wehr setzten. Die Aufschrift lautete: Geheime Staatspolizei – Hauptamt.
Kriminalrat Krakmeyer begann diesen Maitag auf gewohnte Weise. Nachdem er seinen Überzieher auf einen Bügel gehängt und mit einem Blick in den Spiegel den korrekten Sitz seiner stumpfgrauen Krawatte kontrolliert hatte, nahm er den Schutzbezug von dem auf dem Fensterbrett stehenden Vogelbauer und füllte für seinen Wellensittich Waldemar Körner und Wasser nach. Dann öffnete er seinen Schreibtisch, holte Federschale, Kalender, Heftklammerbehälter und Füllhalterständer hervor und stellte alles millimetergenau auf die von ihm dafür vorgesehenen Plätze rings um die grüne Schreibunterlage. Kritisch prüfend überschaute er die Anordnung, korrigierte mit spitzen Fingern den um Haaresbreite verrutschten Radiergummi und ging endlich zum Panzerschrank, wo er die Siegelschnur aus der Knetmasse löste und die schwere Tür aufschloss.
Mit einer daumendicken Akte kam er zum Schreibtisch zurück. Für beinahe eine Stunde war nun in seinem Zimmer nichts weiter zu hören als das leise Rascheln beim Umblättern der eng beschriebenen Protokollseiten und von Zeit zu Zeit ein schüchternes Piepen aus dem Vogelbauer.
„Schwarze Kerze“ stand auf der Akte. Krakmeyer schnitt ein Gesicht, als quäle ihn heftiges Sodbrennen. Diese Leidensmiene hellte sich auch nicht auf, als er den Schnellhefter endlich aus der Hand legte. Nachdenklich erhob er sich und ging zum Vogelbauer. Dort steckte er seinen Zeigefinger zwischen die dünnen Gitterstäbe und lockte leise schnalzend den Sittich heran. Der kleine blaue Vogel begann ohne Scheu seine Schnabelschärfe an dem dargebotenen Fingernagel zu erproben. Krakmeyer ließ es geschehen und wurde dabei offensichtlich zu neuen Überlegungen angeregt. Allmählich verschwanden die Schatten aus seinem Gesicht. Als er den Finger behutsam zurückzog, war sogar die Spur eines Lächelns um seine blassen, dünnen Lippen. „Genug, Waldemar“, bestimmte er und wandte sich wieder dem Schreibtisch zu, wo er zum Telefonhörer griff.
Die Wählerscheibe schnurrte.
„U eins!“, meldete eine scharfe Stimme am anderen Ende der Leitung.
„Krakmeyer! – Wie weit?“
„Fehlmeldung, Herr Kriminalrat. Der Mann ist jetzt im Revier. Hat’s an den Nieren bekommen diese Nacht. Wahrscheinlich geht er drauf, meint der Doktor. Wir haben getan, was wir …“
„Stümper!“ Krakmeyer legte auf und wählte erneut. „Morgen, Krap. Ergebnis? Ich erwarte Sie!“
Wenige Minuten später betrat ein junger, sportlich wirkender Mann das Zimmer. Krakmeyer wies auf einen Stuhl. „Wenn man nicht alles selbst macht!“, klagte er und betrachtete seinen Mitarbeiter wehleidig. „Diese Lümmel im U eins haben den Vogel zerschlagen, ehe er singen konnte. Widerlich. Die Logik stirbt aus. – Und Sie?“
Der Assistent und Untersturmführer Felix Krap unterdrückte ein Grinsen. Er war nun schon über ein Jahr Mitarbeiter dieses Mannes und mit dessen Schrullenhaftigkeit längst vertraut. Es hatte keine vierzehn Tage gedauert, bis ihm verständlich geworden war, warum man Krakmeyer schon am 1. November 1934 aus der Polizeiabteilung I A, der Politischen Polizei in Preußen, in die Gestapo übernommen hatte. Er hatte schnell begriffen, dass sich hinter der Maske des verspießerten Jämmerlings ein gerissener Menschenjäger verbarg, der seine Opfer mit geradezu unheimlicher Geduld und mathematischer Präzision zur Strecke brachte. Krakmeyer galt im Führungsstab als Spezialist für schwierige Recherchen und wurde nur selten bei Massenaktionen eingesetzt. War er auf einer Spur, so gehörte es zu seiner Art, immer trübsinniger und klagesüchtiger zu werden, je näher er seinem Ziel kam. Eine unmittelbar bevorstehende Verhaftung seiner Opfer kündigte sich bei ihm meist mit einem beängstigenden Anfall von Depressionen an. Krakmeyers verhältnismäßig gute Laune an diesem Morgen ließ Felix Krap schlussfolgern, dass der Fall Schwarze Kerze seinem Vorgesetzten noch erhebliches Kopfzerbrechen bereitete. Wahrscheinlich war es eine der kompliziertesten Aufgaben, die man dem Kriminalrat in seiner langjährigen Tätigkeit übertragen hatte.
Im Sommer 1938 war die Gestapoleitstelle in Leipzig einer Widerstandsgruppe auf die Spur gekommen, die in einer illegalen Druckerei antifaschistische Flugblätter herstellte. Wochenlangen Ermittlungen folgte schließlich eine ausgedehnte Verhaftungswelle, bei der den Gestapoleuten auch ein Mann in die Hände fiel, der ihnen bis dahin unbekannt gewesen war. Man fand bei ihm authentische, technisch detaillierte Aufzeichnungen über zwei Flugzeugabstürze in einem Geschwader der Luftwaffe.
Spionage?
Ein Fall für die Abwehrleute des Admirals Canaris?
Der Leiter der Leipziger Gestapodienststelle wusste von Kompetenzstreitigkeiten und wollte unter keinen Umständen einen Fehler machen. Er gab die ganze Angelegenheit an das Geheime Staatspolizeiamt in Berlin weiter. Auch der Chef der Gestapo, SS-Standartenführer Müller, zögerte. Erst eine Verständigung zwischen ihm und dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD, SS-Gruppenführer Heydrich, sowie eine Aussprache mit Göring in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber der Luftwaffe brachten eine Entscheidung. Gleichzeitig mit seiner Ernennung zum SS-Hauptsturmführer erhielt Krakmeyer den Auftrag, diesen Fall zu übernehmen.
Unverzüglich ließ Krakmeyer den Unbekannten, der bisher weder seinen Namen genannt noch seinen Wohnsitz angegeben hatte, nach Berlin bringen. Felix Krap erwartete eine scharfe Vernehmung. Er wurde enttäuscht. Der Kriminalrat stellte den Vogelbauer zwischen sich und dem Häftling auf den Schreibtisch und hielt einen halbstündigen Vortrag über die Unterschiede zwischen Wellensittichen und Kanarienvögeln. Danach interessierte er sich offenbar nur dafür, ob der Mann eine Vorliebe für ganz bestimmte Haustiere besaß. Der Häftling war nicht weniger verwirrt als der junge Untersturmführer. Nach knapp einer Stunde befahl Krakmeyer, den Mann in die Zelle zurückzubringen. Keine zermürbenden Fragen! Keine Faustschläge, kein Sengen mit Zigarettenglut! Krap war sprachlos. Welche Bedeutung sollte es für die Ermittlungen haben, dass man über die Abneigung des Häftlings gegen Vögel und Katzen sowie über seine Sympathien für Dackel und schwarze Pudel Bescheid wusste?
Als Felix Krap mit einer unverhohlen ironischen Bemerkung darauf anspielte, dass der Kriminalrat mit seiner Methode lediglich „auf den Hund“ gekommen sei, schien das bei Krakmeyer eine Gallenkolik auszulösen. Er ächzte gequält und erläuterte dann weinerlich, dass doch zuerst einmal festgestellt werden müsse, wer dieser verstockt schweigende Mann eigentlich war. Jetzt stehe auf Grund des Dialektes, den der Unbekannte sprach, mit Sicherheit fest, dass die Gestapo- und Polizeidienststellen im Gau Thüringen am ehesten etwas zur Identifizierung beitragen könnten. Krap war überwältigt.
Mitte Februar wusste Krakmeyer, dass sein Häftling Walter Bruchmann hieß, aus dem thüringischen Städtchen Eisenthal stammte und dort bis 1933 einer kommunistischen Zelle angehört hatte. Seit 1935 arbeitete er als Materialdisponent in den Kasseler Flugzeugwerken.
Der Kriminalrat nutzte seine Sondervollmachten und ordnete eine genaue Überprüfung der drei übrigen Mitglieder jener kommunistischen Zelle in Eisenthal an. Nachdem die Namen dieser Leute bekannt geworden waren, setzte er Krap auf einen Fred Laurenz an und widmete sich selbst den beiden anderen. Seitdem waren nun zwei Monate vergangen.
„Nun?“, fragte Krakmeyer und beobachtete missmutig seinen hirseknabbernden Wellensittich Waldemar. Im Sonnenlicht, das schräg durch die hohen Fensterscheiben ins Zimmer fiel, wirkte das Gesicht des Kriminalrates noch vergilbter als sonst.
Krap, der einen Stuhl zum Schreibtisch gezogen hatte, brachte aus seiner Aktentasche einige Papiere zum Vorschein. „Ein Fuchs, kann ich Ihnen sagen!“, begann er. Dabei war deutlich herauszuhören, dass er mit dem Ergebnis seiner Arbeit sehr zufrieden war. „Dieser Laurenz hat es tatsächlich fertiggebracht, sich im Juli neunzehnhundertdreiunddreißig auf ganz raffinierte Weise zu verkriechen. Und raten Sie mal, wohin? Als Zwölfender in die Reichswehr! Weiß der Teufel, wie das zugegangen ist. Im Sommer neunzehnhundertfünfunddreißig war er jedenfalls schon Unteroffizier in der Luftwaffengruppe eins, Kampfgeschwader vier! Und genau dort stürzten die Maschinen ab! – Hier ist die Personalakte des Vogels.“
Mit spitzen Fingern nahm Krakmeyer die Papiere entgegen. Er begann zu lesen und schnitt eine Grimasse: Acht Klassen Volksschule in Eisenthal, drei Jahre Lehrzeit in einer Schlosserei. Keine Vorstrafen. Ledig. Evangelisch.
„Ein Glas Wasser!“, verlangte der Kriminalrat säuerlich. Er schaute dabei nicht auf. Reglos über die Unterlagen gebeugt, saß er auch noch, als Krap mit einem vollen Glas zurückkam.
„In Spanien von der Legion Condor desertiert“, bemerkte der Assistent nachdrücklich. „Und das Tollste: Er war dort Spieß in einem Spezialkommando. Sein Name steht auf der Liste der Geheimnisträger. Eine Gruppe deutscher Wissenschaftler war in besonderer Mission eine Zeit lang bei dieser Einheit, mehr konnte ich nicht erfahren. Die Kameraden vom SD halten es für möglich, dass unser Mann zu viel gesehen hat. Sie suchen ihn seit Monaten.“
Müde setzte Krakmeyer das Glas auf den Tisch und betupfte die Lippen mit einem Taschentuch. „Natürlich erfolglos“, erriet er bekümmert. „Alles Stümper. – Wann fliegt die nächste Maschine nach Madrid?“
„Nach …?“ Krap hob verdutzt die Brauen. „Aber wir haben doch die beiden anderen. Vielleicht bringen die uns …“
Leise stöhnend lehnte sich Krakmeyer im Schreibtischsessel zurück. Vorsichtig seine Lebergegend abtastend, unterbrach er den Assistenten: „Was, denken Sie, habe ich in den letzten Wochen getan? Die beiden können Sie vorläufig mal vergessen. Die wissen nicht viel. Schutzhaft! Buchenwald! Einer war Schichtmeister bei Junkers in Dessau, der andere Dreher bei Heinkel in Warnemünde.“
„In Flugzeugwerken, beide? Das ist doch ganz klar ein …“
„Sabotagering, was sonst. – Das Ei heute morgen war wieder viel zu hart. Besorgen Sie mir Natron und zwei Flugkarten für die nächste Maschine nach Madrid. – Gehen Sie schon, Mann!“
Krap wagte keine weiteren Fragen.
Als der Untersturmführer das Zimmer verlassen hatte, zog Krakmeyer die Schublade seines Schreibtisches auf und holte einen kleinen schwarzen Kasten hervor. Er breitete sein Taschentuch über die Schreibunterlage und entnahm dem Kästchen eine kleinkalibrige Pistole, die er mit großer Sorgfalt zu reinigen begann. Er hatte sie seit der Nacht vom 9. zum 10. November des Vorjahres nicht mehr in der Hand gehabt.
Zwei Kugeln aus dieser Waffe hatten damals den Unterleib eines jungen Mannes zerfetzt. Er war mit einem Feuerhaken auf eine Meute von SA-Leuten in Zivil losgegangen. Sie hatten seine Eltern, einem jüdischen Spielwarenhändler und seiner Frau, die Kleider vom Leib gerissen und die beiden vor Kälte und Furcht Zitternden mit Gebrüll durch die Straße getrieben.
Krakmeyer spürte Übelkeit bei der Erinnerung an diesen Vorfall. Die „Kristallnacht“ gehörte zu jener Art von Einsätzen, die er nicht mochte. Herdenarbeit nannte er sie verächtlich. Seine Leidenschaft entzündete sich nur an Aufgaben, die Kopfarbeit erforderten.
Schwarze Kerze war ein solcher Fall.
Im dunklen, träge dahinfließenden Wasser des Manzanares flimmerte schon der Widerschein des Abendrotes, als zwei Tage später die planmäßige Verkehrsmaschine der Deutschen Lufthansa zur Landung auf dem Madrider Flughafen ansetzte. Von einem Fensterplatz im Restaurant des Empfangsgebäudes aus beobachtete ein Herr in cremefarbenem Maßanzug interessiert, wie der Pilot die dreimotorige Ju 52 weich auf das Rollfeld aufsetzte, die Geschwindigkeit drosselte und den weißen Metallvogel schließlich zum Stehen brachte. Als die kleine, fahrbare Treppe an den Ausstieg geschoben wurde, trank Coronel Salazon, Sektionschef im Hauptquartier der Politischen Polizei, seine Orangeade aus, glättete den strichfeinen schwarzen Bart über seiner Oberlippe und ging seinen Besuchern entgegen.
„Willkommen in Madrid! Ich hoffe, Sie hatten einen guten Flug“, begrüßte er Krakmeyer und dessen Assistenten an der Zollabfertigung. Er gab dem Beamten einen Wink, die Formalitäten auf ein Minimum zu beschränken. Salazon hatte zwei Jahre am Polizeiinstitut in Berlin-Charlottenburg studiert und sprach ein beinahe akzentfreies Deutsch.
„Danke“, murmelte Krakmeyer und betrachtete lustlos die neue Umgebung. Er hatte eine Abneigung gegen dunkelhäutige Menschen, und so war ihm der spanische Kollege vom ersten Augenblick an nicht sehr sympathisch. Bei solchen Kerlen weiß man nie genau, ob sie nicht einen Isaak oder Levi im Stammbaum haben, dachte er. Von den Anstrengungen der langen Reise war ihm nichts anzumerken. Sogar die ihm eigene krankhafte Blässe fiel jetzt neben dem grünbleichen Gesicht seines Assistenten nicht auf. Dem Untersturmführer lag die Übelkeit wie eine Wachsmaske auf Nase und Wangen. Der Kriminalrat schenkte diesem Zustand jedoch nicht die geringste Beachtung, sondern befahl: „Nehmen Sie die Koffer, Krap!“
Wortlos gehorchte der Assistent. Er riss sich zusammen und trug das nicht allzu schwere Gepäck hinter den beiden Männern her zum Ausgang. Ihm war dabei, als müsse er durch zähen, knietiefen Schlamm waten.
Vor dem Empfangsgebäude stand ein weißes Sportkabriolett. Salazon fuhr selbst. Er nahm dabei den Fuß kaum einmal vom Gaspedal. Krap hockte wie zerschlagen auf dem Rücksitz und presste in jeder Kurve krampfhaft würgend die Hand auf den Mund.
„Wenn Sie sich im Hotel etwas erfrischt haben, hole ich Sie zum Abendessen ab. Ich habe ein paar Freunde eingeladen. Auch von Ihrer Botschaft werden zwei Herren mit ihren Damen da sein.“
Salazon redete unentwegt, ohne auch nur mit einem Wort den Grund für ihr Zusammentreffen zu erwähnen. Dabei wusste er recht gut, worum es ging. Krakmeyer hatte ihm telegrafisch den Namen des Mannes mitgeteilt, den die Gestapo in Spanien suchte. Offenbar trauen sie uns nicht viel zu, wenn sie gleich zu zweit anmarschieren, hatte er gedacht, als sich der Besuch ankündigte. Deswegen ließ er nun die beiden mit Absicht noch ein wenig im Ungewissen. Er saß auf dem Fahrerplatz bequem wie in einem Klubsessel und führte das Lenkrad nur mit einer Hand. „Sie haben Glück, Kamerad Krakmeyer. Übermorgen können Sie in der Arena unseren Don Alfredo bewundern. Ein Torero, einfach … Sie werden sagen: knorke!“
„Ein Deutscher?“, fragte Krakmeyer. Seine wässrigblauen Augen blickten unverwandt auf die Tachometernadel. Sie stand zwischen fünfzig und sechzig, sank aber jetzt ziemlich schnell bis unter die Vierzig.
„Ein Deutscher? Don Alfredo?“ Salazon war verblüfft und wusste einen Moment lang nicht recht, ob er diese Frage als schlechten Scherz oder gezielte Taktlosigkeit werten sollte. Immerhin war der Torero für ganz Kastilien eine Art Nationalheld. Salazon bewunderte zwar Hitlerdeutschland, aber er hatte auch verschiedentlich die nationalistische Arroganz der Hakenkreuzleute kennengelernt. Nicht zum ersten Male liefen ihm Gestapobeamte über den Weg.
„Selbstverständlich ist er Spanier, sogar aus uralter Familie“, sagte er und legte dabei seiner Freundlichkeit merklich Zügel an. „Wie kommen Sie darauf, dass er …“
„Weil uns hier nur ein Deutscher interessiert, Herr Kollege!“ Krakmeyers sachliche Schärfe ließ keinen Zweifel daran, dass er während des Madrider Aufenthaltes weder auf Stierkämpfe noch auf irgendwelchen anderen Zeitvertreib Wert legte.
Ein echter Preuße, dachte Salazon. In diesem Gedanken war zwar ein Funken Geringschätzung, viel mehr aber noch die Ehrfurcht vor einem Arbeitseifer, zu dem sich der Sektionschef niemals imstande gefühlt hätte.
Das Hotel „Alegria“ lag nahe des Puerta de Sol im Herzen der Hauptstadt. Salazon begleitete Krakmeyer und Krap zur Rezeption und wollte sich verabschieden, nachdem die beiden ihre Zimmerschlüssel in Empfang genommen hatten. Der Kriminalrat übersah die Hand, die ihm der Spanier entgegenstreckte. Er wandte sich dem Lift zu und forderte Salazon mit einem halb über die Schulter gesprochenen „Bitte!“ zum Mitkommen auf.
Über der Nasenwurzel des Sektionschefs wurden zwei kleine, schräg gegeneinanderlaufende Falten sichtbar. Er zögerte. Weiß dieser Giftkranke nicht, wen er vor sich hat?
Wenn ich so mit mir umspringen lasse, stellt er mich übermorgen zum Schuheputzen an!
Wieder, diesmal noch empfindlicher, war Salazons Stolz getroffen. Die Worte seines Vorgesetzten fielen ihm ein: Es scheint, dass dieser SS-Hauptsturmführer und Kriminalrat der deutschen Gestapo bei uns eine wichtige Mission zu erfüllen hat. Dieser Laurenz ist kein kleines Licht. Unterstützen Sie die Deutschen mit allen verfügbaren Kräften. Und keine Komplikationen, bitte! Salazon zog die Luft tief durch die Nase. Also keine Komplikationen! – Er folgte den beiden zum Lift.
Die zwei Einzelzimmer lagen in der vierten Etage und waren durch ein gemeinsames Bad miteinander verbunden. Nachdem Krakmeyer die Räume inspiziert und sich für das nach seiner Auffassung weichere Bett entschieden hatte, entließ er Krap vorläufig. Ohne sich von der deutlich wahrnehmbaren Ungeduld des Spaniers drängen zu lassen, holte er aus seinem Koffer ein Paar knöchelhohe, karierte Filzschuhe. Erst als er sie ächzend und prustend gegen die engen, altmodischen Stiefeletten ausgetauscht hatte, fand er Zeit für den Coronel.
„Würden Sie uns bitte etwas zu trinken bestellen, Herr Kollege“, bat er und wies auf das Telefon.
Salazon nickte. „Bier? Wein? Kognak?“
Leicht entrüstet widersprach Krakmeyer. „Keinesfalls Alkohol! Einen milden Tee vielleicht, wenn ich bitten darf. Pfefferminz oder Kamille.“
Tee! Salazon fühlte sich augenblicklich wieder überlegen. Doch kein echter Preuße, dachte er.
Das Hotel „Alegria“ schien ein gutgeführtes Haus zu sein, denn es vergingen nur ein paar Minuten, bis ein schlankes, dunkelhaariges Stubenmädchen das Gewünschte brachte. Wohlgefällig betrachtete der Coronel die junge Frau.
Der Kriminalrat bemerkte es und rümpfte die Nase. „Zur Sache, Coronel!“
„Nicht Ihr Typ, wie?“
„Ich bin Arier!“ Er zog ein zusammengefaltetes Papier aus der Brusttasche, einen Personalbogen, an dem ein Passfoto befestigt war. „Bitte, um dieses Individuum geht es.“
Salazon warf einen Blick auf das Foto und schmunzelte.
„Ein arisches Individuum, wie ich sehe! Und woraus schließen Sie, dass dieser Laurenz in Spanien zu finden ist?“
„Er ist im April neunzehnhundertachtunddreißig von einer Sondereinheit unserer Legion Condor desertiert. Südlich von Bilbao.“
„Ein Roter also. Warum suchen Sie ihn dann nicht zuerst einmal in Frankreich? Wir haben ihn jedenfalls nicht in unseren Listen.“
Schon im August 1936 war in London ein sogenanntes Nichteinmischungskomitee gebildet worden, dem auch, wie zum Hohn, die deutschen und italienischen Aggressoren angehörten. 1938 schlossen die dort vertretenen imperialistischen Mächte ein Abkommen, nach dem alle ausländischen Freiwilligenverbände und Streitkräfte aus Spanien zurückgezogen werden sollten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Francoputschisten durch das Eingreifen der Legion Condor zwar große Teile des Landes besetzt und wichtige strategische Positionen erobert, aber dennoch hätte das spanische Volk gesiegt, wenn das Londoner Abkommen wirklich korrekt durchgeführt worden wäre. Während jedoch die Internationalen Brigaden das Land verlassen mussten, wurde kein Mann, kein Flugzeug, kein Kriegsschiff der hitlerdeutschen und mussoliniitalienischen Streitkräfte abgezogen. Die meisten Kämpfer der Internationalen Brigaden gingen nach Frankreich, wo viele von ihnen in Konzentrationslager gesperrt wurden.
Krakmeyer schlürfte einen Schluck Tee und betrachtete den Spanier mitleidig. „Sie unterschätzen uns, Coronel. Nach unseren Informationen ist Laurenz nie bei den Internationalen Brigaden eingetroffen, demzufolge auch kaum über die Pyrenäen gegangen. Wahrscheinlich trieb er sich irgendwo in Ihrem Hinterland umher. Eine unsichtbare Brandfackel sozusagen. Wir haben ihm schon vor einiger Zeit den Decknamen Schwarze Kerze gegeben.“