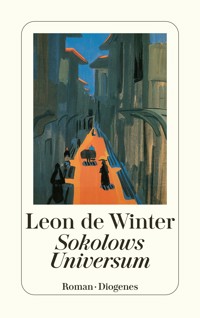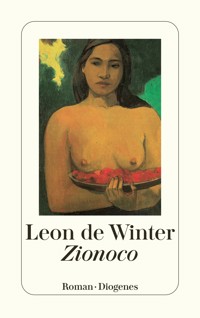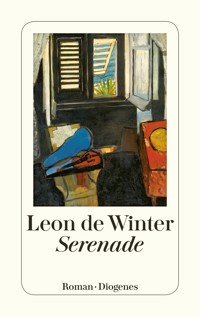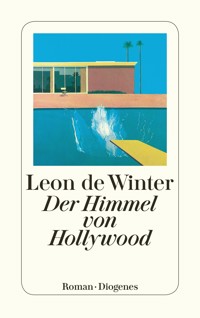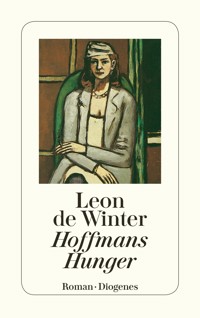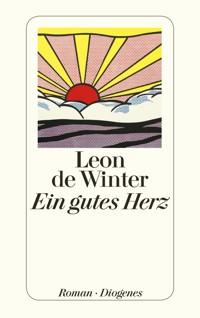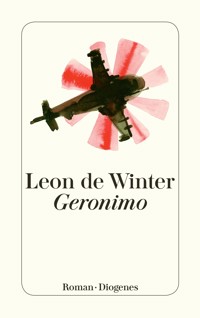11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der vierjährige Bennie spurlos verschwindet, denkt sein Vater, Bram Mannheim, erst an einen Unfall, dann an ein Verbrechen. Dass das Verschwinden des Jungen mit Weltpolitik zu tun haben könnte, entdeckt er erst sechzehn Jahre später. Und er tut alles, um seinen Sohn wiederzubekommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Leon de Winter
Das Recht auf Rückkehr
Roman
Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers
Diogenes
Für Moos, Moon & Jes
PROLOG
Tel Aviv
April 2024
1
Nach seiner Schicht war Bram Mannheim noch bis nachts um halb drei in der Kantine des Rettungsdiensts hängengeblieben. Im Licht der Leuchtstoffröhren hatte er mit den Jungs von der Nachtschicht erst Kaffee getrunken und danach Salzgebäck gegessen, das sie mit Wodka übergossen.
Zehnmal waren sie am Abend in den zentralen Bezirk ausgerückt. Vier Verkehrsunfälle, zwei Vergiftungen, ein Selbstmordversuch, drei verunglückte ältere Menschen.
Punkt halb sieben am nächsten Morgen leckte Hendrikus wie üblich seine Hand. Bram war auf dem Sofa eingeschlafen. Während der kleine Hund geduldig wartete, schlüpfte Bram in Trainingshose und T-Shirt und schnappte sich sein Handy vom Tisch. Dann nahm er Hendrikus auf den Arm und schlurfte in Plastiklatschen die Betontreppe vom fünften Stock ins Erdgeschoss hinunter.
In einer halben Stunde würde Tel Aviv erwachen und sich seinen alltäglichen Sorgen ausliefern, aber noch lagen die staubigen Straßen still unter dem Morgenhimmel. Ein wolkenloser Tag mit purpurrotem Sonnenaufgang. Es roch nach Stadt, aber auch nach Meer, sowohl nach etwas, das an diesem Tag in aller Unschuld und Frische seinen Anfang nahm, als auch nach etwas, das seit Jahrtausenden zu diesem Teil der Welt gehörte und ihn charakterisierte: Untergang und Verfall.
Hendrikus nahm sich Zeit für seinen Spaziergang. Der alte Rüde brauchte nicht mehr überall seine Duftmarken zu setzen, sondern versprühte seinen Urin erst am fernsten Punkt ihrer Runde in einem speziellen Hundepissoir, das vor langer Zeit mit amerikanischen Fördergeldern in dem Bemühen angelegt worden war, dieses ursprünglich deutsche Immigrantenviertel mit seiner »orientalischen« Bauhausarchitektur für alle Ewigkeit vor Hundepisse zu bewahren – es hatte Zeiten gegeben, da für so etwas Kommissionen ins Leben gerufen wurden. Doch heutzutage war Wasser zu kostbar, als dass man damit Hundepisse wegspülte, und so war in einem Umkreis von fünf Metern um das Pissoir der Gestank unerträglich. Hendrikus störte sich nicht daran. Bram blieb in einiger Entfernung stehen und bewunderte das Durchhaltevermögen des drahtigen Tiers. Hendrikus war schwerhörig und nach der Attacke eines in seiner Ehre gekränkten Bouviers vor sechs Jahren auf einem Auge blind. Laut ihrem Tierarzt war Hendrikus einer der fünf ältesten Hunde der Stadt – der Älteste war der sechsundzwanzigjährige Jeffrey, eine krasse Kreuzung aus Schäferhund und Bullterrier und eine Ausnahmeerscheinung, da mittelgroße Hunde meistens jünger starben als kleine Promenadenmischungen wie Hendrikus.
Jeden Morgen absolvierte Hendrikus einen festen Parcours entlang den stillen Monumenten deutscher Sachlichkeit. Das Tier folgte dabei einem von ihm selbst festgelegten Rechteck, in dem sechs Wohnblöcke standen, beschnüffelte Laternenpfähle, die Räder von Müllcontainern, Autoreifen, strategisch positionierte Sträucher und hin und wieder einen anderen Morgenhund.
Bram hatte den Eindruck, dass es vor zehn Jahren noch weit mehr Hunde gegeben hatte. Tel Aviv war zu einer armen Stadt geworden, in der Hunde nur noch von der verbliebenen Handvoll Reichen gehalten wurden. Daher waren die Hunde, denen sie unterwegs begegneten, auch genauso betagt, bedächtig und müde gebellt wie Hendrikus selbst. Junge Hunde waren eine Seltenheit, und die Alten wurden von ihren alten Herrchen gehätschelt, als wären sie ihre Kinder.
Sie standen an der Ecke einer Straße, die direkt auf den Strandboulevard zulief. An ihrem Ende, zweihundert Meter weiter, war für den Bruchteil einer Sekunde ein Kampfhubschrauber in der schmalen Öffnung zwischen den Häusern zu sehen, der wenige Meter oberhalb vom Strand lautlos nach Süden, Richtung Jaffa, sauste. Er gehörte zu einer neuen Generation von Hubschraubern, deren Motoren kaum lauter waren als der Flügelschlag eines Greifvogels. Taiwan hatte zwanzig von diesen Dragon Wings XR3 geliefert. Die Orthodoxen hatten eine Umbenennung verlangt, weil der Drache ein Ungeheuer aus einer unjüdischen asiatischen Mythologie sei. Im Volksmund nannte man sie nun »Chicken Wings«.
Brams Handy läutete. Es war ein antikes Stück, dreizehn Jahre alt, ohne die neuesten Finessen.
Auf dem Display erschien Ikkis Name. Mit Ikki Peisman zusammen betrieb Bram »Die Bank«, eine kleine Agentur zur Ermittlung verschwundener Kinder. Ihr Büro hatten sie in einem leeren Bankgebäude, daher der Name. Ikki war vierundzwanzig und hatte eine Bein- und eine Armprothese, war auf der linken Seite also komplett elektromechanisch. Eine Explosion hatte ihn dort zerfetzt, doch in israelischen Krankenhäusern konnte man nach jahrzehntelangem Terror inzwischen rekonstruieren wie nirgendwo sonst auf der Welt. Bis auf das Gehirn ließ sich so ungefähr jedes Organ und jeder Körperteil ersetzen.
Bram sagte: »Ikki?«
»Ja, ich bin’s. Bram! So, wie’s aussieht, lebt die kleine Sara noch!«
In ihrer Datei befanden sich zwei Saras. Die Ältere war mit dreizehn verschwunden, vor drei Monaten erst. Die Jüngere galt seit drei Jahren als vermisst und war damals fünf gewesen.
»Glaubwürdiger Hinweis?«
»Ich denke schon. Ein Wunder, nach so langer Zeit.«
Über sich spürte Bram eine Veränderung, als verdeckte irgendetwas den Himmel. Hendrikus hob den Kopf und schaute nach oben. Auch Bram schaute auf. Es war ein Chicken Wing, zehn Meter über den Dächern, ein stilles, schwarzes Insekt, das seine Augen auf ihn gerichtet hielt. Dieser eine Moment, da er sein Gesicht zeigte, genügte der Besatzung, um seine Identität festzustellen. Form und Linien seines Gesichts wurden mittels eines Gesichtserkennungsprogramms mit einer Datenbank abgeglichen, was kaum eine Sekunde dauerte: Blitzschnell schoss die Info via Satellit zu dem Bunker nördlich der Stadt, wo die Computer summten. Schon drehte das Ding ab, weil die beiden Piloten auf dem virtuellen Bildschirm in ihrem Helm Brams harmlose Personalien gelesen hatten. Der Hubschrauber verschwand hinter den Gebäuden, und zurück blieben nur ein Flüstern im Laub der Bäume und ein leichter Staubwirbel auf der Straße.
Bram, ein kleines Nichts am Boden, wandte sich wieder Ikki zu: »Das sind schöne Neuigkeiten. Hast du den Hinweis von Samir?«
»Von seinem Vetter. Nennt sich Johnny.«
»Schöner arabischer Name«, erwiderte Bram. »Was hast du ihm versprochen?«
»Fünfundzwanzigtausend.«
»Das ist viel, Ikki.«
»Finde ich auch. Vielleicht sollten wir mit Protestaktionen drohen. Das sind doch Unsummen.«
Bram entgegnete: »Protestaktionen? Was glaubst du denn, wo du lebst? In Schweden?«
»Ach, die Presse macht mich wahnsinnig«, sagte Ikki. »Ich lese keine Zeitungen mehr. Ich habe keinen Bock mehr, immer nur zu lesen, dass wir mit den Palästinensern reden müssen.«
»Wir müssen aber weiterhin mit ihnen reden, wir können ja wohl kaum allen den Schädel einschlagen«, sagte Bram. »Kennst du diesen Johnny?«
»Nein. Aber auf Samir ist Verlass. Er hat die Verbindung zwischen uns hergestellt.«
»Da drüben sind alle Vettern«, sagte Bram.
»Ja, eine einzige große fucking family. Aber wenn’s sein muss, schlagen sie sich gegenseitig die Birne ein«, sagte Ikki.
»Genau wie wir«, ergänzte Bram.
»Aber es gibt ein kleines Problem.«
Bram nickte ergeben, auch wenn Ikki ihn nicht sehen konnte. Obwohl der Chicken Wing verschwunden war, hatte er immer noch das Gefühl, dass er beobachtet wurde.
»Kleines Problem … Ich hatte nichts anderes erwartet«, sagte er.
Ikki zögerte einen Moment und sagte dann leise: »Sie ist drüben.«
2
Ikki lenkte seinen »behindertengerechten« Wagen den Strandboulevard entlang nach Süden. Da er auf der rechten Körperseite fast keine Kraft mehr hatte, hatte er sich einen britischen Wagen zugelegt, einen uralten Rover, der mit seiner mechanischen linken Hand und seinem mechanischen linken Fuß zu beherrschen war. Extreme Anstellerei, denn er hätte sich auch einen Wagen mit Automatikgetriebe kaufen können. Bram saß nun als Beifahrer dort, wo sich in einem normalen Auto der Fahrer befand, und er konnte sich nicht daran gewöhnen, dass er machtlos auf Ikkis Geschicklichkeit vertrauen musste. Hier auf dem Boulevard waren die beiden Fahrtrichtungen durch einen Grünstreifen voneinander getrennt, doch auf den meisten Straßen der Stadt rasten entgegenkommende Fahrzeuge direkt an seiner Tür vorbei, und es war erstaunlich, dass ihnen der Außenspiegel noch nicht abgerissen worden war.
Der vorliegende Fall war eines von Ikkis Projekten, Bram kannte nur die Akte – Mappen voller Fotos, Dokumente, E-Mail-Ausdrucke, DVDs. In keinem der von ihm behandelten Vermisstenfälle waren irgendwelche Fortschritte zu verzeichnen. Ikki dagegen war ein Naturtalent. Manche waren zum Wissenschaftler oder Geiger geboren, Ikki zum Kinderfinder.
Seit Bram mit Ikki zusammenarbeitete – sie hatten sich vor ungefähr tausend Tagen kennengelernt, am Tag des schweren Erdbebens in Kasachstan, das sowohl von Rabbinern als auch von Imamen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, als eine verdiente Strafe Gottes betrachtet wurde –, hatten sie fast jeden Monat ein Kind wiedergefunden. Allein in diesem Monat sogar schon zwei. Doch die Liste der vermissten Kinder in ihrer Datei war dreihundertsiebzehn Namen lang, und sie waren auf Hinweise, Zufallstreffer und Ikkis »Gefühl dafür, Dinge zu sehen, die man nicht sieht«, wie er selbst es ausdrückte, angewiesen. Wenn sie ein vermisstes Kind wiederfanden – die Mehrzahl blieb unauffindbar –, war es fast immer tot.
Sie waren unterwegs nach Jaffa, nach »drüben«. Die jüdische Bevölkerung war von dort weggezogen, und die verbliebenen Araber wollten den Anschluss an Palästina. Die israelische Armee, beziehungsweise was davon übrig war, hatte die Grenze, die südlich vom jüdischen Tel Aviv verlief, elektronisch verstärkt und eine Betonmauer errichtet. In Jaffa war es nach zwei Jahren erneut zu Selbstmordattentaten gekommen. Zwei arabische Frauen hatten sich in diesem Jahr an Kontrollposten in der Altstadt in die Luft gesprengt, wobei übrigens keine Juden, sondern ausschließlich Araber ums Leben gekommen waren. Da war noch anhand der Fingerabdrücke kontrolliert worden, aber die Frauen – sie hatten beide in israelischen Gefängnissen gesessen – hatten mittels Lasertechnik neue Papillarlinien bekommen. Als Reaktion darauf hatte man an den Grenzposten DNA-Scanner installiert, mit denen auf die umfangreichen Datenbanken zurückgegriffen wurde, in denen sich Juden in den letzten zwanzig Jahren hatten speichern lassen, weil sie verlorengegangene Verwandtschaftsbeziehungen klären und unbekannte Vorfahren ausfindig machen wollten. Dank neuer Techniken wurden nun also DNA-Kontrollen durchgeführt.
Sara war während eines Nachmittags am Strand von Tel Aviv, zwei Kilometer nördlich von Jaffa, verschwunden. Wie Bram von Ikki wusste, hatte Saras Mutter, Batja Lapinski, Wasser und Limonade, Butterbrote und Trauben dabeigehabt, hatte eine armeegrüne Zeltplane ausgebreitet, sie mit der flachen Hand glattgestrichen und daneben die angespitzte Stange eines Sonnenschirms in den warmen Sand gesteckt, und Sara hatte mit bunten Plastikförmchen Sterne, Halbmonde und Würfel aus Sand gebacken. Das fünfjährige Mädchen mit blonden Locken und großen blauen Augen hatte in seinem knallroten Badeanzug, der um den molligen kleinen Leib spannte, den Patrouillenbooten zugewinkt, die in hundert Meter Entfernung auf den Wellen schaukelten. Batja hatte im Schatten des Sonnenschirms das neueste Buch von David Manowski gelesen, dem im kanadischen Vancouver lebenden israelischen Autor, der im Jahr zuvor den Literaturnobelpreis erhalten hatte, und dabei immer wieder mal mit dem Mittelfinger die Sandkörner weggewischt, die in Saras Mundwinkeln klebten. Sie hatte die Zeit und die Ruhe gehabt, sich auf ihrem steinalten iPod die Neunte von Dvořák anzuhören. Sie hatte Sara ein Salamibrot gegeben und sich auf der Plane ausgestreckt. Sie hatte bei Manowskis Buch, der Geschichte seines im Herbst 2006 gefallenen Sohnes, geweint. Als sie sich mit dem Handrücken die Tränen weggewischt und danach einen Blick über ihre Schulter geworfen hatte, um das beruhigende Bild von ihrer spielenden Tochter in sich aufzunehmen, hatte sie eine Handvoll anderer Kinder gesehen – es gab nicht mehr viele. Sie hatte sich aufgerichtet und den Blick über den Strand schweifen lassen. Sie hatte Sara gesucht. Sie hatte andere Mädchen gesehen, aber nicht ihre Tochter.
Ikki fragte: »Wann bist du zum letzten Mal in Jaffa gewesen?«
»Keine Ahnung. Das ist Jahre her. Mindestens sieben oder acht Jahre. Was soll ich auch dort?«
»Ich bin bestimmt zehn Jahre nicht mehr dort gewesen«, sagte Ikki. »Alle meine Kontakte, wenn ich jemanden von drüben brauche, laufen telefonisch. Als Kind bin ich noch hin und wieder mit meinen Eltern dort gewesen. Dann haben wir in einem dieser kleinen Lokale am Hafen gegessen. In den arabischen Läden eingekauft. Frische Kräuter. Lammfleisch. Obst. Geht jetzt nicht mehr.«
Bram sagte: »Nein, das geht nicht mehr. Aber wenn wir schon mal dort sind, können wir doch ruhig in einen Laden gehen. Was sollte uns denn passieren?«
»Schlimmstenfalls, dass sie am Rande von Jaffa unsere abgehackten Köpfe auf Stangen spießen.« Ikki musste selbst grinsen und fügte hinzu: »Bei deinem Kopf wird es nicht viel ausmachen, ob tot oder lebendig.«
»Vielen Dank für das Kompliment«, erwiderte Bram.
»Hast du das Geld mit?«
Bram klopfte auf seinen Oberschenkel. Er trug eine Trekkinghose mit vielen Taschen. Ikki hatte drüben ein Netzwerk von Informanten, die er gut bezahlte und die daher verlässlich waren. Die Palästinenser waren zwar kurz davor, die Juden zu besiegen, doch ihr übervölkertes Land bot keine Arbeit, keine Zukunft, keine Hybridautos. Samir war ein palästinensischer Gewährsmann, auf den Ikki von Anfang an gesetzt hatte. Mit Samirs Hilfe hatten sie die Akten von fünf Vermisstenfällen schließen können. Auch den mit den Chassidim in Jerusalem hatte Ikki über Samir gelöst.
Vor einem Jahr hatten Bram und Ikki Schlagzeilen gemacht, als sie ein Kind wiedergefunden hatten, das acht Jahre zuvor verschwunden war; der mittlerweile elfjährige Junge lebte an Sohnes statt bei einem kinderlosen chassidischen Ehepaar in Jerusalem. Es war ein Zufallstreffer gewesen – Ikki führte es auf seine Intuition zurück. Er hatte darauf in Tel Aviv drei Tage lang Weltruhm genossen. Die leiblichen Eltern durften den Jungen, der von den frommen Pflegeeltern gut und sehr gläubig erzogen worden war, seither einmal im Monat besuchen. Die orthodoxen Pflegeeltern hatten ihn von einer professionellen jüdisch-palästinensischen Kidnapperbande gekauft. Diese Entdeckung hatte für öffentlichen Aufruhr und diplomatischen Zündstoff zwischen Israel und Palästina gesorgt, das die gesamte Altstadt inklusive der Viertel der Ultraorthodoxen verwaltete.
Die Schlagzeilen waren auch Saras Mutter nicht entgangen. Zwei Jahre lang hatte sie auf die Polizei vertraut, deren Berichte abgewartet und versucht, das Grauen in ihrem Kopf und ihrem Herzen zu betäuben – sie hatte Tabletten geschluckt, Hasch geraucht, Wodka getrunken. Dann hatte sie drei Monate lang ununterbrochen geweint und anschließend in einer Art Vakuum gelebt, bis sie durch die Medien von der Agentur erfuhr, wie sie Ikki erzählt hatte. Sie hatte ihm alle Polizeiberichte gegeben, Fotos vom Strand und die Zusammenfassungen dessen, was sie von Hellsehern zu hören bekommen hatte. Ein Jahr lang hatten Ikki und Bram gesucht und nichts gefunden, und nun hatte sie wie so oft der Hinweis eines Gewährsmannes dem vermissten Kind näher gebracht.
»Fünfundzwanzig?«, fragte Ikki.
»Dreißig Mille.«
»Dafür machen sie’s. Bestimmt. Das hab ich im Gefühl.«
Die neue Grenze verlief erst acht Kilometer südlich von Jaffa, aber das Militär hatte auch hier schon einen festen Kontrollposten eingerichtet, um Infiltrationen vorzubeugen.
Ikki fuhr an den Straßenrand und blickte auf die Betonmauer hundert Meter vor ihnen, in der sich eine Öffnung befand, die zur Kontrollschleuse führte.
Es herrschte wenig Verkehr nach Jaffa. Zwei Autos warteten vor der Schleuse, die mit chemischen und elektronischen Messgeräten zum Aufspüren von Sprengstoffen bestückt war. Sie sah aus wie eine automatische Waschstraße, ein tunnelartiges, von blitzender Elektronik strotzendes Gebilde, das Fahrzeug und Insassen abtastete. Man fuhr den Wagen an den Eingang heran, und dann glitt das ganze Gehäuse zweimal über das Fahrzeug hinweg – nicht mit Wasser und Bürsten, sondern mit alles erfassenden Sensoren.
»Fühlt sich nicht gut an dahinten«, sagte Ikki.
»Wie meinst du das, fühlt sich nicht gut an?«, fragte Bram.
»Wie ich’s sage, es fühlt sich nicht gut an«, wiederholte Ikki.
»Wo?«
»Da«, Ikki schluckte. »Ich weiß nicht. Ich bin einfach … Da wird was passieren.«
Am Kontrollposten war nichts Ungewöhnliches zu entdecken. Soldaten mit Kevlar-Schutzwesten, zwei Autos, die mit Stacheldraht umzäunte Mauer, die blitzende Waschanlage und jenseits davon der blaue Himmel über den Dächern von Jaffa. Die Sicherheitsmauer erstreckte sich bis ans Meer und verschwand dort im Wasser.
Bram sagte: »Ikki, wir haben einen Termin. Sara, erinnerst du dich noch?«
»Spar dir deinen Sarkasmus«, unterbrach ihn Ikki. Er starrte weiter geradeaus.
»Dann erklär’s mir doch«, bat Bram. »Worin besteht dieses Fühlen bei dir?«
»Ich weiß nicht. Beunruhigung. Ich rieche das.«
»Was riechst du?«
»Irgendwas. Ich weiß nicht, was.«
»Dahinten am Kontrollposten?«
»Ja.«
»Was sollte denn dort sein?«
»Ich weiß es doch nicht!«, fuhr Ikki ihn mit hilflosem Blick an. Er seufzte. »Entschuldige. Ich weiß auch nicht, was es ist.«
»Was passiert, wenn du diesem … diesem Gefühl nicht nachgibst?«
»Weiß ich nicht.«
»Hast du das schon mal untersuchen lassen?«
»Was meinst du damit?«
»Diese Gefühle … Hast du je mit jemandem darüber geredet?«
»Du meinst, mit einem Seelenklempner?«
»Zum Beispiel.«
»Warum sollte ich?«
»Na, weil du dadurch beeinträchtigt wirst.«
»Ich werde durch gar nichts beeinträchtigt.«
»Ach nein? Empfindest du diese Gefühle als Bereicherung?«
»Ja.«
»Wir haben einen Termin«, wiederholte Bram.
»Ich weiß.«
»Fährst du weiter?«
Ikki starrte auf die Mauer und nickte dann einige Sekunden lang, als mache er sich selbst Mut. »Okay.«
»Gut«, sagte Bram.
Ikki lenkte den Wagen wieder auf die Straße zurück und fuhr auf die Waschstraße in der Mauer zu, die jetzt verlassen war. Die anderen Wagen waren bereits hindurch.
Um den internationalen Medien gegenüber den Anschein von Gleichbehandlung zu wecken, wurde zu beiden Seiten des Postens kontrolliert, obwohl es elf Jahre her war, seit eine jüdische Terrorgruppe zuletzt eine Serie von Anschlägen in den arabischen Dörfern Israels verübt hatte. Sie waren der Auslöser für die Abspaltung der arabischen Dörfer in Galiläa gewesen. Jetzt wollten auch die Araber Jaffas den Anschluss an Palästina. Das kleine jüdische Land war zu einem Stadtstaat von der Fläche Groß-Tel-Avivs plus einem Sandkasten zusammengeschrumpft.
Einer von den fünf Soldaten an der Mauer signalisierte ihnen gelangweilt, anzuhalten. Als ob das nötig gewesen wäre. Wenn man nicht anhielt, wurde man in die Luft gesprengt.
Der Soldat war Chaim Protzke, ein rothaariger Jude mit roten Backen und zehn Kilo Übergewicht auf den Hüften. Er war einer von Brams Studenten gewesen, vor mehr als zwanzig Jahren, als er noch an der Universität unterrichtet hatte. Jetzt leistete Protzke seinen Quartal-Reservedienst ab. Bram ließ das Seitenfenster hinunter.
Protzke erkannte ihn sofort: »Professor Mannheim!«
»Hallo, Chaim.«
Bram hatte ihn vor einem Jahr im Krankenhaus wiedergetroffen, als er einen Patienten in der Notaufnahme abgeliefert und Protzke ihn dort im Wartezimmer angesprochen hatte. Protzke hatte auf das Ergebnis einer Untersuchung seines Sohnes gewartet, der beim Fußballspielen unglücklich gestürzt war – man stellte eine Bänderdehnung im Fußgelenk fest. Bram entsann sich, was er zu Protzke gesagt hatte: Solange es hier noch Jungen gibt, die Fußball spielen, besteht Hoffnung.
Protzke beugte sich zum Wagen hinunter: »Geht es Ihnen gut, Professor?«
»Ja. Und dir? Deinem Fußballer?«
»Lonnie hat wirklich Talent. Er ist jetzt in Polen. Die haben eigens seinetwegen einen Scout geschickt, der ihn zu verschiedenen Tests mitgenommen hat.«
2022 hatte Legia Warschau den Europacup gewonnen. Die Polen hatten den Sieg mit überlegener Abgeklärtheit gefeiert. Er war die Besiegelung ihres neuen Status als führende und prosperierende europäische Nation.
Bram sagte: »Schlag einen hübschen Vertrag für ihn raus.«
»Er bleibt drei Wochen dort. Lonnie ist wirklich gut.« Protzke warf einen Blick auf den Wagen und wandte sich wieder an Bram: »Und Sie suchen Spannung und Nervenkitzel?«
»Gibt es einen anderen Grund, nach Jaffa zu fahren?«
»Ich wüsste nicht«, erwiderte Protzke. Bei ihrer Begegnung im Krankenhaus hatte er erzählt, dass er, als Bram nach Princeton gegangen war, sein Geschichtsstudium gesteckt hatte und Programmierer geworden war.
Protzke richtete das Wort an Ikki: »Und Sie?«
»Spannung und Nervenkitzel«, sagte Ikki.
»Wir sind da drüben einem Kind auf der Spur«, sagte Bram. Protzke wusste, was sie machten. In der Notaufnahme hatte er sich mit Bewunderung über Brams Arbeit geäußert.
Protzke fragte: »Wissen die, dass Sie kommen?«
Er meinte die Polizei in Jaffa. Mit einigen wenigen Mannschaften sowie Hunderten von Kameras und biochemischen Schnüffelposten, deren Standort fast täglich verändert wurde, gelang es der Polizei, die unruhige Stadt in Schach zu halten.
»Nein, wir haben nicht angerufen«, antwortete Bram.
»Soll ich das kurz machen? Ich gebe das Kennzeichen durch. Aber dieser britische Rover fällt ohnehin auf. Oder stammt er aus Australien?«
»Australien«, bestätigte Ikki mit einem Nicken.
»Wenn du anrufen würdest, Chaim, gern«, sagte Bram.
Protzke reichte ihnen zwei in transparentes Cellophan verpackte Wattestäbchen. »Haben Sie das schon mal gemacht?«
»Ich hab davon gelesen«, antwortete Bram.
Protzke erklärte: »Kurz damit über die Innenseite der Wange streichen, bitte, und danach in den Scanner stecken. Ich sag dann schon Bescheid.«
Er wandte sich wieder an Ikki: »Fahren Sie dann bitte in die Schleuse? Sie müssen im Auto bleiben. Fenster öffnen. Und auf die Anweisungen hören. Motor aus, bitte.«
Protzke trat zwei Schritte zurück und signalisierte, dass sie fahren konnten.
Ikki lenkte den Rover zum Eingang der elektronischen Schleuse und behielt dabei ein rotes Warnblinklicht im Auge. Als es ausging, zog er die Handbremse an und stellte den Motor ab. Jetzt setzte sich das Schleusengehäuse in Bewegung und schob sich über den Wagen. Die in seinen Wänden befindlichen Sensoren konnten sehen, riechen, schmecken, ja sogar in den Magen der Insassen schauen und anhand von dem, was dort geknetet und angesäuert wurde, feststellen, woraus das heutige Frühstück bestanden hatte. Bram und Ikki nahmen die Wattestäbchen aus der Verpackung und taten, was Protzke ihnen aufgetragen hatte.
Bram blickte auf die feuchte Spitze seines Stäbchens. »Und was jetzt?«
»Das Ding musst du gleich in so’n Ding tun«, sagte Ikki.
»Alles klar. Wie geht es dir jetzt?«
Ikki zuckte die Achseln. »Auf dem Weg nach Haifa haben sie genau so was installiert. Und auf halber Strecke nach Jerusalem. Sie durchleuchten uns komplett. Bei mir bekommen sie viele hübsche Sachen zu sehen.«
»Und wie steht’s mit deinem Gefühl?«
»Danke, bestens.«
»Vor was hattest du denn nun eigentlich Angst?«
»Was heißt denn ›hattest‹?«
Das Schleusengehäuse bewegte sich wieder zur Vorderseite des Wagens zurück.
Ikki sagte: »Ich hab neulich noch einen Artikel über die DNA und die alte Frage, wer nun eigentlich Jude ist, gelesen. Die DNA, die über Generationen hinweg unverändert bleibt, ist das Y-Chromosom des Mannes. Das wird vom Vater an den Sohn weitergegeben. Ursprünglich ging es den Rabbinern wirklich um die Blutlinie der Mutter, die war maßgeblich fürs Jüdischsein. Aber das sind überholte Ansichten. Eine jüdische Frau, die eine Tochter von einem Goi bekommt, bringt eine Tochter mit einem jüdischen und einem nichtjüdischen X-Chromosom zur Welt, das eine von ihr, das andere von ihm. Bekommt diese Tochter wieder eine Tochter von einem Goi, kann diese zwei nichtjüdische X-Chromosomen haben – und ist, obwohl sie demnach physisch ganz und gar nichtjüdisch ist, für die Rabbiner eine Jüdin. Kommst du noch mit?«
»Mehr oder weniger«, sagte Bram. »Also?«
»Seit wir etwas über die DNA wissen, ist klar, dass die rabbinischen Regeln Schrott sind.«
»Ich werd’s dem Oberrabbinat mailen«, sagte Bram. »Von jetzt an sind nur Juden jüdisch, die einen jüdischen Vater haben.«
Protzkes Stimme ertönte: »Die Stäbchen in den Scanner, bitte.«
In Höhe der geöffneten Fenster wurden zu beiden Seiten des Wagens Scanner aus dem Schleusengehäuse ausgefahren, zwei Stahlkästchen mit einer Art Schlüsselloch, in das die Stäbchen passten.
Protzke wiederholte: »Die Stäbchen in den Scanner, bitte.«
Sie steckten die Stäbchen in die Scanner, die daraufhin wieder eingezogen wurden und nun binnen zehn Sekunden feststellen konnten, ob ihre DNA ethnische jüdische Merkmale aufwies.
Bram sagte zu Ikki: »Du findest also, es wäre falsch, jetzt nach Jaffa reinzufahren.«
»Ja. Aber wenn ich es mir genau überlege, finde ich hier alles falsch.«
»Hier?«
»Ja, hier.«
»Wo könntest du sonst hin?«
»Nirgendwohin.«
Die Ergebnisse ihrer Überprüfung erschienen offenbar sofort auf dem Monitor Protzkes, denn er tönte aus dem Lautsprecher: »Sie können weiterfahren, Professor.«
»Bis später«, erwiderte Bram. »Und vielen Dank.«
»Bis dann.«
Ikki startete den Wagen, fuhr aus der Schleuse hinaus und manövrierte zwischen Betonblöcken hindurch zur Straße, die hundert Meter weiter auf die ersten Häuser Jaffas zuführte.
3
In einem anderen Leben war Bram unbefangen mit Rachel durch die Gassen Jaffas geschlendert, seinen Sohn in einem Tragegurt vor der Brust. Die Araber waren damals nicht von den Israelis zu unterscheiden gewesen, ihre Frauen hatten Röcke getragen und ihre Gesichter und ihre Lippen hergezeigt. Seinerzeit wurden alte Häuser renoviert, es gab Straßencafés und Restaurants und Galerien, und Touristen mit Digitalkameras fotografierten die weißen Steine, von denen man den jahrtausendealten Staub heruntergeschrubbt hatte. Die antike Festungsstadt hatte so jung ausgesehen wie das Kind, das an seinem Herzen schlief. Jetzt waren die Frauen Jaffas verschleiert. Und die Männer trugen Bärte, Dschellabas, Sandalen.
Die Altstadt von Jaffa war klein, aber sie brauchten zwanzig Minuten, bis sie die Adresse gefunden hatten. In einer schmalen Straße zwischen hohen Häusern mit schiefen Balkonen und verwitterten Rahmen stellte Ikki den Wagen vor einem Café ab. Bram folgte ihm nach drinnen.
Grünliches Licht aus Leuchtstoffröhren fiel auf Holztische, schmutzig gelbe Fußbodenfliesen und die Kafiyas von zehn, zwölf Männern. Ein Ventilator an der Decke brachte mit drei breiten Flügeln Bewegung in die rauchgeschwängerte Luft, die nach Eimern voll Zigarettenasche roch. Keiner schenkte ihnen Beachtung, als wäre es ganz alltäglich, dass hier zwei Juden hereinspazierten. Ein Mann saß allein am Tisch, mit aufgestützten Ellenbogen, eine Zigarette zwischen den Fingern, eine Tasse Tee vor sich. Wie die anderen schaute er zu einem Fernsehbildschirm über dem Eingang hinauf. Ein amerikanisches Basketballspiel wurde übertragen. Schwarze Riesen tänzelten um den Ball herum. Ikki sah Bram fragend an, als könnte Bram ihm weiterhelfen. Dabei hatte Ikki selbst das Treffen vereinbart. Mit wem? Ikki ging zu dem einsamen Araber hinüber und setzte sich mir nichts, dir nichts an dessen Tisch. Der Mann musterte ihn kurz, nickte, schaute Bram eine Sekunde lang misstrauisch an und verlagerte seinen Blick wieder auf den Bildschirm.
Ikki hatte erklärt, dass sich der Mann an einem öffentlichen Ort mit ihnen treffen wollte, weil er argwöhnte, dass sie bewaffnet sein könnten. Das war Unsinn. Grund dafür, dass ein öffentlicher Ort als Treffpunkt vereinbart wurde, war meistens, dass die Leute ihre Partner um sich haben wollten. Es handelte sich im vorliegenden Fall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine Entführung. Vermutlich waren alle in diesem Café Handlanger. Bram zog sich einen Stuhl von einem leeren Tisch heran und ließ sich neben Ikki nieder.
Der Araber drückte seine Zigarette in einem vollen Aschenbecher aus. Er trug eine Kafiya wie die anderen, aber seine Wangen und sein Kinn waren glattrasiert. Keine Spur von Schweiß. Am rechten Handgelenk eine protzige Rolex, mit Sicherheit ein Imitat. Noch immer schien er das Basketballspiel interessanter zu finden als Brams Geld. Theater. Er wollte nichts lieber als ihr Geld.
Ikki fragte: »Sie sind Johnny?«
Der Mann wandte sich ihm zu und nickte. Etwas Ironisches und Gewitztes im Blick, sagte er: »Johnny, ja. Und Sie sind Sean?«
»Sean«, bestätigte Ikki.
»Guter katholischer irischer Name«, sagte Johnny.
»Ich bin nach einem amerikanischen Filmschauspieler benannt worden«, erwiderte Ikki. »Sean Penn.«
»Sean Penn hatte einen jüdischen Vater.«
»Guter Schauspieler«, sagte Ikki, überrascht, dass der Mann wusste, von wem er sprach. Die Bedrücktheit, die ihm unterwegs anzumerken gewesen war, verschwand aus seinem Gesicht.
»Aber komplett verrückt«, entgegnete Johnny. »Hätte niemals Senator werden dürfen.«
Ikki musterte ihn mit fröhlichem Blinzeln in den Augen: »Und nach wem hat man Sie benannt?«
Johnny antwortete: »Nach Tarzan. Johnny Weissmüller.«
Ikki kicherte. Johnnys Unsinn gefiel ihm. Er sagte: »Weissmüller war ein guter Schwimmer. Aber ein schlechter Schauspieler, wenn auch beliebt. Er hatte ungarische Eltern.«
Den Blick auf das Spiel über der Tür gerichtet, erwiderte Johnny: »Es heißt, er hatte eine jüdische Mutter. Und ich finde schon, dass er ein guter Schauspieler war.«
Ikki warf Bram einen amüsierten Blick zu. Er war offensichtlich auf alles, nur nicht auf einen Tarzankenner in Jaffa vorbereitet gewesen.
»Das wusste ich nicht«, sagte Ikki voller Bewunderung.
Johnny nickte zufrieden über Ikkis Vorlage. Ohne das Spiel auf dem Bildschirm aus dem Auge zu lassen, sagte er: »Ich schätze, du weißt noch einiges andere nicht, was ich weiß. 1924, vor genau hundert Jahren also, gewann Weissmüller bei den Olympischen Spielen in Paris die hundert Meter Freistil erstmals in unter einer Minute. Inzwischen sind wir bei einundvierzig achtzehn. Aber er war zu seiner Zeit eine Sensation. Faszinierendes Leben. Starb schließlich einsam in Mexiko. Acapulco. Sein Haus dort steht noch. Es heißt ›Casa de Tarzan‹, und man kann es mieten, es gehört zu einem Hotel. Ein rundes Haus, rosa, ich hab Fotos davon gesehen. Er war fünfmal verheiratet, kostete ihn einen Haufen Geld, und das ging ihm dann irgendwann aus. Aber Tarzanfilme wurden nicht mehr gedreht, und was anderes wurde ihm kaum angeboten. Um seinen Unterhalt zu verdienen, hat er sogar eine Weile den ›Begrüßer‹ in einem Casino in Las Vegas gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Der große Weissmüller im Foyer von so ’nem Casino? Ich hab nie herausbekommen, welches Casino es war. Das ›Flamingo‹ oder ›Caesars Palace‹. Er ist arm gestorben, obwohl er nicht vergessen war. Begraben in Acapulco. Bei seiner Beerdigung haben sie seinen Dschungelschrei ertönen lassen. – Klasse Dunking.«
Bram drehte sich zum Bildschirm um und sah die Wiederholung des Korbwurfs in Zeitlupe. Der Spieler schwebte auf den Korb zu und drückte den Ball mit beiden Händen von oben hinein. Die Männer im Café klatschten.
Johnny erklärte: »Ismail Hamdar. Stammt aus Hebron. Seine Eltern sind 2000 weggegangen. In Houston geboren. Zwei Meter fünf. Ich hab dreihundert auf ihn gesetzt.«
Er winkte dem beleibten Mann, der am Nebentisch pechschwarzen Kaffee nachschenkte – aus hoch erhobener Silberkanne dirigierte er den Strahl elegant in die Tassen –, und bestellte auf Arabisch zwei Tee.
»Hamdar muss dreißig Punkte machen. Dann habe ich meinen Einsatz verdoppelt.«
Ikki sagte: »Dreißig ist viel.«
»Sein Durchschnitt in den letzten zehn Spielen liegt bei sechsunddreißig«, erwiderte Johnny.
»Wie viele muss er noch?«, fragte Ikki.
»Zweiundzwanzig.«
»Wird also noch schwierig.«
»Hamdar läuft immer erst im letzten Viertel zur Höchstform auf. Er muss noch auf Touren kommen.«
Johnny zog eine platt gedrückte Zigarette aus einer zerknüllten Packung, zündete sie sich mit einem antiken Ronson an und sagte: »Eines Tages werde ich ihn live spielen sehen.«
»In Houston?«, fragte Ikki.
»In Houston. Bei den Rockets. Im Toyota Center.«
»Dann komme ich mit«, sagte Ikki.
Johnny wandte sich an Bram: »Und du?«
»Was ich?«
»Kommst du auch mit?«
»Ich komme auch mit«, antwortete Bram.
»Also wir drei«, sagte Johnny zufrieden.
Bram fand, dass sie den Ritualen jetzt Genüge getan hatten: »Könnten wir drei noch etwas anderes machen?«
Johnny nickte. »Wir könnten auch noch zu den Los Angeles Clippers.« Er machte Platz, damit der beleibte Mann zwei Gläser Tee auf den Tisch stellen konnte. »Und zur ›Casa de Tarzan‹ natürlich.«
Ikki legte beide Hände um das Glas, als wollte er sie daran wärmen, aber er überspielte damit nur seine Anspannung, denn Brams Einwurf setzte ihn unter Druck. Es waren mindestens dreißig Grad hier drinnen. Das Einzige, was der Ventilator an der Decke bewerkstelligte, war, dass der Rauch gleichmäßig im Raum verteilt wurde.
Ikki erklärte: »Bram meint … das Mädchen …«
Johnny sah Bram an: »Du heißt Bram?«
»Bram. Avraham. Ibrahim.«
Ikki sah ihn abwartend an. Er wollte, dass Bram das Wort führte. Bram war schließlich der Chef.
Bram sagte: »Ich möchte zum Geschäftlichen kommen.«
Johnny hüllte sich in eine Rauchwolke. »Nichts dagegen.«
»Wir müssen zuerst mal feststellen, ob wir von derselben Sache reden.«
»Daran habe ich keine Zweifel«, erwiderte Johnny ungerührt.
Bram sagte: »Ich habe noch keine Beweise gesehen.«
»Die habe ich.«
»Können wir sie sehen?«
Johnny tastete nach etwas, was unter dem Tisch stand. Eine Ledertasche. Er klappte sie auf, zog einen Umschlag heraus und schob diesen über den Tisch zu Bram hin. »Schau’s dir nachher an. Nicht hier«, sagte er.
»Ich brauche die Beweise jetzt.«
»Nein, nicht jetzt. Ich will nicht, dass die anderen das sehen.«
Ikki flüsterte: »Samir sagte, du weißt alles.«
»Samir ist ein altes Klatschweib. Er hat keine Ahnung.«
»Kommen wir jetzt ins Geschäft oder nicht?«, fragte Bram. Er wusste zwar, dass es nicht ratsam war, einen arabischen Geschäftsmann zu drängen, aber er wurde langsam ärgerlich. Es ging hier schließlich nicht um den Kauf eines Gebrauchtwagens.
»Ich mache gerne Geschäfte«, erwiderte Johnny gelassen, »vorausgesetzt, wir sind uns einig, worum es geht.«
»Das Mädchen«, sagte Bram. »Sara Lapinski. Vor drei Jahren verschwunden.«
Er zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Brusttasche seines Oberhemds und legte es auf den Tisch. Es war der Farbausdruck von einem Foto. Bram war schweißgebadet, und das Papier fühlte sich feucht an. Johnny rührte es nicht an.
Bram sagte: »Schau’s dir an. Es ist die Bearbeitung eines Fotos, so muss sie heute aussehen. Sie wird in drei Monaten acht. Vor drei Jahren ist sie am Strand verschwunden. Man hat sie gesucht, Taucher haben den Meeresboden Meter für Meter nach ihr abgesucht, es hat einen Aufruf im Fernsehen gegeben, sie wurde angeblich in Herzlia, Ramallah und Oslo, Norwegen, gesehen. Arme Irre haben Überstunden gemacht und gemailt, sie hätten von ihr geträumt und seien sich absolut sicher, dass sie in einem Harem in Riad oder Islamabad sei. Oder auf einer Ranch in Neuseeland und Schafe hüte. Es wird Zeit, dass sie nach Hause kommt. Das ist uns Geld wert. Wir können also ins Geschäft kommen, wenn du uns hilfst, sie zu finden. Wir stellen keine Fragen. Das Einzige, was wir wollen, ist, dass sie zurückkommt.«
Die Männer hinter Bram klatschten. Johnny warf einen Blick auf den Bildschirm. »Noch zwanzig Punkte«, sagte er.
»He, Johnny, es geht hier um ein Kind«, betonte Bram mit unverhohlenem Ärger. »Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, denen es sehr viel bedeutet? Oder hat der Judenhass oder der berühmte arabische Geschäftssinn alles in dir abgetötet? Also, kommen wir jetzt ins Geschäft oder nicht?«
»Glaubst du etwa, du kannst etwas erreichen, wenn du mich beleidigst? Eine falsche Bewegung, und jeder hier reißt dir mit größtem Vergnügen den Kopf ab. Achte also besser auf deine Worte.«
»Du bluffst«, sagte Bram. Er musste in der Offensive bleiben. »Du kannst gar nicht liefern. Du hast keinen blassen Schimmer von dem Mädchen.«
»Ich bin Geschäftsmann«, erwiderte Johnny. »Ich weiß, wann ich liefern kann. Und wann nicht.«
»Der Deal ist Sara.«
»Ihr versteht mich nicht. Es gibt keine Sara mehr.«
Ikki schluckte, sah Bram erschrocken an.
»Du hast uns also herkommen lassen, obwohl du gar nichts zu bieten hast?«, fragte Bram aggressiv.
Ungerührt zuckte Johnny die Achseln. »Samir ist ein Träumer«, konstatierte er.
»Lass uns gehen«, sagte Bram und machte Anstalten, sich zu erheben.
Ikki hielt ihn am Arm zurück: »Ich kenne Samir seit Jahren. Und er hat gesagt, dass Johnny unser Mann ist.«
Johnny sagte: »Ich weiß nicht, wieso ich überhaupt noch mit euch rede. Aber gut … Samir hat etwas Entscheidendes verschwiegen. Deshalb habe ich euch kommen lassen.«
»Was?« Bram setzte sich wieder.
»Dass sie tot ist.«
»Tot?«, wiederholte Ikki und kniff mit seiner mechanischen Hand in Brams Arm.
Johnny sagte: »Das Mädchen ist vor einem halben Jahr gestorben.«
»Wusste Samir das?«, fragte Bram.
»Nein.«
Ikki suchte nach Worten, brachte aber keinen Ton heraus.
Bram fragte: »Was ist passiert?«
Auf die glühende Spitze seiner Zigarette starrend, antwortete Johnny: »Soweit ich gehört habe … Sie wurde krank, vor sieben, acht Monaten. Ein, zwei Wochen darauf ist sie gestorben.« Er blickte zum Fernsehschirm hinauf. »Ich meine nur: Welchen Deal wollt ihr? Sie ist gestorben. Hätte nicht passieren dürfen. Ist aber passiert. Sie haben sie nicht wie einen Hund in einen Graben geworfen. Sie haben sie bestattet. Anständig.«
Ikki murmelte: »Haben sie den Kaddisch gesprochen?«
Johnny schüttelte den Kopf: »Auf welchem Planeten lebst du denn? Natürlich nicht.«
»Sie war jüdisch«, entgegnete Ikki barsch.
Johnny drückte seine Zigarette aus und zündete sich gleich wieder eine neue an. Das Ronson zitterte leicht in seiner Hand. Er gab sich als harter Macho, doch mit der Nachricht, die er zu überbringen hatte, tat er sich schwer.
Bram fragte: »Hast du Namen für uns?«
Johnny sah ihn mitleidig an. »Ist das jetzt ein seriöses Gespräch oder nicht?«
»Wo ist sie begraben?«, fragte Ikki.
»In heiliger Erde. Sie ist jetzt im Paradies, Inschallah.« Johnnys Blick wurde wieder vom Spiel angezogen. »Noch achtzehn Punkte. Der Junge ist eine Wucht.« Er sah Ikki an. »Tut mir leid. Ich kann mir vorstellen, wie sich das anfühlt. Große Kacke ist das, excusez le mot.«
4
Schweigend lenkte Ikki den Wagen aus dem Labyrinth. Auch Bram sagte kein Wort. Ikki hatte nicht ausreichend nachgeforscht, und wenn Johnny sie hintergangen hätte, wäre ihr Geld jetzt für ein totes Mädchen weg gewesen. Es war siedend heiß, und die Klimaanlage im Auto war defekt. Bram hatte auf seiner Seite die Scheibe hinuntergelassen, und das beunruhigte Ikki. Er sah überall Bedrohungen. Nervös steuerte er durch die arabischen Gassen.
Bram warf einen Blick auf den Inhalt des Umschlags, den Johnny ihm gegeben hatte. Es war ein Foto von Sara. Sie lag auf dem Rücken und sah aus, als schlafe sie; weißes Kleid, Hände auf der Brust gefaltet, auf dem Bauch Rosen und Hyazinthen, Augen geschlossen – es war das Bild von ihrem Totenbett. Bram schloss den Umschlag sofort wieder. Vielleicht würde er sich das Foto später ansehen, wenn er die Kraft dafür hatte.
Ikki und er behandelten ihre Fälle jeder für sich. Es gab Zeiten, da die Eltern, die ihre Hilfe gesucht hatten, von neuer Hoffnung beflügelt oder von Kummer zermürbt wochenlang zehnmal am Tag anriefen, simsten oder mailten, und dadurch entwickelte sich unweigerlich eine persönliche Beziehung. Sara Lapinski war Ikkis Fall. Hätten sie Sara freikaufen können, hätte Ikki ihre Mutter anrufen dürfen. Aber die schlechte Nachricht musste Bram überbringen. Er war fast dreißig Jahre älter als Ikki, und da sollte die Aufgabe der Benachrichtigung von der Katastrophe besser auf seinen Schultern ruhen. Achtundzwanzigmal hatte er das schon gemacht. Es gab Offiziere, die viele Dutzende solcher Besuche absolviert hatten. Sie bekamen den Befehl und hatten keine Wahl. Bram schon. In sechs Fällen hatten sie die Polizei auf die Spur zu einem Grab bringen können, aber auch da war Bram gegangen, obwohl er es einem Polizeibeamten hätte überlassen können, bei den Hinterbliebenen anzuklopfen. Bram hatte Batja Lapinski nie kennengelernt und musste ihr nun sagen, dass ihre Tochter tot war – falls sie sich auf Johnnys Auskunft verlassen konnten. Sprach das Foto vom Totenbett für sich? Bram war sich nicht sicher.
Nach einigen Minuten beidseitiger Sturheit – Ikki fragte nichts, und Bram starrte unwirsch vor sich hin – rief Ikki verzweifelt aus: »Ja, ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe! Es tut mir leid!«
Bram erwiderte: »Dein guter Samir hat dich hängengelassen.«
»Den knöpfe ich mir vor«, sagte Ikki. »Können wir auf einem anderen Weg zurückfahren?«
»Nein.«
»Durch diesen Kontrollposten ist die einzige Möglichkeit?«
»Ja.«
»Shit«, seufzte Ikki.
»Vorgefühl?«
»Ja.«
»Riechst du was?«
»Sarkastischer Arsch«, sagte Ikki.
Kurz bevor sie in das offene Gelände vor dem Kontrollposten hinausfuhren, nackter Boden bis an die Betonmauer, kamen sie am Markt vorüber. Verschleierte Frauen. Männer in Wallekleidern.
Ikki sagte: »Ihre Mutter … Wir müssen es ihr sagen.«
»Ich weiß.«
»Ich mach das schon«, murmelte Ikki. »Meine Schuld.«
Bram fragte: »Was ist deine Schuld?«
»Dass sie sich Hoffnungen macht.«
»Was hast du ihr denn erzählt?«
»So gut wie nichts.«
»So gut wie nichts ist zu viel.«
»Gibt es wirklich keinen anderen Weg?« Ikki nahm den Fuß vom Gaspedal.
Bram wurde ärgerlich: »Herrgott noch mal, hör auf zu nerven! Fahr einfach!«
Ikki schüttelte den Kopf, gab aber wieder Gas.
Sie ließen die Altstadt hinter sich und näherten sich der Schleuse des Kontrollpostens. Die Mauer, die elektronischen Sensoren, die Kameras und die Durchgangsschleuse bedeuteten, dass die Juden de facto akzeptiert hatten, dass Jaffa nicht mehr ihnen gehörte. Bram und Ikki hatten dort keinen einzigen jüdischen Soldaten gesehen. Das Militär überwachte aus der Luft, und in dem Städtchen wimmelte es von Elektronik im Straßenpflaster, in Hausmauern und Dachrinnen, ja, manche behaupteten sogar, unter den Tüchern, in die sich die Frauen hüllten. Es war zu gefährlich, Mannschaften am Boden patrouillieren zu lassen.
Es war ein Uhr mittags. In der nächsten halben Stunde würden sich die Straßen Jaffas leeren und die Bewohner den Schatten ihrer Häuser aufsuchen.
Ikki setzte sich auf und umklammerte das Lenkrad, als könne er dadurch Spannung abbauen.
»Da ist überhaupt niemand am Kontrollposten«, sagte Bram, »niemand, der irgendetwas anrichten könnte. Was soll schon passieren?«
»Ein Tohuwabohu«, sagte Ikki, »ein schlimmes Tohuwabohu.«
»Das Gefühl hast du?«
»Ja, das Gefühl habe ich.«
»Aber bei Samir hat dich dein Gefühl getrogen?«
»Was soll die Häme?«
»Samir ist schuld daran, dass du dir jetzt in die Hosen machst. Hätte er nicht gelogen, müsstest du nicht durch diese Schleuse.«
»Vielleicht wusste er’s nicht.«
»Vor einer Minute wolltest du ihn dir doch noch vorknöpfen, oder?«
»Was hätte er davon gehabt, uns umsonst zu Johnny zu schicken?«
»Eine Handvoll Scheine vielleicht? Aber Samir hatte nicht damit gerechnet, dass Tarzan ehrlich sein würde. Ein ehrlicher Araber, Ikki, wir haben gerade einen ehrlichen Araber kennengelernt. Er heißt Tarzan und liebt Basketball.«
»Das wird Samir aber freuen.«
»Dieses Basketballspiel …«, sagte Bram. »Wie spät ist es jetzt in Houston?«
Ikki zuckte die Achseln. »Sieben Stunden Zeitunterschied?«
»Acht«, sagte Bram. »Dort ist also jetzt früher Morgen. Oder das Spiel wurde nicht live übertragen.«
»Na und?«
»Er sagte, er hätte Geld darauf gesetzt. Aber das Ergebnis stand längst fest. Es war eine Aufzeichnung. Tarzan hat eine Show abgezogen.«
»Na und?«, sagte Ikki noch einmal.
»Was hatte er davon? Warum musste er uns weismachen, er sei ein Zocker?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Ikki. »Du bist der größte Paranoiker, den ich kenne. Wann sagst du Saras Mutter Bescheid?«
»Nachher … Nein, nachher habe ich Schicht beim Rettungsdienst. Morgen. Ich gehe morgen zu ihr.«
»Sonst sagst du immer, dass die Eltern sofort …«
»Ja, sonst. Aber nicht jetzt. Ich gehe morgen, okay?«
Ikki trat auf die Bremse, und sie blieben ruckartig stehen. Das würde mit Sicherheit die Aufmerksamkeit der Soldaten am Grenzposten auf sie lenken. Die richteten jetzt dreihundert Panzerabwehrraketen auf den Wagen aus.
»Ich schaff das nicht«, sagte Ikki.
Bram verlor die Geduld und brüllte ihn an: »Verdammt noch mal, Mann! Stell dich nicht so an! Steig aus, ich fahre!«
Ikki nickte ergeben. Sie stiegen aus und tauschten die Sitze. Brams Handy läutete.
Ungeduldig fischte er es aus seiner Hosentasche. Das Display zeigte keine Nummer an. Er drückte auf die Freisprechtaste und hörte: »Professor?«
»Chaim?«
»Professor, ist irgendwas mit Ihrem Wagen?«
»Nein, nichts. Ich wollte nur mal ein Stück fahren. Hab noch nie einen Wagen gefahren, bei dem das Lenkrad rechts ist.«
»Nicht der ratsamste Ort für solche Einfälle, Professor.«
»Wir werden es nicht wieder tun, Chaim.«
»Ich schleuse Sie schnell durch.«
»Danke. Woher hast du meine Nummer?«
»Natürlich habe ich die. Ich sehe hier auf meinem Bildschirm auch, wann Sie heute Morgen den Hund rausgelassen haben. In welcher Zeit leben Sie denn, Professor?«
Bram hatte keine Ahnung, in welcher Zeit er lebte. Welche historische, technische, wissenschaftliche, moralische Zeit war jetzt eigentlich? Das Einzige, was er wusste, war, dass die Zeit der Sicherheit und Geborgenheit, die Zeit des felsenfesten Vertrauens darauf, dass das Morgen die ungetrübte Fortsetzung des Heute sein würde, eines Heute voller Ehrgeiz, Verantwortungsgefühl, Liebe, Wohlstand, dass diese Zeit vorbei war, schon seit langem.
Er antwortete: »In der vollendeten Vergangenheit, Chaim.«
ERSTER TEIL
Tel Aviv
Zwanzig Jahre früherApril 2004
1
Er hatte das Angebot abgelehnt. Die meisten Historiker auf der Welt wären an seiner Stelle vor Freude auf die Knie gesunken, aber Bram hatte nein gesagt. Niemand in seinem Umfeld wusste von dem Anerbieten, bis auf Rachel natürlich, und wenn er darauf eingegangen wäre, hätte es mit Sicherheit für öffentlichen Unmut gesorgt. So ganz einwandfrei war ein Wegzug aus Israel nie; jeder, der für längere Zeit wegging und den Windschatten eines westlichen Landes aufsuchte, zog sich die Verachtung der gesamten Nation zu. Doch in dieser Verachtung schwang nicht selten eine gehörige Portion Neid mit. Wer wollte nicht weg aus diesem Irrenhaus? Wer konnte in dem Dreck, der seit Jahrzehnten nicht nur aus den Gebieten, sondern aus der gesamten Region auf sie abgeschleudert wurde, noch frei atmen? Alle wollten weg, aber zugleich wollte niemand aufgeben und dem wundervollen Experiment, das dieses Land darstellte, den Todesstoß versetzen. Dies war Brams Land, dies waren sein Sand und seine Felsen, und mochte es vielleicht auch andere Orte auf der Welt geben, wo er um ein Uhr nachts entspannt unter einer alten Palme draußen in der süßen Stadtluft stehen konnte, er hatte nun mal hier Wurzeln geschlagen, hier seine Frau gefunden, hier ihr Kind gezeugt und hier seine Doktorarbeit verfasst, die ihn nicht nur zum Hochschullehrer gemacht, sondern ihm auch einen gewissen akademischen Ruhm eingebracht hatte.
An einer Kreuzung im Herzen des alten Tel Aviv wartete er darauf, dass in der Schneise zwischen den dicht an dicht hochgezogenen, nicht mehr als fünfstöckigen und um diese Zeit fast vollständig dunklen Gebäuden ein Taxi auftauchen würde. Er hatte zwar sein Handy bei sich und konnte auch die Taxizentrale anrufen, aber er fand es nicht unangenehm, nach einem schweißtreibenden Abend noch einen kleinen Bummel zu machen; er beschloss, zur Bograshov, einer der großen Durchgangsstraßen, zu laufen. Mit dem Zeigefinger der einen Hand hielt er das über die Schulter geworfene Jackett am Aufhänger fest, mit der anderen Hand schlenkerte er seine dicke, braune Aktentasche.
Die Sitzung, an der er gerade teilgenommen hatte, hatte sich doch länger hingezogen als versprochen, und so hatte er sich vor zwei Stunden, als sein Handy läutete und auf dem Display die erwartete amerikanische Nummer aufleuchtete, entschuldigt und den kleinen Saal verlassen, in dem sie seit acht Uhr beratschlagt hatten. Draußen auf dem kahlen Korridor, unter dem kalten Licht der Leuchtstoffröhren hatte er dann mit gedämpfter Stimme sein Gespräch mit dem Chef der Historiker in Princeton, Frederick Johanson, geführt.
Sie kannten sich von Kongressen und aus Beiträgen in Fachzeitschriften. Johanson war der amerikanische Nachfahre schwedischer Seeräuber, ein Hüne mit groben Pranken und großem, prähistorisch anmutendem Kopf (immer blaurot, durch zu viel Alkohol, hohen Blutdruck oder erbliche Vorbelastung?), mit albinoweißen Wimpern und dichtem, rotem Haarschopf. Johanson hatte am Nachmittag schon einmal angerufen, aber da war Brams Handy ausgeschaltet gewesen, weil er Vorlesung hatte. Als Bram später zurückgerufen hatte, war wiederum Johanson nicht erreichbar gewesen. Heute Abend nach elf hatte Bram ihm auf die Mailbox gesprochen. Der Zeitunterschied zur amerikanischen Ostküste betrug sieben Stunden.
Vor drei Wochen hatte Johanson ihm mitgeteilt, dass einer seiner Historiker emeritiert würde und er Bram die Professur garantieren könne, falls er sich bewarb. Bram hatte sich Bedenkzeit erbeten.
Bis Viertel nach sechs hatte Bram unterrichtet und danach in seinem Zimmer in der Universität den Unterricht für den nächsten Tag und die Sitzung ihrer Friedensgruppe vorbereitet. Als er dann im Café auf dem Campus eine Kleinigkeit gegessen hatte – das Schauspiel schien immer reichhaltiger und erlesener zu werden: prachtvolle Studentinnen mit wehenden Locken über schimmernden Schultern, in nabelfreien Shirts und kurzen Röcken, die ihre bildschönen Beine sehen ließen –, hatte er sich mit Rachel besprochen. Sie überlasse die Entscheidung ganz ihm, hatte sie gesagt, sie werde mit allem einverstanden sein, es gehe schließlich um ihn, nicht um sie. Bram hatte irgendetwas Undeutliches dagegen eingewandt. Darauf hatte sie gesagt: »Mach doch jetzt, was du am liebsten möchtest. Nimm dieses Angebot an. Das ist eine Ehre. Eine Chance. Dort ist es ruhig. Für Ben wird es gut sein.«
»Aber ist es gut für dich?«, hatte er gefragt. Eine rhetorische Frage, denn er wusste, was sie antworten würde.
»Für mich ist gut, was für dich gut ist.«
Johanson rief eine Minute nach elf an. Der Klingelton störte den Monolog Jitzchak Balins, der die Stunden in dem glutheißen Raum schweißfrei durchgestanden und nicht mal seinen Schlips abgelegt hatte – er war für seine extravaganten Krawatten bekannt. Über seine Lesebrille hinweg verfolgte er irritiert, wie Bram sein Telefon aus der Tasche zog. Balin war ein kleiner Mann von Anfang fünfzig mit vor Ernst und Pflichtbewusstsein grauem, gequältem Gesicht. Friedensstifter war seine Profession, und der widmete er sich mit Hingabe.
Bram machte eine linkische Gebärde Richtung Gang, murmelte eine Entschuldigung, erhob sich und zog die Tür hinter sich zu. Die Zukunft des Nahen Ostens überließ er für den Moment den sieben Männern und zwei Frauen – bis auf Balin allesamt in Hemdsärmeln oder dünnen Blusen und mit idealistischen Mienen, in denen keinerlei Enttäuschung oder gar Verzweiflung sichtbar werden durfte –, mit denen er zwei Stunden lang lauwarmes Wasser und bitteren Kaffee getrunken hatte, um die zähen Plätzchen runterzuspülen, die Sara Lippman, Balins Mutter, am Vormittag noch eigenhändig gebacken hatte. Aus Solidarität konnte keiner sie unangerührt stehen lassen. Solidarität war in ihren Kreisen ein Schlüsselbegriff.
In seinem holzgetäfelten Zimmer in Princeton, über das schon seit zwei Tagen winterliche Schauer hinwegzogen, fragte Johanson: »Hast du es dir überlegt?«
Auf dem kahlen Korridor antwortete Bram: »Ja.«
»Ist es jetzt zu spät für ein Gespräch? Soll ich morgen noch einmal anrufen?«
»Nein, nein, wir können reden«, sagte Bram, den Blick auf die Tür geheftet, da man ihn womöglich hörte.
»Hast du eine Entscheidung getroffen?«
»Ja, das habe ich.«
Johanson schwieg, um Bram Zeit zu geben, seine Antwort zu formulieren. Bram würde die Solidarität mit Jitzchak und Sara und Yuri und all den anderen, vielleicht sogar mit diesem ganzen Land, verletzen, wenn er jetzt sagte, dass er es machen würde. Aber er wollte weg. Mit achtzehn war er aus den Niederlanden nach Israel gekommen, weil er in einem Anflug von Boshaftigkeit beschlossen hatte, in Tel Aviv zu studieren – er glaubte, damit seinem Vater eins auswischen zu können –,war geblieben, war israelischer Staatsbürger geworden, hatte seinen Militärdienst in den Gebieten abgeleistet und gekämpft und mit seiner Einheit in Nablus einen Terroristen getötet, und nun, fünfzehn Jahre nach seiner Ankunft, wollte er weg. Aber wegzugehen war Verrat. Obwohl er sich vorgenommen hatte, jedes Jahr wiederzukommen, um seinen Reservedienst abzuleisten, denn seine Einheit durfte er nicht aufgeben; die Männer, die ihr Leben für ihn geben würden und für die er sein Leben geben würde, durften auf keinen Fall unter seinem Wegzug leiden. Er war der großen Worte und der großen Fragen müde. Er wollte nicht in Begriffen wie »sie geben ihr Leben für mich« denken. Er träumte davon, ein langweiliger Professor in einer langweiligen Kleinstadt zu sein. Stieß er dann mal auf den Terminus »Existenzrecht«, sollte der sich nach einer fernen historischen Abstraktion anhören und nicht nach virulenter Aktualität. Er war dreiunddreißig Jahre alt, aber erschöpft. Das kam nicht nur durch Ben, den Rachel in den vergangenen Monaten auch nachts hatte stillen müssen, sondern hatte vor allem mit der immer gleichen Leier zu tun, die er in den letzten drei Jahren mitmachen musste. Die zum Teil Balin zu verdankenden Berlin-Abkommen hatten rein gar nichts bewirkt. Einmal mehr hatten sie heute Abend mit großem Engagement Szenarien erörtert, wie man die Abkommen wieder ins öffentliche Bewusstsein rücken könnte, doch selbst Balin schien sich mit dem Status quo abgefunden zu haben.
Balin, der wie andere aus dem Kreis derer, die die Abkommen aushandelten, über ein weltweites Netzwerk verfügte und auf europäische Subventionen zurückgreifen konnte, hatte verbissen und manchmal auch verzweifelt mit den Palästinensern um jeden Punkt und jedes Komma gerungen – es gehe um die Abfassung von Dokumenten, die beweisen könnten, dass historische Kompromisse möglich seien, hatte er seinen Verhandlungspartnern immer wieder vor Augen gehalten. Sie waren somit zu Werke gegangen, als hätten sie den Segen der politischen Führung ihres Landes und als würden die Dokumente, die sie abfassten, anschließend mit präsidialem Siegel versehen werden. Und als sie bekanntgemacht hatten, was sie in jahrelanger Arbeit im Geheimen erreicht hatten, war es ihnen auch gelungen, die Aufmerksamkeit und Bewunderung der Weltpresse zu wecken.
Am ersten Dezember des vergangenen Jahres, also erst vor fünf Monaten, hatten sie in Berlin eine beeindruckende Show veranstaltet, die Bram zu Hause im Fernsehen bestaunt hatte. Richard Dreyfuss, der Schauspieler aus Der weiße Hai, hatte als Moderator fungiert. Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter und der ehemalige polnische Präsident Lech Walesa waren nach Berlin geflogen und hatten die Abkommen gerühmt und als historisch bewertet; Nelson Mandela hatte ein Video mit einer persönlichen Botschaft geschickt. Hunderte von Journalisten hatten der Friedensshow beigewohnt. Auch Bram hatte sich dem Rausch des Erfolgs nicht entziehen können.
Doch die Mehrheit der Israelis quittierte die Abkommen mit einem Schulterzucken, gar nicht mal feindselig, sondern eher mit gelangweiltem Wohlwollen: Dieser Balin wieder, dieser Expolitiker ohne Partei, ohne Basis, mittlerweile sogar noch ohne Frau (sie hatte ihn drei Monate zuvor wegen des Machos verlassen, mit dem sie seit zwei Jahren eine erfolgreiche Talkshow im Fernsehen machte), ohne Humor oder Relativierungsvermögen, aber mit europäischen Freunden, die so gern einen Palästinenserstaat hätten, notfalls eine Diktatur unter einem Terroristenführer.
Die Palästinenser interessierten die Abkommen genauso wenig.
»Ich kann morgen noch einmal anrufen, gar kein Problem«, sagte Johanson.
»Ist schon gut«, erwiderte Bram.
Er ging ans Ende des Korridors. Das Hallen seiner Schritte auf den Fliesen konnten sie drinnen hören.
Johanson fragte: »Um welche Uhrzeit soll ich anrufen?«
»Nein, ich meine: Wir können jetzt reden.«
»Dann rede«, sagte Johanson.
»Okay.«
»Geht es in Ordnung?«, fragte Johanson erwartungsvoll.
»Nein«, sagte Bram, »nein, meine Antwort ist nein. Nein, ich mache es nicht.«
»Höre ich richtig?« Jetzt klang Johanson erstaunt.
»Ja, du hörst richtig.«
Bram drehte sich zur Wand, die im Neonlicht blau aufschimmerte, mit dem Rücken zur zehn Meter entfernten Tür, und flüsterte: »Ich kann nicht von hier weg. Mein Sohn ist gerade erst hier auf die Welt gekommen.«
»Das ist sehr schade«, sagte der schwedische Hüne. »Aber ehrlich gesagt: Ich hatte nichts anderes erwartet.«
Die Enttäuschung in seiner Stimme verriet, dass er es eben nicht erwartet hatte.
»Trotzdem«, fuhr Johanson fort, »kann ich dich nicht doch noch überreden?«
Er erzählte, dass er einen Rundruf gemacht habe und ihm gegebenenfalls die Unterstützung der Mehrheit des Fakultätsrats für Brams Ernennung zugesagt worden sei. Die Bewerbungsfrist ende in einer Woche.
Bram starrte den leeren Gang hinunter, auf die schlichten Bodenfliesen, die Leuchtstoffröhren an der Decke, alles puritanisch und funktional, um die Kosten niedrig zu halten und zu unterstreichen, dass Ornamente überflüssig waren. Das Gebäude stand im Herzen des Bauhausviertels, der Wiege Tel Avivs, der Traumstadt deutscher Juden, die mit Jugendstil und Barock aufgewachsen waren, aber auf ihre Flucht nichts als modernistische Strenge mitgenommen hatten. Ästhetik um der Ästhetik willen war nur Ballast. Hinter der Tür warteten Balin, die alte Sara und die anderen auf das Ende seines Telefonats. Er hatte bei der Universität sechs Monate Kündigungsfrist, könnte also im September abreisen. In acht Monaten würde er dann mit Ben im Garten hinter ihrem Haus in Princeton einen Schneemann bauen. Er stellte sich ein Holzhaus mit Veranda und Doppelgarage vor, einen Allradwagen auf der Auffahrt, einen roten oder grünen Briefkasten auf einem Pfahl an der Straße. Er sah die Dachlawinen aus vereistem Schnee von den Häusern rutschen und auf den gefrorenen Büschen zerbersten. Zwischen den Vogelspuren im Schnee lagen Reste von den Erdnüssen, die Ben im Futterhäuschen hinter einer der Weißfichten für die hungrigen Vögel auslegte. Bram würde seine Studenten zurücklassen, seine Kollegen, seinen Vater, der in diesem Jahr vierundsiebzig wurde. Gleich würde er in den Raum zurückgehen und sich wieder am Gespräch über die Zukunft dieses Landes beteiligen. Schicksalsverbundenheit, das war es, was er mit denen da drinnen und der großen Abstraktion, die dieses Land war, teilte. Das konnte er nicht einfach abstreifen, auch wenn er wollte.
»Es tut mir leid«, sagte Bram zu dem Mann, der in seinem amerikanischen Lederdrehsessel vor dem Mahagonibücherschrank saß und durch die hohen Fenster auf den Regen und die knospenden Bäume im Park vor seinem Büro starrte – einem Raum, der aufwendiger war als das Amtszimmer des israelischen Premiers. »Ich würde schon gern … Vielleicht in ein paar Jahren, Frederick … Ich … Es ist ein unheimlich schönes Angebot, ein Jugendtraum. Aber es geht nicht. Sorry.«
»Schade. Falls du es dir bis Montag noch anders überlegen solltest, du hast ja meine Nummer. Einige meiner Kollegen haben noch einen anderen Israeli im Auge, aber ich hätte lieber dich. Mach’s gut, Abe.«
Einen anderen Israeli. Bram war neugierig, wen er wohl meinte, aber es war ausgeschlossen, nach dem Namen zu fragen, und Johanson würde ihn auch niemals verraten.
»Du auch, mach’s gut.«
Es sollte noch zwei Stunden dauern, bis Bram das Gebäude verlassen konnte. Sie verabschiedeten sich vor der Tür, und Bram ging die Straße hinunter und hoffte einige Minuten lang auf ein zufällig vorüberkommendes Taxi. Danach lief er durch die schlecht erleuchtete Straße Richtung Rothschild Boulevard, vorbei an den dunklen Wohnblocks, den ungepflegten Vorgärtchen und vergitterten Schaufenstern, den dicht hintereinander und nah an der Bordsteinkante geparkten staubigen und zerbeulten japanischen Autos, und dabei beschlich ihn ein schreckliches Bedauern über seine Absage. Er erwog, Frederick gleich anzurufen und ihm zu sagen, dass er es sich anders überlegt habe und die Stelle annehmen werde – eine Professur in Princeton, er war ja verrückt, das auszuschlagen, wegen etwas so Ungreifbarem wie einem Land, einem Volk. Er blieb stehen, stellte die Tasche vor seinen Füßen ab und tastete sein Jackett nach seinem Handy ab, während er aus dem Augenwinkel drei junge Männer wahrnahm, die plötzlich aus einer Gasse zwischen zwei Gebäuden aufgetaucht waren. Kein Grund zur Beunruhigung; das hier war nicht downtown Detroit.
Das Telefon in der Hand, fragte er sich, ob es nicht lächerlich war, jetzt gleich anzurufen. Und wollte er das wirklich? Morgen früh würde er bestimmt wieder anders darüber denken. Verzweifelt blieb er auf der Stelle stehen und schaute auf, weil er das Gefühl hatte, beobachtet zu werden.
Die drei jungen Männer waren stehen geblieben. Trotz der Dunkelheit sah er, dass sie keine achtzehn waren. Also noch nicht wehrpflichtig. Bevor er sich des vertrauten und ein wenig beschämenden Denkreflexes – nämlich der Frage: Araber oder sephardische Juden? – bewusst geworden war, machten alle drei eine schnelle, eckige Bewegung mit den Armen und ließen, als hätten sie das vor dem Spiegel geübt, im selben Moment drei schlanke Klingen aus ihren Fäusten hervorschnellen. Springmesser, die blitzend das spärliche Licht dieser Straße einfingen.
Bram verstand nicht, was das zu bedeuten hatte, denn die Messer konnten unmöglich ihm gelten, und er sah die Jungen – Turnschuhe, weite Trainingshosen und T-Shirts –, die etwa vier Meter von ihm entfernt den schmalen Gehweg versperrten, verwundert an, griff zu seiner Aktentasche und schob sich seitlich zwischen zwei parkenden Autos hindurch auf die Straße.
Gelenkig sprang einer der Jungen auf die Motorhaube eines geparkten Lieferwagens und von dort auf die Straße – die akrobatische Eleganz erinnerte Bram an moderne chinesische Kung-Fu-Filme –, um sich drohend vor Bram aufzubauen, mitten auf der Fahrbahn jetzt. Unwillkürlich drückte sich Bram Schutz suchend an das hohe Seitenteil des Lieferwagens, während sich die beiden anderen Jungen zu ihrem Kumpan gesellten. Sie waren jung, nervös, übermütig. Araber, chancenlose junge Männer aus Jaffa, mit hübschen Gesichtern ohne eine Spur von Akne, mit fast mädchenhaften, mandelförmigen Augen und Körpern, die sie zu geschmeidigen Kampfmaschinen geschliffen hatten, denn sie waren arbeitslos und unterstützungsberechtigt und hatten alle Zeit der Welt, tagaus, tagein in einem Fitnessstudio zu trainieren. Sie sahen sich ähnlich, junge Männer mit Gesichtern wie Filmstars, mit regelmäßigen Zähnen, orientalisch geschnittenen Nasen, elegant geschwungenen Augenbrauen. Sie sind miteinander verwandt, dachte Bram, Vettern, Angehörige eines gekränkten Familienclans. Sie bewegten sich einen Schritt in seine Richtung, womit sie ihm ein Entkommen vereitelten, und nahmen eine Haltung ein – Beine gespreizt und die Knie leicht gebeugt, die Hand mit dem Messer in Augenhöhe, als wären sie geübte Messerhelden –, die ein schnelles Agieren mit den Messern ermöglichte.
Bram spürte das Blech des Lieferwagens im Rücken und konnte nicht weiter zurück. Wenn es gegangen wäre, hätte er sich hineingepresst. Er umklammerte den Griff seiner Aktentasche. Und mit der anderen Hand, in der er noch immer sein Telefon hielt, presste er sein Jackett an sich, um sich weniger verletzlich zu fühlen. Er war größer als sie und vermutlich stärker als jeder Einzelne von ihnen, aber sie waren zu dritt und hatten Messer.
»Geld«, war das stumpfsinnige Wort, das der Mittlere von den dreien ausstieß.
Bram hörte es an seinem Akzent: Araber. Der Junge hatte einen flaumigen Schnurrbart. Seine Augen waren vor Spannung geweitet – oder waren Drogen im Spiel? Er schien etwas älter zu sein als die beiden anderen, zwanzig vielleicht. Bram als moderner, progressiver Israeli, der Verständnis für die jungen israelischen Araber hatte, die unter schwierigen sozioökonomischen Bedingungen aufwachsen mussten, wollte ihn nicht hassen. Die Jungs hatten ja keine Ahnung, was er heute Abend gemacht hatte. Er musste es ihnen erklären.
»Ich möchte euch etwas erzählen«, sagte er mit beherrschter Stimme zu dem mittleren Jungen. Er hatte Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen. Es kam zwar immer wieder vor, dass er nervös war, wenn er einen Hörsaal betrat, aber er hatte gelernt, seine Stimme dagegen abzuschirmen.
»Don’t fuck with us«, zischte der Junge ihm zu, plötzlich wilden Hass in den Augen. Er war offenbar ein Rap-Fan. »Gib deine Tasche her.«
Er streckte seine freie Hand danach aus, aber Bram schob die Tasche zwischen den Wagen und seine Beine.
»Ich gebe euch Geld, aber meine Tasche … Darin ist meine Arbeit … Zwei Jahre Arbeit über …«
Er zögerte. Es war die Fortsetzung seiner Untersuchung über die Flucht und Vertreibung der Palästinenser. Sie belegte, dass man die Vorfahren dieser Jungen ungerecht behandelt hatte. Er hatte zwar nur einen Ausdruck bei sich, aber darin standen unzählige handschriftliche Notizen, die er im Laufe eines Jahres gemacht hatte.
»Wenn du die Tasche nicht rausrückst, schlitzen wir dich auf, willst du das?«