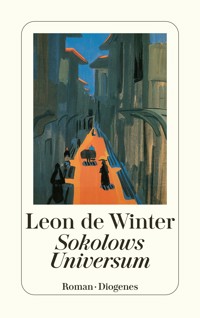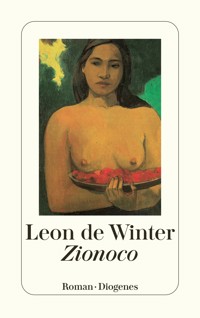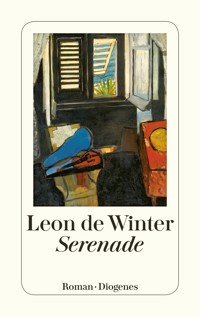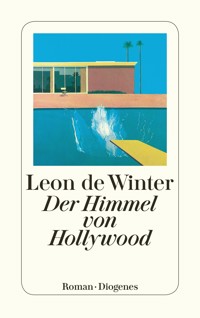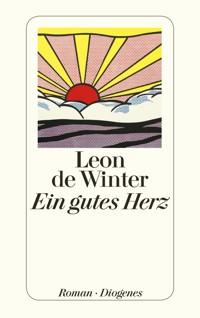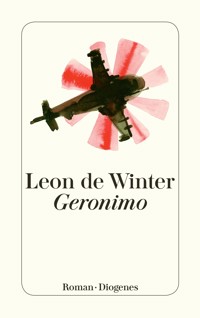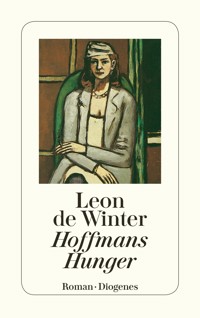
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer spannenden Spionage-Geschichte kreuzen sich die Schicksale dreier Männer: Felix Hoffman, niederländischer Botschafter in Prag, der seinen leiblichen und metaphysischen Hunger mit Essen und Spinoza stillt, Freddy Mancini, Zeuge einer Entführung, John Marks, amerikanischer Ostblockspezialist. Zugleich die Geschichte von Europa 1989, das sich eint und berauscht im Konsum. Ein Rausch, der nur in einem Kater enden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Leon de Winter
Hoffmans Hunger
Roman
Aus dem Niederländischen von Sibylle Mulot
Diogenes
Die Nacht des 21. Juni 1989
Freddy Mancini hatte beim Ungarn vier Steaks verdrückt, aber er hatte Hunger, als er über den Flur zu seinem Hotelzimmer trottete. Es war warm in Europa. Freddys gewaltiger Bauch hing schwer unter seiner schwitzenden Brust, die maßgefertigten Jeans spannten über seinem fetten Hintern. Seine Frau Bobby ging leichtfüßig neben ihm her. Sie machte ihm Vorwürfe, daß er heute abend seine Diät verhunzt habe.
»Verhunzt hast du sie, Freddy! Lernst du’s denn nie? Die letzten Tage hast du dich so schön dran gehalten – und nun? Du lernst es wirklich nie.«
In seinem Magen fühlte Freddy ein brennendes Schamgefühl, aber auch der Hunger bohrte weiter – Hunger nach Erfüllung und immerwährender Befriedigung. Er hatte mal gelesen, daß ein besonderer Magennerv das Hungergebiet im Gehirn kitzelte. So erklärten es sich die Rationalisten und Optimisten.
Die Diätassistentin zu Hause in San Diego hatte ihm vor ein paar Monaten etwas anderes gesagt.
»Wie lange kommst du jetzt schon zu mir, Freddy? Drei Jahre?«
»Dreieinhalb. Beinahe vier.«
»Was, schon so lange?«
»Was wolltest du sagen, Sandy?«
»Jedes Pfündchen geht durchs Mündchen, das kennst du ja, aber bei den meisten ist es auch etwas im Gehirn, was sie dick macht. Nur bei dir, Freddy, bei dir sitzt es ausschließlich im Gehirn. Bei dir ist Hunger ein mentales Problem.«
Das hatte damals wie eine Zauberformel geklungen, und er hatte einfältig dazu genickt. Dann hatte er sich hinter das Steuer seines Chrysler New Yorker gezwängt und sich auf dem Weg zu seinem Büro, von dem aus er seine zwölf Waschsalons regierte, gefragt, was eigentlich den Hunger in seinem Kopf verursachte. Die Klimaanlage hatte kühle Luft an seine verschwitzten Wangen geblasen. Er war erfolgreich und liebte Bobby; sie hatten drei wohlgeratene Kinder großgezogen, die gut verheiratet waren und ihrerseits Familien gegründet hatten; sie wohnten in einem schönen Haus mit Schwimmbad, fuhren einen Chrysler, einen Dodge und einen Jeep Cherokee; er war ein guter Amerikaner, zahlte Steuern und wählte die Republikaner, aber er hatte diesen Makel: Er wog dreihundertfünfzig amerikanische Pfund. Alles, was er aß, schlug direkt an. Und nun, in seinem Chrysler, den Blick starr auf die Straße gerichtet, die unter der glühenden kalifornischen Sonne vibrierte, die Worte seiner Diätassistentin noch im Ohr, war ihm plötzlich klargeworden, daß er unglücklich war. Dieser Gedanke machte ihn ganz wirr. Er fuhr auf den Parkplatz eines Supermarktes und starrte dort minutenlang vor sich hin. »Ich bin nicht glücklich«, murmelte er entsetzt. Er hatte alles und war nicht glücklich. Sofort meldete sich sein Schuldbewußtsein: wie konnte er nicht glücklich sein. Bobby! Es würde ihr einen Schlag versetzen, wenn er ihr beim Nachhausekommen erzählte, daß irgend etwas fehlte. Er liebte sie nicht mehr. Nein, Unsinn, natürlich liebte er sie noch, genauso wie die Kinder, die Waschsalons, die Autos, das Haus und die zwei Katzen, aber irgend etwas fehlte. Du lieber Himmel, was war das nur?
Es war ihm vorher nie aufgefallen, daß die Dinge so kompliziert waren. Er wußte nicht, was ihm fehlte. Und das war der Grund für seinen Hunger, schloß er mit deprimierender Klarheit.
Unwillkürlich tastete seine Hand nach dem Zündschlüssel, aber er fuhr nicht los. Durch die Schaufenster des Supermarktes schimmerten Regale mit Lebensmitteln. Er hatte einen beißenden Hunger. Er kämpfte sich aus dem Auto und ging in den Laden. Dort kaufte er einen ganzen Arm voller Tüten, Beutel, Riegel. Im Auto schlang er alles hinunter. Auf dem Beifahrersitz türmte sich das Verpackungsmaterial.
Freddy Mancini begriff an diesem Tag, daß von nun an alles anders sein würde. Äußerlich war ihm nichts anzumerken, aber in seinem Kopf hatte eine Umwälzung stattgefunden, eine Revolution wie in Kuba, und er würde bis an sein Lebensende in einsamer Stille das Gefühl haben, er sei eine unglückliche und tragische Figur, die alles besaß und doch zu kurz gekommen war. Er hatte im kühlen Auto angefangen zu zittern, sein Gesicht in eine offene Tüte gedrückt und Tränen auf die salzigen Chips fallen lassen.
Bobby öffnete die Zimmertür im Hotel International in Prag. Freddy folgte ihr. Die Mauern strahlten noch die Hitze des Tages aus. Vier Schwangerschaften hatten Bobbys Körper nichts anhaben können. Sie hatte die Figur einer Achtzehnjährigen. Ihre Haut war natürlich älter geworden, aber wenn sie am Strand entlangging, warfen die Knaben noch immer lüsterne Blicke auf ihren Busen und ihren Hintern. Sie schwor ihm, daß er die vier Steaks morgen zu büßen hätte.
»Und außerdem war das Zeug kaum zu fressen!« rief sie verzweifelt, »das sollen Steaks gewesen sein? Lederlappen, die wir nicht mal einem Hund vorsetzen würden! Und du stürzt dich mit einer Gier drauf, als hättest du jahrelang vor lauter Armut Fleisch nur im Schaufenster gesehen! Herrgott, Freddy, du mußt abnehmen, Sandy und Doktor Friedman haben dir doch gesagt, daß du bis zum nächsten Wochenende zwei Kilo runter haben mußt. Lächerliche zwei Kilo! Und was tust du? Du nimmst zwei Kilo zu! Wenn du morgen wagst, überhaupt etwas zu essen, dann schlag ich es dir persönlich aus dem Mund. Zu deinem eigenen Besten.«
»Ich hatte Hunger«, sagte er. »Weil ich das Mittagessen übersprungen habe.«
»Menschenskind! Jetzt gehst du schon hundert Jahre zu Sandy und hältst dich noch immer nicht an die Regeln! Wie oft muß ich es dir noch sagen? Tausendmal? Hunderttausendmal? Du sollst ja zu Mittag essen, aber was Leichtes. Und abends ganz normal. Ohne dich derart vollzustopfen. Willst du vielleicht mit neunundvierzig sterben?«
Ja, antwortete er still für sich.
Sie ging ins Bad, und Freddy ließ sich in einen Stuhl sacken. Das Holz ächzte, als er seinen Hintern zwischen die Armlehnen quetschte. Die Kacheln im Bad gaben Bobbys Stimme einen metallischen Klang. Er hörte nicht zu.
Sie hatte ihn auf diese Reise mitgeschleppt, vier Wochen, die ihn ein Vermögen kosteten. Sandy und Doktor Friedman hatten ihm dazu geraten, sie meinten, er würde wahrscheinlich leichter abnehmen, wenn er seine festen Gewohnheiten durchbrach, und Bobby hatte für sie beide diese Gruppenreise gebucht.
Er wußte nicht mehr, in wie vielen Hotels sie schon übernachtet hatten. Heute früh waren sie mit einem klimatisierten Bus mit Bar und WC aus Wien abgefahren, fünf Stunden hatte die Fahrt gedauert. Eine Stunde hatten sie an der Grenze gewartet, während der Bus von ein paar finsteren Männern mit Maschinengewehren gefilzt wurde. In Prag waren sie zunächst im Hotel International abgestiegen und hatten dann eine Stadtrundfahrt gemacht, über die Burg mit ihren Kirchen und Palästen, wo die Regierung ihren Sitz hat, und dann an einem Fluß mit allen möglichen Gebäuden entlang, die er schon wieder vergessen hatte.
Ihr Hotel war ein pompöser Kasten in einem Stil, den man laut Auskunft des österreichischen Reiseführers im Westen den »stalinistischen Zuckerbäckerstil« nannte. Die Eingangshalle war riesig, mit breiten Pfeilern und einer ausladenden Rezeption. Auf dem Marmorfußboden lagen abgetretene Teppiche, die Sitzecken bestanden aus klobigen Möbeln, überall hing dieser penetrante Geruch nach verkochtem Kohl, und obwohl das Gebäude mit seinen breiten Fluren einen anderen Eindruck machte, waren die Zimmer erdrückend klein. Es war eben kein Hilton, nicht einmal ein Ramada Inn oder ein Howard Johnson. Ihr Bus war bequemer.
Im Bett neben ihm atmete Bobby gleichmäßig und ruhig. Der Hunger stach wie ein Bajonett in seinen Magen und schnitt ihm in Herz und Kehle. Der Schlaf konnte ihn davon nicht erlösen. Er hörte, wie die Luft durch seine Nasenlöcher pfiff. Seine fette Brust keuchte auf und ab. Er veränderte seine Lage und richtete sich mühsam auf, zog alle Fettringe und Wülste mit sich hoch. Die Matratze ächzte, als er sich erschöpft und nach Luft ringend wieder fallen ließ. Das Laken klebte an seiner Haut.
Bobby ließ sich nachts von seinem Geschnaufe schon lange nicht mehr aus ihren Träumen reißen. Nach harten Jahren der Gewöhnung an all seine Geräusche war es allein der Wecker von Bell & Howell, der sie mit seinem Gerassel aus dem fernen Land zurückholen konnte, in das sie entschwand, sobald sie das Leselämpchen ausgeknipst hatte. Das Ding hatten sie aus San Diego mitgeschleppt, ohne daran zu denken, daß die hochnäsigen Europäer zwar schon seit Jahren ihr vereinigtes Europa hätschelten, aber noch nicht imstande gewesen waren, einen einheitlichen Stecker und eine einheitliche Voltzahl einzuführen.
Freddy versuchte sich zu erinnern, vor wieviel Jahren sie zum letzten Mal miteinander geschlafen hatten. Nach der Fehlgeburt war es eigentlich schon vorbei gewesen, und als Bobby mit ihrem letzten Kind schwanger war, hatte sie den Hahn endgültig zugedreht. Damals ging Freddy in die Breite. Er begriff, daß ein Zusammenhang bestand zwischen dem völligen Mangel an Sex und seinem Umfang, aber man konnte natürlich nicht einfach davon ausgehen, daß er sein Normalgewicht zurückbekam, wenn er wieder wöchentlich mit Bobby schlief. Abgesehen davon, daß er physisch dazu gar nicht mehr imstande war, wie er selbst merkte.
Magensäure stieg ihm in den Hals, er schluckte. Sie hatten in einem ungarischen Restaurant zu Abend gegessen, in der Nähe vom Vaclavské Namesti, dem Platz in der Stadtmitte. Fast jeder hatte den grauen Lappen, der auf der Speisekarte als »first class sirloin steak with gypsy sauce« umschrieben wurde, liegengelassen, nur Freddy hatte gleich drei weitere von seinen Nachbarn mitgegessen. Manche hatten sich gegen die Qualitäten der kommunistischen Küche gewappnet und zauberten Hershey-Schokoriegel und Mars-Familienpackungen aus ihren Nylon-Hüfttaschen, ein Autohändler aus Wisconsin, ein gewisser Browning, schwor sogar, im Hotel bekäme man Hamburger mit Ketchup.
Mühsam stieg er aus dem Bett. Bobby atmete friedlich. Sie streifte durch Länder, die er nie betreten würde. Nach dieser Reise würde er für immer in Amerika bleiben. Natürlich fand er es interessant, all die alten Städte und die Geschichte und Tradition und so, aber er fühlte sich hier verloren. Die Tschechoslowakei war ein Entwicklungsland.
So leise wie möglich zog er sich an. In der Stille des Hotels hörte er seinen eigenen keuchenden Atem. Auf jede Bewegung folgte ein schwerer Atemstoß, als hätte er eine Dampfmaschine in der Lunge. Er verließ das Zimmer.
Am Gangende saß ein alter Mann unter einer trüben Funzel und las. Er schaute auf, als er Freddy hörte. Freddy sah den Unglauben in seinen Augen und ging schweigend zum Lift. Irgend jemand aus der Reisegruppe hatte erklärt, daß alle Etagen rund um die Uhr bewacht würden, weniger, um die Gäste vor ungebetenem Besuch zu schützen, als um die eigenen Leute fernzuhalten. Ohne Spezialausweis kam man hier als Tscheche nicht über die Schwelle. Die Hotelhalle war leer. Freddy schleppte sich über den abgetretenen Teppich zur Rezeption. Er sah in der Nähe der Drehtüren zwei Männer in Sesseln herumlungern. Sicherheitskräfte, hatte der Reiseführer gewispert. Er fühlte, wie sich ihre Blicke in seinen Körper bohrten. Nicht ein einziges Kleidungsstück bot ihm Schutz. Er war immer nackt.
An der Rezeption war niemand zu sehen. Es gab auch keine Klingel, um sich bemerkbar zu machen. Er hielt sich am schwarzen Marmortresen fest und wartete. In amerikanischen Hotels hörte man immer Musik, er hatte sich oft gefragt, warum. Jetzt begriff er, wie schwer die Einsamkeit in einem totenstillen Gebäude auszuhalten war. Von fern drangen aus dem Inneren des Hotels ein paar matte Geräusche. Aber sonst kein Straßenlärm, kein Türquietschen, das sein verzweifeltes Schnaufen übertönt hätte.
Zu Hause in San Diego hatte er seine Bewegungen und Unternehmungen auf das Notwendigste beschränkt. Er mußte abnehmen, weil er sonst keine fünf Jahre mehr zu leben hatte, aber der Hunger war eine Qual, saß wie ein toller Hund in seinem Magen und fraß wild um sich. Er war unglücklich, und dieses Gefühl, das wußte er nun, zeichnete sich aus durch das Fehlen von Hoffnung. Sein unstillbares Verlangen nach dem Zustand vollkommener Sättigung trug einen Flor untröstlicher Trauer.
Er wurde ungeduldig. Rief etwas. Erschrak vor den schrillen Tönen, die aus seinem Mund in die Halle drangen. Er hörte, wie die Männer sich hinter ihm aufrichteten. Und in der Türöffnung hinter dem Tresen erschien ein Mann in seinem Alter, so um die fünfzig, in zerknittertem Anzug und mit ganz kleinen Augen. Er hatte ein Nickerchen gemacht.
»Sie wünschen?« fragte er ohne eine Spur von Freundlichkeit. Er musterte Freddy von oben bis unten.
»Meine Frau hat Hunger, ich wollte wissen, ob sie noch etwas zu essen bekommen kann.«
»Alles ist zu«, sagte der Mann sofort und drehte sich entschlossen wieder um.
»Gibt’s hier denn keinen Sandwich oder so was? Kaltes Huhn? Oder einen Hamburger? Meine Frau ist schwanger, sie hat Hunger. Ich habe gehört, es gibt hier Hamburger.« Der Mann blieb stehen und sah ihn an.
»Das Restaurant schließt um neun.«
»Und danach?«
»Danach gibt’s nichts mehr.«
»Und wenn hier nachts Reisegruppen ankommen? Die müssen doch auch etwas essen?«
»Die kommen nicht nachts an.«
»Könnte aber vorkommen.«
»Kommt nicht vor.«
»Nein?«
»Nein«, sagte der Mann. Seine Stimme klang gereizt.
»Sie muß aber was essen, sonst wird sie krank.«
Der Mann seufzte und schaute kurz zu den zwei Männern an der Tür.
»Es gäbe da vielleicht eine Lösung, aber einfach ist das nicht.«
Freddy nickte. Er zwängte eine Hand in die Hosentasche, zog einen Fünfdollarschein heraus und legte ihn auf den Tresen. Mit der Geschwindigkeit des erfahrenen Empfangschefs legte der Mann eine Hand auf den Schein.
»Restaurant Slavia«, sagte er. Er schob den Schein zu sich heran und schloß die Faust darum. »Ein Seitensträßchen von der Francouzska. Ladovagasse Nummer dreiundsechzig. Dreimal klingeln. Privatrestaurant. Ganze Nacht geöffnet.«
»Wie kommen wir da hin?« fragte Freddy flehentlich.
»Das ist Ihre Sache«, sagte der Mann.
Er verschwand hinter der Tür.
Vorsichtig drehte sich Freddy um, er hatte Angst, das Gleichgewicht zu verlieren, und das mußte er verhindern, denn sein Körper kam nicht mehr in die Senkrechte, wenn er der Schwerkraft einmal nachgegeben hatte; er schlurfte auf die Drehtüren zu. Einer der Männer erhob sich. Sie waren beide Ende Zwanzig, beide im Trainingsanzug. Der Mann hielt ihn mit einer Handbewegung zurück.
»Papiere«, sagte er.
Freddy schnappte nach Luft. »Warum?«
»Polizei.«
»So sehen Sie aber gar nicht aus.«
»Den Ausweis«, fluchte der Mann. Freddy zerrte das Ding aus der Brusttasche.
Ungeduldig nahm ihm der Mann das Dokument aus der Hand und verglich das Foto mit dem Original. Untersuchte das eingestempelte Visum.
»Es ist zwei Uhr nachts«, sagte er. »Was haben Sie so spät noch vor?«
»Das ist doch meine Sache.«
»Was wollen Sie um diese Zeit noch tun?«
»Also hören Sie mal, niemanden auf der Welt geht das auch nur das geringste …«
»Wenn Sie nicht antworten, verhafte ich Sie wegen Informationsverweigerung.«
Freddy schluckte und warf einen Blick auf den anderen Mann, der sich um eine mögliche Verhaftung nicht zu kümmern schien und sich in aller Ruhe eine amerikanische Zigarette anzündete, eine Marlboro.
»Meine Frau hat Hunger«, erklärte Freddy.
Der Mann sah ihn scharf an. Dann warf er einen Blick über die Schulter zu seinem Kollegen und sagte etwas auf tschechisch; es klang fragend, als ob er sagte: »Weißt du, was der will, der Dicke?« Der Mann im Sessel schüttelte den Kopf, ließ das Feuerzeug aufflammen. Der erste Mann sagte noch etwas, worauf der andere anfing zu lachen, der Rauch quoll in kurzen Stößen aus seinem Mund.
»Alles ist zu«, rief der Mann aus seinem Sessel. Der Rauch quoll weiter aus seinem Mund wie indianische Rauchzeichen. »Sie müssen bis zum Frühstück warten.«
»So lange hält es meine Frau nicht aus.«
»Wir sind nicht in New York. Hier gehen die Leute früh ins Bett. Sie müssen arbeiten.«
»Wenn Sie mir meinen Paß zurückgeben, kann ich selber nachsehen, ob hier alle schon schlafen.«
Der Mann vor ihm wedelte mit seinem Paß. Der andere hatte sich wieder aus der Unterhaltung zurückgezogen.
»Ich finde Sie ziemlich respektlos.«
»Sie wird krank, wenn sie nicht schnell was zu essen bekommt.«
»Ein Grund mehr, vorsichtig zu sein.«
»Was glauben Sie, was ich nachts hier tue? Was soll man in dieser Stadt tun? Was unterstellen Sie mir?«
»Es ist unsere Aufgabe, die Sicherheit der Touristen zu überwachen. Ich muß Ihnen abraten, um diese Uhrzeit in die Stadt zu gehen.«
»Ich nehme ein Taxi.«
»Haben Sie denn eine Adresse?«
»Wir fahren herum, und dann werden wir schon was finden.«
»Es treiben sich auch Leute herum, die ein antisozialistisches Verhalten zeigen.«
»Was ist denn das?«
»Die sind scharf auf Ihr Geld.«
Freddy schaute ihn mit großen Augen an. »Aber in einem Taxi bin ich doch sicher?«
»Soviel wir wissen, ja.«
»Was ist denn das für ein Land? Überall Polizei, und dann noch unsichere Straßen!«
»Noch so eine Beleidigung, und ich nehme Sie fest.«
»Bitte, kann ich dann gehen? Was soll jemand wie ich hier schon tun?«
»Vielleicht haben Sie Kontakte mit antisozialistischen Elementen.«
»Ich?«
»Ja, Sie. Warum gehen Sie denn sonst ausgerechnet jetzt nach draußen! Glauben Sie etwa, wir schlucken das so einfach, daß Ihre Frau Hunger hat? Warum erzählen Sie uns nicht die Wahrheit? Wir können Sie festnehmen und so lange festhalten, bis Sie uns erzählen, warum Sie um zwei Uhr nachts auf die Straße wollen.«
»Weil ich Hunger habe! Okay, ich gebe es zu! Hunger! Sehen Sie denn nicht, wie schwer ich bin? Ich muß was in den Magen kriegen, wissen Sie, ich konnte vor lauter Hunger nicht schlafen, und da dachte ich, ich gehe einfach runter und frage, ob ich noch etwas bestellen kann, aber …«
Seine Augen füllten sich mit Tränen. Der Hund in seinem Magen hatte sich festgebissen. Das Vieh versuchte jetzt, ihm ein Loch ins Zwerchfell zu beißen, damit es seine Kiefer in Freddys fettes Herz schlagen konnte. Der Schmerz kroch die Speiseröhre hinauf bis in seinen Hals. Er keuchte die ganze Zeit, seine Lungen waren zu klein, um seinen Riesenleib mit Sauerstoff zu versorgen.
Der Mann im Sessel sagte etwas, ohne aufzuschauen, und konzentrierte sich auf die Rauchwölkchen, die aus seinem Mund kamen. Er sprach die tschechischen Worte tonlos, wie einen Befehl. Der Mann, der Freddy befragt hatte, sah sich unterwürfig nach ihm um.
Freddy schlug die Augen nieder und versuchte zu retten, was zu retten war.
»Ich kann schlecht erklären, was Hunger für mich bedeutet. Die meisten Leute verstehen es nicht.«
Vor seinem Bauch tauchte sein Paß auf.
»Sie können gehen.«
»Ja?«
Der Mann machte eine ungeduldige Bewegung mit dem Paß. Freddy nahm sein Dokument und nickte.
»Vielen Dank. Ich bin wirklich kein …«
Der Mann hatte sich schon umgedreht und ging wieder zu seinem Sessel.
Freddy betrachtete das Heftchen zwischen seinen dicken Fingern. Seine unbezähmbare Gier nach Nahrung hatte beinahe zu einer Festnahme und zum Aufenthalt in einem kommunistischen Gefängnis geführt. Aber er mußte eben alle Probleme, die diese Hungertour mit sich brachte, blind akzeptieren. Er war schwach: der Sklave seines Magens.
Er ging nicht durch die Drehtür, weil er bei seiner Ankunft am eigenen Leib erfahren hatte, daß die einzelnen Abteile nicht für Lebewesen seines Kalibers berechnet waren. In einer Scheibe fing er sein Spiegelbild auf. Ein Riesenbaby, das gerade laufen gelernt hatte. Durch die Seitentür verließ er das Gebäude und trat in die laue Nacht.
Es war warm. Die kräftige Luft draußen roch nach Öl, Staub und Gras. Der Platz vor dem Hotel lag verlassen unter dem Sternenhimmel, nur ein einziges Auto stand direkt vor der Tür, ein eckiges Modell, dessen Rücksitz hoffentlich breit genug für ihn war. Freddy ging zur Fahrerseite und sah hinter dem offenen Fenster einen schlafenden Mann mit grauem Haar. Er pochte an die Wagentür.
Der Mann richtete sich auf und zwinkerte mit den Augen, als wäre Freddys Anblick die Fortsetzung eines Traums. Freddy fragte ihn, ob er englisch spräche, und nannte ihm dann die Adresse vom Restaurant Slavia. Träge stieg der Taxifahrer aus. Er öffnete die hintere Tür und wartete ab, bis Freddy sich in das Auto gezwängt hatte. Erst schob Freddy seinen Hintern hinein. Dann drehte er sich langsam mit eingezogenem Kopf um, preßte sich zwischen Rücksitz und Lehne und zog seine schweren Beine hinterher. Bequem saß er nicht, aber er konnte befördert werden.
Der Taxifahrer war ein älterer Mann, der schweigend und vorsichtig seinen Wagen fuhr. Die Stadt war kaum beleuchtet. Freddy erkannte ein Gebäude wieder, das sie bei der Stadtrundfahrt fotografiert hatten, aber ansonsten war alles undeutlich und geheimnisvoll. Der Straßenbelag bestand aus glatten runden Steinen, die den Wagen förmlich zu schleifen schienen. Freddys Fettmassen zitterten bei jeder Unebenheit. Der Hunger starrte mit ihm auf die unheimliche Stadt.
Früher, als Bobby ihn noch nicht auf Diät gesetzt hatte, war Freddy nachts manchmal in den Straßen herumgefahren auf der Suche nach Erlösung. Er lenkte seinen New Yorker durch die stillen Geschäftsstraßen und Alleen von San Diego und schielte nach Junkies und Nutten; die kalte Luft aus der Klimaanlage wirbelte ihm um den Kopf. Bei diesen Fahrten fühlte er sich wie früher die Kreuzfahrer in ihren Rüstungen: Er hatte eine Mission, war bereit, sein Leben zu opfern, während er in den ärmeren Vierteln von Downtown S.D. herumkurvte, die man auch Hell’s Kitchen nannte, und nach einem Leuchtschild suchte, das ihm verkündete: GREAT BURGERS OPEN ALL NITE.
Aber hier: nirgends ein hellerleuchteter Hamburger-Shop mit verchromter Theke, keine laute Musik aus stromlinienförmiger Musicbox (im Stil der fünfziger Jahre, wie auch die Speisekarte und der Rest der Einrichtung), keine Mädchen und Jungs, die in Doppeldecker hineinbissen, kein Betrieb round the clock. Prag gewann in diesen Stunden absoluter Verlassenheit seine natürliche Gestalt. Hochmütige Giebel, schwarze Fenster, unerreichbare Denkmale. Diese Stadt war ein schwarzes Museum, das seine Besucher nur widerwillig erduldete.
Das Taxi hielt bei einer unbeleuchteten Gasse. Der Fahrer drehte sich zu ihm um und legte müde einen Arm auf die Rücklehne.
»Ist es hier?« fragte Freddy.
Der Mann nickte.
Freddy starrte in die dunkle Höhle, konnte aber kein Schild und kein helles Fenster entdecken.
»Wieviel?«
Der Mann hob die Schultern. »Was Sie geben wollen«, sagte er.
Freddy fand einen Dollarschein zwischen dem Bündel Tschechenkronen, das er in seiner Brusttasche aufhob. Sein restliches Geld steckte in seiner Hosentasche, aber im Sitzen bekam er nicht mal den Rand eines Fingernagels zwischen den Stoff, das wußte er aus Erfahrung, weil sein Bauchfett und sein Hüftfett die Hose zum Platzen gespannt hielten. Der Mann nickte, sichtlich zufrieden.
Freddy stieß die Tür auf und hielt sich am Türrahmen fest. Er zog sich aus dem Auto und fühlte, wie ihm die Knie zitterten, als er sein volles Gewicht auf seine Beine verlagerte. Dann fiel ihm plötzlich ein, daß das Taxi keinen Funk hatte, und er fragte den Fahrer, ob er in einer Stunde wieder hier sein könne.
»Wenn Sie im voraus bezahlen …«
Freddy zog das Bündel Dollarscheine aus der Hosentasche und gab dem Mann noch einen Schein. Ohne Gefühlsregung nahm er das Geld an. Freddy sah jetzt, daß der Mann älter schien als er war. Haare und Augen hatten die Farbe von Verbitterung und Resignation, aber seine Wangen waren glatt und elastisch.
Das Taxi ließ ihn in einer stinkenden Wolke zurück. Die Abgase rochen hier anders als zu Hause. So schnell ihn seine Beine trugen, entfernte er sich aus der Wolke und ging auf die schmale Gasse zu.
Im Dunkeln sah er die Umrisse von Giebeln. Er suchte nach der Hausnummer, konnte aber nirgends eine Numerierung neben den Türen entdecken. Doch stieg ihm etwas in die Nase, das ihm verriet, daß er seinem Ziel ganz nahe war. Er roch Bratfett, einen schweren, warmen Duft, der ihm den Geschmack von Pommes frites und gebackenen Tintenfischringen in den Mund zauberte und kurz darauf eine Welle heißer Spucke, er nannte sie »Hungersaft«, ein süßes Rachenwasser, das die Happen, die er hinunterschluckte, sanft in seinen Magen beförderte. Er schluckte und versuchte herauszubekommen, wo der Duft nach Gebratenem herkam. Er atmete tief durch die Nase, drehte sich um, aber die ganze Gasse schien voll davon und verriet nichts über die Quelle des betörenden Duftes. Er schluckte wieder, flehte den Hund in seinem Magen an, noch ein paar Sekunden abzuwarten und begann, sich an einer Mauer entlangzuschieben, alle fünf Sinne in höchster Alarmbereitschaft.
Auch wenn die Finsternis zu signalisieren schien, daß es hier nichts zu essen gab, behauptete seine Nase tröstlicherweise das Gegenteil: Die Gasse stimmte. Er hoffte jetzt, daß seine Ohren der Nase zu Hilfe kämen: Wenn das Restaurant wirklich noch offen hatte, mußten irgendwo, und sei es noch so leise, Gläserklingen, Lachen und Gesang zu hören sein.
Er lehnte sich an die Mauer, während er schnüffelte und lauschend weitertappte. Sein Hemd war schweißnaß. Hörte er da etwas? Ein Messer, das auf einem Teller quietschte? Das plopp eines Korkens, der aus der Flasche schießt? Hinter den blinden Türen und Fenstern einer dieser Fassaden wurde schamlos gefressen und gesoffen, und Freddy war überzeugt, daß er den Morgen nicht mehr erleben würde, wenn er nicht augenblicklich mitnaschen und schlucken durfte.
Lähmende Mattheit sank ihm vom Nacken in die Glieder. Vielleicht hatte der Mann im Hotel ihm eine alte Adresse gegeben, oder der Taxifahrer hatte ihn zum Narren gehalten. Ein verrückter Einfall überfiel ihn: Er würde hier an einer akuten Magensäureattacke sterben; diese schwarzen Steine waren sein Grab.
Der Schmerz, der sich plötzlich in seinem Hinterkopf meldete, überraschte ihn nicht. Keine Magenblutung, sondern eine Gehirnblutung, schoß ihm beruhigend durch den Kopf, ein schwaches Äderchen hatte bei diesem schrecklichen Hunger versagt. Seine Knöchel gaben nach, und er verlor das Gleichgewicht. Schnell griff er haltsuchend nach der Mauer, aber das verzögerte die Sache nur: Unaufhaltsam sackte er in sich zusammen. Der Aufschlag auf den Steinen klang dumpf und tat eigentlich nicht weh.
Das also war es gewesen. Auf der Jagd nach einem Hamburger oder einem Beefsteak in einem fremden Land schlug die Tür hinter ihm zu. Und nun wollte er wissen, was es war, wie es sich anfühlte, auch wenn er Bobby nie mehr davon berichten konnte. Adieu, Bobby, sagte er zu sich selbst. Sie konnte leicht einen anderen finden, sie sah ja gut aus; in ein paar Tagen würde sie all sein Geld erben und wäre dann auch noch eine reiche Witwe. Er wartete jetzt auf eine besondere Empfindung, und plötzlich wußte er, worauf er wartete: auf den Tunnel mit dem blendenden Licht, über den er in Reader’s Digest gelesen hatte, einen Tunnel voll paradiesischer Gesänge, der Ruhe und Frieden verbreitete, wie das gefesselte Erdenleben – in seinem Fall durfte man das wörtlich nehmen, dachte er spöttisch – sie niemals hatte erzeugen können. Gleich würde er verstorbenen Verwandten begegnen. Menschen, die er geliebt hatte und die er hatte begraben müssen; sie würden bei ihm sein und ihn umarmen. Er lächelte und freute sich zutiefst auf dieses Wiedersehen.
Der Schmerz in seinem Kopf schien abzunehmen, und weil er davon ausging, daß Schmerzen zu seiner körperlichen Hülle gehörten und nur sein Geist und seine Seele Zugang hatten zu dem langen Tunnel, betrachtete er das als ersten Beweis dafür, daß sein Ich davonschwebte, um in den Himmel aufgenommen zu werden. Und mit Schrecken stellte er plötzlich fest, daß er niemals etwas über die Beinahe-Todeserfahrungen von Menschen gelesen hatte, die auf dem Weg zur Hölle gewesen waren! Vielleicht war gerade dies die Hölle, schloß er, war gerade das vollkommene Nichts bei jenen Menschen, die klinisch tot gewesen waren und keinen hellen Gang gesehen hatten, die gab es natürlich auch, der Vorhof zur Hölle, und die Hölle war das Nichts. Freddy begriff, daß er noch immer über sein Denkvermögen verfügte, weil er Probleme logisch zu lösen versuchte, die sich jetzt stellten, so daß er eigentlich keinen anderen Schluß daraus ziehen konnte als diesen: er war mit Geist und Seele bereits unterwegs zum LICHT.
Und da war Licht. Er sah es, auch wenn er keine Augen mehr hatte. Es tanzte undeutlich und bewegte sich hin und her in einem Rhythmus, zu dem er die Musik hören wollte. Und dann hörte er zwei Stimmen, die eine Sprache sprachen, die er nicht verstand, aber er wußte ganz sicher, daß sich ihm der Schlüssel zu dieser Sprache gleich offenbaren würde. Dann fühlte er etwas, das einer Leibesvisitation nicht unähnlich war: Hände betasteten seinen Körper. Und schockartig wurde ihm klar, daß er sich noch immer in seinem Körper befand und offenbar nicht wirklich gestorben war.
Er schlug die Augen auf und sah zwei Männer, die sich über ihn beugten. Einer beleuchtete mit der Taschenlampe die flinken Hände des anderen. Nun wurden seine Hosentaschen geleert. Und als der Mann mit der Lampe für einen Augenblick den Kopf in Freddys Richtung drehte, erkannte Freddy das melancholische Gesicht des Taxifahrers. Unbekannte Wörter fielen aus seinem Mund, als er in Freddys offene Augen sah, und sofort holte der andere Mann aus und schlug mit einer Art Knüppel zu.
Freddys Schädel brannte von diesem Schlag. Trotz der Schmerzen empfand er nur eins: Er trauerte um das Entzücken, das er nun nicht mehr erleben würde. Er war bereit gewesen zu sterben und Abschied zu nehmen von dieser Welt, um schwerelos als Geist und Seele durch den Tunnel zu schweben. Er trauerte, daß all dies nur die Folge eines Knüppelschlags war, den ihm ein finsterer Taxifahrer und dessen Kumpan verpaßt hatten.
Der Taxifahrer sagte etwas, während er die Taschenlampe ausknipste. Die Männer rannten weg.
Es dauerte Minuten, bis er genügend Kraft gesammelt hatte, um sich aufzurichten. Als er mit dem Rücken an der Mauer saß, hielt er sich an den Stäben eines Gitters fest, das vor einem Fenster angebracht war. Er zog sich hoch, fühlte seine Armmuskeln anschwellen. Man konnte sie unter der dicken Fettschicht nicht sehen, aber sie waren durch langes Training mit seinem Eigengewicht stark geworden. Der Hunger begann seinen Magen zu zerfleischen, sein Magen wurde aufgefressen, mußte in einem Loch verschwinden, das er selber war.
Als er stand, hatte er jede Orientierung verloren. Kein Geld, keine Ortskenntnis, keine Sprache. Vorsichtig nahm er Kurs auf das Lichtpünktchen am Ende der Gasse, in der Hoffnung, dort die Straße zu finden, an der ihn der Schuft von Taxifahrer abgesetzt hatte. Ein schriller Krampf zuckte durch seinen Kopf. Er bewegte sich langsam fort, als seien seine Beine aus Schilfrohr. Wieviel Geld hatte er genau bei sich gehabt? Vielleicht zweihundert Dollar. Er würde darüber schweigen.
Freddy kam am Ende der Gasse an und stellte fest, daß er hier nicht aus dem Taxi gestiegen war. Eine enge Straße mit hohen, leblosen Häusern, mit Straßenlaternen, die schmutziges Licht verbreiteten. Kein Mensch war da, den er nach dem Weg fragen konnte, und auf gut Glück ging er nach links.
Zweihundert Dollar waren in diesem Land ein Vermögen. Der Reiseleiter hatte erzählt, daß sie auf dem Schwarzmarkt das acht- oder neunfache des offiziellen Kurses brachten. Im ungarischen Restaurant hatte sich Freddy acht- oder neunfach die Steaks der anderen verkniffen. Er hatte nur vier gegessen. Sie schwammen auf einer sahnigen »gypsy sauce« – mit Paprika –, die seine Landsleute, sofern sie bereit gewesen waren, mit der Qualität des Fleisches vorlieb zu nehmen, zur Raserei brachte, weil ihnen die Flammen nur so aus dem Gaumen schlugen. Cuisine communiste. Sie hatten es dann mit Saufen probiert.
Freddys gutes Glück entpuppte sich als schlechtes Glück. Wieder eine Seitenstraße. Wieder kein Mensch. Er fragte sich, ob er nicht doch tot war und schon in der Hölle angekommen – ein leeres stilles Prag konnte eigentlich nur die Hölle sein. Plötzlich verschwand auch noch das wenige Licht aus seinen Augen. Er war kurz vorm Umkippen.
Freddy blieb stehen, um die Schwindelanfälle vorbeiziehen zu lassen. Er befürchtete, daß der Knüppel eine Gehirnerschütterung verursacht hatte, und fragte sich, ob er morgen nach Wien zurückfliegen konnte, um sich in einem kapitalistischen Krankenhaus untersuchen zu lassen. Er setzte sich auf einen Abfalleimer in einem geschützten Winkel der Straße, unter einer breiten gußeisernen Treppe, und dachte über dieses Problem nach. Er konnte Bobby nicht erzählen, daß er ausgeraubt worden war und auch nicht, daß er sich untersuchen lassen wollte. Er wußte nicht einmal, ob man in einem kommunistischen Land in ein Reisebüro gehen und ein Flugticket bestellen konnte. Gab es hier überhaupt Reisebüros?
Er sah auf, als er etwas hörte. Alles geschah sehr schnell, und wenige Minuten später tat er den Vorfall als Hirngespinst ab, denn er war Zeuge der Entführung eines seiner Mitreisenden geworden, des jungen Autohändlers aus Wisconsin. Der war ein Mann in den Dreißigern, dessen Geschäft German Motor Company hieß (er hatte Freddy seine Visitenkarte überreicht) und der ausschließlich »Luxusgebrauchtwagen« verkaufte. Der Autohändler kam plötzlich um eine Ecke, verfolgt von zwei Männern, die Freddy noch nie zuvor gesehen hatte, gleichzeitig tauchte aus einer anderen Straße ein Auto auf und schnitt dem rennenden Autohändler den Weg ab, indem es auf den Bürgersteig fuhr. Der Mann mußte dem Auto ausweichen und verlor dadurch ein paar kostbare Sekunden, so daß seine beiden Verfolger die Möglichkeit hatten, ihren Rückstand aufzuholen. Sie stürzten sich auf den Autohändler, zerrten ihn in das Auto, das mit quietschenden Reifen davonfuhr und aus Freddys Blickfeld verschwand. Alles zusammen hatte vielleicht fünfzehn Sekunden gedauert.
Freddy hatte sich unter seiner Treppe nicht gerührt. Was er gesehen hatte, konnte nicht wirklich passiert sein. Und wenn es wirklich passiert war, dann war der Mann nicht der Autohändler aus Wisconsin gewesen. Und dann war noch die Frage, ob es überhaupt eine Entführung gewesen war. Nein, natürlich nicht: Es war eine Verhaftung. Er rieb sich die Augen und spürte, wie der Hunger schon wieder von seinem Körper Besitz ergriff und diesen seltsamen Vorfall aus seinen Gedanken verscheuchte.
Orientierungslos und verzweifelt stieß er eine halbe Stunde später auf ein Taxi. Er bezahlte mit einer tschechischen Banknote und ließ sich zum Hotel International zurückbringen. Der Kopfschmerz hämmerte bis zum Morgen in ihm weiter, und krank vor Hunger begab er sich in den Frühstücksraum. Dort bekam er pappiges Brot, brennend süße Marmelade und ranzige Butter, zweitklassiges Essen, aber im Überfluß vorhanden. Es war wieder ein warmer Tag. Er aß und aß und machte sich nichts aus Bobbys Ermahnungen und immer strenger klingenden Vorwürfen. Um neun Uhr stiegen sie in den Bus zu einem weiteren Ausflug, und Bobby schluckte ihren Ärger auf einem Sitz an der anderen Gangseite herunter, während Freddy mit einer Frau aus Pasadena Verhandlungen aufnahm über den Ankauf einer Tüte M & M’s.
Dann fragte der Reiseleiter, der vorne vor der getönten Windschutzscheibe stand, ob jemand Michael Browning aus Wisconsin heute früh beim Frühstück gesehen hätte, denn er war nicht im Bus und auch nicht auf seinem Zimmer.
Die Nacht des 22. Juni 1989
»Nachdem die Erfahrung mich gelehrt hat, daß alles, was im gewöhnlichen Leben sich häufig uns bietet, eitel und wertlos ist, da ich sah, daß alles, was und vor welchem ich mich fürchtete, nur insofern Gutes oder Schlimmes in sich enthielt, als die Seele davon bewegt wurde, so beschloß ich endlich nachzuforschen, ob es irgend etwas gebe, das ein wahres Gut sei, dessen man teilhaftig werden könne, und von dem allein, mit Ausschluß alles übrigen, die Seele erfüllt werde, ja ob es etwas gebe, durch das ich, wenn ich es gefunden und erlangt, eine beständige und vollkommene Freude auf immerdar genießen könne.«
Während der köstliche salzige Kaviar seinen Gaumen streichelte, versuchte Felix Hoffman, der neunundfünfzigjährige Diplomat, der am Abend zuvor einen Empfang für den Kanzleistab und das Diplomatische Corps gegeben hatte, diesen Satz zu erfassen.
Es waren die Eingangsworte eines Buches, das er vor einer Woche in einem verstaubten Schrank auf dem Dachboden seines neuen Hauses gefunden hatte. Obwohl er früher als Laie versucht hatte, seinen Weg durch das Dickicht der Philosophie zu finden, hatte er sich an das Werk jenes Autors, von dem das Buch stammte, Baruch de Spinoza, nie herangetraut.
Hoffman hatte das Buch aufrecht hinter seinen Teller gestellt, damit er lesen konnte, während er die reichlichen Überreste vom Empfang in sich hineinstopfte, aber es blieb nicht von selbst stehen. Er hatte die Champagnerflasche zu sich herangezogen und das Buch an die Flasche gelehnt, aber auch das half nichts, denn der Inhalt der Flasche befand sich in Hoffmans Magen. Die leere Flasche war elegant über den weißen Marmortisch gerutscht, und das Buch war hintenüber gefallen. Dann hatte er den schweren Kühler mit geschmolzenem Eis an seinen Teller gestellt. So blieb das Buch stehen.
Auf einen durchweichten Toast Melba hatte er einen Suppenlöffel mit Russischem Kaviar gehäuft, hatte schmatzend das Buch aufgeschlagen und den ersten Absatz der philosophischen Abhandlung von Baruch de Spinoza gelesen.
Das letzte Stück Philosophie, das er genossen hatte, war Hermans Übersetzung von Wittgensteins Tractatus gewesen, aber er gab ritterlich zu, daß die strengen Paragraphen dieses Buches seiner Natur nicht entsprachen, auch wenn der letzte Satz – wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen – ihm gut gefallen hatte. In seiner Studentenzeit hatte er natürlich Kant, Nietzsche, Sartre und Heidegger gelesen, und außerdem hatte er mit Hilfe von Bertrand Russells Philosophie des Abendlandes den Versuch unternommen, breitere Kenntnis von den Ideen der großen Denker zu erlangen. Von Rilke und Morgenstern kannte er Dutzende dunkler Gedichte auswendig, er hatte Hannah Arendts Schriften gelesen, hatte bei der Frankfurter Schule und in der Phänomenologie herumgepickt, aber an seinem geistigen Habitus veränderte das nichts: Er mußte sich eingestehen, daß er als Intellektueller unterentwickelt war, ungeübt in den Regeln der Logik und Rhetorik. Er war für Leibniz und Bergson zu klein, und wenn er etwas über die französischen »neuen Philosophen« las, nahm er sich vor, die klaffenden Lücken in seinem Wissen endlich zu füllen; er wollte lesen, was Cioran und Levinas geschrieben hatten, aber er kam doch nie dazu.
Um sein Unvermögen nicht immer wieder nutzlos auf die Probe zu stellen, las er lieber einen Krimi oder einen Spionage-Thriller. Er las, um die Zeit totzuschlagen, und letzteres nahm er durchaus wörtlich.
Der Titel von Spinozas Buch Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes und über den Weg, auf dem er am besten zur wahren Erkenntnis der Dinge geleitet wird hatte ihn zum Lachen gereizt; unter dem warmen Dach hatte er den Staub vom Buch gepustet und es mit nach unten genommen.
Es war ein ziemlich hohes Buch mit kartoniertem Einband und dicken, schweren Seiten. Das Papier war faserig aufgeschnitten und vergilbt, hie und da befleckt, weil offenbar früher einmal ein Glas Wein darauf verschüttet worden war. Der Druck war groß und deutlich. Es war von einem Buchbinder gebunden, daher ließ es sich leicht aufschlagen.
Er füllte den Löffel noch einmal mit dem herrlichen blauschwarzen Kaviar und schob die ganze Ladung ohne schlappen Melba-Toast in seinen Mund.
Der Eingangssatz von Spinozas Abhandlung war der sonderbarste, den er je gelesen hatte. Wahrscheinlich war der Ton des Satzes für jemanden aus dem siebzehnten Jahrhundert unerwartet persönlich und direkt. Hoffman war im Gegensatz zu seiner Frau Marian, einer Vondel-Spezialistin, kein Kenner der Literatur des siebzehnten Jahrhunderts; er erinnerte sich nur an ein paar Titel, die zur Pflichtlektüre gehörten. Im Lauf der Jahre hatte er immer mal wieder Marians Studienbücher und Aufzeichnungen beschnuppert und betastet, wenn sie irgendwo herumlagen, aber er hatte sich nicht berufen gefühlt, ins siebzehnte Jahrhundert hinabzusteigen, ihre Passion für diese Zeit blieb ihm fremd. In der Studentenzeit hatte er aufmerksam ihre Interpretationen von Vondels Sonetten gelesen, aber er blieb trotzdem immer nur Zaungast bei einem Spiel, dessen Regeln er nicht ergründete.
Mit Marian hatte er nie eine geistige Beziehung gehabt. Von allem Anfang an war sie seine Frau gewesen, er ihr Mann. Sie sprachen wohl über Filme und Bücher, aber auf eine primitive, sehr subjektive Art. Später sprachen sie über das Zahnen und die Kinderkrankheiten der Zwillinge, und zum Zauber dieser Jahre paßten keine Gespräche über den Gottesbeweis bei den Scholastikern.
Hinter dem »Ich« des ersten Satzes in diesem Buch sah er plötzlich das fremdartige, langgestreckt-eiförmige Haupt von Spinoza, mit großen, milden Augen, frischen Wangen, einer geraden Nase und langem, dichtem Haar. Der Kopf war vorn im Buch abgebildet, kaum mehr als eine Skizze, aber sehr eindringlich.
Dieser Spinoza strahlte eine große Ruhe aus, Hollands Philosoph spanischer Abkunft aus dem siebzehnten Jahrhundert, ein Mann, der seine Aufgabe gefunden hatte und neugierig auf einen Punkt rechts von seinem Zeichner schaute. Hoffman wußte nicht, was da zu sehen war, aber der Philosoph besaß unbestreitbar einen offenen, wachen Blick.
Hoffmans Gesicht zeigte Falten und Furchen, ein kompliziertes Grabensystem, worin die Schweißtropfen, die er in den vergangenen heißen Tagen reichlich abgesondert hatte, im Zickzack herunterliefen. Seine Augen lagen versteckt unter kleinen Säcken, die an seinen Augenbrauen befestigt schienen, aber wer sich die Mühe machte, diese Säckchen hochzuziehen, fand Augen von unverbrauchter Qualität: mit hellem Glanz, aber erschrocken und traurig, wie die Augen eines zehnjährigen Jungen, der gerade bestraft worden ist.
Hoffmans Kopf war früher ebenso gesund behaart gewesen wie der von Baruch, aber im Lauf der Jahre war der Haaransatz immer weiter von seinen Augen zurückgewichen. Dünnes graues Haar, das er auf amerikanische Art kurz geschoren hielt, erinnerte ihn Tag für Tag an sein nahendes Ende. Er hatte ein schweres Kinn und breite Schultern, schleppte an die zwanzig Kilo Übergewicht mit sich herum, besaß große Hände und Füße und eine Stimme, die einen vollen Saal ohne Mikrofon ausfüllte; er war der letzte aus einer Familie starker rothaariger Juden, die in früheren Jahrhunderten die Arbeitspferde in polnischen und russischen Schtetln gewesen waren und aussahen wie Bauern aus der Ukraine.
Er beugte sich über den Küchentisch und griff nach einer Flasche. Er trank direkt aus dem Flaschenhals und vermischte den starken Nachgeschmack des Kaviars mit einem Schluck lauwarmen Champagners von Moët & Chandon.
Von der Tischplatte reflektierte das Lampenlicht in alle Küchenecken. Im stillen Haus saß Hoffman wie in einem Kokon aus Licht. Tagsüber fiel der Blick durch ein hohes Fenster über der Anrichte in einen ausgedehnten Garten, aber jetzt wirkten die dunklen Fensterscheiben wie ein Spiegel, in dem sich die Küche selber betrachten konnte. Es war besser, die Fenster geschlossen zu halten, draußen war es noch wärmer, und die Mücken saßen in Scharen außen an der Glasscheibe.
Der Tisch war vollgeladen. Mit Salaten, Aufschnitt und Pasteten, mit Krabben und Hummer, französischem und holländischem Käse, exotischen Früchten, Nüssen, Weinflaschen und Likören. Seit der kommunistischen Machtübernahme hatte kein Tscheche solche Delikatessen auf einem Haufen gesehen.
Das große Haus stand in einem vornehmen Außenbezirk von Prag und diente seit 1973 als Sitz des Botschafters und Generalbevollmächtigten Ihrer Majestät der Königin der Niederlande. Es war ein rechteckiges Gebäude mit drei Stockwerken, eingerichtet von einer vom Auswärtigen Amt eigens für diese Zwecke geschaffenen Abteilung, die das Idealbild des Königreichs scharf im Auge behielt: solide, aufrecht, zurückhaltend. Wer hier über die Schwelle trat, fand einen Gutshof in einem calvinistischen Polder vor.
An der Straßenseite erstreckte sich ein Salon fast über die Hälfte des gesamten Erdgeschosses und enthielt gleich drei Sitzgruppen. Eine Schwingtür öffnete den Zugang zu einem separaten Eßsaal, worin ein massiver Tisch stand, der für offizielle Essen benutzt wurde. In der Mitte lag eine Empfangshalle komplett mit Bechsteinflügel und einer breiten Treppe, die sich theatralisch in den ersten Stock hinaufschwang. Zur Gartenseite hin hatte ein voraussschauender Geist ein zweites kleineres Eßzimmer für die täglichen Mahlzeiten eingerichtet; es gab eine geräumige Küche für die größeren Diners und eine Beiküche für die gröberen Arbeiten sowie eine pikante zweite Treppe hinter einer Schranktür.
Im ersten Stock lagen Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer mit Bibliothek, im zweiten Stock weitere Schlafzimmer, und unter dem Dach standen auf dem nackten Holzboden des Speichers ausrangierte Möbel, Bücher und Kram.
Jeder neue Bewohner füllte die Möbel des AA mit seinen eigenen Sachen, um dem Haus eine persönliche Note zu geben, und jeder ließ beim Auszug irgend etwas Überflüssiges zurück. So war auch das Buch von Spinoza auf den Speicher gekommen, von einem Botschafter beim Umzug verbannt, oder von seiner an Lebensfragen interessierten Ehefrau.
Der Moët & Chandon war nicht schlecht, aber Hoffman trank lieber Taittinger, auch wenn angeblich Dom Perignon der beste sein sollte. Der Dom war eigentlich nur teuer, fand Hoffman, ein typischer Champagner für Neureiche ohne Geschmack. Dieser Moët war für den Empfang am Vorabend von jemandem aus der Botschaft eingekauft worden – der Name des Mannes war ihm entfallen, er selbst war ja erst seit kurzem hier in Prag –, der behauptete, daß der Taittinger in dem Geschäft im nahen München, wo sich das Prager Corps mit Delikatessen versorgte, ausverkauft gewesen sei.
Was hatte Spinoza nun eigentlich zu sagen?
»Nachdem die Erfahrung mich gelehrt hat, daß alles, was im gewöhnlichen Leben sich häufig uns bietet, eitel und wertlos ist …« – dies war eine Mitteilung, die ihn nicht gerade umwarf. Auch Felix Hoffman hatte dies feststellen können nach neunundfünfzig Jahren Alltagsdasein, auch er hatte erfahren, daß alles eitel und wertlos war, aber Spinoza hatte nicht ohne Grund den Ruf, ein bedeutender Philosoph zu sein und würde deshalb wahrscheinlich bald einen Trumpf aus dem Ärmel ziehen.
»… da ich sah, daß alles, was und vor welchem ich mich fürchtete, nur insofern Gutes oder Schlimmes in sich enthielt, als die Seele davon bewegt wurde …« war ein Zusatz, der auch nicht gerade Furore machte.
Damit meinte der alte Philosoph, daß man im Grunde nur Angst hatte vor der eigenen Angst. Ein Auto zum Beispiel ist ein harmloses Stück Blech, aber eine Mordwaffe, wenn es von einem Saufbold mit zwölf Flaschen Champagner im Leib gefahren wird – wenn man dies wußte, würde man a) keinen Tropfen mehr trinken und b) sich nie mehr in ein Auto setzen.
Er las weiter.
»… beschloß ich endlich nachzuforschen, ob es irgend etwas gebe, das ein wahres Gut sei, dessen man teilhaftig werden könne, und von dem allein, mit Ausschluß alles übrigen, die Seele erfüllt werde …«
Dies waren vermutlich die Worte gewesen, die ihn beim ersten Lesen getroffen hatten. Spinoza ging auf die Suche nach etwas, das die Seele erfüllen konnte, oder nach etwas, das ihn glücklich machen konnte, eine Verheißung, die im letzten Satzteil noch einmal wiederholt wurde: »… ob es etwas gebe, durch das ich, wenn ich es gefunden und erlangt, eine beständige und vollkommene Freude auf immerdar genießen könne.«
Baruch de Spinoza suchte das Glück.
Felix Hoffman nahm sich vor, die Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes und über den Weg, auf dem er am besten zur wahren Erkenntnis der Dinge geleitet wird gründlich zu lesen.
Er stand auf und öffnete den Kühlschrank. Der Korken einer neuen Flasche Moët schoß wie eine Rakete aus dem Flaschenhals. Es war nicht angenehm, direkt aus der vollen Flasche zu trinken, und er füllte ein Glas mit dem schäumenden Champagner.
Am Morgen hatte er im Hradschin den Präsidenten besucht und ihm sein Beglaubigungsschreiben überreicht.
»An das Staatsoberhaupt der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik,
Exzellenz,
Ich habe beschlossen, Herrn Felix Aaron Hoffman, einen angesehenen Bürger des Königreiches der Niederlande, zu meinem Botschafter und Generalbevollmächtigten bei Ihrer Regierung zu ernennen.
Er ist über die gegenseitigen Interessen unserer beiden Länder informiert und teilt meinen aufrichtigen Wunsch, die schon lange bestehende Freundschaft zwischen uns zu erhalten und zu festigen.
Mein Vertrauen in seinen noblen Charakter und seine Fähigkeiten gibt mir die volle Überzeugung, daß er seine Pflichten auf eine für Sie genehme Art und Weise erfüllen wird.
Ich bitte Sie daher, ihn mit allen Ehren zu empfangen und ihm Ihr geneigtes Ohr zu leihen, wenn er im Namen des Königreiches der Niederlande spricht und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik meine besten Wünsche überbringt.
Beatrix R.«
Mit neunundfünfzig hatte er die Beförderung erhalten, auf die er schon seit fünfzehn Jahren ein Anrecht hatte. Das AA hatte ihm den Status vorenthalten, und Hoffman hatte jahrelang seine Feinde in Den Haag gezählt und seine Chancen berechnet. Er hatte sich bereits damit abgefunden, als überalterter Botschaftsrat in den Ruhestand zu gehen. Plötzlich gaben sie ihm gegen Ende seiner Laufbahn diesen Posten, und dies war ein positiverer Abschluß seiner stürmischen Verbindung mit dem AA, als er aufgrund seiner Beurteilung hatte erhoffen dürfen.
Seinen ersten Posten bekam er 1960 in Caracas als Dritter Sekretär, vier Jahre später folgte die Stelle in Madrid als »Wirtschaftsexperte«, wieder vier Jahre später die Stelle in Lima, Peru. Es war nur ein Zufall, daß alle Länder spanischsprachig waren; das Amt befleißigte sich einer völlig willkürlichen Berufungspraxis und hielt nichts davon, Experten heranzubilden, die ihren Beruf nur innerhalb einer einzigen Kultur ausübten. 1971 ging er zum erstenmal nach Afrika, nach Dar-es-Salaam in Tansania, und vier Jahre später war es wieder Südamerika, Rio de Janeiro. Damals hatte er schon Anrecht auf einen Botschafterposten, aber er kam 1979 als Generalkonsul nach Houston. 1983 reiste er, nur im Rang eines Geschäftsträgers auf Zeit, also deutlich ohne Beförderung, nach Khartum, und dort war er bis zu seiner Berufung nach Prag geblieben.
Auf den Entwicklungsposten hatte er sich mit Arbeit betäuben können, denn in diesen Ländern forderte die Arbeit den ganzen Mann und ging nie aus. Mit der Tschechoslowakei dagegen waren die diplomatischen Beziehungen so gut wie eingefroren, und auf wirtschaftlichem Gebiet spielte sich nicht viel mehr ab als ein bißchen Handel im Umfang einer Zugladung Skodas und ein paar Dutzend Vogelkäfigen. Prag galt als langweiliger Posten, und er befürchtete, daß er hier seine Energie nicht loswerden konnte. Aber seine Beförderung hatte ihn mit Genugtuung erfüllt.
Wim Scheffers war der Mann im AA, dem er seinen Posten zu verdanken hatte. Wim war ein schlanker Mann mit grauen Augen und sonnengebräuntem Teint. Hoffman hatte ihn in der »Klasse« getroffen, wie sie ihre eigene Ausbildung beim AA nannten. Wims Vater, ein Jude, der den Krieg dank seiner Mischehe heil überstanden hatte, hatte kurz nach Beginn von Wims »Klasse« den Kopf in eine Schlinge gesteckt und den Stuhl unter seinen Pantoffeln weggestoßen. Entmutigt wollte Wim daraufhin der Klasse und dem diplomatischen Dienst den Rücken kehren, aber Hoffman hatte ihn in Den Haag festgehalten, und Wim hatte im Außenministerium Karriere gemacht. Sie nannten sich die Jewish gang, ein Jude und ein Halbjude (was auch immer das sein mochte), die durch die Maschen des AA geschlüpft waren.
Scheffers war jetzt Ministerialdirektor beim Auswärtigen Amt, MDAA, ein Bürokrat, der immer höher kletterte, je mehr Dienstjahre er hatte. Er war ein berüchtigter lady’s man.
Hoffman hatte ihn in das Des Indes eingeladen und einen Château Margaux bringen lassen. Wim beschnüffelte den Margaux stumm und ausdauernd.
»Köstlicher Wein«, sagte er, »es gibt doch nichts Köstlicheres als einen Margaux.« Der Ober schenkte weiter ein.
»Ich weiß, du bist ganz wild auf Margaux. Eine Kiste ist unterwegs zu dir.«
»Du bist verrückt, Felix. Laß das doch.«
»Ohne dich hätte ich die ganzen Jahre nicht überstanden, Wim. Nur ein Zeichen meiner Dankbarkeit.«
»Nein. Du brauchst nicht dankbar zu sein.«
Hoffman lehnte sich über den Tisch und sagte vertraulich: »Wir wollen die Dinge doch beim Namen nennen. Dein Einfluß hat mich nach Prag gebracht. All das andere Pack kann mich nicht ausstehen. Das sind doch sture Arschlöcher und Duckmäuser, die nur noch an ihr Häuschen in der Ardèche denken, das sie zusammengespart haben …«
»Also das hab ich auch, Felix …«
»Ich weiß, ich weiß, aber du bist kein Arschloch, du bist frankophil. Zwar weiß ich bei Gott nicht, warum ein gesunder Mensch frankophil sein muß, aber ich werde den lieben Gott bitten, daß er dir vergibt.«
»Die Kultur, Felix, die Kultur …«
»Ach, scheiß doch auf die Kultur, du meinst die französischen Nutten …«
Er wußte, daß er Wim Scheffers mit solchen Reden amüsierte. Im Lauf der Jahre war diese Rollenverteilung entstanden: Wim blieb der lustige Junggeselle mit seiner kleinen Passion, die er in einem umgebauten Bauernhof am Rand eines mittelalterlichen Dorfes im tiefsten Frankreich auslebte, und Hoffman spielte den vom Leben gezeichneten Elefanten, der ab und zu durch Wims Porzellanladen trampelte und Banalitäten fallen ließ. Scheffers war nie verheiratet gewesen.
»Wirklich, im Ernst, Wim, ich bin dir dankbar. Ich hab diese Hohlköpfe allzulange Hanswurst spielen sehen. Jetzt darf ich auch mal Hanswurst sein. Ich bin froh darüber. Aber ein schaler Nachgeschmack bleibt doch, denn es hat ziemlich lange gedauert, was?«
»Du hast es dir selbst nicht gerade leicht gemacht.«
»Ach, hab ich es doch mir selber zu verdanken?«
»Ein Posten bei einem Verlag oder bei einer Filmgesellschaft hätte vielleicht besser zu dir gepaßt.«
»Ach ja?«
»Du bist eigentlich zu … zu künstlerisch für unseren Job, ich meine, du bist viel zu locker und direkt. Manche Leute haben es nicht leicht gehabt mit deiner Art, Felix.«
Damit meinte Scheffers, daß Hoffman ein Großmaul war, besonders in betrunkenem Zustand, was in Scheffers Ausdrucksweise mit dem Wort »künstlerisch« umschrieben wurde.
»Und eigentlich … ich sag mal einfach, wie es ist, Felix, eigentlich ist es ein Wunder, daß du überhaupt noch im Amt bist. Du hast es manchmal ganz schön bunt getrieben.«
»Halb so schlimm«, sagte Hoffman.
»Na, zum Beispiel … mit diesem, na, diesem leichten Mädchen in Kenia. Das ging wirklich zu weit, Felix, wenn du mich fragst, zu weit.«
»Wollen wir nicht von was anderem reden, Wim? Ich hab dich eingeladen, damit wir was feiern. Ich hätte nicht davon anfangen sollen. Dumm von mir.«
Er lenkte die Unterhaltung auf Kollegen, und bald ließ ihr Klatsch den Vorfall in Kenia wieder in den Verliesen seines Gehirns verschwinden, wo er hingehörte.
In der Küche seines neuen Hauses setzte sich Hoffman wieder vor sein Buch, das geduldig am Champagnerkühler lehnte. Ohne Wims Hilfe wäre er jetzt ein verbitterter kleiner Beamter. Sein neuer Rang bewirkte, daß sich die Pension nach seinem ehrenvollen Abschied um gute zwanzig Prozent erhöhen würde, und obwohl er nicht mit einem langen Leben nach der Pensionierung rechnete und das Geld eigentlich nicht nötig hatte, beruhigte es ihn doch, über ein festes Einkommen zu verfügen, wenn sein Arbeitsleben zu Ende war.