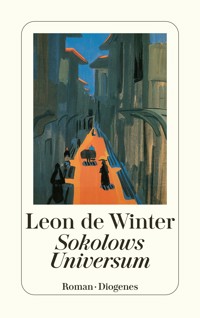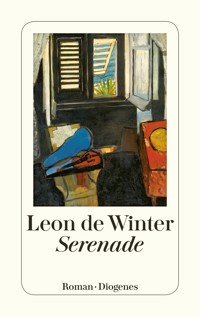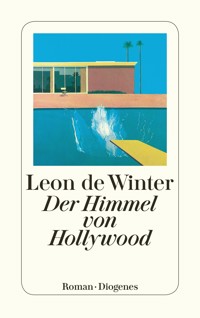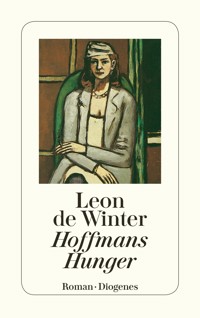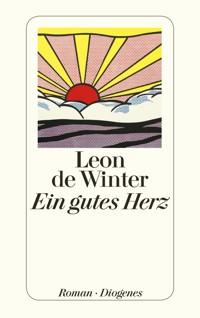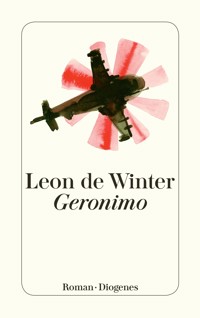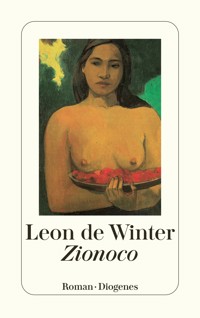
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
De Winter beschreibt mitreißend und ergreifend die tragikomische Suche nach dem unerreichbaren Vater. Rabbi Sol Mayer verkauft in New York absolute Wahrheiten und zweifelt dennoch: an Gott, an seiner Ehe und am selbst erlebten Wunder, das den Lebemann und Taugenichts bewogen hatte, Rabbi zu werden wie sein Vater. Als er sich in eine junge Sängerin verliebt, bringt das nicht nur seine Hormone durcheinander.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Leon de Winter
Zionoco
Roman
Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers
Diogenes
Für Moos und ebensosehr für Jessica
Wer nicht an Wunder glaubt
ist kein Realist.
Jüdische Redensart
Nordamerika – im Frühjahr 1994 –
1
Die Boeing 737 stand auf dem in Regenschleier gehüllten Logan International in Boston und wartete auf die Starterlaubnis für den kurzen Flug nach La Guardia in New York. Sol Mayer war auf der Rückreise von einem Kongreß über »Die Rolle des Rabbiners in einer sich verändernden Gesellschaft«, und die Frau, die zu seiner Überraschung neben ihm Platz nahm, hatte er am Abend zuvor von weitem bewundert.
Sie war die Sängerin der fünfköpfigen Band, die das Abschlußdiner mit jazzigen Evergreens und Ballads, zu melancholischen Schmachtfetzen umarrangierten bekannten amerikanischen Liedern, untermalt hatte. An seinem Tisch hatte man sich kurz über die Musik unterhalten, und ihm war nicht entgangen, welches Interesse seine Kollegen der Quelle des Gesangs entgegenbrachten. Sie trug ein schwarzes Kleid, das ihre Beine – sie steckten in schwarzen Strumpfhosen – weitgehend unbedeckt und Knöchel, Waden und den Ansatz der Oberschenkel vorteilhaft zur Geltung kommen ließ; ziemlich gewagt für einen Festabend von Rabbinern. Dunkelbraunes langes Haar, betont nachlässig hochgesteckt, umrahmte ihr ovales Gesicht. Ihre expressiven Augen blieben unbeirrt von den Blicken der jüdischen Seelsorger in den farblosen Anzügen, die in der kühlen Pracht des Hotels dinierten und krampfhaft versuchten, ihr Staunen über diese aufregende Erscheinung zu verbergen.
Nach einer kurzen Pause kehrte sie, von zögerndem Applaus begrüßt, in einem Kleid zurück, das ihr nun zwar bis über die Knie reichte, dafür aber ein eng anliegendes Oberteil hatte. Sie hatte kleine Brüste und schutzsuchende, verletzliche Schultern. Sol betrachtete sie, wie er auch andere attraktive Frauen betrachtete, angetan von den Reizen der Schöpfung und sich gleichzeitig seiner eingeschränkten Möglichkeiten deutlich bewußt.
In dem opulenten Speisesaal des Hilton Hotels, eine kalte Platte mit geräuchertem Lachs vor sich (häufig dieselben Gänge bei solchen Diners: vorausgesetzt der Rabbiner gab nicht ausdrücklich zu verstehen, daß er sich an die Kaschruth-Vorschriften hielt, bekam er zunächst Hühnerbrühe, dann ein Stückchen Lachs, anschließend gebratenes Hähnchen und zum Abschluß etwas Obst), rutschte er unruhig auf seinem Stuhl hin und her, als sich das betörende Bild ihres Körpers – ohne Kleid und Strumpfhose – in seine Vorstellung schlich.
Die Synagoge, der er angehörte, stand in der Fifth Avenue, und die attraktivsten Schauspielerinnen und Models ließen sich auf deren Bänken nieder, um seinen Predigten zu lauschen. Sol war sich seines rhetorischen Geschicks und seines südländischen Aussehens mit dem starken Bartwuchs, der mindestens zwei Rasuren am Tag erforderte, durchaus bewußt, und wenn er auf eine Karriere als Ehebrecher aus gewesen wäre, hätte er sich schon vor Jahren die Seele aus dem Leib vögeln können. Aber er war treu. Und ängstlich. Und vorsichtig. Er hatte noch das ganze Leben vor sich, und seine jetzige Stellung versprach eine Zukunft in materiellem Überfluß. Für eine Bettgeschichte mit einer Modepuppe oder Sängerin würde er seine Existenz nicht aufs Spiel setzen.
Gegen Mitternacht verabschiedete er sich von seinen Kollegen. Sie stand nicht im Fahrstuhl, er begegnete ihr nicht auf dem Flur, sie fand keinen Eingang in seine Träume in dem übergroßen Bett. Doch jetzt, einen Tag später, setzte sie sich in der Boeing neben ihn, und er fragte sich, ob er das als Geschenk oder als Fluch betrachten sollte.
Sie nickten sich distanziert zu. Sie trug verwaschene Jeans, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Lederjacke mit abgewetzten Stellen, und ihr Gesicht war zum größten Teil hinter den Vorhängen ihres offenen Haars versteckt, das er gern berührt hätte. Soweit er sehen konnte, war ihr Gesicht, im Gegensatz zum gestrigen Abend, ungeschminkt. Sie setzte sich, und er erhaschte dabei einen Blick auf ihren wohlgeformten Hintern in der engen Hose.
Der Flugkapitän meldete sich über den Bordlautsprecher zu Wort (»Ich muß Ihnen leider mitteilen, daß wir ein wenig Verspätung haben«) und versuchte den erwartungsgemäßen Unmut in der Maschine zu beschwichtigen. Dem Stimmengewirr hinter sich entnahm Sol deutliche Verärgerung. Eine halbe Stunde Verspätung. Seine Nachbarin bemerkte: »So lange dauert ja beinahe der ganze Flug.«
Kein sonderlich bemerkenswerter Satz. Sol nickte und wollte sich wieder dem Artikel zuwenden, den er gerade las. Doch er tat etwas anderes. Er sprach die Worte aus, die – seltsamerweise – in der Luft zu liegen schienen. Er sagte: »Wenn die Wartezeit zu lang wird, könnten Sie vielleicht eines Ihrer wunderbaren Lieder singen.«
Überrascht sah sie ihn an: »Wie meinen Sie das?«
Er antwortete: »Ich habe Sie gestern abend singen hören.«
Sie strich sich das Haar zurück und unterzog ihn einem forschenden Blick. Kein Make-up, keine Ohrringe, keine Kette um den vollendeten Hals. In ihrem lebhaften Gesicht steckte etwas Unsicheres, etwas Unschuldiges und Kindliches, und er sah, daß sie nach einer gefaßten Entgegnung suchte. Nach einigen Sekunden wußte sie nichts anderes zu sagen als: »Ha, so ein Zufall.«
Wie auf ein Zeichen zogen sie sich in ein unbehagliches Lächeln zurück und schlugen die Augen nieder. Wahrscheinlich hatte die Nervosität, die er bei sich wahrnahm, gar nichts mit dieser Frau zu tun. Vielleicht entsprach sie zufällig seinem Schönheitsideal, wenn er sich auch nicht bewußt war, so etwas überhaupt verinnerlicht zu haben. Hoffentlich war es nur das – die Entdeckung, daß es ein menschliches Wesen gab, welches seine ästhetischen Maßstäbe zutage förderte.
Die letzten Passagiere der Business Class suchten ihre Sitzplätze auf, und eine Stewardeß bot Orangensaft und Champagner an, die unnötigen Beigaben zu ihren kostspieligen Tickets. Sie nahm Champagner, und er verschmähte den Saft, um ihrem Beispiel zu folgen. Normalerweise trank er nur zum Abendessen Alkohol und ganz sicher nicht am Vormittag, weshalb also jetzt? Weil er etwas mit ihr teilen wollte, wurde ihm bewußt, weil er das Strahlen ihrer Augen suchte. Erneut nickten sie sich zu, diesmal, um sich zuzuprosten, und nervös trank er das Glas in einem Zug aus.
»Durst«, erklärte er beklommen, als er das leere Glas abstellte. Er wußte nicht, zu wem er das eigentlich sagte.
Sie lächelte und öffnete die Lippen. »Wer nicht?« fragte sie. Er sah, daß auch ihr Glas geleert war. Ewiger Himmel, betete er, ersticke die Begierde meines Schoßes. Eine Sängerin.
»Ich trinke nur zum Essen«, entschuldigte er sich.
»Ich, wenn ich Durst habe.«
»Ich könnte nicht arbeiten.«
»Ich nicht ohne«, sagte sie unumwunden. War das ihr Ernst oder nur die großspurige Antwort einer verlegenen Seele?
Er lächelte breit und gab so etwas wie ein Schnauben von sich, einen Luftstoß durch die Nasenlöcher, der verbergen sollte, daß ihm keine Entgegnung einfiel. Er führte sich auf wie ein Volltrottel.
»Jeder ist eben anders«, sagte er und schämte sich für die Banalität seiner Worte.
»Anders und doch gleich.«
Er wußte nicht genau, was sie meinte. Was war anders, und was war gleich? Die Maßstäbe, nach denen sie wertete, urteilte und einordnete, waren ihm unbekannt. Vermutlich spielte sich ihr Leben in Proberäumen und Künstlergarderoben hinter Bars und Festsälen ab, und die Begriffe, mit denen er sich herumschlug, interessierten sie nur ganz am Rand. Was wußte er schon vom Leben einer Sängerin? Was wußte sie vom Leben eines Rabbiners?
Die Stewardeß belohnte die Geduld der Erste-Klasse-Passagiere mit einer Extrarunde. Diesmal nahm er ein Glas Saft vom Tablett. Die Frau blieb bei Champagner.
»Sind Sie schon lange Sängerin?«
Diese Frage war zwar auch nicht gerade sehr originell, aber er fand, daß er seiner Neugier hinsichtlich ihrer Gedankenwelt durchaus nachgeben konnte. Er hätte am liebsten festgestellt, daß sie gar keine besaß und nicht mehr war als eine leere Hülle. Und wer würde sich schon von einer leeren Hülle angezogen fühlen?
»Fünf Jahre etwa.«
»Ist das ein hartes Leben?«
»Nicht, wenn es einem Spaß macht.«
»Macht es Ihnen denn immer Spaß?«
»Meistens schon. Wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme.«
Sie hatte nicht das Bedürfnis, sich zu unterhalten. Er genausowenig.
»Fein«, sagte er und beugte sich aufs neue über die Zeitschrift, die er am Hotelkiosk gekauft hatte. Er zwang sich, ihre Anwesenheit zu vergessen und nicht an die Beine zu denken, die da vorn auf der Bühne des weiträumigen Speisesaals den Takt der Songs begleitet hatten. Rhythmisch hatte sie die Hacke eines Fußes in den schwarzen Pumps bewegt oder die Knie leicht von links nach rechts geschwungen. Manchmal reckte sie sich und spannte die Muskeln ihrer langen Beine an – sie steckten jetzt in Strumpfhosen mit einem Satinschimmer. Die Linien ihrer Beine weckten unweigerlich die Begierde nach der Stelle, an der sie zusammenliefen. In diesem Saal voller gelehrter Juden leuchtete ihre Körperlichkeit auf wie eine Flamme in der Wüstennacht.
Den Artikel, den Sol Mayer zu lesen versuchte, hatte er selbst geschrieben. Die Zeitschrift war eine Ausgabe von Shalom, einem der wichtigsten Sprachrohre des progressiven Judentums in Amerika, in dem Sol regelmäßig etwas über rabbinische Angelegenheiten veröffentlichte. Dieser Artikel befaßte sich mit dem moralischen Gehalt des rabbinischen Lebens. Er hatte ihn aufgrund der Sache mit dem chassidischen Rabbiner Jossi Finkelstajn geschrieben, der im Zusammenhang mit der Entführung eines Millionärssohns verhaftet worden war. Für Sol der geeignete Aufhänger, um den chassidischen Anspruch auf die Wortführerschaft für das gesamte Judentum anzugreifen.
Im Gegensatz dazu, wie die Chassíden mit ihren Gegnern verfuhren (wer nicht für sie war, war gegen sie), hatte er nicht alle Ultraorthodoxen über einen Kamm scheren, sondern den kriminellen Chassiden lediglich als ein Symptom beschreiben wollen.
Wie viele von ihnen hatte der kinderreiche, fromme Finkelstajn große Geldsorgen: Der Ewige hatte ihn mit acht Töchtern und nur zwei Söhnen gesegnet, was bedeutete, daß er das Vermögen für acht Aussteuern zusammenzubringen hatte. Von der Angst getrieben, daß er sein Ansehen innerhalb seiner Gemeinde verlieren würde, wenn er seinen Töchtern nur magere Aussteuern mitgeben konnte, kam Finkelstajn auf den Gedanken, sich durch Erpressung das nötige Kapital zu beschaffen. Sol hatte ihn als tragisches Opfer einer antiquierten Tradition beschreiben wollen, als einen von vielen, die das Judentum als ein System schizophrener Rigidität auffaßten, aber er mußte gestehen, daß der Ton härter, aggressiver und arroganter ausgefallen war, als er es beabsichtigt hatte.
Der Regen schlug gegen die Kabinenfenster. Die Sängerin blätterte in einer Zeitschrift. Unauffällig versuchte Sol die Schlagzeilen über den Artikeln zu lesen und stellte verwundert fest, daß es sich um eine Ausgabe des Scientific American handelte. Ging ihr also doch mehr im Kopf herum als nur die Songtexte von Cole Porter und Burt Bacharach? Unterschwellig hatte er sie verurteilt, was ein Beweis für seine Blasiertheit und sein seelenloses Überlegenheitsgefühl war. Und selbst wenn sie nur die Reime anderer nachplappern konnte, durfte er die Besonderheit ihres Wesens – von dem er keinen blassen Schimmer hatte – nicht herabmindern oder verkennen. Sie hatte genausoviel Anrecht auf den Sauerstoff in diesem Flugzeug wie er.
Sie stand auf und zog sich hinter die WC-Tür zurück. Sie war noch größer, als er gestern auf die Entfernung hatte beurteilen können, so um die eins achtzig, schätzte er; die Rückseite ihrer Beine verriet feste Schenkel, und der Übergang zum Po versprach eine Wölbung, vollendet wie ein Kunstwerk – gequält schloß er die Augen und schüttelte den Kopf: Was, um Himmels willen, tat er da, warum gab er sich diesen unsinnigen Beobachtungen hin? Über die Menschheit (für ihn ein bedeutungsvoller Begriff), über die Moral, die Jugend, den Krieg, Afrika, die modernen Medien, die Gewalt im Fernsehen, den aufkommenden Fundamentalismus (von jüdisch bis islamisch), die Umwelt, die Ozonschicht, die Verschwendung, den Überfluß, den Hunger, die Armut, den Bevölkerungszuwachs, die Verschmutzung der Meere, die Walfische, die Massentierhaltung, künstliche Duft- und Geschmacksstoffe, über das alles und noch mehr machte er sich Sorgen. Aber das gab ihm keinen Freibrief dafür, sich an einer unbekannten kleinen Sängerin zu weiden, einer Schickse vermutlich, deren gesamtes Wesen von seinen wollüstigen Augen zu einer Möse mit Gliedmaßen reduziert wurde. Er schämte sich.
Die Stewardeß machte zum drittenmal die Runde. Das salzige Hotelfrühstück – Rührei mit Räucherlachsstreifen – hatte ihn durstig gemacht, und er bestellte ein Glas Tomatensaft. Pfeffer, Tabasco? Nein, danke. Sie stellte das Glas auf die breite Armlehne zwischen den beiden Sitzen, und er las das Namensschildchen der Stewardeß: Anne Goldstein. Welche Bedeutung mochte ihre Abstammung für sie haben? Für viele jüdische Amerikaner war dieser Hintergrund nicht mehr als eine frivole Verkomplizierung ihrer amerikanischen Identität. Sol war in den Niederlanden geboren. Seine Eltern stammten aus Familien, die generationenlang Töpfe und Pfannen, Streichhölzer, Kleidung, Stoffe und andere Handelswaren über die Deiche geschleppt hatten. Ein Dasein voller Unsicherheiten, voller Ängste und Bedrohungen, in dem sich das Judentum als Reaktion auf die schwersten Entbehrungen zu einer Überlebenskunst entwickelt hatte. Die meisten amerikanischen Juden dagegen praktizierten ihre Religion so, wie die Baptisten oder Katholiken es tun konnten, nämlich als etwas, dem in der Freizeit nachgegangen wurde, ohne daß die restriktive Seite – die Verbote, die Pflichten – den Alltag belastete. Ein entfernter europäischer Verwandter, der in einer Gaskammer umgebracht worden war, erhöhte sogar den exotischen Charme, den der Glaube der Hebräer ausstrahlte, wie eine Lage Furnier auf einer Spanplatte. Der jüdische Amerikaner war nicht einfach nur ein auf Modewellen mitschwimmender, oberflächlicher Konsument in den großen Vereinigten Staaten, nein, er hielt Tuchfühlung mit den Schlimmsten Auswüchsen der Geschichte und der Ältesten Tradition. Judesein war hier eine Form von Snobismus.
Sol übertrieb, dessen war er sich bewußt. Vielleicht läutete das moderne amerikanisch-jüdische Leben ja die endgültige Befreiung aus dem Ghetto ein. Er predigte vor wohlhabenden Menschen, die aufrichtig Anteil nahmen am Schicksal von Minderheiten, Obdachlosen, Armen und Farbigen, die in den Innenstädten verelendeten, und er hielt ihnen Ideen und Gedanken vor, ohne den politisch korrekten Clown zu spielen. Aber er wußte nicht, ob sie als Juden lebten. Und damit meinte er etwas, was von der Kontroverse zwischen dem orthodoxen, dem konservativen und dem Reformjudentum nicht berührt wurde. Er war zwar nicht ohne Grund ein liberaler Rabbiner, doch was seine Meinung über den Wert des disziplinierenden Charakters der jüdischen Tradition betraf, so teilte er diese mit seinen strenggläubigeren Kollegen.
Die Sängerin verließ die Toilette und steuerte wieder den Sitz neben Sol an. Erneut war er von ihrer Schönheit gefangen, und er schloß die Augen, um ihr Nachbild so lange wie möglich festzuhalten. Sol steckte voller Widersprüche. Er war Moralist, und zugleich kapitulierte er im stillen vor etwas, womit er die Geregeltheit seiner Existenz durcheinanderbrachte. Zu Hause, bei Naomi, hatte er dieses Verlangen nach gedankenloser Intimität zu erleben, nicht in einem Flugzeug bei einer kleinen Sängerin.
Er öffnete die Augen und sah, daß sie ihre Zeitschrift vom Sitz nahm. Während sie sich setzte, stieß sie mit der Zeitschrift sein Glas Tomatensaft um. Bevor er aufspringen konnte, schwappte ihm der rote Inhalt des Glases über den Schoß. Intuitiv schrie er auf (zusammen mit der Sängerin, wie er hörte), und mit erhobenen Händen, als müsse er die um jeden Preis sauberhalten, blickte er schreckerstarrt auf den Tomatensaft, der seine Hose, sein Hemd und die Ärmel seines Jacketts besudelt hatte. Indigniert warf er ihr einen kurzen Blick zu und sah ihre erschrockenen Augen. Er wandte sich wieder dem Malheur zu und hörte sie sagen: »Es tut mir furchtbar leid, wirklich, ich hatte das Glas nicht gesehen, ich werde es saubermachen, bleiben Sie sitzen.«
Sie richtete sich auf, um ihren Sitz zu verlassen, aber die Stewardeß war bereits mit Servietten und einer Flasche Wasser herbeigeeilt. »Darf ich mal eben?«
»Ich mach das schon«, entgegnete die Sängerin resolut.
Sie nahm die Servietten, sprenkelte etwas Wasser darauf und beugte sich zu ihm hinüber. Er roch ihre Haare. Mit den nassen Tüchern berührte sie seine Oberschenkel, und er fühlte, wie die Feuchtigkeit durch den Stoff drang.
»Das Schlimmste werden wir schon wegbekommen, und Ihre Wäscherei erledigt dann den Rest. Haben Sie eine zweite Hose dabei?«
»In meinem Koffer.«
»Vielleicht können Sie die nachher auf La Guardia anziehen. Es tut mir wirklich sehr leid. Blöd, daß ich das Glas nicht gesehen habe.«
»Kann passieren«, sagte er, ohne ihr etwas vergeben zu wollen.
»Vielleicht kommen Sie doch besser kurz mit mir mit«, beharrte die Stewardeß, »dann können wir es hier in der Pantry etwas gründlicher behandeln.«
Sol sah ein, daß sie recht hatte, blieb aber trotz der Verärgerung und des Schocks über das Mißgeschick sitzen. Wenn er sich der Sängerin etwas mehr nähern würde, könnte er mit der Zunge ihr Ohr streicheln und ihr sanft ins Ohrläppchen beißen. Er hielt den Atem an bei dem Gedanken, daß er sich womöglich nicht beherrschen könnte. Es war bestimmt dreizehn Monate her, seit er mit Naomi geschlafen hatte, und er fragte sich, ob die Enthaltsamkeit vielleicht Auslöser für diesen Irrsinn war.
Die Sängerin bewegte sich mit ihrem Tuch nun auf seinen Hosenschlitz zu, und unwillkürlich sagte er: »Den Rest mach ich schon selbst.«
»Ja?«
Die Frage erübrigte sich. Selbstverständlich konnte sie den Stoff dort nicht säubern.
Er stand auf, nahm Abstand von ihrem Hals und ihrem Ohr und folgte der Stewardeß in die Pantry. Die Blicke von Mitreisenden begleiteten ihn. Die Stewardeß zog den Vorhang zu und bot ihm saubere Papiertücher an. Er tupfte sich den Saft von der Kleidung, doch es blieben Flecken zurück, die er nicht wegbekommen konnte.
Der Flugkapitän gab durch, daß sie eine Startposition zugewiesen bekommen hätten und nun gleich abfliegen könnten.
»Wenn es ein bißchen getrocknet ist, wird es schon gehen«, sagte er.
»Müssen Sie noch weit reisen?« fragte die Stewardeß.
»Manhattan.«
»Die Wäscherei wird den Rest schon herausbekommen.«
Er bedankte sich bei ihr und kehrte in die Kabine zurück. Die Sängerin hatte ihren Platz verlassen. Die Tür des Flugzeugs wurde geschlossen, und die Maschine entfernte sich rückwärts vom Flugsteig. Die Stewardeß zeigte die Sicherheitsvorschriften und führte vor, wie man die Sauerstoffmaske aufsetzt. Noch immer regnete es, die Betonfläche des Rollfeldes lag naß glänzend unter drohenden Wolken. Er sah nach der Anzeige der Toilette, aber die verriet, daß die Tür nicht verschlossen war. Hatte sie im letzten Moment das Flugzeug verlassen? Als die Motoren angingen und das Flugzeug zur Startbahn zu rollen begann, fragte Sol den Purser, der die Sicherheitsgurte der Passagiere kontrollierte, wo seine Sitznachbarin geblieben sei.
»Sie hatte ein Economy-Ticket. Saß hier falsch. Geht’s?«
»Ein Fall für die Wäscherei.«
»Wenn ich Sie wäre, würde ich ihr die Rechnung schikken.«
Sol nickte, wenn er so etwas auch niemals tun würde.
Der Purser wünschte ihm einen guten Flug, und Sol fragte sich laut: »Saß sie hier versehentlich oder …?«
Der Mann hob die Schultern: »Manche probieren es immer wieder. Und natürlich entgeht es uns mitunter auch. Wenn die Business class nicht voll besetzt ist, gibt es immer Economy-Kunden, die es mal versuchen.«
Fünf Minuten später hob die Maschine von der Startbahn ab und schoß in die Wolken hinein. Die Lichtverhältnisse verschlechterten sich, als wäre plötzlich die Dämmerung hereingebrochen, und die Schrauben und Bolzen der Boeing wurden von wilden Sturmböen auf die Probe gestellt. Sie hätten nicht abfliegen dürfen, konstatierte Sol, verwerfliche Überlegungen (eine Maschine am Boden kostete Geld, in New York warteten Passagiere auf einen Flug nach Boston) hatten den Kapitän zu seinem Entschluß bewogen. Das Leben von hundert Menschen war in Gefahr. Sol zog eine Ausgabe des Boston Globe aus seiner Tasche und blätterte die Zeitung durch. Weniger um zu lesen, als vielmehr um der Beruhigung willen, die von der Blätterei ausging. Jemand, der ruhig in einer Zeitung blättert, stürzt nicht ab.
Im Lokalteil stieß er auf einen Artikel über den Kongreß. Sein vorgestriger Vortrag wurde als »klar« und »gerade noch am Rande des Ideengutes des liberalen Judentums« beschrieben. »Es fehlt nicht mehr viel, und Rabbi Sol Mayer, der Julio Iglesias des progressiven Judentums, ist nicht mehr der liberalste der Liberalen, sondern ein Reformer, der seine Mutterkirche à la Luther in eine Art jüdische New-Age-Kirche überführen möchte.«
Sol hielt das für eine unsinnige Beschreibung seiner Person und seiner Ausführungen. Er hatte dafür plädiert, größeren Nachdruck auf die Rolle der Natur zu legen. Der Siegeszug der menschlichen Kultur über die ärgsten Launen der Natur habe im zwanzigsten Jahrhundert seinen definitiven Höhepunkt erreicht, hatte er seinen Kollegen aufgezeigt, sei nun jedoch dabei zu pervertieren. Noch immer halte der Jude an jahrtausendealten Denkbildern fest, die ihren Ursprung in einem Leben in der Wüste hätten, wo die Natur in jeder Weise lebensbedrohlich gewesen sei. Er plädierte für einen vorsichtigen Umgang mit Thora-Passagen, die die menschliche Überlegenheit – wie etwa bei der Opferung von Tieren – in nicht mehr zeitgemäßer Weise darstellten. »Gott hat uns als gespaltene Wesen erschaffen: Wir sind Sein Ebenbild, und zugleich sind wir Säugetiere, die auf zwei Beinen zu laufen gelernt und ihre Hände für die Fertigung von Artefakten frei gemacht haben. Diese Gespaltenheit ist in meinen Augen eine Qualität, mit der wir auf positive Weise umgehen müssen.«
Ein vernichtender Knall, lauter als alles, was er je gehört hatte (bis auf das Konzert von Led Zeppelin, das er irgendwann während seiner verspielten Jahre besucht hatte), warf die Maschine aus ihrer unsicheren Bahn, und für den Bruchteil einer Sekunde leuchtete es draußen auf. Sie waren in ein heftiges Gewitter hineingeflogen. Erschrocken ließ er die Zeitung fallen und klammerte sich an seinem Sitz fest. Der nächste Donnerschlag warf die Maschine nach rechts, und er flog beinahe aus seinem Sitz. Hinter ihm ertönten Schreie. Er suchte die Augen der Stewardeß und des Pursers, die mit dem Gesicht zur Kabine in der Pantry saßen und bleich auf einen Punkt nahe ihren Füßen starrten. Sie hatten genausoviel Angst wie Sol. Die Maschine versuchte das Gleichgewicht wiederzufinden, er spürte, daß die Umdrehungsgeschwindigkeit der Motoren schwankte. Dann fiel die Beleuchtung aus. Seine bangen Ohren fingen auf, daß der Lärm der beiden Motoren stark nachließ und im Gebrüll des rasenden Windes unterging. Die Maschine sank, und der Druck auf seine Ohren nahm so zu, als würde er auf den Boden eines tiefen Sees sinken. Eine Serie von Blitzen beschien die panischen Gesichter der beiden Besatzungsmitglieder, und hinter ihm wurde geschrien und gewimmert. Ein Besessener stimmte lauthals das Starspangled Banner an und erhielt Beifall von anderen zum Tode Verurteilten, die offenbar alle als Patrioten zu sterben wünschten, doch Sol blieb stumm und kniff krampfhaft die Augen zu.
Er sah seine Eltern, als sie noch jung waren und mit ihm zu dem Denkmal auf dem Dam in Amsterdam spazierten, er sah die Flure ihres Hauses aus dem siebzehnten Jahrhundert an der Herengracht und den betrübten Blick seiner Mutter, als sie in ihrem Bett vom Krebs ausgehöhlt wurde, und er sah die letzte Grußgebärde seines Vaters, als er in das Flugzeug nach Surinam stieg, wo er in einem tropischen Fluß ertrinken sollte, und er sah das Glas unter seinem Schuh, als Naomi mit ihm vermählt wurde, und dann sah er, während die Boeing durch schwarze Wolken fiel, die Sängerin, die gestern abend für ihn gesungen hatte. Er sah ihre Ohrmuschel und die feinen Härchen auf ihrem Ohrläppchen. Er würde die Frau nie kennenlernen, bedachte er, für immer würde sie ein Mysterium für ihn bleiben, eine Sängerin, die den Scientific American las und, ohne einen Aufpreis zu bezahlen, in der Business class reisen wollte. Ob sie jetzt wohl die Nationalhymne mitsang? War sie jetzt genauso ängstlich wie er, schweißgebadet wie nach dem Viertelmarathon durch den Central Park? Von Liebe, Sehnsucht und Treue hatte sie gesungen, und diese abgedroschenen Wörter hatten durch ihre Lippen neuen Glanz gewonnen. Niemals würde er den schwarzen BH-Träger von ihren glatten Schultern schieben, niemals würde er sie aus einem spitzenbesetzten Höschen steigen sehen, halb vorgebeugt, doch mit geradem Rücken und prüden Knien, niemals würde er mit dem Gesicht zwischen ihren Schenkeln in ihr ertrinken.
Seine Ohren hörten das erlösende Brummen der Motoren, und sein Körper registrierte, daß der Sturzflug verlangsamt und nach einigen Sekunden ganz beendet wurde. Eine Minute später ging das Licht an, und in der Kabine wurden Jubelrufe und Klatschen laut. Mit fester Stimme, so als sei das gerade nur ein kleiner Spaziergang gewesen, erzählte der Kapitän, daß der Blitz die Bordcomputer durcheinandergebracht habe und sie nun per Handsteuerung nach La Guardia fliegen würden. Die Passagiere bräuchten sich keine Sorgen zu machen, die Besatzung sei darauf trainiert und sie würden bei der Landung in New York vorrangig abgefertigt werden.
Die Bewölkung nahm ab, und das Dämmerlicht löste sich in die Normalität eines ganz gewöhnlichen Donnerstagvormittags auf.
Mit verspannter Muskulatur und rauschenden Ohren verharrte Sol Mayer regungslos in seinem Sitz, bis die Reifen die Rollbahn berührten, bange, daß eine falsche Bewegung die Maschine aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Während des Sturzfluges hatte er sich damit abgefunden, daß sein letztes Stündlein geschlagen hatte, und nun glich die Fortsetzung seines Lebens einem Geschenk, das der Empfänger ganz verwirrt öffnet. Er hatte eigentlich kein Recht mehr darauf, denn er hatte ihm bereits entsagt. Beiläufig, instinktmäßig, ohne hysterisch zu werden, hatte er seine letzten Sekunden durchlebt. Glückselig fühlte er sein Herz rasen, das noch immer unter dem Einfluß enormer Adrenalinstöße stand, aber gleichzeitig ergriff ihn auch eine seltsame Traurigkeit über seinen so gelassenen Abschied. Obwohl er mit der attraktiven Tochter einer der reichsten Frauen Manhattans verheiratet war und sich auf einen Platz in der obersten Schicht der mächtigsten Nation der Welt zubewegte, hatte er in dem Moment, da sein Leben zu Ende zu gehen drohte, nach einer unerreichbaren Möse gelechzt.Sol kam zu dem Schluß, daß er, ohne den schleichenden Prozeß wahrgenommen zu haben, total verrückt geworden war.
2
Sols Taxi bog vor dem Plaza Hotel in die Central Park South ein. An der Ecke des Parks warteten naßgeregnete Kutschen hinter Pferden mit Regenschutz auf japanische Touristen, und Obdachlose nutzten eine Pause zwischen zwei Schauern dazu, sich ein paar Münzen zusammenzubetteln. Die großen, eckigen Taxis holperten über den schadhaften Asphalt an den Hotels gegenüber dem Südrand des Parks entlang, und Sol wies den Fahrer an, die Auffahrt von 210CPS zu nehmen.
Der uniformierte schwarze Chefportier, der seit der Anschaffung seines Anzugs bestimmt fünfzig Pfund zugenommen hatte, hob den Koffer aus dem Kofferraum, während Sol bezahlte. Noch immer hatte er die Neigung, dem Mann zuzurufen, daß er das selber machen könne, auch wenn er mittlerweile gelernt hatte, daß er damit dessen Existenzberechtigung in Frage stellte. Nie würde er sich die Selbstverständlichkeit aneignen, mit der reiche Amerikaner ihr Personal behandelten. Niederländischer Calvinismus.
»Gute Reise gehabt, Rabbi?«
»Ja, prima, Donnie. Hat es stark geregnet?«
»Wie aus Kübeln, Rabbi. Der liebe Herrgott wollte wohl den Abschaum von den Straßen spülen.« Der Portier spielte auf die Obdachlosen an, die am Parkrand biwakierten.
»War’s denn so schlimm? Auch diese Menschen haben ein Daseinsrecht, Donnie.«
»Sie sind zu tolerant, Rabbi. Jeder muß sich sein Brot verdienen.«
Sol begegnete in Donnies Kommentaren häufig dem paradoxen Konservatismus jener Gruppen, die mit dem Liberalismus eigentlich besser fahren würden, doch aus Wissensmangel und Angst vor Veränderung die Uhr zurückdrehen wollten, was für viele Republikaner gleichbedeutend war mit einer Rückkehr zu den guten alten fünfziger Jahren. Über den Dreck schimpfend, den die Obdachlosen hinterließen, trug Donnie den Koffer durch die marmorne Empfangshalle und wartete, bis Sol den Fahrstuhl betrat. Der Koffer hatte Rollen, aber Donnie wünschte ihn zu tragen. Heute wurde der Fahrstuhl von Alfredo bedient, einem düster dreinblickenden, kurzgeschorenen Puertoricaner mit dem Körperbau eines Gewichthebers. Im Gegensatz zu Donnie trug er keine Uniform, sondern ein schlichtes weißes Hemd, schwarze Hosen und stets blinkende Schuhe.
Sol bedankte sich bei Donnie und ließ sich in den zwanzigsten Stock hinauffahren.
»Geht’s gut, Alfredo?«
»Sehr gut, Rabbi.«
»Auch mit Helena?«
»Sie ist wieder ganz in Ordnung, Rabbi.«
»Ein Glück. Und die Kinder?«
»Die sind richtig gut in der Schule.«
»Schön. Irgendwas vorgefallen?«
»Ihre Schwiegermutter ist oben.«
»Schön. Sonst noch was?«
»Und die Schwester Ihrer Frau.«
»Tamar? Die mit den kurzen Haaren?«
»Ja, Rabbi. Sie weinte.«
»Ach.«
Er steckte Alfredo einen Fünfdollarschein zu. »Schöne Schuhe, Alfredo.«
»Danke, Rabbi.«
Die Tür öffnete sich, und Sol betrat die Eingangshalle seines Penthouse, vierhundert Quadratmeter, rundum Terrassen, Sauna, fünf Badezimmer, zwei Küchen, Eigentum seiner Schwiegermutter, das sie ihrer Tochter kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Manuela, von Donnie instruiert, erwartete ihn bereits und nahm Alfredo den Koffer ab.
»Fein, daß Sie wieder zu Hause sind.«
»Danke. Ist Besuch da?«
»Ja. Im Zimmer der gnädigen Frau.«
Bedächtig zog sie seinen mobilen Koffer in sein Ankleidezimmer. Sie wurde zu alt für diese Arbeit, aber mit Naomi zusammen hatte er beschlossen, sie zu behalten. Manuela hatte die breiten Hüften einer Frau, die viele Kinder zur Welt gebracht hat (elf, von denen sechs gestorben waren: zwei infolge von Krankheiten, vier durch Gewalteinwirkung), und die Schwielen an ihren Händen zeugten davon, daß sie seit ihrem zehnten Lebensjahr gearbeitet hatte. In den vergangenen zwanzig Jahren hatte Manuela so gut wie täglich in Harlem den Bus bestiegen, um dieses Apartment sauberzuhalten.
Sol betrat das glänzende Parkett, das den Boden des gesamten Apartments bedeckte, und klopfte an die Tür von Naomis Arbeitszimmer.
Ohne eine Antwort abzuwarten, ging er hinein und stellte fest, daß er in ein Familientreffen hineinplatzte. Auf dem roten Chesterfield am Fenster, den Rücken der Aussicht auf die nassen Dächer der West Side, den farblosen Hudson und das Grün von New Jersey zugewandt, saßen Naomi und Tamar und blickten zu ihrer Mutter auf, die in der Mitte des Zimmers einen Vortrag hielt. Jenny rauchte eine Zigarette und gestikulierte mit ihrer dicht beringten Hand.
»… denn ich hab ihm, ehrlich gesagt, nie getraut, da bin ich jetzt ganz offen, auch wenn das für dich schwer zu verkraften ist.«
Sie drehte sich um, als sie merkte, daß die Aufmerksamkeit ihrer Töchter abgelenkt war.
»Ha, Sol«, sagte sie, »du bist genau der Mann, den wir jetzt brauchen.«
Naomi kam ihm auf halbem Wege entgegen und begrüßte ihn mit einem Kuß, der einzigen Intimität, zu der sie in den letzten dreizehn Monaten imstande waren.
»Tag, Schatz«, sagte sie, »alles in Ordnung?«
»Natürlich. Und hier?«
»Ach …« Sie wollte es ihm unter vier Augen erzählen.
»Tag, Jenny.«
Er versuchte seine Schwiegermutter auf beide Wangen zu küssen, aber er spürte, daß sie sich das Make-up nicht lädieren lassen wollte. Er berührte ihre Schultern und fühlte ihre Knochen unter dem haarigen Kaschmirpullover. Sie litt nicht etwa an einer tödlichen Krankheit, sondern war von einem Schlankheitsideal besessen und wog höchstens hundert Pfund; dafür ernährte sie sich ausschließlich von Salat und fettfrei gedünstetem, salzlosem Gemüse. Vor zwei Jahren hatte sie sich die Falten entfernen lassen, wodurch ihre Augen etwas Mongoloides bekommen hatten und ihr Mund zu einem ewigen Grinsen verzogen worden war.
»Tag, Schatz. Zum Glück gibt es noch anständige Männer. Einer davon bist du.«
»Wenn Übertreibung eine Kunst wäre, würdest du den Nobelpreis dafür bekommen.«
»Du schmeichelst mir, aber ich wünschte, es wäre so.«
Er wollte Tamar begrüßen, doch sie schlug die Hände vors Gesicht und begann leise zu schluchzen.
»Kommst du mal eben, Sol?«
Er folgte Naomi auf den Flur hinaus. Ihr dickes, krauses Haar hing ihr offen über die Schultern, und er sah ihre fruchtbaren Hüften und Beine. Während er sich an den Körperformen einer Sängerin weidete, nahm sich seine Ehefrau in aller Unschuld der Sorgen und Nöte ihrer Schwester an.
Sie schloß die Tür hinter ihm und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Noch immer hatte sie volle, faltenlose Wangen, wodurch sie viel jünger aussah, und ihre weisen Augen unter vollendet geschwungenen Brauen suchten sorgenvoll sein Verständnis. Ihre Oberlippe war frisch epiliert. Sie hatte schwer mit Körperbehaarung zu kämpfen, der Kehrseite ihrer verschwenderischen schwarzen Haarpracht auf dem Kopf. Er legte die Hände auf ihre lieben Hüften.
»Ist etwas passiert?«
»Tom hat eine Affäre mit Maria.«
»Maria? Wer ist Maria?«
»Die Tochter von Victoria.«
»Victoria? Ihrer Haushälterin?«
»Ja, der Victoria. Maria ist ihre Tochter.«
Er wußte, wer Victoria war. Eine kleine Jamaikanerin, deren Gesicht keinerlei Erinnerung hinterließ.
»Was ist das da auf deiner Hose und auf deinem Ärmel?«
»Im Flugzeug hat jemand ein Glas umgestoßen. Tomatensaft.«
»Wäscherei. Hör zu. Tamar hatte eine Verabredung, aber die wurde unterwegs per Autotelefon abgesagt, und sie fuhr nach Hause zurück. Und weißt du, was sie in der Küche vorfand?«
»In der Küche?«
»Sie trieben es auf dem Butcherblock!«
»Was ist denn ein Butcherblock?«
»Ein Holztisch, auf dem man Gemüse schneidet, Fleisch entbeint, na, einfach ein separater Tisch zum Schneiden. Bist du unterwegs begriffsstutzig geworden?«
»Ein bißchen müde. Und weiter?«
»Na, was denkst du? Tom hatte die Hose auf den Knöcheln hängen, und sie schaute direkt auf seinen nackten Hintern, und Maria lag da mit den Füßen auf seinen Pobacken, und sie waren … heftig miteinander zugange.«
Dumm von seinem Schwager, dachte Sol. Zu Hause in der Küche.
»Auf dem Butcherblock«, wiederholte er.
»Ist das das einzige, was du dazu zu sagen hast?«
»Nein, natürlich nicht. Ich finde es fürchterlich für Tamar. Aber das klingt schon ziemlich extrem, auf dem Butcherblock. Als wollte er damit etwas demonstrieren.«
»Sol, du redest Unsinn.«
»Ja? Na gut, vielleicht. Und weiter?«
»Sie ist dann gleich zu mir gekommen. Wir haben Jenny angerufen, und die Hölle ist losgebrochen. Tamar will sich scheiden lassen.«
»Scheiden? Sie sollte erst mal ein wenig Abstand gewinnen und die ganze Sache abkühlen lassen.«
»Es ist gerade erst passiert, sie ist völlig außer sich. Sie bekommt nachher gleich ein Beruhigungsmittel.«
»Soll ich mit ihr reden?«
»Ja, wenn du möchtest. Sie waren so glücklich zusammen.«
Das behaupten andere auch von uns, dachte er.
Sie zog seinen Kopf zu sich heran und küßte ihn auf die Lippen.
»Sol, so etwas tust du doch nicht? Sag mir, daß du so etwas nicht tust.«
Er überspielte sein Unbehagen: »Sobald du aus der Tür gehst, falle ich über Manuela her. Ich bin verrückt auf Sechzigjährige mit Hüften aus Beton.«
Sie lächelte und schien sich fürs erste mit seiner Ausflucht zu begnügen.
Auch Jenny kam jetzt aus dem Zimmer heraus. Von ihrem straffen Gesicht war seit dem Facelifting kaum eine Gefühlsregung abzulesen, aber ihre Bestürzung war so groß, daß sie sogar ohne den Einsatz ihrer hohen, messerscharfen Stimme deutlich zu verstehen gab, was sie empfand.
Naomi fragte: »Weint sie noch?«
»Ja. Jetzt weint sie natürlich gern. Sie war schon immer etwas labiler als du. Wann hab ich dich schon mal weinen sehen? Bei der Chuppáh!«
»Meinst du nicht auch, daß Sol mit ihr reden sollte?«
»Natürlich mußt du das, findest du nicht?«
»Bei solchen Dingen ist es besser, wenn Frauen das untereinander ausmachen«, gab Sol zu bedenken. Er verspürte einen gewissen Widerwillen, mit seiner Schwägerin über Ehebruch zu sprechen. Der Vormittag, den er erlebt hatte, war keine gute Vorbereitung auf so etwas gewesen.
»Es ist dein Los als Rabbiner«, antwortete Jenny, und sie nahm Naomi beim Arm und ließ ihn stehen.
Als er hereinkam, stand Tamar am Fenster und sah nach draußen, die Arme vor der Brust verschränkt, als sei ihr kalt. Während Naomi in den letzten Jahren leicht zugenommen hatte, hatte Tamar ihr Gewicht gehalten. Mit achtzehn hatte sie beschlossen, mit Kurzhaarfrisur durchs Leben zu gehen, da sie die Hoffnung begraben hatte, die gleiche Haarpracht zu entfalten wie ihre Schwester.
Sie drehte sich bei seinem Eintreten nicht um, sondern wartete darauf, daß er etwas sagen würde. Er setzte sich in einen Sessel neben dem Chesterfield und betrachtete ihr Profil. Sie hatte ein schmales, semitisches Gesicht und schlug mehr nach dem verstorbenen Vater als Naomi, deren Gesicht die Züge von Jennys Familie trug.
»Hat Tom das, denkst du, öfter gemacht?«
Ohne ihn anzusehen, nickte sie. Sie schluckte und bemühte sich, einen erneuten Weinkrampf zu unterdrücken. Auf den Park hinabstarrend, setzte sie die Kopfbewegung fort, als ob sie auch auf andere Fragen, die nur sie hörte, beipflichtend nickte.
»Mit anderen?«
Sie zuckte die Achseln, sagte noch immer nichts.
»Denn wenn er es mit der Tochter des Dienstmädchens treibt, dann treibt er es sicher auch mit anderen. Das denkst du, nicht wahr?«
»So in etwa«, sagte sie leise.
»Habt ihr Sex miteinander?«
Sie schluckte, und ihre Augen begannen zu flackern.
»Tamar, sag es mir, du bist nicht die erste, die ich das frage, das gehört zu meiner Arbeit.«
»Seit wann bist du Sexologe?«
»Seit ich Rabbiner bin.«
»Gehört das zum Reformjudentum?«
»Das ist eine blöde Bemerkung. Es gehört zu meiner Arbeit als Vermittler. Ich habe Hunderte von Ehekrisen aus der Nähe miterlebt, Tamar, und dabei wird über alles geredet. Wirklich alles.«
»Ja, wir haben miteinander geschlafen.«
»Zur Zufriedenheit?«
»Willst du auch wissen, welche Stellungen wir praktiziert haben?«
»Wenn das eine Rolle spielt, was die Qualität eurer Beziehung anbelangt. Und für deren Gestörtsein.«
»Zur Zufriedenheit.«
»Und Tom? Warum, denkst du, hat er das getan?«
Sie schüttelte fassungslos den Kopf und blieb stumm.
»Möchtest du mir erzählen, was du gesehen hast?«
»Nein.«
»Hat Tom sich entschuldigt?«
»Ich öffnete die Küchentür und sah auf seinen nackten Hintern.«
»Und das Mädchen?«
»Sie war wie ausgehungert.«
»Sie haben dich gleich gesehen?«
»Nein, der Fernseher auf der Anrichte war an. Sie hörten mich nicht.«
Erneut schüttelte sie den Kopf. Sie sah etwas, was ihr weh tat. »Das lief schon lange, Sol, sehr lange.«
»Was tat er, als er dich sah?«
»Nichts. Er sah mich an, als wäre ich gar nicht vorhanden. Aber sie fing an zu schreien, und da bin ich weggegangen und hierhergekommen.«
»Möchtest du, daß alles wieder ins reine kommt?«
»Nein. Ich werde das niemals vergessen können.«
»Es ist gut, daß du darüber redest. Erzähl es Naomi, deinen Freundinnen, sooft du willst, behalt es nicht für dich. Hast du einen Therapeuten?«
»Nicht mehr.«
»Laß dir einen Termin geben. Versuch dir darüber klarzuwerden, ob du noch mit Tom weitermachen willst oder ob dies den absoluten Bruch für dich bedeutet.«
»Ich will, daß er stirbt.«
»Ich verstehe, daß du wütend bist.«
»Ich bin nicht wütend. Ich bin ganz ruhig. Ich will, daß er stirbt, an den schlimmsten Krankheiten.«
»Und ob du wütend bist, Tamar. Sonst würdest du so etwas nicht sagen. Dein Mann hat dich betrogen. Das kommt häufiger vor. Es ist nie schön, diese Entdeckung zu machen. Aber es gibt Schlimmeres. Er schlägt dich nicht, er ist kein Mörder, kein Strauchdieb, kein Hochstapler. Du fühlst dich mißbraucht und hintergangen.«
»Ich lasse mich von ihm scheiden, und ich sorge dafür, daß er wie ein Hund krepiert.«
»Ich weiß nicht, ob du das ertragen könntest.«
»Du unterschätzt mich, Sol.«
»Nein, das tue ich nicht. Ich weiß, was in dir vorgeht, und ich bitte dich, gönn dir ein wenig Ruhe. Bleib hier bei uns, solange du willst, und vertrau dich uns an.«
»Ich gehe nachher zurück. Jenny hat ihn schon angerufen und ihm gesagt, daß ich ihn nicht mehr im Haus vorfinden will, wenn ich zurückkomme. Es ist mein Haus. Alles gehört mir. Ich will in meinem eigenen Bett schlafen.«
»Das Recht hast du natürlich. Laß ihn ruhig eine Zeitlang leiden, irgendwo in einem Hotelzimmer.«
»Ich weiß nicht, ob er so sehr leidet. Sie wird wohl bei ihm sein.«
»Du mußt dir selbst mehr einräumen, Tamar, nimm dich in acht, daß du nicht in deiner Verbitterung hängenbleibst.«
»Victoria war schon neun Jahre bei mir. Sie versuchte mich zurückzuhalten, als ich zur Küche lief. Sie würde mir schon etwas holen. Mein Dienstmädchen wußte die ganze Zeit, daß mein Mann ihre Tochter bumst, und ich wußte von nichts.«
»Nimm dir eine andere Victoria.«
»Ich kann keiner Haushälterin mehr vertrauen.«
»Was kann ich sonst noch für dich tun?«
Sie zuckte die Achseln und begann erneut, den Kopf zu schütteln.
Sol stand auf und fragte sich einen Moment lang, ob er ihr die Hand auf die Schulter legen sollte, aber es war vermutlich besser, die Distanz zu wahren und nur verbal Trost zu spenden.
»Bleibt Jenny heute nacht bei dir?«
»Weiß ich nicht.«
»Ich finde, daß Tom sich wie ein Schuft benommen hat, und ich hoffe, daß er Tschuwáh empfinden wird, Reue.«
»Reue? Du bist nicht in der Schul, Sol.«
Sie sah ihn jetzt an, voller Hohn und Spott, und er kam sich wie ein belächeltes Kind vor.
»Mit Haß kann man nicht leben.«
»Dann mußt du noch ’ne Menge lernen, Rabbi.«
»Ich verstehe, daß du jetzt auch in mir – denn ich bin schließlich ein Mann – einen Feind siehst, aber ich versuche nur zu vermitteln. Ich fände es schrecklich, wenn ihr auseinandergehen würdet.«
»Dann versuch dich mal dran zu gewöhnen.«
»Ich werde mit ihm reden.«
»Er ist geiler auf sie als auf mich. So simpel ist das. Was will man da machen? Ich genüge nicht.«
»Aber du sagtest doch gerade, daß ihr ein schönes Liebesleben habt.«
»Du hast ihn nicht gesehen, Sol. So kenne ich ihn nicht. So genießerisch. Und dieses Flittchen, wie die dalag. Und du vergißt noch etwas: Sie trieben es in der Küche. Nicht im Bett, nicht unter der Dusche, nicht auf dem Fußboden, sondern auf dem Butcherblock in der Küche. Warum? Verstehst du das?«
Sol glaubte es zu verstehen. Er sagte nichts, weil er Zeit brauchte, um es in Worte zu fassen, doch er spürte, welche Rolle dieser Ort spielte.
»Soll ich dich in Ruhe lassen?« fragte er.
»Du solltest nicht immer alles tun, worum Naomi dich bittet.« Sie sagte das mit dem Anflug eines Lächelns.
Sol nickte und konnte kurz ihren Arm berühren.
Naomi und Jenny standen in der zentralen Halle, einem runden, fensterlosen Raum, der Zugang zu acht Zimmern bot. In seiner Mitte prunkte ein Louis-seize-Tisch mit Marmorplatte, auf dem, von sechs Spots angestrahlt, stets ein Blumenstrauß stand.
Nervös blickte Naomi ihm entgegen: »Tom ist unten. Ich hab gesagt, daß er hier nicht willkommen ist. Wieso tut er das? Er macht sich so doch selbst unmöglich.«
»Ich werde runtergehen«, sagte Sol.
Jenny fragte, ob sie mitkommen solle.
»Nein. Ich werde mit ihm in das Lokal um die Ecke gehen.«
Von der Fahrstuhltür aus rief er Donnie an.
»Ist mein Schwager noch da?«
»Er wartet in seinem Auto, Rabbi.«
»Sag ihm, daß ich komme.«
Er nahm seinen Regenmantel, steckte ein paar Banknoten ein und wartete, bis Alfredo ihn mit dem Fahrstuhl holte.
Draußen saß Tom Wirtschafter in dem dunkelgrünen Range Rover, der in der Auffahrt des Apartmentgebäudes geparkt war. Als Sol in den hohen Wagen stieg, kam ihm der Duft der scharfen ägyptischen Zigaretten in die Nase, die Tom rauchte.
»Sie ist oben, hm?«
»Ja. Sie will dich jetzt nicht sehen.«
»Ich will mit ihr reden. Ich will alles erklären.«
»Das wird dir heute nicht gelingen. Laß uns um die Ecke was trinken gehen. Okay?«
Sol bat Donnie, das Auto eine halbe Stunde stehen zu lassen, und sie gingen zu Fuß zur Seventh Avenue. Leichter Regen nieselte auf ihre Mäntel herab. Toms dickes, rostfarbenes Haar zeigte keine Spur von Älterwerden und sah genauso jung und kräftig aus wie der Rest seines Körpers. Er ging täglich in den New York Athletic Club. Im feuchten Wind lief er geschmeidig neben Sol her zum Café Europa, Ecke Fifty-seventh, schweigend und konzentriert mit einem Feuerzeug hantierend, um sich eine neue Zigarette anzuzünden.
»Du rauchst zuviel.«
Tom überhörte seine Ermahnung und hatte nach einigen Versuchen plötzlich lange genug Feuer. Er nahm rasch ein paar tiefe Züge und trat die Zigarette dann vor der Tür des Lokals aus. Sie nahmen im hinteren Teil Platz, an dem großen Fenster mit Blick auf die Kreuzung von Seventh und Fifty-seventh, und sahen sich an. Tom hatte große blaue Augen, und sein Gesicht mit Schlägerkinn und plattgedrückter Nase sah aus, als wäre er mal Berufsboxer gewesen. Das war er nicht. Er hatte eine Laufbahn als Nachtclubpianist hinter sich und hatte höchstens mal von einem Gläubiger eins draufbekommen; von einer schweren Schlägerei, die ihm diese Nase eingebrockt haben könnte, war Sol nichts bekannt. In den Augen von Frauen hatte Tom ein begehrenswert männliches und verführerisch wildes Aussehen. Sol dagegen sah darin nur die irreführende Maske eines im Grunde rührend schwachen Mannes, der ständig an seinen Qualitäten und seinem Lebenszweck zweifelte. Heute lag Panik in seinen Augen. Heute hatte er es sich gründlich verdorben.
Sol bestellte einen Cappuccino für sich und ein Pils für Tom.
»Schieß los«, sagte Sol, als sich die Kellnerin entfernte.
»Womit?«
»Daß es dir leid tut und du nicht weißt, wie du es wiedergutmachen sollst.«
»Es tut mir leid. Wirklich. Ich hatte nicht … ich wußte nicht, daß sie zurückkommen würde.«
»Wäre es nicht irgendwo anders gegangen?«
»Denkst du wirklich, daß ich mich woanders mit ihr getroffen habe? Ich sah sie einfach nur bei uns zu Hause.«
Auch sie wohnten in einem fürstlichen Apartment, Ecke Park Avenue und Seventy-second. Eigentum von Jenny.
»Warum? Tamar ist eine wundervolle Frau. Sie ist intelligent, reich – warum, Tom?«
Tom schlug die Augen nieder und versuchte sich über etwas klarzuwerden, was er bis jetzt vage registriert hatte, ohne dem jedoch auf den Grund zu gehen. Er leckte sich die Lippen und zwinkerte heftig mit den Augen.
»Warum, Tom?« wiederholte Sol.
Mit nervösem Kopfschütteln antwortete Tom: »Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Das einzige, was ich weiß, ist … es klingt so lächerlich, Sol, so platt, aber das einzige, was ich weiß, ist: Maria ist total geil. Wirklich total geil. Und Tamar ist anders. Ich weiß, daß das keine mildernden Umstände sind, aber …«
Er beugte sich dichter zu Sol hinüber: »Das darfst du Tamar nicht sagen, die macht mich kalt, aber dir kann ich es anvertrauen, denn du bist Rabbiner und du erzählst es nicht weiter. Ist doch so, Sol, oder?«
Sol nickte: »Was du mir erzählst, bleibt unter uns.«
»Schön, schön.«
Tom nahm das Bier von der Kellnerin in Empfang und leerte das Glas bis auf den Boden. Dann schnappte er nach Luft und schaute sich um, ob sie belauscht wurden.
»Früher bin ich zu einer Hure gegangen. Jeden Tag in jedem Monat im Jahre des Ewigen. Ein fantastisches Weib in der fünfunddreißigsten Straße. Ich hab mich dumm und dämlich gefickt. Das war gut. Niemand wußte etwas davon, ein bißchen Geld bar auf die Hand, ich nahm ’ne Dusche, und alles war in bester Ordnung. Bis Victoria ihre Tochter mitzubringen begann. Gottverdammich, entschuldige den Ausdruck, aber du kennst sie nicht, und ich versichere dir: Wenn du die Chance hättest, würdest auch du, selbst du, nur schwer die Finger von ihr lassen können.«
»Was ist denn an ihr so besonders?«
»Alles!« Tom versuchte seine Begeisterung zu zügeln. Selbst jetzt, da die Katastrophe greifbar nahe war, da seine Ehefrau, die den Schlüssel zu einer sorgenfreien Existenz in Händen hielt, ihn demaskiert hatte, konnte er nicht verhehlen, wie empfänglich er für Marias Reize war.
»Ihre Augen, Junge! Die müßtest du mal sehen! Die gesamte Karibik in zwei dunklen Guckern! Und ihre Titten und ihr Bauch und die Art, wie sie geht! Alles an ihr ist Geilheit und Fleisch und Speichel und bettelt um Sperma!«
»Tamar will sich von dir scheiden lassen.«
Tom nickte und starrte niedergeschlagen auf sein leeres Glas.
»So kannst du als verheirateter Mann nicht leben, Tom. Dein Sexualleben mußt du mit deiner Ehefrau teilen, und wenn das nicht geht, mußt du dich von ihr scheiden lassen. Kommt dir das irgendwie bekannt vor?«
»Ohne Tamar bin ich erledigt.«
»Das wußtest du auch schon, bevor du heute früh diese Frau bestiegen hast.«
»Ich wußte nicht, daß Tamar zurückkommen würde.«
»Das ändert nichts an der Tatsache.«
»Ich bin jahrelang zu Huren gegangen! Hat sie das unglücklich gemacht? Nein! Tamar wußte es nicht! Und das ist am besten. Ich war immer gut gelaunt, wenn ich von der Hure kam, und hab mich bei Bedarf auch zu Hause ins Zeug gelegt. Warum sollte man alles erzählen?«
»Weil du sonst das Vertrauen eines anderen mißbrauchst! Tom, du hörst dich an wie einer, der die einfachsten Wahrheiten vergessen hat!«
»Nein! Ich bin Pragmatiker. Das ist alles! Wenn etwas gut funktioniert, sollte man nicht daran herumdoktern! Alles lief bestens! Tamar war zufrieden, ich war zufrieden, aber dann mußte sie plötzlich in die Küche spaziert kommen!«
»Es ist also ihre Schuld?«
»Ja. Eigentlich schon.«
»Ich verstehe dich nicht, Tom.«
»Ich bin ein bißchen durcheinander, es geht auch alles viel zu schnell. Wie fühlt sie sich?«
»Gut, glaube ich.«
»Was hat sie jetzt vor, weißt du das?«
»Nein. Sie ist wütend.«
»Ich will alles wiedergutmachen. Ich werde ihr hoch und heilig versprechen, daß ich Maria nie mehr wiedersehen werde. Ich werde alles sagen, was sie hören möchte.«
»Und wirst du es dann auch einhalten?«
»Das wird schwer sein, wirklich schwer, aber ich werde es versuchen, ich schwöre es, aber Maria ist … Ich hab mich noch nie so gefühlt bei einer Frau, als ob alles, mein ganzer Körper, überall, alles, nur eines wollte: in sie hineinkriechen, sie auslutschen und mich ergießen.«
»Hast du einen Psychiater?«
»Brauch ich nicht. Ich hab kein Kindheitstrauma.«
»Du mußt dir diese Frau aus dem Kopf schlagen, Tom. So kannst du nicht weiterleben. Du machst dich selbst verrückt.«
»Ich finde es scheiße für Tamar. Ich möchte wirklich, daß zwischen uns wieder alles ins reine kommt. Nimmst du noch was?«
»Ich hab noch.«
Tom winkte der Kellnerin. Hinter ihm, auf der anderen Seite der verkehrsreichen Straße, lief die Sängerin, in der schwarzen Jacke, die sie heute morgen in der Boeing getragen hatte, in derselben Jeans, die ihren ultimativen Hintern bedeckt hatte. Sol erhob sich, weil es ihm selbstverständlich erschien, jetzt nach draußen zu gehen und sie anzusprechen.
Tom fragte: »Was siehst du?«
Sol sah, daß sie am Fotolabor an der Ecke vorüberging und auf den Eingang der Subway zulief. Es juckte ihn in allen Gliedern. Für das, was er empfand, hatte er keine Worte, es war gedanklich nicht zu erfassen.
Er sagte: »Ich bin gleich wieder da.«
Ohne sie aus den Augen zu lassen, hastete er nach draußen. Sie verschwand in der Subway-Station, und er wußte, daß er Zeit verlieren würde, wenn er die Straße überquerte. Also spurtete er zum nächstgelegenen Subway-Eingang und jagte die Treppe hinunter, kurvte im Slalom um Passanten herum und nahm drei Stufen auf einmal. Keuchend erreichte er die Bahnhofshalle und schaute sich um, aber sie war offenbar schon ein Stockwerk tiefer auf der Bahnsteigebene. Er sprang über den Arm eines der Stempelautomaten und stieß sich dabei den Knöchel. Während sich der Schmerz ausbreitete, rannte er die Treppe hinunter. Der Schmerz in seinem Fuß hatte einen kuriosen Effekt: Sol begann nachzudenken. Was machte er hier? Mitglieder seiner Gemeinde konnten womöglich sehen, wie er sich als verliebter Schuljunge aufführte. Aber er war nicht verliebt. Er wußte nicht mal, wie sie hieß. Er blieb stehen und blickte zu den Fahrgästen auf dem Bahnsteig hinüber. Sie stand fünfzehn Yards von ihm entfernt, völlig ahnungslos, daß er sie beobachtete, und lief ein Stück mit dem einfahrenden Zug mit. Sie fuhr Richtung Downtown. Sie trug eine große Plastiktragetasche, auf der er den Namen eines Supermarkts lesen konnte, Zabar’s, der Laden am Broadway, wo Reiche und Yuppies ihren Käse, ihr Brot und ihr Olivenöl kauften, und sie ließ anderen Fahrgästen den Vortritt, ehe sie selbst als letzte einstieg. Hieß das, daß sie schon bald wieder aussteigen mußte? Er starrte zu dem Zug hinüber und spürte den Schmerz durch sein Bein ziehen. Verwundert über den Mangel an Beherrschung, über die Wucht der Gefühlswallung, die ihn nach draußen getrieben hatte, über die aufflammende Begierde nach einer vollkommen unbekannten Frau, humpelte er zu seinem Schwager zurück.
3
Der Gottesdienst verlief nicht anders als an anderen Samstagen. Temple Yaakov, eine der größten Synagogen der Welt, war relativ gut besucht, und Sol erfüllte seine Pflichten. Howie Kohn, der Kantor, flatterte durch die Liturgie, als sänge er zu Hause unter der Dusche, und war durch niemanden zu bremsen, wenn er, auf den Flügeln seiner Euphorie abhebend, den Ton einige Takte lang hielt und danach auf Applaus wartete. Howie hatte eine Stimme, die die Carnegie Hall oder die Met ausfüllen konnte, aber eine professionelle Gesangskarriere hatte er nie angestrebt. Wochentags dirigierte er außer einer Supermarktkette eine ganze Legion von Anwälten, mit denen er einen zermürbenden Streit gegen einen Konkurrenten führte.
Sols Predigt befaßte sich mit dem Starrsinn des Pharao, der Moses’ Plagen auszuhalten hatte. Die Bibel verkündete, Gott habe das Herz des Pharao besonders verhärtet, auf daß dieser stur an seinem Widerstand gegen den Auszug der Juden festhalte. Es war eine der vielen rätselhaften Bemerkungen über Gottes Wege. Er gab dem Pharao keine Chance, sich vernünftig zu verhalten, Er tauschte dessen Herz gegen einen Stein aus, auf daß Er Seine Allmacht demonstrieren könne.
Sol erläuterte, daß die Bemerkung über den Starrsinn des Pharao unterschiedlich gelesen werden könne. Eine der Interpretationen betraf die Herkunft einer Eigenschaft wie dem Starrsinn. Auch die stamme von Ihm ab, wie alles Bestehende von Ihm abstammte. Es konnte aber auch heißen, daß der Pharao sich nur von seinem Herzen leiten ließ: sobald Gott dieses verhärtete, wurde der Pharao zum hilflosen Spielball seiner Emotionen, und die Vernunft mußte ohnmächtig zuschauen.
Sols Meinung nach hatte Gott einen Plan, in dem der Pharao nicht mehr als eine Schachfigur war. Und in dem Plan ging es nicht nur darum, die Ägypter für den blinden Starrsinn ihres Königs zu bestrafen, sondern vor allem darum, den Glauben der Juden zu stärken. Die wollten, ohne es selbst zu wissen, Beweise sehen, Zeichen, die ihnen Kraft geben würden, den langen Marsch durch die Wüste – dem Anschein nach vielleicht noch schwerer als das Leben unter dem Pharao – zu bewältigen.
»Wir brauchen immer noch Wunder«, verkündete Sol. »Ohne uns dessen bewußt zu sein, warten wir genau wie damals auf ein Zeichen von Ihm, ein Signal, daß wir nicht allein sind und zu guter Letzt, in allerletzter Minute, wenn wir schon fast aufgeben, auf eine Stimme zählen können, die uns von unseren Sünden, unseren Schmerzen, unseren Sehnsüchten erlösen kann. Aber wir atmen in einer Zeit, in der Wunder sich nicht mehr so stark in unserem Leben manifestieren können wie damals, als namenlose Schreiber diese Geschichten zu Papier brachten. Sie lebten in einer Welt, die noch von Magie durchleuchtet war, in der die Geschehnisse Bedeutungen trugen, die sich weit aus dem Grau des Alltags heraushoben, und wir müssen versuchen uns für die Erfahrungen zu öffnen, die uns ihrer Glanzlichter teilhaftig werden lassen.«