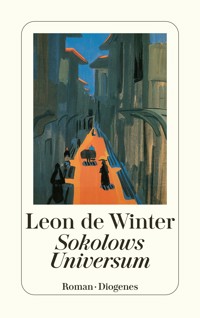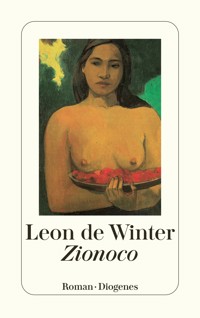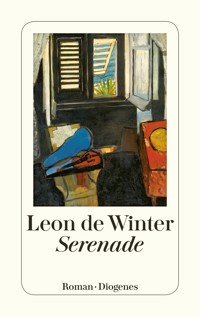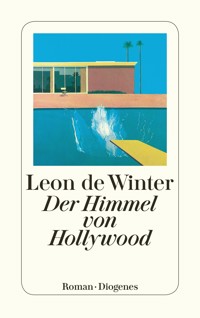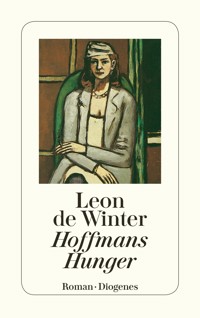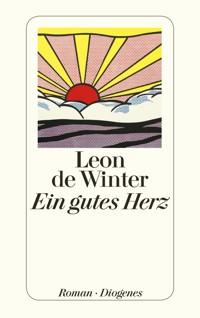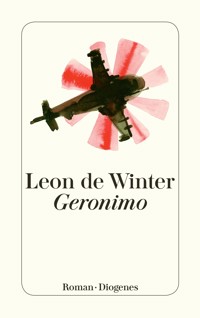8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
'Was macht ein Jude am Schabbesmorgen in einem Porsche!' – bekommt Max Breslauer zu hören, als er durch die Amsterdamer Innenstadt gerast ist und einen chassidischen Jungen angefahren hat. Eine Frage, die andere Fragen auslöst: 'Was bin ich eigentlich? Worum dreht sich mein Leben?' Max, Erbe eines Textilimperiums namens SuperTex, landet auf der Couch einer Analytikerin, der er sein Leben erzählt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Leon de Winter
SuperTex
Roman
Aus dem Niederländischen von Sibylle Mulot
Diogenes
Für Gideon Spitz, wo immer er jetzt auch sein mag
A SCHO IN GANÉJDN IS OJCH GUT
Auch eine Stunde im Paradies ist der Mühe wert
Jiddisches Sprichwort
EIN SAMSTAG IM OKTOBER1990
1
Das Sprechzimmer von Dr. Jansen lag im obersten Stock eines Apartmenthauses an der Ecke Apollolaan und Olympiaplatz. Der Platz war eingezäunt und in Rasenfelder aufgeteilt; am Nachmittag stieg das Geschrei erschöpfter Feierabendsportler zu den großen Fenstern des Sprechzimmers auf. Es war ein heller Raum, ein abgetretener Perserteppich bedeckte einen Teil des Parkettbodens, als Tisch diente ein alter Stahlschreibtisch mit schwarzem Gummibelag – er sah aus wie ein Kasernenmöbel –, auf dem eine schlichte weiße Bürolampe aus dem Kaufhaus stand. Bei meinem Eintritt war der Bürostuhl dahinter leer und halb umgedreht.
Das Sofa befand sich vor dem Fenster. Es war eine breite Couch, auf der man bequem zu zweit hätte liegen können. Eine dicke Wolldecke war darüber gebreitet. Letztes Jahr hatte ich die Decke einmal zurückgeschlagen und festgestellt, daß an der Stelle, wo die Hintern der von Neurosen und Traumata geplagten Patienten – von Dr. Jansen beharrlich »Klienten« genannt – herumrutschten, ein tiefes Loch gähnte, das mit trockenem Stroh aufgefüllt war. Man spürte das Loch, wenn man auf der Decke lag, und hatte den Eindruck, es sei von Dr. Jansen so beim Polsterer bestellt worden. Das Loch stellte eine direkte Verbindung zur Kanalisation her. Auf diese Weise wurde der Seelenkram über die Eingeweide in unsichtbare Tiefen befördert.
Der Therapeutenstuhl neben dem Sofa war ein brauner Ledersessel mit verschlissenen Armlehnen. Das Leder an der Kopfstütze war dunkel verfärbt und glänzte.
»Setzen Sie sich, Herr Breslauer«, sagte eine weibliche Stimme.
Wenn G’tt eine Frau wäre, hätte sie die Stimme von Frau Dr. Jansen, Nervenärztin zu Amsterdam. Sie war ungefähr siebzig und hatte die gedrungene Gestalt von Menschen, die mit zunehmendem Alter geschrumpft sind; sie war nicht größer als eins fünfundfünfzig. Ihr dichtes Haar kräuselte sich, und in dem einen Jahr, da ich ihr Sofa gemieden hatte, waren auch die letzten braunen Strähnen schneeweiß geworden. Ihre großen braunen Augen schauten mich klar und mitleidlos an. Sie hatte ein schmales Gesicht mit einer kräftigen Nase. In früheren Zeiten war etwas Mediterranes in ihre Familie eingeschlagen, wodurch das Aussehen der Familie Jansen exotische Züge angenommen hatte. Sie war keine Jüdin. Das war der Grund, warum ich beim ersten Mal ihren Rat gesucht hatte. Ich wollte keinen jüdischen Therapeuten.
Ich setzte mich aufs Sofa. Sie nahm ein Blatt Papier vom Schreibtisch und hievte sich wie ein Kind auf die Sitzfläche des hohen Sessels. Das Formular legte sie auf ihre übereinandergeschlagenen Beine, die den Boden gerade nicht mehr berührten. Ein Mädchen von elf im Körper einer Siebzigjährigen. Aus flachen schwarzen Schuhchen, höchstens Größe vierunddreißig, schauten spindeldürre Fesseln heraus. Sie trug einen grauen Rock, der bis zur halben Wade reichte, und unter der Strickjacke eine Seidenbluse mit breitem Kragen. Nicht gerade modisch, aber von zeitloser Qualität.
»Danke, daß Sie Zeit für mich hatten, Doktor.«
»Der Klient ist König«, lächelte sie und schaute auf das Papier. »Ich hab mal eine kurze Zusammenfassung von den Sitzungen gemacht, die wir damals abgehalten haben. Es waren nicht viele, nur vier. Sie haben die Behandlung nach dem Tod Ihres Vaters abgebrochen.«
»Ja.«
»Und auf einmal rufen Sie an und erzählen mir, daß Sie in Not sind, und bezahlen mir ein Vermögen, um wieder herkommen zu können.«
»Geld interessiert mich nicht.«
»Wirklich nicht?« Sie schaute mich mit scharfen Augen an, die mir klarmachten, daß Bluff sofort bestraft würde.
»Im Moment nicht«, verbesserte ich mich wie ein aufmerksamer Schüler.
»Sie sind heute nacht aufgeblieben?«
»Warum fragen Sie das?«
»Sie sehen aus, als hätten Sie kein Auge zugetan.«
»Ich hab nicht geduscht. Aber ich hab gut geschlafen.«
Sie nickte und zwinkerte. Ich erinnerte mich, daß sie das immer machte, wenn sie sich konzentrierte. »Wie gehen Ihre Geschäfte?«
»Sehr gut. Mit Ups und Downs natürlich, aber die gibt es in jedem Business. Sie werden auch manchmal Flaute haben.«
»Nicht in meiner Branche. Die menschliche Psyche macht keine Ferien.«
»Der Geldbeutel schon. Aber ich kann nicht klagen.«
»Körperlicher Zustand?«
»Na ja, rund fünfzig Pfündchen Übergewicht. Es sitzt alles hier um die Taille und um mein Gesicht. Beine und Arme sind ziemlich normal, aber die Hüften sehen aus, als ob ich einen Ring anhätte, wie früher beim Schwimmen.«
»Sie haben Übergewicht, ja. Eßanfälle?« Sie fragte so sachlich, wie ein normaler Arzt nach dem Stuhlgang fragt.
»Ich kann einen ganzen Tag lang nichts anrühren, und auf einmal stopfe ich mich voll, bis ich platze.«
»Und weiter? Kurzatmig? Herzklopfen?«
»Ich laß mich einmal im Jahr durchchecken, und der Doktor meint, es wäre alles in Ordnung, bis auf mein Gewicht.«
»Hat er Ihnen eine Diät empfohlen?«
»Nicht nur einmal. Funktioniert bei mir aber nicht.«
»Warum nicht?« Sie hielt den Kopf leicht schief und schaute mich mit einem traurigen Lächeln an.
»Nach einer Woche macht es mich verrückt, und dann ist die Sache gelaufen.«
Meine unbeholfenen Worte zerbröselten irgendwo hinter ihren Augen, und sie zwinkerte. Sie warf einen Blick auf ihre Unterlagen. »Wie steht’s mit der Liebe?« Diese Frage stellte sie so beiläufig wie möglich, ohne mich dabei anzusehen.
»Ich bin jetzt schon eine Zeitlang mit derselben Frau zusammen.«
»Zufrieden?«
»Wie meinen Sie das?«
»Sie kamen damals zu mir, weil Sie ein Problem hatten.«
»Das hat sich nach dem Tod meines Vaters gegeben.«
»Inwiefern?«
»Na, wie ich schon sagte. Ich will nicht behaupten, daß ich sofort nach seinem Begräbnis eine Morgenerektion hatte, wenn ich’s mal so ausdrücken darf, aber das Problem war auf einmal von selbst weg.«
»Sie dürfen sich ruhig so ausdrücken. Es war auf einmal weg?«
»Das meine ich ja: nicht am nächsten Tag. Es ging von selbst weg. Eines Tages war es vorbei.«
Sie nickte und gab mir das Gefühl, daß sie mehr verstand als ich, und machte mit einem harten Bleistift eine kurze Notiz. Ich hörte die Spitze auf dem Papier kratzen.
»Ihre Mutter lebt noch?«
»Ja, zum Glück.«
»Gesund?«
»Mehr denn je.«
»Ist sie noch rüstig?«
»Sie kocht selbst und kauft ein, hat natürlich ein Mädchen und eine Putzfrau, aber sonst ist sie das blühende Leben.«
»Und Ihr Bruder?«
Mein Herzschlag setzte aus, und etwas schoß mir durch die Augen – Angst, Scham, Eifersucht? –, das ihr nicht entging, sie sah mich unverwandt an, hielt Ausschau nach einem zitternden Mundwinkel und wartete auf meine Antwort.
»Mein Bruder wohnt zur Zeit in Casablanca.«
»Casablanca? Was macht er da?«
»Ja, was macht er da? Wissen Sie es?«
»Geschäfte oder so?«
»Nein.«
Sie hielt plötzlich den Mund, und die Sekunden, die folgten, boten mir Gelegenheit, meine Antwort zu begründen. Aber ich war noch nicht soweit. Die Geschichte meines Bruders verlangte Vorbereitung.
»Warum ist er dann dort?« fragte sie, als sie merkte, daß ich nichts sagen würde.
»Darum geht es ja gerade«, sagte ich. »Darum geht es auch.«
»Was geht worum?«
»Dies hier. Daß ich jetzt bei Ihnen bin.«
»Ist irgend etwas mit ihm passiert, ein Unfall oder so?«
»Nein, nein …«
»Sie sagten, Sie seien in einer Notlage.«
»Ja, so was Ähnliches«, sagte ich.
»Und das hat mit Ihrem Bruder zu tun?«
»Sagen wir mal … ohne den Umzug meines Bruders nach Casablanca säße ich vermutlich nicht hier.«
»Das müssen Sie mir schon näher erklären.«
»Schauen Sie …«
Wo sollte ich anfangen? Es war eine lange Geschichte, die ich erzählen mußte. Lang und verrückt. Ich sagte: »Vielleicht sollte ich mit heute früh anfangen.«
2
Ich mußte Jimmy Tschin anrufen, und der elektrische Wecker fing an zu quengeln.
Ich lag an Marias warmen Hintern gedrückt. Schläfrig drehte sie sich um, als sie merkte, daß ich aufstehen wollte. Sie schlang die Arme um mich und hing nun mit ihrem vollen Gewicht an meinem Hals. Das machte mir nicht soviel aus, denn mein Übergewicht hatte sich zum Teil an meinem Hals festgesetzt.
»Warte, Schätzchen«, sagte ich, »erst muß ich anrufen, dann leg ich mich wieder zu dir.«
Sie brummte mit geschlossenen Augen. Ihre schläfrige Hand suchte an meiner Schulter erfolglos nach meinem Geschlecht, und ich stand auf.
Der Anruf hatte mit einem verspäteten Transport zu tun. In Thailand ließen wir Hemden, Blusen, Röcke, Kostüme, Zweiteiler und alles mögliche andere von der Firma Golden Textiles zusammennähen und verkauften die Partien Misch-Konfektion dann in diesem Teil Europas.
An den Kassen unserer SuperTex-Läden wurden die Kleider in orange-grün bedruckte Plastiktaschen mit roten Henkeln geschoben. Die sparsame Einrichtung unserer Geschäfte und die relativ niedrigen Personalkosten sicherten uns eine ansehnliche Gewinnspanne, und so hatten wir uns einen festen Platz auf dem niederländischen Textilmarkt erobert.
Wir liefern ziemlich gute Ware zu Schleuderpreisen. Dafür tritt der Kunde immer gern über die niedrige Schwelle. Außer aus Thailand importieren wir auch Konfektion aus Sri Lanka, Südkorea, Hongkong und Indien, und wir beliefern ähnliche Ladenketten wie unsere eigene SuperTex, in Deutschland etwa Billighaus oder Dufour in Frankreich.
Jimmy Tschin hatte es nicht geschafft, eine Sendung mit Winterware termingerecht abzuschicken, und dadurch konnten wir mit unseren deutschen Vertragspartnern Probleme bekommen. Die hatten in ihren Läden in Köln und Karlsruhe eine Großaktion geplant, und die Werbeaufträge waren schon aus dem Haus. Die Regale warteten auf meine Jacken, Mäntel, Hosen, Hemden, Blusen und Pullover. Wenn ich nicht rechtzeitig lieferte, zwang mich der unnachsichtige Vertrag, für die Kosten der Werbekampagne und den Umsatzverlust aufzukommen. Über Fernmeldesatellit hatte Jimmy mir geschworen, daß er die gesamte Partie noch vor dem Wochenende aus dem Haus schaffen würde. Er konnte sie nicht mehr per Schiffscontainer verschicken, hatte mir aber versichert, daß er sie per Flugzeug nach Europa bringen lassen würde. Für ihn vervielfachte das die Kosten, aber das war immer noch besser als der Schaden bei Billighaus, denn den würde ich auf jeden Fall auf ihn abwälzen.
Jimmys Sweatshops standen in einem Dorf nördlich von Bangkok, und der Strom war ausgefallen. Golden Textiles hatte vor drei Monaten eine Anzahl neuer Generatoren aus Singapur importiert, aber schon bald war in der gesamten Anlage eine Betriebsstörung aufgetreten, und die Produktion lag still. Aus Singapur wurden Monteure eingeflogen, die den Schaden reparierten, aber nach drei Wochen wiederholte sich das Problem. Es wurde ein Leidensweg. Ich hatte Jimmy im Verdacht, daß er die Generatoren gebraucht gekauft hatte, aber er schwor hoch und heilig, sie seien fabrikneu gewesen. Und nun versicherte er mir ständig, die Brother-Nähmaschinen würden innerhalb von zwei Tagen wieder anfangen zu surren.
Es war von größter Wichtigkeit, daß er seine Produktion schnell wieder in Gang brachte, denn die thailändische Winterkollektion – »Kollektion« ist ein großes Wort für das, was bei uns im Laden liegt – mußte nicht allein die leeren Truhen bei Billighaus füllen. Wir liefern an Dutzende von Markthändlern, und in erster Linie brauchten wir die Ware aus Thailand für unsere eigenen Geschäfte. Jimmy wußte das, und meine Position zwang mich, ihn daran zu erinnern. Mein Vater hätte genau dasselbe getan.
»I have to deliver in time, Jimmy«, hatte ich gesagt, »und wenn ich nicht rechtzeitig liefere, dann muß ich ein Bußgeld bezahlen. Und das ist nicht wenig, lieber Freund.«
»Ich werde dafür sorgen«, sagte Jimmy so munter wie möglich mit seinem chinesischen Zungenschlag, »don’t you worry.«
»Ich mach mir aber Sorgen!«
»Beruhige dich, Max, ich bin dein Freund.«
»Das weiß ich, aber du lieferst nicht rechtzeitig. Und jemand, der nicht rechtzeitig liefert, den kann ich schwerlich weiter meinen Freund nennen.«
»Ich tu mein Bestes.«
»Das ist nicht genug, Jimmy.«
»Morgen früh weiß ich mehr.«
»Und dann will ich ganz genau wissen, wann du lieferst.«
»Mach dir keine Sorgen, Max.«
»So wenig wie möglich. Und weißt du, warum? Wenn das Bußgeld fällig wird, dann glaube ich nicht, daß ich es bezahlen werde.«
»Don’t you worry.«
Dieses Gespräch fand am Freitag morgen statt, am Samstag sollte ich ihn wieder anrufen.
In Thailand haben sie einen halben Werktag hinter sich, wenn wir morgens aufstehen. Ich hatte den Wecker gestellt, damit ich um halb sieben die Nummer von Jimmys Geschäft in Bangkok eintippen konnte. Er kannte den Stellenwert, den der Samstag bei mir hatte, und ein Anruf um diese Uhrzeit würde Eindruck machen.
Meine Sekretärin hatte mir ein Dossier mit den wichtigsten Unterlagen mitgegeben, die mir erlaubten, Jimmy notfalls die genauen Zahlen und Klauseln um die Ohren zu hauen. Ich ging in mein Arbeitszimmer und sah die Grachtenhäuser auf der anderen Seite der Amstel in sanftem Morgenlicht liegen. Die Grachten waren leer. Normalerweise blieben wir am Samstagmorgen etwas länger im Bett liegen, kauften dann ein und lebten ruhig dem Montag entgegen. Ich zog eine Unterhose an, öffnete meine Tasche und holte das Dossier heraus.
Ich sah sofort, daß Yvonne mir die falschen Papiere mitgegeben hatte. Das mußte mich im Prinzip nicht davon abhalten, Jimmy anzurufen und meinen Zorn in den Hörer zu brüllen, falls in Bangkok irgend etwas schiefging, aber ich wollte die Verträge zwischen uns und Golden Textiles in der Hand haben, daraus zitieren, mahnen, zurechtweisen. Eine der Klauseln gestattete uns, nicht nur die Unkosten, sondern auch die Gewinnverluste auf Jimmy abzuwälzen, und die wollte ich ihm wörtlich unter die Nase reiben. Noch bedeutsamer war die Klausel über Nichterfüllung. Dies war bereits das dritte Mal in Folge, daß mit den Lieferungen von Golden Textiles etwas nicht stimmte, und ich hatte einen möglichen Ersatzpartner in Polen gefunden. Die Anfahrtswege von Warschau und Gdansk waren viel kürzer, die Aufsicht über die Sweatshops dort lag in den Händen abtrünniger Kommunisten, beinharter Sklaventreiber, die ihre unterbezahlten Landsleute bis aufs Blut aussaugten. Dieses business ist nichts für Samthände. Meine Verantwortung betrifft die Kontinuität unseres Betriebs, und wenn sie bei einem neuen Lieferanten besser gewahrt wird, fühle ich mich gezwungen, die alten Bande zu kappen.
Mein Vater hatte den thailändischen Chinesen Fu Fai Tschin – Jimmys Vater – bei einer Textilmesse in Mailand im Jahr 67 oder 68 getroffen. Wahrscheinlich hatten sie sich die Einsamkeit des ewigen Flüchtlings gegenseitig von den Augen abgelesen. Die Wiege meines Vaters stand in Galizien, die von Tschin in Kanton. Sie hatten gute Geschäfte miteinander begonnen.
Mein Vater hatte eine Menge Geschäftsbeziehungen, aber ich glaube, ungeachtet der kulturellen Verschiedenheiten pflegte er die mit Tschin am meisten. Das eine Mal, als wir zusammen in Bangkok waren, konnte ich zusehen, wie er in aller Ruhe die Vertragsverlängerung mit Fu Fai Tschin besprach. Er saß entspannt am blankpolierten Mahagonitisch, der nach Bohnerwachs roch; ein paarmal beugte er sich vor und legte eine Hand auf den Arm von Fu Fai Tschin, der diese Freundschaftsgeste damit beantwortete, daß er seine Hand auf die meines Vaters drückte. Am späten Nachmittag machte Tschin auf dem Parkplatz des Hilton seine trägen Gymnastikübungen, gedehnte Bewegungen, die Konzentration und Körperbeherrschung erforderten, und mein Vater schaute ihm wie ein liebevoller Bruder zu. Wir schlossen einen schönen Vertrag.
Es war uns nicht verborgen geblieben, daß thailändische Mädchen mit wieselflinken Fingern unsere Kleider bei schlechtem Licht für einen Hungerlohn zusammennähten, aber der gesamte wohlhabende Westen kam auf diese Weise an preiswerte Textilien. Sollten wir, die Euro Textil International BV, die Holding unserer SuperTex-Ladenkette – ein Name, den sich mein Vater ausgedacht hatte, der aber zu lange im Mund herumrollte und ETI abgekürzt wurde – etwa tugendhafter sein als C&A? Wir machten munter mit auf dem Jahrmarkt des modernen Imperialismus.
Ich mußte Jimmy anrufen und hatte die falschen Unterlagen in der Hand. Unterlagen zur Marokko-Affäre, die wir gerade überstanden hatten. Das marokkanische Dossier war wohl das letzte, was ich jetzt sehen wollte, und eine Riesenwut packte mich, schlimmer als es dieser kleine Zwischenfall rechtfertigte.
Nachdem nun einige Zeit vergangen ist, sehe ich im nachhinein selbst, daß die Ursachen für die ganze Aufregung beim fehlgeschlagenen Marokko-Geschäft lagen und bei den aufsehenerregenden Folgen, die dies für meinen Bruder Boy gehabt hat, aber zu einer ausgewogenen Analyse hatte ich an diesem Morgen keine Zeit. Ich rief Yvonne zu Hause an.
»Ja?« antwortete sie halb im Schlaf.
»Verdammt noch mal, du hast mir die falschen Unterlagen mitgegeben! Ich steh hier um halb sieben Uhr am Telefon und will anrufen, und was sehe ich: das falsche Dossier!«
»Oh, Herr Breslauer, wie ist das möglich?«
Ich hörte, daß sie jetzt hellwach war. Vermutlich saß sie aufrecht im Bett.
»Wie das möglich ist? Das fragst du mich? Du bist die Sekretärin, nicht ich!«
»Ich hatte es wirklich hingelegt, Herr Breslauer.«
»Ja, du hattest es wirklich hingelegt. Aber das falsche, liebe Yvonne.«
»Wie kann denn das … ich habe doch …«
»Yvonne, hör zu, das ist das letzte Mal, daß du was verkehrt gemacht hast.«
»Oh, Herr Breslauer, es tut mir wirklich leid, es wird nicht wieder vorkommen.«
»Nein, es wird nicht wieder vorkommen! Und weißt du auch, warum? Weil du entlassen bist, Yvonne! JETZT. Fristlos! Verdammt noch mal, ich steh hier wie ein Ölgötze!«
Wütend schmiß ich den Hörer auf die Gabel und marschierte aufgebracht vor den Fenstern auf und ab. Fluchend warf ich das Dossier weg, die Papiere flatterten auf das glänzende Parkett.
»Was ist los, Max?« Maria stand in der Tür. Sie war mitsamt dem Laken aus dem Bett gestiegen und strich ein paar blonde Haarsträhnen aus dem Gesicht. Sie war auch morgens, ohne Wimperntusche, Lippenstift und Lidstrich, die schönste Frau, die ich kannte. Hätte Marilyn Monroe nicht gelebt, dann hätte man Maria nicht beschreiben können. Wenn ich sie zwischen den Bettlaken anbetete, und fast jede Nacht ließ sie das zu, dann lautete mein Mantra: »Du bist so wunderbar wie MM.« Manchmal genügte ihr das nicht, und ich setzte hinzu: »Wenn sie ihren wirklich guten Tag hatte.«
»Wen hast du angerufen?«
»Yvonne.«
Ich ließ mich auf die Couch fallen. Hinter den großen Fenstern lagen die Dächer von Amsterdam. Von hier aus sah man bei klarem Wetter in der Ferne sogar die Türme des Textilzentrums, wo sich die Verkaufsbüros von ETI befanden.
Maria setzte sich auf die Armlehne eines Sessels. Das weiße Bettuch hob sich von dem schwarzen Leder ab, und ihr goldenes Haar und ihre nackten Beine vervollständigten das glossy Reklamefoto, das man jetzt von ihr hätte machen können. Jede Haltung, die sie einnahm, war graziös und fotogen.
Mein eigener Anblick bot weniger ästhetisches Behagen. Ich starrte auf die Fettrollen um meine Taille, meine Schenkel lagen breit und schwer auf der Couch.
»Sie hat mir die falschen Unterlagen mitgegeben. Ich muß Bangkok anrufen.«
Sie nickte mechanisch.
»Warum setzt du dich nicht schnell ins Auto? Die Stadt ist leer, in fünf Minuten bist du dort.«
»Dann muß ich mich erst duschen und anziehen …«
Die Vorstellung, daß ich mich jetzt beeilen mußte, gefiel mir gar nicht. Wieder fuhr mir der Ärger über die Schlamperei meiner Sekretärin in die Glieder, und wie ein verwöhntes, lästiges Kind wischte ich einen Stapel Bücher von dem niedrigen Tisch, der vor der Couch stand. Ich weiß nicht, warum ich das tat. Hilflos purzelten die Bücher auf das Eichenholz.
Maria ging aufrecht in die Hocke und legte beherrscht die Bücher zurück. Das Bettuch glitt von einer Achsel und entblößte eine ihrer vollkommenen Brüste.
»Du ziehst dir schnell was an und kommst dann gleich wieder zu mir«, sagte sie wie eine Lehrerin zu ihrem Lieblingsschüler, »wir sind noch nicht fertig miteinander.« Ihre Worte klangen verführerisch, aber ich spürte, daß sie keine Geduld mehr hatte.
Ich beugte mich zu ihr hinunter und küßte ihre Schulter. Sie roch nach Schlaf und warmem Tier.
»Du hast recht«, sagte ich.
Ich stand auf und ging zurück ins Schlafzimmer. Ich wohne hier in einem Penthouse, fünfzig Meter rechts vom Theater Carré, oben auf einem der höchsten Herrenhäuser an der Amstel. Das Haus war 1723 gebaut worden, das Penthouse 1983. Ein halbes Jahr vor dem Tag, den ich hier zu beschreiben versuche, hatte ich es für satte anderthalb Millionen gekauft, was ein Haufen Geld ist, aber man muß es mit dem Ankauf eines wertvollen Gemäldes vergleichen: Kunst und Geldanlage zugleich.
Ich stieg schnell in meine Jeans Größe XL, zog ein T-Shirt von SuperTex über meinen fetten Körper und schlurfte in Hausschuhen zum Fahrstuhl. Maria rief mir nach: »Hast du ihr gekündigt?« Sie mußte die Antwort kennen, denn sie hatte das Gespräch mitgehört.
Ich blieb stehen und hielt die eigensinnigen Fahrstuhltüren auseinander.
»Ja.«
Ich hörte, daß sie mir nachkam, und wartete. Ohne wirklich hinzusehen, glitt mein Blick über das Foto, das dort von meinem Vater hing, vor über dreißig Jahren aufgenommen, als er jünger war als ich heute. Er hatte Boy und mich gerade hochgehoben, und in dem Augenblick, da seine Lippen meine runde Kinderwange berührten, hatte der Fotograf abgedrückt. Es war mein Lieblingsbild.
Jetzt erschien sie auf dem Flur; eine griechische Göttin.
»Das finde ich nicht nett«, sagte sie. Ihre Stimme klang kalt und böse.
»Ich bin auch nicht nett. Das hab ich dir schon früher gesagt.«
»Ein einziges Versehen, und schon wird sie entlassen?«
»Misch dich da nicht ein«, sagte ich scharf. »Laß die Finger von meinen Angelegenheiten.«
Ich betrat den Fahrstuhl, und die Türen schoben sich zu. Durch eins der runden Fenster sah ich, wie sie sich abwandte und ins Schlafzimmer ging. Kurz bevor die Stahltüren den Fahrstuhl ganz verschlossen, hörte ich sie ein paar Worte sagen, die nicht für meine Ohren bestimmt waren: »Dein Vater war netter, Mamser.«
»Aber der ist tot!« rief ich durch das Sicherheitsglas. »Und dies ist das letzte Mal, daß du von ihm redest, hörst du! Ich will nichts mehr von ihm hören!«
Ja, ich weiß, ich habe überreagiert. Seit ich aus Marokko zurück war, damals vor zwei Monaten, war ich unruhig, ungeduldig, unausstehlich. Ich hatte zwei wichtige Geschäfte vermasselt, weil ich im falschen Augenblick explodiert war, ich hatte bereits fünf Leute entlassen (mit Yvonne waren es jetzt sechs), ich hatte wieder angefangen zu rauchen (Maria verbot mir, in der Wohnung zu rauchen, aber im Auto wartete eine ganze Stange auf mich), und ich hatte jede Woche ein ganzes Kilo zugenommen (was mich in diesem Augenblick gefährlich in die Nähe der Hundertkilomarke brachte). Sie hatte ihre Bemerkung nicht für meine Ohren bestimmt, aber es war die tödlichste Beleidigung, die sie mir zufügen konnte, und sie wußte das. Wie ein wilder Bär schlug ich gegen die Wand der unschuldigen Fahrstuhlkabine. Dröhnend echote es im Aufzugsschacht.
Im Untergeschoß wartete zwischen den Sportwagen der anderen Hausbewohner und neben Marias rotem Ferrari mein anthrazitgrauer Porsche 928 S. Stöhnend ließ ich mich hinter das Steuer sinken. Jede Fahrt begann mit dem Kampf gegen meine lästigen Pfunde, und falls ich noch dicker würde, mußte ich mir ein anderes Auto zulegen, denn die liegende Steuerhaltung war bei meinem Umfang nicht nur unbequem, sondern sogar gefährlich. Ich war vernarrt in meinen 928er. Er fuhr geschmeidiger als Marias Ferrari Testarossa. Mit dem remote öffnete ich die Garagentür.
Ich ließ den Wagen an, und der schwere Motor des hochgezüchteten Porsche röhrte zwischen den Betonwänden. Ich gab Gas, schoß unter der halbgeöffneten Tür hervor und fuhr an der Amstel entlang. An der Mageren Brücke schaute ich mich um. Kein Polizeiwagen zu sehen. Schnell lenkte ich den Wagen auf die Brücke, was von dieser Seite aus verboten ist, und streichelte das Gaspedal. Der Porsche flitzte über die Holzbalken der Brücke auf die andere Seite, dort bog ich links ab und fuhr wieder zurück. Ich warf einen Blick aus dem Seitenfenster und sah, daß die Garagentür auf der anderen Uferseite schon fast wieder geschlossen war. Der Wagen flog über die Buckel der Grachtenbrücken, und am Ende dieses Amstelabschnitts lenkte ich den Porsche Richtung Frederiksplein.
Einen Augenblick lang überlegte ich mir den kürzesten Weg zum Textilzentrum. An Werktagen fuhr ich immer über den Amsteldijk und dann durch die Kennedylaan zum Ringweg, aber die Stadt lag wie ausgestorben, und ich beschloß, über den Stadhouderskade zu fahren, den Museumsplein zu überqueren und dann die Lairessestraat zu nehmen.
Ich drückte das Pedal weiter hinunter, es waren nur Millimeter, und die acht hochgezüchteten Zylinder des 928er jaulten. Die breiten Pirellireifen drehten auf dem glatten Asphalt durch, ich merkte, wie der Wagen schlingerte, aber als die Reifen warm wurden und wieder auf dem Asphalt hafteten, schoß das Auto voran. Von null auf hundert in weniger als sechs Sekunden. Deswegen hatte ich das Auto gekauft, und für den Kick bei dieser Beschleunigung mußte ich wieder abnehmen. Ich wurde in den Schalensitz gedrückt und bog in den Stadhouderskade ein. Innerhalb einer halben Minute war ich beim Reichsmuseum, fuhr drum herum, raste über den Museumsplein und donnerte, ohne vor der Ampel an der Van Baerlestraat zu halten, direkt in die Lairessestraat. In einer Hundertstelsekunde war ich am Concertgebouw vorbei, und die schnurgerade Lairessestraat lag wie eine freie Rennbahn vor mir.
Es passierte an der Ecke Banstraat.
Ich weiß nicht, woher sie kamen, aber sie waren auf einmal da. Offenbar waren sie mit dem absoluten Weltrekord im Hundertmeterlauf aus der Banstraat in die Lairessestraat gespurtet, und als wollte sie mir persönlich einen bösen Streich spielen, hielt die Chassidenfamilie direkt vor meinem Porsche an.
Ich hatte sie nicht die Fahrbahn betreten sehen, aber da standen sie unverkennbar, und sie schienen nicht die Absicht zu haben, ihren Platz mitten auf der Straße zu räumen. Ich bremste.
Das Anti-Blockier-System gehört zur Standardausrüstung jedes Porsche, und ich merkte jetzt, daß das kein überflüssiger Luxus ist. Irgendwo unter der Motorhaube organisierte ein Computer das pumpende Bremsen, und ich spürte, wie die Sicherheitsgurte mich im Schalensitz festschnürten.
Auch wenn der Vorfall höchstens zwei Sekunden gedauert haben kann – ich hatte genug Zeit, mir die Chassiden genau anzusehen. Durch dicke Brillen guckten sie erschrocken zu mir hin und warteten bewegungslos auf den Aufprall. Den Fuß krampfartig auf das Bremspedal gedrückt, sah ich sie furchterregend schnell näher kommen. Die zwei Sekunden dehnten sich wie zweihundert, ich konnte jetzt ihre Gesichter erkennen: den bärtigen Vater mit dem schwarzen Hut, seine beiden Söhne, der jüngere etwa zehn, der ältere fünfzehn Jahre, genau wie ihr Vater in Schwarz, mit dicker Brille, Hut und schönen vollen Peies, diesen mädchenhaften Schläfenlocken, die die streng orthodoxen Juden tragen. Alle drei starrten mich an, als wäre ich ein Ungeheuer, eine von G’tt gesandte Prüfung – so heilig ist Sein Name, daß er weder geschrieben noch gesprochen werden darf –, und diese Prüfung konnte nur auf eine einzige Art beantwortet werden: einfach stehenbleiben, nicht zur Seite gehen, unbeugsam diesen Test durchstehen und notfalls als Märtyrer von Ihm in Sein Haus berufen werden.
Ich spürte, daß ich sie anfahren würde. Eine halbe Chassidenfamilie, früh am Samstag morgen auf dem Weg zur Synagoge, um zu G’tt zu beten und auch für mich um Vergebung zu bitten – gleich würde ich sie auslöschen, weil ich so dringend ein Telefongespräch mit Bangkok wegen einer Partie Winterkleider führen mußte. Gleich würde man die Chassiden von meiner Windschutzscheibe kratzen, und ich selbst mußte ins Kittchen. Ich fuhr hier mit hundertzwanzig Sachen und wollte gerade in den vierten Gang schalten, um am Ende der Lairessestraat in den fünften zu gehen; damit fuhr man über zweihundert.
Ich sah ihre unschuldigen frommen Gesichter näher kommen und fing an zu beten. Wieder hatte der Herr mich auserwählt.
Die ABS-Bremsen von Ingenieur Porsche verlangsamten den Wagen um viele Kilometer pro Meter, und es sah jetzt so aus, als würde ich genau auf der Höhe des vordersten Chassidenjungen zum Stillstand kommen. Wie von einer Riesenhand zurückgeschoben, verlor das Auto die letzte Geschwindigkeit. Ein winziger Ruck kündigte absolute Ruhe an, und als ob sich mein Tastsinn bis in die Stoßstange ausgedehnt hätte, merkte ich, daß ich den Jungen gerade nur antippte, wie man jemandem einen Klaps auf die Schulter gibt.
Ein Weilchen blieb alles still, weitere zwei Sekunden tiefer Besinnung. Diesmal spürte ich das erlösende Glücksgefühl, daß die Tragödie durch irgend jemandes Eingreifen – Ingenieur Porsche oder Er Dort Oben? – verhindert worden war. Der Morgen war mild und schön.
Ich sah, daß der Junge aus der Betäubung erwachte, die die nahende Gefahr ihm eingeflößt hatte. Sobald die Erkenntnis zu ihm durchgedrungen war, daß er noch lebte und daß das Auto sein Bein berührt hatte, verließen über fünftausend Jahre Verfolgung mit einem lauten Schrei seinen Hals. Er fing an, auf seinem gesunden Bein herumzutanzen, während er das angetippte Bein mit beiden Händen festhielt, als würde es sonst abfallen.
Seine beiden Angehörigen, die sich in aller Stille schon darauf vorbereitet hatten, mit G’tt gleich ein erstes Orientierungsgespräch zu führen, lösten sich aus der Erstarrung, die mein heranbrausendes Auto verursacht hatte, und scharten sich um ihn. Der Junge zog das Hosenbein von seiner schwarzen Sabbathose hoch, und durch die Windschutzscheibe konnte ich nicht einmal eine Schürfwunde entdecken. Aber er schrie trotzdem weiter.
Der Vater, ein kleiner Mann mit dünnen Fingern, einem schmalen Gesicht und scharfen Augen, klopfte zornig auf mein Seitenfenster, und ich öffnete es mit einer Taste.
»Was glaubst du eigentlich, wer du bist, daß du hier so schnell fährst? Du hast mein Kind verletzt, und ich versichere dir, dafür wirst du büßen!« Er sah mein Autotelefon. »Ruf einen Krankenwagen«, verlangte er, »mein Kind braucht Hilfe.«
»Es tut mir leid. Aber wie ich sehe, ist gar nichts passiert, und ich hab’s eilig.« Meine Stimme zitterte vor Aufregung, das Herz schlug mir im Hals, und ich war dankbar, daß nichts Ernstes geschehen war.
»Sie haben es eilig? Und woher wissen Sie, daß nichts passiert ist? Sind Sie vielleicht Arzt? Nein, so sehen Sie nicht aus. Sie rufen jetzt einen Krankenwagen, oder ich hole die Polizei.«
Ich stieg aus und ging zu dem Jungen. Sein kleiner Bruder sah mich kommen und stellte sich mit fatalistischem Heldentum vor ihn. Zweifellos fürchtete er, ich würde mein Henkerswerk mit bloßen Händen vollenden. Ich sah die Panik in seinen Augen.
»Was ist denn los?« fragte ich so freundlich wie möglich. »Es ist doch nicht so schlimm? Laß mich mal sehen.«
Ich bückte mich und betrachtete das Bein des Jungen. Die Tränen rollten ihm über die Wangen, aber ich war überzeugt, daß es nur der Schreck war. Vorsichtig berührte ich das bleiche Bein. Der Junge schrie, und sofort spürte ich die Hand des Vaters auf meiner Schulter. Die Vaterschaft gab dem Männchen Riesenkräfte, sein Griff tat weh.
»Rühr ihn nicht an!«
Ich richtete mich auf und versuchte ein Lächeln. »Soviel ich sehe, ist es nur halb so schlimm. Ich glaube nicht, daß Ihrem Jungen etwas passiert ist.«
»Warum heult er dann? Glauben Sie, er tut das zu seinem Vergnügen? Jakov! Jakov! Hast du Schmerzen?«
Der Junge nickte, sein Gesicht war vom Leiden gezeichnet.
»Der Junge hat Schmerzen, und Sie sagen, er hat keine Schmerzen? Wer fühlt hier was? Wer stand hier auf der Straße, und wer saß hinter dem Steuer? Wissen Sie, was Sie sind? Ein verantwortungsloser Goj. Wissen Sie, was ein Goj ist?« Er machte eine kurze Pause. Sein Sohn hatte darauf gewartet und fing heftig an zu stöhnen. »Ein Goj ist einer, der am Samstag morgen in so einem …« – er wies mit zitterndem Finger, als ob er in einem Shakespearestück mitspielte, auf meinen Porsche – »… in so einem Auto zu fahren wagt. Das ist ein Goj!«
»Sie irren sich«, sagte ich. »Auch ich habe meine Bar-Mizwa gefeiert.«
Seine Augen zwinkerten ungläubig hinter den dicken Brillengläsern. Verblüfft schüttelte er den Kopf und half seinem Sohn auf die Motorhaube.
»Jemand muß einen Krankenwagen rufen«, sagte er, »Sie können telefonieren, wir nicht.«
Ich zog mein Portemonnaie heraus und zeigte dem Jungen einen Zweihundertfünfzigguldenschein. Natürlich wußte ich, daß fromme Juden am Samstag kein Geld anrühren, aber ich hatte die Handbewegung schon gemacht, bevor ich merkte, wie taktlos sie war.
»Hier, Jakov«, sagte ich, vor Scham errötend. »Kauf dir was Schönes dafür.«
In einem Anfall rasender Wut riß mir der Vater den Geldschein aus der Hand und zerfetzte ihn mit theatralischen Gebärden. Man darf am Sabbat auch nichts zerreißen – die Frommen unter uns reißen bereits am Freitag nachmittag das Klopapier in handliche Streifen, damit sie auch am Tag des Herrn den Popo putzen können –, aber er übertrat das Verbot.
»Was fällt Ihnen ein! Geld, Geld am Schabbes! Jemand muß anrufen!« Die Fetzen des Geldscheins tanzten über die Straße. Ich sah meine Dummheit über den Asphalt flattern.
Er hatte mich nicht direkt darum gebeten, denn das durfte er auch nicht, aber der »jemand« konnte niemand anderes sein als ich. Ich beugte mich in den Wagen und rief die 06–11.
»Wo ist es?« fragte das Mädchen in der Zentrale.
»Ecke Banstraat – Lairessestraat.«
»Opfer?«
»Zum Glück nicht. Nur ein Leichtverletzter.«
»Also ein Opfer. Wir kommen.«
Jakov saß mit geschlossenen Augen auf der Motorhaube. Sein Vater und sein kleiner Bruder hielten ihn tröstend und beschützend fest. Ihre Blicke verbannten mich für ewig in die Hölle, falls es sie gibt.
»Der Krankenwagen ist schon unterwegs«, sagte ich mit nervösem Lachen, obwohl es nichts zu lachen gab. »Geht es ihm wieder besser?«
»Ganz ausgezeichnet, danke vielmals«, sagte der Vater bitter. »Wir wissen es zu schätzen, daß Sie so mitfühlen.«
Der jüngste Sohn, kaum älter als zehn, sah mich scharf an. »Wenn Sie ein Jude sind, was tun Sie dann am Schabbesmorgen in einem Porsche?«
»Ist das hier ein Porsche?« rief sein Vater. »Also das ist das Auto von Herrn Professor Porsche, der für Herrn Hitler den Volkswagen gebaut hat? Und deswegen kommen wir zu spät zum Haus des Herrn?«
»Ich hatte es eilig«, sagte ich entschuldigend. Ich gebe zu, es war ein schwaches Argument.
»Am Schabbes hat man keine Eile«, sagte der Jüngste und warf mir einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Es tut mir wirklich leid.«
»Leid?« sagte der Kleine, und seine Augen, die schon jetzt mehr gelesen hatten als die meinen, sahen mich vernichtend an. »Leid? Was ist das?«
»Hat dein Vater dir das nie erklärt?« Ich wollte sarkastisch sein, sah aber bereits voraus, daß mir der Kleine auch hierin überlegen war.
»Leid tun ist etwas von der Oberfläche«, stellte das Kind mit Erwachsenenweisheit fest, »was Sie empfinden sollten, ist Scham. Scham, weil Sie am Tag des Herrn, gelobt sei Sein Name, in einem Porsche sitzen und beinah meinen Bruder totgefahren hätten.«
»Ich hab niemanden totgefahren, du übertreibst.«
»Übertreibst?« polterte der Vater. Trotz seiner zarten Gestalt hatte er die Lungen von Pavarotti. »Wer übertreibt hier? Hätten Sie sich, wie es sich gehört, gleich bei uns entschuldigt und echte Reue gezeigt, dann hätten wir zu einem Vergleich kommen können …«
»Vergleich? Was wollen Sie damit sagen?« versuchte ich ihm ins Wort zu fallen. Aber er fuhr einfach fort.
»So aber glaube – was sage ich? – schwöre ich Ihnen, daß Sie nicht so glimpflich davonkommen. Heute kann ich über Geldsachen nicht reden, aber morgen komme ich darauf zurück. Ihre Karte! Geben Sie mir Ihre Karte!«
Ich sackte hinter das Steuerrad und nahm eine Visitenkarte aus dem Handschuhfach. Und ich rief Maria an.
Eine Gruppe ausgelassener Chassiden erschien an der Ecke Banstraat. Der Bürgersteig war dort aufgegraben, ein Sandhaufen und gestapelte Pflastersteine versperrten die Sicht auf die Seitenstraße. Ich wußte plötzlich, warum ich die Familie nicht gesehen hatte. Das Amsterdamer Stadtbauamt, dessen Wege so unerforschlich sind wie die Wege des Herrn, hatte dort ein Loch gegraben, um mich zum Mord an einer braven Chassidenfamilie zu verleiten.