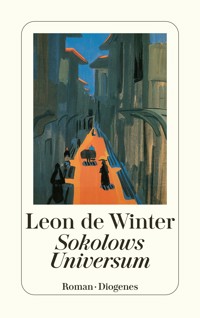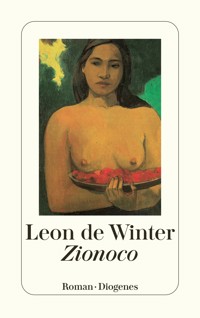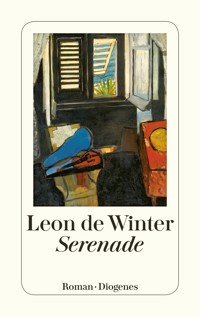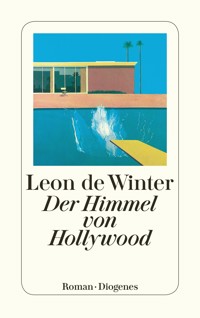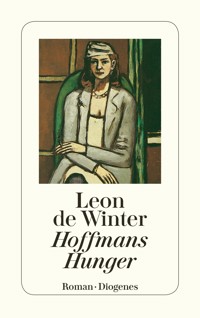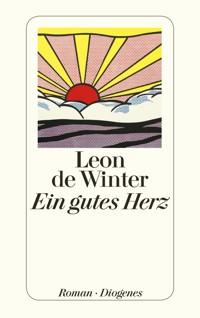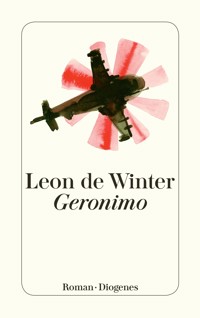6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paul de Wit hat eine Obsession: Er möchte die Geschichte korrigieren. Vor allem die seiner Familie. Ausgerechnet auf der Place de la Bastille meint er seinen totgeglaubten Zwillingsbruder entdeckt zu haben. In ihm flammt die wahnwitzige Hoffnung auf, sich doch noch mit seiner Geschichte versöhnen zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Leon de Winter
Place de la Bastille
Roman
Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers
Diogenes
L’histoire n’est qu’une fable convenue
De Fontenelle (1687–1757)
1
Zu der Zeit guckte ich alles. Während die Abende mit dem Korrigieren von Klassenarbeiten verstrichen, zeichnete der Videorecorder die Sendungen auf, die ich mir nachts ansah. Ich hockte vor dem Fernseher, bis sich das Unwetter hinter meinen Augen ausgetobt hatte, worauf ich, auf dem Sofa liegend, ein paar Stunden durch lautlose Träume lief.
Obwohl das Gegenteil näherliegend erscheint, verminderte sich dank des Videorecorders die Anspannung in der Schule. Die Bilder und Geräusche, die ich nachts im Fernsehen gesehen und gehört hatte und morgens, wenn ich mit dem Fahrrad zu dem verfallenen neoklassizistischen Gebäude im Stadtzentrum fuhr, in meiner Stirn vorfand (seltsamerweise schienen sie sich dort aufzuhalten – nicht im Hinterkopf, nicht irgendwo im Innern, sondern in der Region über meinen Augenbrauen, die schwer und massig auf meine Augäpfel drückte), verblaßten im Laufe des Tages und lösten sich in einem Nebel von Müdigkeit auf. Der Rausch, in den ich geriet, machte mich zur Unterrichtsmaschine, die sich Stunde um Stunde automatisch von der einen in die andere Klasse begab und reibungslos die verlangten Informationen ausstieß, auch wenn es in meinen Ohren sauste und mir in dem unerträglichen Tageslicht die Augen brannten. Ich brachte mich vorsätzlich an den Rand eines physischen Zusammenbruchs: Ich wollte mich in einem erschöpften Körper verirren, in Schmerz verlieren.
Diese Phase, die zeitlich nicht sehr weit hinter mir liegt und doch längst vergangen scheint, dauerte ungefähr sechs Monate, das zweite Schulhalbjahr lang. Unaufhörlich drohte mir damals blinde Panik (ein jeden Gegenstand anfressendes Beben, ein fundamentaler Zweifel, der Wände aufreißt und Fußböden spaltet), die meinen Kopf immer tiefer höhlte, ohne daß ich imstande gewesen wäre, sie auszuräuchern: Zischelnd fraß sie sich weiter, nagend, quälend.
Den letzten Schultag feierte ich mit einer ununterbrochenen Fernsehsession bis weit in den Vormittag des nächsten Tages hinein. Meine beiden Töchter krabbelten morgens zu mir auf den Schoß und guckten mit, bis Mieke, meine Frau, sie wütend wegschickte. Sie habe mich nachts wieder mit dem Video gehört, sagte sie, und das müsse ich selber wissen, aber sie wolle nicht, daß ich die Kinder ansteckte. Ich müsse mit der Vergangenheit abschließen, sagte sie, die Probleme durchstechen, die ich selbst aufgeblasen hätte. Ich stand auf, stammelte, daß ich die Zeit aus den Augen verloren hätte, taumelte benommen ins Schlafzimmer und ließ mich aufs Bett fallen.
Ich erwachte am späten Nachmittag. Der tiefe, traumlose Schlaf hatte meinen Kopf gereinigt, und ich schaute gedankenlos zu den Balkontüren, die Mieke geöffnet hatte (denn ich konnte mich nicht entsinnen, daß ich selbst dorthin gegangen war, bevor ich mich ins Bett gelegt hatte). Sie gewährten einen harmonischen Ausblick, der mir so noch nie aufgefallen war. Der zufällige Stand der Türen und der Sonne, dazu die große Ulme in einem der hinteren Gärten und meine eigene Position – ich lag seltsamerweise mit dem Kopf zum Fußende – bewirkten eine Bildkomposition, die ich als harmonisch empfand: Der Abstand zwischen den Falten der reglos herabhängenden Gardinen schien genauso groß zu sein wie der zwischen den weißen Eisenstäben des Balkongeländers, so daß ein bestimmter Rhythmus von der Gardine links auf das Geländer übersprang, sich dort fortsetzte und dann in der Gardine rechts seinen Abschluß fand.
Wenn ich mich bewegte, mich zehn Zentimeter zum Kopfkissen hinaufschob, würde sich meine Perspektive verändern, wie ich wußte; meine Sicht und meine Interpretation waren von meinem Standpunkt abhängig. Ich litt an der krankhaften Angewohnheit, dem Anschein nach alltägliche Begebenheiten von allem zu befreien, was an Zwangsläufigkeit, Vorsatz, Absicht grenzte. Warum hatte ich mich verkehrt herum aufs Bett gelegt? Was hatte mich dazu bewogen, mich nicht auf die linke Seite sinken zu lassen, wie ich das jeden Abend tat, sondern nach rechts, so daß ich beim Aufwachen ein Bild wahrnahm, das von kompositorischer Natur war (das ich als kompositorisch empfand?). Ich kroch zum Kopfende und sah, wie sich die Zusammenhänge in dem Bild auflösten. Dadurch daß sich der Winkel zwischen den Türen und meiner Position verändert hatte, fehlte der strenge Rhythmus von Gardinenfalten und Balkongitterstäben. In dem Bild, das ich jetzt sah, gab es keine besonderen Zusammenhänge; jetzt nahm ich die Rückseite einer Häuserreihe wahr, zwischen zwei offenstehenden Balkontüren hindurch gesehen, unauffällig still, im Licht eines sonnigen Samstagnachmittags.
Ich stand auf und ging ins Wohnzimmer. Der große, helle Raum mit seinen selbstverständlichen Stühlen, Tischen, Farben tat mir gut. Ich blätterte in der dicken Samstagsausgabe der Volkskrant, las einen bestimmten Artikel an, verlor aber den Zusammenhang. Mehrmals las ich die einleitenden Absätze und versuchte die Wörter in ihrem Kontext zu erfassen, obwohl mich das Thema eigentlich nicht interessierte. Ich legte die Zeitung weg und sah mich lustlos, nach der friedlichen Leere von kurz nach dem Erwachen verlangend, um. Am Fenster zur Straße stand der Fernseher, unter dem Tischchen blinkte mit seiner strengen Form der Videorecorder, daneben, in einem schlichten Gestell, schlummerten siebenundvierzig Kassetten. Mit einer willkürlichen Kassette voll verläßlicher abendlicher Unterhaltung konnte ich die Unruhe übertäuben, mit einem Western, einer Show, einem Film über das Amazonasgebiet. Es war absurd, daß ich die Suchtsymptome aufwies, die auch ein Alkoholiker kennt: Bei der geringsten Unebenheit sprang der Deckel auf, der Mechanismus setzte sich in Gang, und die Verführung tanzte um mich herum. Können Bilder verführen? Szenen? Filme? Fotos?
Ich flüchtete in mein Arbeitszimmer, denn ich wollte nicht, daß Mieke mich erneut vor dem Fernseher antreffen würde. Auf den leeren Schreibtisch (der unentwirrbare Papierwust befand sich in den Schubladen und im Schrank rechts im Zimmer; Rechnungen, Mahnungen, Korrespondenz, Aufzeichnungen, alles hatte ich, auf einen windstillen Tag wartend, dem Blick entzogen und weggesteckt) hatte sie mir einen Zettel gelegt.
»Bin mit Hanna und Mirjam zu meiner Mutter. Werden wohl zum Essen bei ihr bleiben. Sind gegen halb neun wieder zu Hause. Überleg dir, was du tust. Schreib bitte dein Buch fertig, auch wenn es nicht das ist, was dich eigentlich beschäftigt. Ich weiß, daß es um deine Eltern geht. Vielleicht nicht nur um sie als Personen, sondern auch um ihre Abstraktion, aber das Buch leitet sich davon ab. Wenn du das Buch fertig hast, wenn du diese Aufgabe vollbracht hast, wird sich hoffentlich auch dein Hang legen, dich langsam, aber sicher zu verflüchtigen. Fehlen dir noch Informationen? Vielleicht mußt du noch einmal nach Paris. Nimm dir alle Zeit. Notfalls fahre ich allein mit den Mädchen nach Zeeland, und du bleibst zu Hause, um zu arbeiten. Bitte denk darüber nach. Mieke.«
Abends, nach ihrer Rückkehr und der Gutenachtgeschichte im Kinderzimmer, sagte ich Mieke, daß ich gern noch mal nach Paris wolle. Sie nickte schweigend und wartete auf weitere Erklärungen, die ich jedoch unterließ. Die Lüge mit dem Buch und die Leichtigkeit, mit der sie mir über die Lippen gekommen war, erfüllten mich mit einer Scham, die bei jedem weiteren Wort als Zittern und Unsicherheit mitschwingen würde.
Komischerweise begann ich selbst an die Geschichte zu glauben, daß ich des Buches wegen nach Paris fuhr. Am nächsten Tag, Sonntag, zog ich aus den verborgensten Tiefen meines Schreibtischs das Manuskript hervor; ich las mir den letzten Teil noch einmal durch, machte Anmerkungen und versuchte zu sondieren, welche Originale ich einsehen mußte, um meine Probleme zu lösen. Ich schien frischen Mut aus dem Gedanken zu schöpfen, daß ich mich binnen kurzem erneut über das historische Material beugen und die aus dem vergilbten Papier aufsteigende Zeit schnuppern konnte. Das war jedoch reinste Heuchelei, denn es lag auf der Hand, daß ich in Paris lediglich die Auspuffgase vom lebhaften Urlaubsverkehr einatmen, aber keine Bibliothek von innen sehen würde. Meiner Gemütsruhe zuliebe spielte ich den eifrigen Quellenforscher, der aufgeregt vom einen Archiv zum nächsten rannte und beim Anblick verstaubter Bücher und Handschriften, die bei ihrer Berührung auseinanderfallen konnten, in Verzückung geriet.
Doch über dieses Stadium war ich längst hinaus.
Mein erster Besuch der Bibliothèque Nationale 1966 war ein verwirrendes und zugleich bewegendes Ereignis gewesen. Ich studierte damals noch und schrieb an einer Hausarbeit. Ich erinnere mich, daß ich mich mit Tränen in den Augen – viel zu große Emotionen für einen unbedeutenden kleinen Archivbesuch – in dem Gebäude zurechtzufinden suchte, in dem Zehntausende von Manuskripten und Millionen von Büchern eine Macht zur Schau trugen, die dem Ausgangsmaterial von Natur aus fremd war (denn das bestand aus nicht mehr als Papier, Druckerschwärze, Leinen, Pergament). Die Vergangenheit, die geordnete, rubrizierte verflossene Zeit, warf ihren unerträglich schweren, pechschwarzen Schatten über mich. Sie stand hinter mir, die GESCHICHTE, und sah auf mich herab. Und sosehr ich mich auch bemühte, ich konnte nicht durch die unzähligen Bücherregale hindurchsehen, hinter denen sie sich versteckte, wenn ich mich umdrehte, um sie ins Visier zu nehmen.
Alter Krempel, verstaubter Mist, muffiges dummes Zeug bist du, schrie ich durch den Gang (in Gedanken), mich kriegst du nicht, sieh doch, wie ich hier gehe und wandele und mich nicht um deine Wendigkeit schere, sieh, wie ich dir den Rücken zukehre und auf deine Macht pfeife!
Aber mir schwindelte, und ich war tief bewegt, ich horchte krampfhaft auf meine vergeblichen Beschwörungen und begriff, daß mein Bewegungsraum von den Wänden vorgegeben wurde, die meine Schritte zurückwarfen und die ich nicht versetzen konnte. Wimmernd wie ein verirrtes Kind suchte ich nach dem Ausweg aus dieser konkreten Metapher. Dies war kein Gebäude, in dem Material versammelt war, das auf die Sinngebung durch einen Historiker oder Soziologen wartete; hinter den vom städtischen Verkehr angefressenen Fassaden wohnte der Wahnsinn, der auch mein Dasein beherrschte und knebelte.
In heller Panik verließ ich das Archiv, und ich beruhigte mich erst nach einem mehrstündigen Spaziergang entlang der Seine, der mich in den Außenbezirk Villeneuve-le-Roi führte, wo die Flugzeuge im Landeanflug auf Orly die Dächer berührten. In einem Restaurant an der Avenue de la République, kaum einen Kilometer von der Landebahn entfernt, aß ich zum erstenmal in den dreiundzwanzig Jahren, die ich damals alt war, ein Stück Schweinefleisch. Ich mußte eine Tat vollbringen, hatte ich mir unterwegs überlegt, ich mußte mir beweisen, daß ich frei war und von dem scheußlichen Gewicht, das ich mit mir herumgeschleppt hatte, nichts als einen leichten Muskelkater zurückbehalten hatte. Und Schweinefleisch zu essen war für mich eine Tat. Das Tischchen, an dem ich saß, bebte, als ich den ersten Bissen nahm – nicht etwa, weil der Himmel seinen Zorn entlud (obwohl mir schon blitzartig durch den Kopf schoß: Das ist eine Warnung, laß das), sondern weil gerade ein Düsenflugzeug herunterkam, das, dem Geräusch nach zu urteilen, auf eine Katastrophe zusteuerte. Ich entsinne mich, daß ich in meinen Bewegungen stockte: Einen Moment lang schwebte ein Stückchen weißes Fleisch vor meinem geöffneten Mund, auf eine Gabel gespießt, die ich hielt, und ich wartete auf den dröhnenden Schlag, der den gesamten Häuserblock wegfegen würde (sie und ich mußten für meine Sünden sterben). Der Lärm ließ jedoch nach, die bebenden Tische und Gläser kamen zum Stillstand, und ich wurde mir der Haltung bewußt, in der ich erstarrt war. Nun gut, dies war ein Tag der Metaphern: Ich hielt mir das Stück Fleisch vor die Augen (schuldloses Fleisch eines schuldlosen Schweins, sprach ich als Gebet), betrachtete es eingehend und schob es mir dann in den Mund.
So also schmeckte Fleisch, das trejfe war, wie Kalbfleisch, aber weniger fade, würziger vielleicht, schärfer. Meine Zunge schickte das Stückchen Fleisch durch meinen Mund, führte es den Bakkenzähnen zu, schob es zu anderen Backenzähnen, vermengte es mit meinem Speichel, warf die zerkauten Fasern in meinen Schlund, suchte zwischen den Zähnen behende nach verbliebenen Resten, rüstete sich für einen neuen Bissen.
Ich genoß die Rache am Archiv. Was kümmerten mich die Gebräuche eines Nomadenvolkes, das vor Jahrtausenden in unwirtlichen Gebieten umhergezogen war und sein Verhalten den allmählich erworbenen Kenntnissen in Hygiene angepaßt hatte. 1966 noch nach Hygienevorschriften von vor dreitausend Jahren zu leben war unsinnig. Ich gehörte zu nichts und niemandem und konnte, wenn mir danach war, an einem Tisch in einem Restaurant Platz nehmen und etwas bestellen, das trejfe war. Geschichte existierte nicht. Archive waren Sammelstellen für nutzloses Altpapier.
Doch mein Magen reagierte mechanisch. Im Vorstadtzug, der mich zur Gare d’Austerlitz brachte, mußte ich mich eine Viertelstunde nach dem Essen übergeben. Mit rachsüchtiger Heftigkeit drehte sich mir der Magen um, und der Salat und die Tomaten und die faserigen Stückchen Fleisch schwappten über meine Zunge auf den blitzsauberen Gangboden. Ich genierte mich, schob das Erbrochene ungeschickt auf eine von einer mitfühlenden älteren Dame angereichte Zeitung und machte mir in der Eile die Hände an dem stinkenden Brei schmutzig. Beim nächsten Halt verließ ich den Zug, die durchhängende, feuchte Zeitung möglichst weit von mir weg haltend.
Tagelang redete ich mir ein, daß dieser Vorfall keine Bedeutung habe. Mein Magen sei solches Fleisch nicht gewöhnt und habe lediglich auf unbekannte Nahrung reagiert. Ich streifte durch die Stadt, während ich in der Bibliothèque Nationale nach Dokumenten und Handschriften hätte spähen müssen. Das wenige Geld, das ich hatte, ging mir bald aus, ohne daß mein Parisaufenthalt den geringsten Fortschritt für meine Hausarbeit erbracht hatte. Kurz bevor ich mein Hotelzimmer in der Nähe der Place de Clichy räumen mußte, weil ich es nicht mehr bezahlen konnte, stattete ich dem Archiv noch einen kurzen Besuch ab. Ich behielt die Nerven unter Kontrolle, schlug nach, was ich benötigte, und notierte in fieberhafter Eile Besonderheiten für meine Hausarbeit über die Flucht Ludwigs XVI. nach Varennes zu Beginn der Französischen Revolution.
Im Zug nach Amsterdam stieg aus der sonnenüberfluteten Landschaft in ersten vagen Umrissen auf, was sich elf Jahre später zum Konzept für ein Buch verdichten sollte. Draußen hinter dem Fenster, in der heißen Luft zwischen den gelben Hügeln, flimmerte es wie eine Fata Morgana, die die Arbeit, an der ich schrieb, auf eine dröge, graue Pflichtübung reduzierte. Aber ich hatte nicht den Mut, das Resultat monatelanger Mühen, das, wie ich wußte, keinerlei Aufsehen erregen würde, zu verwerfen und Ludwigs Fluchtversuch von einem völlig anderen, farbigeren Blickwinkel aus zu untersuchen.
Ich arbeitete nun schon drei Jahre an dem Buch, das ich mich damals nicht zu schreiben getraut hatte. Es umfaßte Hunderte dicht beschriebener Seiten und stellte meine Gegenstudie zur Flucht der französischen Königsfamilie aus den Tuilerien dar, die hoffnungslos mißglückt war, in meinem Buch jedoch gelang.
Schon während meines Studiums hatte ich eine Vorliebe für hypothetische Fälle gehabt, für die sogenannte Modellbildung, wie der Fachterminus lautete. Sie begann mit dem magischen Wörtchen wenn; wenn nun aber …, und dann entwickelte sich ein atemberaubendes Spiel mit unberechenbaren Ergebnissen.
Elf Jahre nach dem ersten Besuch der Bibliothèque Nationale, der den Grundstein gelegt hatte, hatte ich das Buch angefangen, und ich arbeitete immer noch daran. Doch ich hatte in den vergangenen Monaten entdeckt, daß die Zahl der Fluchtvarianten im Prinzip unbegrenzt war, was bedeutete, daß ich das Buch niemals vollenden würde. Dann und wann arbeitete ich krampfhaft daran und stieß immer wieder auf neue Möglichkeiten und Einstiege, und manchmal, wenn mich der Anblick des unendlichen Manuskripts in verzweifelte Wut versetzte und ich es am liebsten vernichtet hätte, machte ich wochenlang einen Bogen darum.
Wir hatten vereinbart, daß ich vier, fünf Tage für das Buch nach Paris fahren würde. Montags, nachdem ich den gesamten vorherigen Tag mit dem letzten Teil des Manuskripts zugebracht hatte, rief Pauline an. Sie komme am nächsten Tag nach Amsterdam, sagte sie, und würde mich gern sehen, mit mir ins Van Gogh und ins Stedelijk Museum gehen. (Zwischen ihren Worten, die sie in den schwarzen Hörer ihres Pariser Telefons sprach, hörte ich den unter dem geöffneten Fenster ihres Appartements dahinrasenden Verkehr, und die alte Metro fuhr durch das rußgeschwärzte Klettergerüst hoch über der Straße an ihrem Zimmer vorbei, auf ihrem nackten Rücken dünne Streifen Sonnenlicht, die sich zwischen den Fensterläden hereingestohlen hatten, Schweiß.) Mieke hatte den Anruf entgegengenommen, blieb während des Gesprächs im Raum und lauschte kopfschüttelnd meinem unbeholfenen Französisch. Meine blitzschnell erfundene Ausrede schien sie zufriedenzustellen, na ja, jedenfalls ging sie nicht weiter darauf ein.
Pauline kam. Wir trafen uns ein paarmal, und als Mieke mit den Kindern nach Zeeland fuhr, stieg ich mit ihr in den Zug nach Paris.
Doch das alles bedarf der Verdeutlichung. Ich werde erklären, wie ich Pauline kennenlernte, wieso ich mir diese albernen Videokassetten ansah, was ich im Archiv suchte. Es ist zwar fraglich, ob eine Schilderung der Ereignisse erhellend wirkt, ob sie Erkennen, Verstehen und schließlich Beherrschung bringt. Aber ich will es dennoch versuchen. Gehen wir also in der Zeit zurück.
2
I