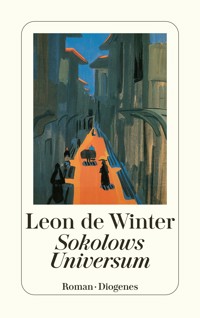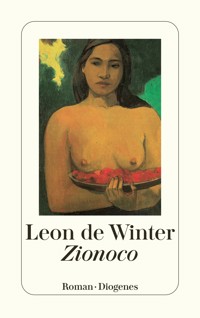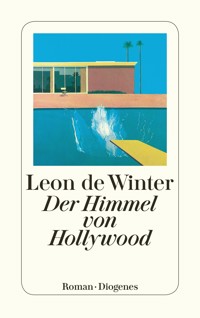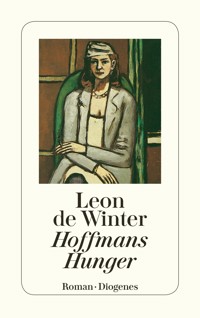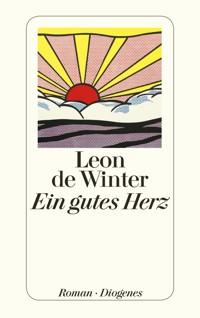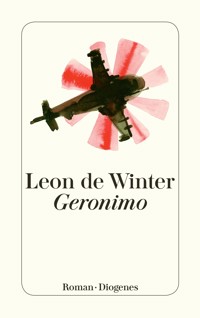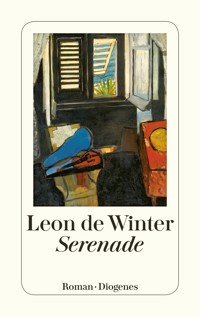
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte eines Sohnes, der seine Mutter neu für sich entdeckt. Und ein aufrüttelndes Buch über die Ohnmacht von uns allen, die wir die Nachrichten verfolgen, die wir über das Schreckliche in der Welt informiert werden, doch nicht imstande sind, etwas dagegen zu tun.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Leon de Winter
Serenade
Roman
Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers
Diogenes
Zum Gedenken an meine Mutter Annie de Winter-Zeldenrust 1910–1994
Meine Mutter litt seit Jahren unter Rückenschmerzen. Wir hatten schon etliche Spezialisten zu Rate gezogen, von qualifizierten Medizinern bis hin zu herumdokternden Quacksalbern, und Diagnosen erhalten, die von altersbedingten Verschleißerscheinungen bis hin zu negativen Erdstrahlen unter ihrer Wohnung reichten.
Als ich hörte, daß die Universitätsklinik Amsterdam sich einen neuen Scanner zugelegt hatte, ließ ich sie gleich auf die Warteliste setzen. Die Wundermaschine konstatierte ganz ordinäre Gallensteine. Endlich hatten wir eine fundierte Erklärung für die Krämpfe, die sie bisweilen mehrere Tage lang quälten. Gallensteine sagten uns was. Kleine Kiesel in ihrem Bauch. Die Ärzte beteuerten, daß deren Entfernung nicht länger als eine halbe Stunde dauern würde. Bis zur völligen Genesung würden dann nicht mehr als drei Tage »stationäre Nachbetreuung« nötig sein.
Hundert Minuten nach Beginn der Operation, nach acht Bechern Kaffee und ausgiebiger Lektüre des Telegraaf einschließlich der erotischen Kontaktanzeigen, schwante mir allmählich, daß die Operation wohl anders verlief, als man es uns prophezeit hatte. Mannhaft klammerte ich mich an den Gedanken, daß meine Mutter immerhin vierundsiebzig und jede Operation anders war; es würde schon gutgehen.
Es dauerte noch einmal zwei Stunden, bis eine Schwester mich davon unterrichtete, daß meine Mutter auf die Intensivstation gebracht worden war.
Sie lag, an Apparate und Schläuche angeschlossen, in einem hellen Zimmer, und ihr kleines Gesicht sah ohne das Gebiß, das man ihr herausgenommen hatte, alt und müde aus. Wie sie immer wieder stolz verkündete, schätzten flüchtige Bekannte sie auf höchstens fünfundsechzig, aber diese Illusion war nun zerstört. Ihre Augenhöhlen waren dunkelblau, ihre eingefallenen Lippen aufgesprungen.
Während ich mich über sie beugte und flüsterte, daß sie in ein paar Tagen wieder zu Hause sein werde, rang sie bewußtlos nach Atem. Sie war nur noch ein Schatten der Frau, die gestern abend munter und vertrauensvoll der Erlösung von den Gallensteinen entgegengesehen hatte. Warum hatte die Operation so lange gedauert?
Neben mir tauchte der Internist auf, der auch ihr Chirurg war. Ein Multitalent.
»Herr Weiss«, sagte er.
Ich gab ihm die Hand und brachte die stumpfsinnige Frage heraus: »Ist alles gut gelaufen?«
Er bat mich, ihn auf den Gang hinauszubegleiten.
Die Tür fiel hinter uns zu, und er wartete einen Moment, bis er genügend Mut gefaßt hatte, um mir den ersten Schlag zu verpassen. Er sagte: »Die Operation selbst ist eigentlich gut verlaufen. Aber Ihre Mutter wird nicht so bald nach Hause können.«
»Warum nicht?«
»Wir haben einen Tumor gefunden. Ein Geschwür, das sich um Gallenblase und Leberausgang gewickelt hat, ein Gallenblasenkarzinom, und das läßt sich nicht behandeln, da ist nichts zu machen, schlechte Prognosen.«
»Was sind schlechte Prognosen?« wollte ich wissen. Meine Stimme zitterte. Aber solange ich redete und Fragen stellte, konnte ich den Anschein von Normalität wahren.
»In der Regel weniger als ein Jahr.«
»Sie hat nicht mal mehr ein Jahr zu leben?«
»Ja. Selbst bei jüngeren Menschen in besserer körperlicher Verfassung als Ihre Mutter führt ein solches Karzinom binnen kurzem zum Tod.«
»Sie hatte schon ewig Rückenschmerzen. Vielleicht hat sie das Geschwür schon lange und kann noch Jahre damit leben«, warf ich blindlings ein.
»Leider ist das in den allermeisten Fällen nicht so«, antwortete der Internist, ein junger Mann in meinem Alter, der den Bauch meiner Mutter aufgeschnitten und darin das Antlitz des Todes gesehen hatte.
»Wird sie Schmerzen haben?«
»Wir konnten das Geschwür nicht vollständig entfernen. Der Leberausgang wird eines Tages abgeschnürt werden. Das wird sehr schmerzhaft für Ihre Mutter sein.«
»Ein Leidensweg?«
»Ja.«
»Was können Sie dagegen tun?«
»Den Schmerz lindern.«
Ich ging in ihr Zimmer zurück und hoffte, daß ihr Bewußtsein vom Morphin in schönere Gefilde befördert worden war, zu Tulpenfeldern in tausenderlei Farben und endlos weiten Panoramen, bis zu den Sternen hinter den fernsten Sonnensystemen.
Ich beschloß, ihr nichts zu sagen. Ich wußte, wie sie reagieren würde. Krebs war ein Wort, das nicht ausgesprochen wurde. Davon sprechen hieß es beschreien. Hin und wieder stöhnte sie.
Niemand hatte das Recht, ihr zu sagen, daß sie in einem Jahr nicht mehr zum Telefonhörer greifen würde, um mich über den zweifelhaften Charakter Arafats ins Bild zu setzen, »dieser Halunke mit seinem Geschirrtuch, dem trau ich nicht, auch wenn er jetzt lächelt und nach Gaza geht«. Niemand hatte das Recht, die Tage, die ihr noch blieben – ein KLM-Abreißkalender mit zwölf Farbfotos von Deichen, Reisfeldern, Berggipfeln und Gletschern –, durch das Geschwätz quacksalbernder Mediziner zu verdüstern.
Mit dem Bewußtsein, daß in ihrem Bauch eine Zeitbombe tickte, würde sie keinen Tag mehr atmen können. Für sie dehnte das Leben sich so endlos aus wie das Weltall. Sollte sich ein plötzliches Ende abzeichnen, würden die glorreichen Kümmernisse, die ihr Sohn, die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, Israel, die Qualität des Fleisches von der Metzgerei Hergo, die Qualität des Brotes von der Bäckerei Van Muyden, die Qualität des Kaffees im Café-Restaurant Delcavi, die Rostflecken an meinem Citroën DS und die Folgen der Serie The Bold and the Beautiful ihr bereiteten, von dem Bewußtsein verdrängt werden, daß alles keinen Sinn mehr hatte.
Sie zeigte eine unbändige, fast kindliche Neugier für ›die Beschaffenheit des Alltäglichen‹, wie Inge es nannte. Wenn ein Spatz vom Dach fiel, dann meldete sich ihre Intuition zu Wort wie ein Hund, der sein Herrchen wittert. Sie war spezialisiert auf das Unansehnliche, Unscheinbare, Unwichtige. Mehr als einmal hatte sie mich schier zum Wahnsinn getrieben mit ihrem endlosen telefonischen Sermon über das Blumenmotiv einer Tischdecke oder das Problem meines klapprigen DS, der, so ihre bescheidene Meinung, meinem Status nicht angemessen sei, aber sie konnte nun mal nicht anders: Für sie hatte noch die geringste Nebensächlichkeit Bedeutung.
In den vergangenen zehn Jahren hatte sie sich mindestens einmal jährlich untersuchen lassen, und alle Spezialisten hatten sich der Reihe nach geirrt. Gallensteine. Vielleicht war auch der neue Befund ein Versehen.
Bevor ich meine Mutter am nächsten Morgen in ihrem Zimmer aufsuchte, bat ich die Ärzte, sie nicht über den Ernst ihrer Krankheit aufzuklären.
Der Internist, sein Assistent und die Pflegeleitung versuchten mich zwar davon zu überzeugen, daß es falsch sei, wenn ich meine Mutter auf diese Weise schonen wollte, aber ich blieb unerschütterlich. Widerstrebend fügten sie sich meinem Wunsch.
Als ich hereinkam, schlief sie. Ohne eine Reaktion zu erwarten, sagte ich, daß ich ihr Blumen mitgebracht hätte. Sofort schlug sie die Augen auf und betrachtete den Strauß mit trübem Blick.
»Tag, Mam.«
»Schön«, sagte sie schwach.
»Ich werde gleich die Schwester um eine Vase bitten.«
»Nicht zu kalt, das Wasser«, hauchte sie.
»Ich werde es ihr sagen. Alles gut gelaufen, hm?«
Sie zog leicht die Schultern hoch und versuchte zu lächeln. So ist das Leben. Krank werden und sich wieder aufrappeln.
Zwei Schläuche führten von einem Sauerstoffapparat zu ihren Nasenlöchern, durch eine Infusion wurde ihr Flüssigkeit zugeführt, und machtlos grinsend stand ich über sie gebeugt.
Sie flüsterte: »Weißt du jetzt endlich, was du dir zum Geburtstag wünschst?«
Während ein Ungeheuer ihr Gallenblase und Leber wegfraß, dachte meine Mutter an meinen Geburtstag.
»Mam, ich hab gerade erst Geburtstag gehabt! Ist das denn jetzt so wichtig? Mein nächster Geburtstag?«
»An was soll ich denn sonst denken?« In ihr Gesicht trat ein Ausdruck des Erstaunens. Immer noch sprach sie leise, aber ihre Stimme war fest.
»Keine Ahnung.«
»Eine Strickjacke«, schlug sie vor.
»Eine Strickjacke? Ich trage nie Strickjacken.«
»Ja, und weißt du auch, warum? Du hast keine Strickjacke.«
»Eine Strickjacke«, wiederholte ich zustimmend.
»Mit einem Muster?« Das war eine rein rhetorische Frage, denn über meine Vorliebe für schlichte Kleidung war sie längst im Bilde.
»Nein. Schlicht.«
»Ich hab nämlich schöne Strickjacken gesehen mit einem hübschen Muster oder zweifarbig.«
»Ganz schlicht«, befand ich.
»Das ist so langweilig«, meinte meine Mutter, mittlerweile erschöpft, aber bereit, den Tod herauszufordern, denn eine Strickjacke für ihren Sohn war das Sterben wert. »Bei dir muß immer alles einfarbig und schlicht sein. Auch deine Oberhemden sind immer schlicht.«
»Ich liebe die Einfachheit.«
»Wieso kann nicht auch eine Strickjacke mit einem hübschen Muster einfach sein?«
»Weil sie ein Muster hat, Mam.«
»Etwas kann einfach sein, auch wenn es ein Muster hat.«
»Für mich nicht.«
»Ach, du mußt dich auch immer abheben. Einfarbig und schlicht ist so altmodisch. Das hat man doch im Nu satt.«
Sie schloß die Augen und beendete das Gespräch. Gespannt wartete ich, ob sich ihre Brust heben und senken würde, und ja, zum Glück atmete sie weiter. Sie schlief. Ich zog mich leise zurück.
Meinem letzten Geburtstag war ein ausführlicher Gedankenaustausch über einen schönen Kamelhaarmantel, einen Anzug, Schuhe, Oberhemden vorausgegangen. Nach sechsundachtzig Telefonaten sagte ich, gut, einen schönen Kamelhaarmantel. Um Charakter zu beweisen, äußerte ich präzise Wünsche: auf keinen Fall zweireihig, nicht zu hell, keine aufgesetzten Taschen und kein breites Revers, und natürlich wollte sie wissen, was denn an einem Zweireiher mit breitem Revers und aufgesetzten Taschen auszusetzen sei. Erblich vorbelastet, stur wie ein Esel, ließ ich mich auf eine Diskussion mit ihr ein.
Vier Wochen später feierten Inge und ich ihre Heimkehr. Unterwegs erklang im Radio des DS einer der Werbespots, für die ich die Musik geschrieben hatte.
»Ich hab schon Besseres von dir gehört«, beliebte sie zu bemerken, meine gerade genesene vierundsiebzigjährige Mutter, etwas in sich zusammengefallen, aber ungebrochen. Früher war sie gelegentlich für eine Französin oder Spanierin gehalten worden, aber nach ihrem sechzigsten wurden ihre Züge semitisch. Leberflecke und Falten verstärkten die Wüstenspuren, die sich über unzählige Generationen hinweg bewahrt hatten.
Sie hatte immer noch einen schön geformten Mund, zumindest wenn sie ihr Gebiß trug. Ihre Nase war im Lauf der Jahrzehnte schärfer hervorgetreten, aber nicht übermäßig, eine markante, stolze Nase unter Augen, die einmal kohlschwarz gewesen waren und nun langsam an Kraft verloren. Nach einigen Jahren beschämenden Haarausfalls hatte der Haarwuchs sich wieder eingestellt, und sie konnte sich wieder ohne Perücke unter die Leute trauen. Auf hochhackigen Schuhen (»Mama, du bist verrückt, in denen herumzulaufen, nicht mal Inge tut das, du machst dir den Rücken kaputt damit.«), das Haar kastanienbraun gefärbt, promenierte sie in maßgeschneiderten Kostümen durch die Beethovenstraat. Ihre Garderobe, geschneidert von einer Türkin, entwarf sie anhand von Beispielen, die sie in internationalen Modezeitschriften fand. Eitel wie ein Filmstar, stolz wie ein Boxer. Noch immer war sie ein Dickkopf und Besserwisser und redete einem in alles rein.
»Dieser Streifen über Bier, der war nichts, finde ich«, tönte sie vom Rücksitz, über dessen Polster ihr Kopf kaum hinausragte, »das Liedchen gefiel mir nicht.«
Sie bezog sich auf einen Fernsehspot, der während ihres Krankenhausaufenthalts erstmals ausgestrahlt worden war.
»Sie waren damit zufrieden, Mam«, antwortete ich mit unverhohlener Verärgerung in der Stimme. Aber meine Gemütsverfassung störte sie nicht im geringsten.
»Wer sie?«
»Die Auftraggeber von der Brauerei.«
»Sie müssen dabei an die Menschen denken. Den Menschen geht so ein Streifen nicht ans Herz.«
»Ich schreibe nur die Musik, Mam. Ich denke mir das nicht aus, ich bin nicht der Regisseur.«
»Na, dann ist deine Verantwortung doch noch viel größer. Von dir muß das Gefühl kommen. Wenn die Menschen nichts fühlen, dann kaufen sie nichts.«
»Die Brauerei ist zufrieden. Das ist für mich das einzige, was zählt.«
»Nicht für mich. Für mich zählt, ob die Menschen zufrieden sind. Und das sind sie nicht.«
»Hast du eine Meinungsumfrage gemacht?«
»Das brauche ich nicht. Ich weiß, was die Menschen denken. Nein, um ganz ehrlich zu sein: Ich hab schon Besseres von dir gehört.«
In den vergangenen fünf Jahren war sie auf vielen Beerdigungen gewesen, und neue Bekanntschaften machte man in ihrem Alter nicht. Sie ging zu Treffen der WIZO, einer jüdischen Frauenorganisation, und einmal im Jahr in die Synagoge. Sie rief täglich an, und nie war ich darauf vorbereitet.
»Hast du das gerade gesehen, im Fernsehen?«
»Was, Mam?«
»Von den Moffen?«
»Was haben die Moffen denn jetzt wieder getan?«
»Also, was die mit den Asylbewerbern machen. Ein Haus haben sie angesteckt.«
»Diese Scheißkerle. Ich hab die Nachrichten nicht gesehen.«
»Was, was hatten wir denn getan, wir hatten doch gar nichts getan! Meine Mutter ging mit Stoffresten von Tür zu Tür, wir waren arm, aber anständig, wir hatten zu essen, aber wir waren arm. Wir hatten nichts getan, und trotzdem wurden sie wie Tiere weggeschleppt. Leo, der Sohn von Tante Saar, ein bildhübscher Junge, Leo war der erste, der einen Aufruf bekommen hatte, und Tante Saar fiel auf die Knie und flehte die Polizisten an, ihn laufenzulassen, aber die Polizei nahm ihn mit, und das waren keine Moffen, das waren Niederländer, Bennie, hörst du, obwohl Tante Saar vor ihnen auf den Knien lag, kannten sie kein Pardon, und danach haben sie alle geholt …«
Ihre Klagen dauerten allerhöchstens fünf Minuten, und sobald sie sich beruhigt hatte, schien sie sich zu schämen. Dann folgte eine Vorschau auf das Spiel ihrer Lieblingself Ajax oder eine Zusammenfassung eines neuen Heftes von Story (»ich weiß ja, daß es ein ziemlich übles Blatt ist, aber wußtest du, daß Lee Towers …«). Bei ihr waren das Unbeschreibliche und das Klischee perfekt ausbalanciert, dazwischen lag nur ein Atemzug, eine Sekunde der Besinnung oder ein Blick auf den Wahnsinn, der lauerte, wenn sie sich nicht beherrschte. Von Auschwitz zum Glücksrad, der großen Gewinnshow.
Vier Monate nach der Operation, abgemagert, aber völlig auf der Höhe, lernte sie Fred Bachman kennen (»Ich habe jemanden kennengelernt, Bennie, einen wirklich netten Jemand.«), und ich hatte ihre Krankheit aus meinem Leben verdrängt.
Zehn Monate nach ihrer Operation war sie plötzlich verschwunden.
Fred Bachman rief um halb acht an, kurz nachdem ich beim Chiang Mai, einer Oase thailändischer Feinsinnigkeit im von örtlichen Vandalen demolierten Herzen Hilversums, Pad Pak Ruamit und Tom Jang Kung bestellt hatte.
Ein paarmal die Woche gab ich so telefonisch meine Bestellung auf, und wenn ich die Schälchen abholte, winkten mir die stets lächelnden Sklavinnen immer so ausgiebig nach, als hätte ich in Gold bezahlt. Wenn die Tür des kleinen Restaurants hinter mir zufiel, klirrte in der Scheibe noch das Echo ihrer Dankesworte: »Guten Appetit, Herr Weiss! Haben Sie vielen Dank, Herr Weiss! Vorsicht Stufe, Herr Weiss!« Ich aß die scharf gewürzten Gerichte, während ich an meinem Roland Masterkeyboard weiterarbeitete, und hatte anschließend mit unstillbarem Durst zu kämpfen.
Am nächsten Morgen sollte ich der »Leitung des Kreativbüros« der Agentur JS-XTH eine Serie von sechs jingles – ein inflationärer Ausdruck, der in unserer Welt vermieden wird – zu Gehör bringen. Im Auftrag einer Ladenkette entwarfen sie eine Kampagne für Damen- und Herrenräder, gußeiserne Gartenmöbel, Innenraumbeleuchtungen und Taschenlampen, alles solide und funkelnd und Made in China. Ruth van Dijk, Motor der Denkfabrik von JS-XTH, hatte mich für diesen Eilauftrag engagiert.
Vor zwanzig Jahren hatte Ruth an der Filmhochschule studiert. Im zweiten Jahr, als sie ihren ersten kleinen Film machte, hatte sie über einen Aushang am Schwarzen Brett des Konservatoriums nach jemandem gesucht, der ein score dazu schreiben konnte. Ich studierte damals Klavier und Kompositionslehre und bewarb mich auf den von Stilfehlern strotzenden handgeschriebenen Zettel hin. Der Film gewann einen Preis auf einem Festival von Filmstudenten. Nach dem Studium landete sie bei der Werbung, und in ihrem Kielwasser geriet ich zu den Spots. In ihrem Auftrag hatte ich die Musik für zig Werbespots geschrieben.
Ruth wollte eine gesungene Kampagne, eine Reihe von Miniclips, und ich sollte eine Melodie liefern, die sich leicht einprägte, simpel, »aber mit Gefühl«, betonte sie, »ohne Gefühl kannst du keinen BH verkaufen«.
Vor drei Tagen hatten wir gemeinsam über die Kampagne beraten, und seit gestern schrieb ich an den Jingles. Sie hatten es eilig. Die Container mit den chinesischen Waren warteten im Verteilerzentrum der Ladenkette und nahmen kostspieligen Lagerraum ein. Aber alles, was ich bis jetzt geschrieben hatte, klang wie leise vor sich hinköchelnder Eintopf.
Fünf Minuten nach meiner Bestellung beim Chiang Mai läutete also das Telefon. Der Anrufbeantworter schaltete sich ein, und nach zehn Sekunden von einem Bicinium, einem zweistimmigen Stück aus dem sechzehnten Jahrhundert, dem genauen Gegenstück zu meinem Jingle-Kram, folgte meine Stimme: »Ben-Weiss-Produktion. Bitte sprechen Sie nach dem Hinweiston.«
»Bennie, hier ist Fred Bachman. Ich weiß nicht, ob du zu Hause bist, aber ich muß dich dringend sprechen.«
Der Freund meiner Mutter. Siebenundsiebzig. Vor einem halben Jahr lernten sie sich bei einem Einführungsabend des Beth Shalom, des jüdischen Altersheims in Osdorp, kennen, und es war Liebe auf den ersten Blick. Meine Mutter war völlig genesen und würde ewig leben.