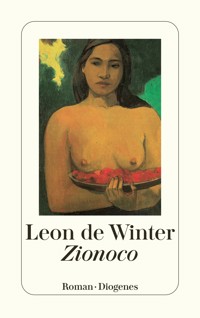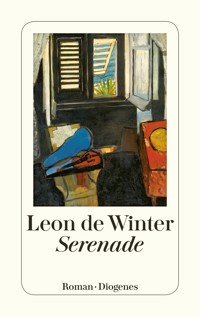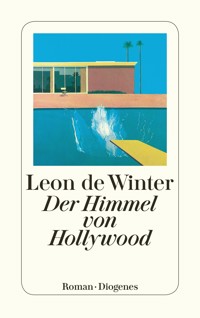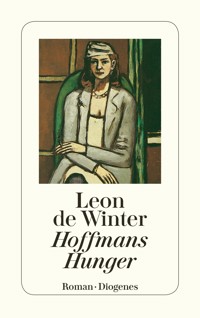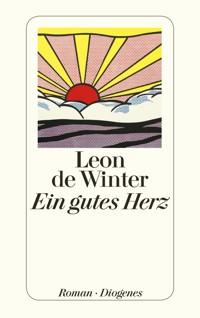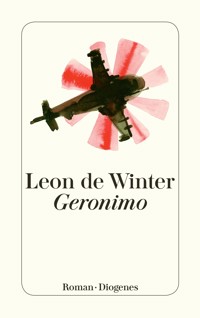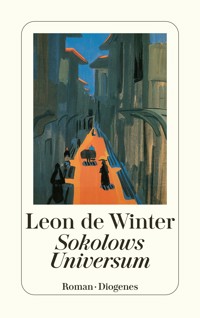
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Straßenkehrer in Tel Aviv wird Zeuge eines Mordes. Der Mann zweifelt an seinem Verstand, denn er glaubt, in dem Mörder einen alten Freund erkannt zu haben. Und dies würde in der Tat alle Regeln der Wahrscheinlichkeit außer Kraft setzen. Denn Sascha Sokolow ist kein gewöhnlicher Straßenkehrer. Noch vor kurzem war der emigrierte Russe einer der angesehensten Raumfahrtforscher seines Landes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Leon de Winter
Sokolows Universum
Roman
Aus dem Niederländischen von Sibylle Mulot
Diogenes
Für Jesicca
Nichts wirst du sehn in ewig leerer Ferne,
Den Schritt nicht hören, den du tust,
Nichts Festes finden, wo du ruhst.
Goethe, Faust
>»Glaubst du nicht, Gott sieht alles?«
»Gott ist ein Luxus, den ich mir nicht erlauben kann.«
Woody Allen,
Verbrechen und andere Kleinigkeiten
Erster Teil
1
Am Sonntag, dem 23. September 1990, wurde in der Schechunat Hatikwah, einem Stadtteil im Süden von Tel Aviv, ein Mord verübt.
Den größten Teil der Rechow Etsel, der Hauptstraße dieses überwiegend von Jemeniten bewohnten Viertels, hatte der dreiundvierzigjährige Alexander Iwanowitsch Sokolow, ein großer magerer Mann mit einem Kindergesicht, bereits sorgfältig, wenn auch träge gekehrt und sich dann an der Ecke von Rechow Etsel und Rechow Roni hinter seinen Straßenkehrerkarren hingesetzt, um heimlich eine Flasche Wodka an den Mund zu führen. Ein paar Sekunden bevor die Schüsse fielen, hatte Sokolow sich wieder aufgerichtet, um seine Arbeit in dieser Straße zu beenden. Es war ein warmer Tag, die Sonne brütete auf seinem rötlichen Haar.
Sokolows Gerätschaft bestand aus einem altmodischen Strohbesen, einem Stockspieß, einer gedeckten Schaufel für Hundekot und einem kleinen Karren. Der rollte auf zwei Fahrradrädern, die mit Bügeln an einem Eisenring befestigt und mit einem V-förmigen Griff versehen waren, an dem man das Ganze schieben konnte. Im Ring hing ein Plastikmüllsack – der Mittelpunkt von Sokolows Aktivitäten. Der Karren war aus minderwertigem Stahl gemacht und schlampig zusammengeschweißt, aber er erfüllte seinen Zweck.
Sokolow hatte sich also mit Kehren bis zur Rechow Roni vorgearbeitet, einer engen Seitengasse, die in der Hauptstraße aufging wie ein Ast in einem Stamm. An dieser T-förmigen Kreuzung mit der Rechow Etsel, einer heruntergekommenen Straße mit billigen Restaurants, Gasthäusern und Imbißbuden, hatte er ziemlich viel Müll vorgefunden. Die Blasen an seinen Händen waren verheilt, seit er Plastikhandschuhe trug, aber sein Kreuz erinnerte ihn noch daran, daß er körperliche Arbeit nicht gewohnt war. Für die wirksamste Kehrbewegung mußte er sich immer leicht vorbeugen, und nach einem Tag angestrengten Straßen- und Rinnsteinfegens kehrte er mit brennendem Rücken in sein Zimmer im ersten Stock eines vergammelten Hauses in der Rechow Iwri zurück, einer anderen Querstraße der Etsel. Bei der Arbeit schweiften seine Gedanken von einem Thema zum anderen, manchmal mit Lichtgeschwindigkeit, manchmal mit dem trägen Schritt eines besoffenen Russen.
Während sich das auserwählte Volk zur Mittagsruhe in den Häusern befand, drehte Sokolow seine Runde, um die Stunden wieder hereinzuholen, die er am Morgen verloren hatte. Erst um halb elf hatte er sich in der Baracke gemeldet, die von der Reinigungsfirma als Depot für die fahrbaren Müllsäcke benutzt wurde, lange nachdem ihn der Wecker aus schweren Träumen gerissen hatte.
Wie im gesamten kapitalistischen Israel vergab die Gemeindeverwaltung auch hier kommunale Reinigungsarbeiten an private Betriebe. Im Hatikwah-Viertel war der billigste Unternehmer ein Jemenite, genannt der Schwarze Jossi. Schwarzer Jossi hatte den Gemeindeauftrag bekommen, weil er erstens die Konkurrenz bedrohte (er verprügelte sie oder zündete ihre Häuser an, wenn sie es wagten, niedriger anzubieten als er), aber auch, weil er zweitens besondere Beziehungen zu den Beamten unterhielt, die die Aufträge verteilten. Seinem Personal zahlte er nur den absoluten Mindestlohn, einen Betrag, der in Israel die Armutsgrenze markierte. Für neunhundert Schekel im Monat kehrte Sokolow an sechs Tagen in der Woche die Straße, das Zimmer kostete ihn zweihundertundfünfzig, Gas und Licht hundert, und der Rest ging mehr oder weniger für Wodka drauf.
Sokolow war heute morgen zu spät gekommen, weil er so sturzbetrunken gewesen war, daß er sich, nachdem er die Weckuhr durchs Zimmer gepfeffert hatte, drei weitere Stunden lang nicht aus dem Bann eines magischen Schlafs lösen konnte. Der Aufziehwecker Made in Switzerland war solide genug, um Sokolow noch die paar Jährchen aus seinen Träumen zu reißen, bis der Messias sich endlich gezeigt hätte (soeben war hier das Neujahrsfest des Jahres 5751 gefeiert worden, und sehr viel länger würde Er doch wohl nicht mehr brauchen). Sokolow hatte die Weckuhr auf dem arabischen Flohmarkt in Jaffa gekauft, und das Ding funktionierte nach einem Dutzend Würfen noch immer tadellos. Mit bohrendem Schädelweh hatte er um zehn Uhr die Augen aufgeschlagen und war ein paar Straßen weiter in Richtung Baracke geeilt, wo Schwarzer Jossi persönlich das Zepter über die Straßenkehrer des Hatikwah-Viertels schwang: über Sascha Sokolow und achtzehn andere Akademiker, die so glücklich waren, überhaupt einen Job gefunden zu haben.
»Früher hatte ich Palästinenser in Dienst«, erklärte der Schwarze Jossi beim Vorstellungsgespräch, »aber man soll doch den olim chadaschim, den Neueinwanderern, helfen, was man kann. Was hast du vorher in Rußland gemacht?«
»Ich bin Ingenieur der Metallurgie«, antwortete Sokolow mit brüchigem Stolz. »Ich habe cum laude über Metallmüdigkeit in Vakuumräumen promoviert.«
»Das fehlt mir noch in meiner Sammlung«, schmunzelte Jossi und zählte die eigentlichen Berufe seiner Straßenkehrer auf: ein Arzt, ein Geiger, ein Geschichtslehrer (»Ja, damit kannst du dir hier den Hintern wischen«), ein Biologe, ein Geologe (»Tundrafachmann oder so, hier auch überflüssig wie ein Kropf«) sowie ein Auto-Designer, der den Moskwitsch und den Wolga mit entworfen hatte (»Steinzeitschlitten, die will hier keiner«).
Am Abend zuvor hatte sich Sokolow betrunken. Er hatte sich auch in der Nacht davor betrunken, und in der Nacht vor dieser Nacht: So ziemlich alle zweihundert Nächte, die er schon in Israel verbrachte, hatte er in Wodka ersäuft. Der Erste Halbe Liter wirkte erquickend und belebend. Aber er weckte auch einen quälenden Durst, der nur mit dem Zweiten Halben gelöscht werden konnte. Und dieser Zweite Halbe brachte wieder zum Vorschein, was mit dem Ersten Halben betäubt worden war. Sokolow war dann nicht mehr imstande, den Verschluß auf die Flasche zu schrauben und sich in sein Lehrbuch Iwrith für Fortgeschrittene zu vertiefen, das im Zimmer herumlag. Dann mußte er sich auf die Suche nach dem zweiten Liter machen und sich ins schwärzeste Vergessen trinken.
Sokolow war schon öfter zu spät gekommen, aber nie so sehr wie heute. Heute sah es nach Rekord aus. Gestern war Sabbat gewesen, ein Feiertag für grenzenloses Besäufnis. Als er sich endlich zum Dienst meldete, wurde er von Jossi heruntergeputzt. Sein Boß saß in der Baracke hinter einem leeren Schreibtisch. In der Ecke stand eine fahrbare Aircondition. Sie dröhnte wie ein Flugzeugmotor. Jossis Stimme übertönte sie mühelos.
»Was glaubst du – bist du vielleicht was Besseres als die anderen?« fragte er. Der Körperbau des Schwarzen Jossi war fast quadratisch, der runde Kopf saß direkt auf dem muskulösen Oberkörper (wozu brauchte ein Schwarzer Jossi so was Elegantes wie einen Hals?), und seine massigen Arme, Ergebnis jahrelangen Trainings in einer Sportschule, hätten den um zwei Köpfe größeren Sokolow in wenigen Sekunden dauerhaft invalidisieren können. Um Jossis Nakken hing ein goldener Davidsstern von der Größe eines Verkehrsschildes, die Handgelenke hatte er sich in massiv-goldene Ketten schlagen lassen, die Finger protzten mit dicken Siegelringen. Dieser Typ, den es auch in der Sowjetunion gab, hieß hier Tschaktschak, ein geistig minderbemittelter ordinärer Hohlkopf mit zuviel zweifelhaft erworbenem Geld.
»Hör mal, Boris, du …«
»Ich heiße Sascha. Alexander Iwanowitsch …«
»Unterbrich mich nicht, Mann, sonst kannst du gleich nach Hause gehen. Also, paß mal auf, du Wicht, du bist jetzt hier im Westen, klar? Hier kannst du dich nicht mehr auf die faule Haut legen wie früher zu Hause. Du bist jetzt im Kapitalismus, und da wird für Geld gearbeitet, verstanden? Das war das letzte Mal, ich warne dich, noch einmal zu spät, und deine Karriere im Reinigungsbereich ist beendet, okay?«
Der Ingenieur für Metallurgie hatte genickt. Er hatte seinen Karren genommen und ihn zu seinem Gebietsabschnitt geschoben.
Es war Viertel vor drei, und eine fettige Schweißschicht bedeckte seinen Körper. Die Luftfeuchtigkeit in Tel Aviv schwankte an heißen Tagen so um die hundert Prozent, ideal für Insekten und Reptilien. Das quälende Kopfweh von heute früh hatte sich in dem Wodka aufgelöst, den er sich seit ungefähr zwölf Uhr einflößte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er in einem Supermarkt eine Flasche Gold Wodka erstanden, ein vierzigprozentiges scharfes und zugleich wäßriges Zeug, verglichen mit dem himmlischen Stolitschnaja, den er von der udssR her gewöhnt war (guter Wodka schmeckte weich und hatte eine ölige Konsistenz), aber einen anderen konnte er sich nicht leisten. In diesem Land zahlte man ein Vermögen für eine Flasche Stolitsch, und falls er hier seinem Hang zu Edelspirituosen nachgab, hätte er seinen Monatslohn jeweils innerhalb von wenigen Tagen versoffen. Dann lieber Gold, eine israelische Marke, unverkennbar viele Stufen tiefer in der Wodka-Hierarchie, aber billig und in den Nachwirkungen offensichtlich auch nicht schlimmer als die teureren Marken. Die Schmerzen, mit denen Sascha erwachte, hingen mit der Menge seines Konsums zusammen sowie mit den Erinnerungen, die er damit ertränkte, das durfte er Gold nicht anlasten.
Seit seinem Debüt als Straßenkehrer hatte Sokolow festgestellt, daß die Israelis, vor allem die Juden aus Nordafrika oder dem Jemen, kein Umweltbewußtsein hatten. Alles warfen sie auf die Straße. Das war für ihn eine neue Erfahrung, vieles sah er erst, seit er die Welt als Straßenkehrer betrachtete, und was er sah, machte ihm die Grenzen seiner Wahrnehmung bewußt. Früher, als Raumfahrtingenieur in der Sowjetunion, hatte er in einer anderen Welt gelebt. Umweltschutz hatte dort nie eine Rolle gespielt. Sibirien und die Ukraine waren kraft ihrer Natur dazu da, ausgebeutet zu werden, und erst nach seiner Ankunft in Israel lernte er westliches Verantwortungsgefühl kennen. Greenpeace. Jetzt ärgerte es ihn, wenn er sah, wie aus den wartenden Fahrzeugen an der Ampel Papierchen und Dosen und Plastikbecher auf die Straße flogen. Immer, wenn in diesem Viertel eine Ampel auf Rot sprang, entstand Arbeit für das Personal von Jossi Cohen. Insbesondere für Doktor Alexander Iwanowitsch Sokolow, dem man die schwierigste Straße im Hatikwah-Viertel zugewiesen hatte.
Den nördlichen Teil der Rechow Etsel – er grenzte an den jemenitischen Markt, der dort in den Straßen und Gäßchen stattfand – hatte er inzwischen gesäubert. In dieser von mageren Bäumen flankierten Straße bestand der Abfall meist aus Verpackungen von Snacks: Papierhüllen von Mars und M & M’s, Pergamentpapier, worin Falaffel und Shoarma-Sandwiches eingewickelt waren, leere Dosen, halb aufgegessene Pfirsiche und Apfelsinen. Zeichen von Wohlstand und Überfluß lagen hier auf der Straße. Früher, zu Hause, flogen allenfalls Flaschen und Papierfetzen in den Rinnstein, die keiner mehr verwenden konnte, aber eigentlich gab es kaum Abfall in der Sowjetunion. Arme erzeugen keinen Müll.
Die vielen Gasthäuser lockten jeden Abend eine Menge Touristen, Studenten und Künstler an, auf der Suche nach der original jemenitischen Küche, nach einer unverfälschten Atmosphäre und billigem Essen. Die Preise in den meisten Gasthäusern waren so niedrig, daß sogar er es sich manchmal leisten konnte, an einem der Holztische Platz zu nehmen. Schalen mit nahrhaften würzigen Saucen kosteten nur ein paar Schekel, ein Körbchen mit Fladenbrot bekam man für einen Schekel, und wenn man Wasser dazu trank (man mußte natürlich seinen eigenen Wodka hineingießen), dann hatte man für nur fünfzehn Schekel eine komplette Mahlzeit mit freiem Blick auf die flanierende Menge.
Jedes kleine Gasthaus hatte sein Stück Gehsteig annektiert und darauf – legal oder nicht – eine Terrasse installiert. Das ganze Jahr über war es dort allabendlich voll. Seit er vor drei Wochen aus dem Apartment in Herzlia ausgezogen war, wohnte er nun in dieser Gegend, und wenn er sich mit dem Ersten Halben genügend Mut angetrunken hatte, um eine Runde zu drehen, sah er aberhundert Leute geräuschvoll essen und trinken, lachen und gestikulieren. Er hielt dann Ausschau nach streichelnden Händen und küssenden Lippen, nach jungen Frauen mit geheimnisvollen Augen und strammsitzenden T-Shirts, und wenn er hinter seiner Sonnenbrille den Blick senkte, sah er unter den Tischen herrliche glatte Schenkel und Waden und Fesseln von einer Schönheit, die ihn schmerzte und ihn wieder in sein Zimmer jagte, wo der Zweite Halbe schon auf ihn wartete.
Sokolow aß nicht viel. Er war mager. An seinem Oberkörper konnte man die Rippen zählen, aber sein Gesicht wirkte rund und gesund. Sein Kopf hatte gar keine Beziehung zum Körper. Der Kontrast war so groß, daß man dachte, er sei bei einer experimentellen Operation mit dem eines anderen vertauscht worden. Sein langer Körper, der so hager war wie der eines Bettelmönches, wurde durch einen schlanken Schwanenhals, in dem ein riesiger Adamsapfel steckte, mit diesem Kinderkopf verbunden. Sein Blick aus großen Augen hatte schon immer etwas Unschuldiges gehabt, das die Mädchen rührte. Eine Zeitlang trug er Schnurrbart, experimentierte mit langen Backenbärten oder züchtete sich ein Kinnbärtchen, aber die Behaarung in seinem Gesicht wirkte immer wie angeklebt – ein Junge, der aussehen wollte wie ein Mann. Noch als er auf die Vierzig zuging, verriet Sokolows Gesicht sein wahres Alter mit keinem Schimmer.
In der Sowjetunion hatte er fortschrittliche Arbeit geleistet: mit einem wohlumschriebenen Ziel, das eines Tages erreicht war und dann von einem anderen Ziel abgelöst wurde, für das man neue Methoden und Apparate ersinnen mußte. Dort war er ein Rädchen im dynamischen Wissenschaftsbetrieb gewesen. Und was machte er hier? Etwas von absolut untergeordneter Bedeutung für alle, die nicht selbst damit befaßt waren. In der Sowjetunion war Straßenfegen Sache einer Legion älterer alleinstehender Frauen, die damit ihre kargen Renten um ein Paar Rubel aufbesserten. Er hatte sie ein Leben lang nur wie ein Schlafwandler betrachtet. In ihrer unmittelbaren Nähe hatte er nichts von ihrer Ausdauer und Muskelkraft geahnt, aber jetzt sah er seine heldenhaften Kolleginnen im Geiste vor sich, korpulente Frauen mit gegerbten Gesichtern und geschwollenen Händen und verschlissenen Kopftüchern. Jetzt erst erinnerte er sich an ihre nie ermüdenden Körper, die sich bückten, drehten, hinhockten und schwer geschuftet hatten, und in seinen Gedanken – dem Universum seines Geistes – erwies er ihnen nachträglich die Ehre. Es war zwar sinnlos, aber besser als nichts.
Nach seiner Ankunft hatte Sokolow mit dem Begrüßungsgeld ein teures Apartment in Herzlia gemietet, gewissermaßen, um sich für die mageren Jahre in Tomsk zu entschädigen. Er erwartete damals noch, innerhalb von kürzester Zeit eine gutbezahlte Arbeit zu finden, angesichts seiner besonderen Spezialisierung, die ihm überall auf der Welt zu einem Job verholfen hätte. Aber in Israel gab es anscheinend nur ein einziges Unternehmen, das ihn haben wollte. Dort herrschten strenge Sicherheitsbestimmungen, und die Untersuchungskommission schloß die Bewerber wie in Amerika an einen Lügendetektor an. Davor war er zusammengebrochen. So hatte er es empfunden: zusammengebrochen.
Der Gedanke an sein Scheitern bei diesem Test verursachte ihm Magenkrämpfe. Er lehnte den Besen an den Karren, öffnete die feste Plastiktüte, die am Schiebegriff hing, und warf einen Blick über die Straße. Die Rechow Etsel lag verlassen da. Die Geschäfte waren geschlossen, Autos parkten. Er trank einen Schluck, und der Alkohol fraß sich ihm die Speiseröhre hinunter bis in den Magen, wo er den Krampf augenblicklich zum Schweigen brachte.
Als er die Flasche absetzte, sah Sokolow auf der anderen Straßenseite einen Mann rasch und athletisch in ein Gasthaus mit geschlossenen Fensterläden eintreten. Die auffallende Qualität der Hose hatte Sokolow aus dreißig Meter Abstand erkennen können. Sie war aus glänzender silbergrauer Seide, mit messerscharfer Bügelfalte. Das Hemd darüber strahlend weiß, auf den kurzen Ärmeln sah man den frischen Bügelfalz. Das Gesicht des Mannes war Sokolow entgangen, aber seine Kleidung verriet, daß er Geld hatte, jedenfalls genug, um Wäscherei und Reinigung zu bezahlen, die in diesem Land, wie er in Herzlia entdeckt hatte, ein Vermögen kosteten. Sokolow selbst trug die Hose eines seiner russischen Anzüge auf. Im ›Sternenstädtchen‹ konnte er, weil er Zugang zu den Spezialgeschäften hatte, die Spitzenerzeugnisse der russischen Bekleidungsindustrie erstehen, aber selbst die waren nur zehntrangig, verglichen mit dem, was in den Schaufenstern der noblen Geschäfte der Dizengoff auslag. Seine Anzüge waren außerdem altmodisch. Geld für Jeans und Turnschuhe hatte er nicht, also beschloß er, einen seiner Anzüge für die Arbeit zu opfern. Er schraubte den Verschluß wieder von der Flasche. Er hatte ernstere Probleme als Kleidung. Vielleicht konnte er nie mehr in seinem richtigen Beruf arbeiten. Vielleicht hätte er die Sowjetunion doch nie verlassen sollen.
Ein Schluck spülte den quälenden Gedanken fort. »Apfelsinen«, las er, während er sich neben seinen Karren auf eine liegengebliebene Holzkiste setzte. Die ersten Monate in Israel hatte er voller Hingabe den Ulpan besucht, die Sprachschule für Einwanderer. In der höheren Schule, während der Studentenzeit und später als Wissenschaftler hatte er immer zu den Ersten gehört, und auch hier zeigte er, was in ihm steckte. Sein trainierter Geist hatte nicht die geringsten Schwierigkeiten mit der Grammatik. Er las und verstand Iwrith, nur mit dem Sprechen haperte es. Ein regelmäßiger Umgang mit Israelis hätte ihm innerhalb eines Jahres ein fließendes Iwrith beschert, aber da war niemand, mit dem er hätte reden können. Im Gegensatz zu den meisten anderen Einwanderern hatte er keine Verwandten in Israel. Und Freunde hatte er im Ulpan nicht gefunden.
Es war im tiefsten Sibirien, in Tomsk, wo er zum Alkoholiker geworden war. In Kaliningrad hatte er vor seiner Deportation nur mäßig getrunken (im Geist verwendete er stets dieses Wort, auch wenn davon keine Rede sein konnte, weder im technischen noch im juristischen Sinn. Sein Konstruktionsbetrieb hatte ihn einfach nur in ein anderes Werk versetzt – dreitausend Kilometer weiter östlich). Nachträglich gesehen hatte er sich beim Wein- und Wodkagenuß also immer bis zu einem gewissen Grad beherrscht, als hätte er instinktiv gewußt, daß er mit Leib und Seele Trinker war. Es war eine Art Warten auf die Katastrophe gewesen, die seine wahre Natur dann enthüllte.
In Tomsk lebte er in einem engen Kämmerlein. Verglichen mit seinem Apartment im ›Sternenstädtchen‹ eine gesellschaftliche Degradierung erster Klasse. Das Zimmer, das er hier bewohnte, war womöglich noch kleiner. Es maß zweieinhalb auf drei Meter, inklusive der Kochecke, in der ein Kühlschrank mit kleiner Kochplatte stand. Die Dusche im Flur mußte er vom nächsten Tag an mit zwei Neueinwanderern teilen, die direkt aus Moskau kamen. Sowohl El Al als auch Aeroflot flogen derzeit zwischen Scheremetjewo und Ben-Gurion hin und her, und seit kurzem gab es die neue Bestimmung, die armen Olim sofort in eine Privatwohnung zu setzen oder sie bei ihren Verwandten unterzubringen. Sokolow fand, die geräumige Apartmentwohnung in Herzlia für neunhundert Dollar im Monat habe ihm eigentlich zugestanden – mit vier Zimmern, weißem Marmor im Bad, einer Terrasse mit Meerblick, einem eigenen Stellplatz in der Tiefgarage (für später, wenn er einen schnellen Japaner fuhr) und einem Hausmeister, der ihn mit »Alles in Ordnung, Doktor Sokolow?« begrüßte. Aber innerhalb von wenigen Wochen hatte er den täglichen Wodkapegel von Tomsk wieder erreicht, morgens im Kampf mit schrillem Kopfweh, das wie von Zauberhand verschwand, sobald er eine Flasche aufschraubte, mittags funktionierend wie ein junger Gott und abends im Gleitflug durch den Kosmos schwebend, wo er, wenn er die zweite Flasche halb geleert hatte, frei und schwerelos zwischen den Sternen umherflog. Sein Bewußtsein dehnte sich aus wie das All und sah die Geheimnisse des big bang im göttlichen Licht leuchten. Sieben Monate hatte er in Herzlia gewohnt.
Schon als Kind war er vom Universum besessen gewesen und hatte davon geträumt, dem Hund Laika – dem ersten Lebewesen im All – Gesellschaft zu leisten. Am 12. April 1961 hatte er bei Gagarins Weltraumreise vor Bewunderung geweint. Er war damals fast vierzehn gewesen und hatte seine Eltern bestürmt, er wolle Raumfahrer werden. Den ganzen Abend lang hatte das Radio über den großen sowjetischen Vorsprung in der Raumfahrt berichtet, und sein verständnisvoller Vater hatte ihm erlaubt, bis Mitternacht aufzubleiben. Achtzehn Jahre später wurde er im ›Sternenstädtchen‹, der abgeschirmten und für Ausländer gesperrten Raumfahrtstadt bei Moskau, Projektleiter eines der Forschungsteams für das sowjetische Raumfahrtprogramm der NPO Energia, die die Antriebsraketen des Buran-Shuttle, der Sojus-Kapseln und der Progress-Frachtkapseln baute. Sechs Jahre hatte er dort gearbeitet, bis zum Debakel der Oktjabr. Und doch wurde er nach der Katastrophe von seinen neuen Kollegen in Tomsk noch mit Achtung und Respekt behandelt. Er war gefallen, aber nicht vergessen. Tomsk markierte das Ende einer aufsehenerregenden technischen Karriere, die vom Schicksal zerschlagen wurde, aber auch in Tomsk wurde er mit ›Doktor‹ und ›Professor‹ angeredet. Erst in Israel wurde er zu einem Schatten zwischen den Häusern.
Momentan verlor er sich in Tagträumen. Er kehrte gern in die früheren Jahre zurück und ließ sich in der Geborgenheit und grenzenlosen Erwartung von damals treiben. Der Schmerz entstand, wenn er wieder an die Oberfläche seiner Gegenwart hochkam, um kurz Luft zu holen – ein dreiundvierzigjähriger Mann, der den Reichtum seines Lebens verspielt hatte. In den letzten Jahren hatte er viel Zeit mit dem Verdrängen der Katastrophe verbracht: Wenn er getrunken hatte, widerrief er den Augenblick, da die Oktjabr explodiert war, und erschuf sich eine neue Vergangenheit, wie ein zaubermächtiges Kind. Seit er hier in Israel war, führten ihn seine Wodkareisen in eine Welt, in der die lineare Zeit in Stücke zerfallen war; sie existierten nebeneinander. Sokolow kannte seine Klassiker. Er wußte, daß die Gesetze von Zeit und Raum für jenes geordnete Universum galten, das von Newton, Einstein und Planck in Formeln gebracht worden war, aber nach einer Flasche Wodka befand er sich in einem anderen Universum, das von seinen Erinnerungen und Ängsten und Sehnsüchten beherrscht wurde, und darin galten diese Gesetze nicht.
Sokolow richtete sich auf und sah, wie jener Mann mit der teuren Hose das Gasthaus auf der anderen Straßenseite verließ. Der Mann blieb vor der Tür stehen, holte aus der Brusttasche seines gestärkten Hemdes eine blinkende Sonnenbrille und setzte sie sorgsam auf die Nase, wobei er sicherheitshalber einen Bügel zwischen Daumen und Zeigefinger festhielt. Geziert spreizte er dabei den kleinen Finger ab. Sokolow stand mit dem Besen in der Hand im Schatten eines der Bäume der Rechow Etsel und schaute zur besagten Stelle auf der sonnenüberfluteten anderen Straßenseite hinüber. Der Mann war schlank, dunkel, hatte kurzgeschnittenes glänzendes Haar, und seine Wangen sahen frisch rasiert aus, als hätte er soeben beim Nachtisch noch den Barbier kommen lassen. Seine Haltung verriet Selbstvertrauen, ein erfolgreicher Typ, der seinen Platz im Leben gefunden hatte. Zufrieden strich er sich mit der flachen Hand übers Haar, gab jedem Härchen die gebührende Position.
Diese Geste wirkte wie ein Signal, denn in diesem Moment tauchte hinter ihm ein zweiter Mann auf – Sokolow hatte ihn nicht kommen sehen, vielleicht aus dem Geschäft daneben –, mit einer Pistole in der rechten Hand. Trotz der Hitze trug der Bewaffnete einen Anzug, offenbar reinseiden, da er wie ein Spiegel in der Sonne blinkte. Der erste Schuß fiel in dem Augenblick, als Sokolow den Mund öffnete, um zu schreien. Ein Warnruf? Ein überraschter Aufschrei?
Der Körper des ersten Mannes erzitterte und beschrieb durch die Wucht der Kugel eine halbe Drehung. Sie war in der Mitte seines Rückens in den Körper eingedrungen und mußte den Brustkasten durchschlagen haben. Auf der Höhe des Brustbeins klaffte ein rotes Loch. Sokolow hatte zu Beginn seiner Laufbahn an der Entwicklung von Munition mitgearbeitet und wußte, daß nicht der Einschlag, sondern der Wiederaustritt einer Kugel die Wunde verursachte. Der Schütze erhob die Waffe und feuerte noch einmal, dieses Mal frontal, und erst jetzt merkte Sokolow, daß er nichts hörte.
Die Sonnenbrille spritzte auseinander, der Hinterkopf des Mannes verwandelte sich in eine große zerquetschte Tomate. Der Getroffene sank in sich zusammen, sein Körper schlug auf dem Boden auf. Das Geräusch, das durch die heiße Luft auf Sokolow zuwaberte, erinnerte ihn an das Klatschen des Zeitungspakets, jener hundertfünfzig mit einem Strick verschnürten Exemplare des Ma’ariv, das von einem fahrenden Lastwagen auf den Bürgersteig vor seiner Millionärswohnung geworfen wurde und für den Laden im Erdgeschoß bestimmt war.
Wie versteinert guckte Sokolow mit offenem Mund zu dem Opfer hinüber. Vor wenigen Sekunden hatte er es noch beneidet. Jetzt lag dort ein Ding, das weggeräumt werden mußte. Und die Frage schoß ihm durch den Kopf, ob er gleich derjenige sein würde, der das Blut vom Asphalt waschen mußte. Und sein nächster Gedanke führte ihn zu der Feststellung, daß er die Welt jetzt wirklich aus der Perspektive eines hirnlosen Straßenkehrers betrachtete: Wie wertvoll waren die Kleider, wer räumte diesen Haufen Muskeln und Knochen weg? So denkt einer, der in der Gosse steht.
Sokolows Augenbewegung war minimal, aber sie veränderte sein Leben von Grund auf: Als er vom Toten zum Schützen aufsah, merkte er, daß der Mann ihn entdeckt hatte. Ihre Blicke trafen sich, und sofort setzte sich der Mann in Bewegung.
Er lief auf Sokolow zu.
Sokolow blieb stehen und hielt sich am Besenstiel fest, als ob der ihm Schutz bieten könnte, und fragte sich, ob das wohl das letzte sei, was er von dieser Welt sah – einen Mord, die äußerste Vergewaltigung menschlicher Würde.
Der Mörder kam näher und wurde immer mehr Person und immer weniger der anonyme Schütze mit der tödlichen Waffe.
Alexander Sokolow hob mit beiden Händen den Besenstiel in die Höhe, nicht um zu schlagen, sondern als primitive Geste, die um Verzeihung bat (es sah aus, als hebe er einen rituellen Stab), und während er alle Ängste durchlebte und das Nahen der Gefahr registrierte, hatte er den Eindruck, er habe den Täter schon einmal gesehen.
Der Mann blieb jetzt dicht vor ihm stehen, auf der anderen Seite des Müllkarrens, und richtete seine Waffe auf Sokolows Kinderkopf. Sie sahen sich in die Augen, und Sokolow erkannte die nervöse Entschlossenheit des Mannes und den Schweiß auf seinen Schläfen und der Oberlippe, und er sagte: »Ja nitschewo nje widjel.« Ich habe nichts gesehen.
Sokolow sagte es auf russisch. Er wußte nicht, wie er diese Worte ins Iwrith übersetzen sollte, denn Russisch war seine Muttersprache, die Klänge, in denen seine Träume und Sehnsüchte und alle Ängste und Schmerzen ihre präzise Form fanden. Und mit einem Mal kämpfte Sascha Sokolow gegen den wahnsinnigen Gedanken, daß er Auge in Auge stünde mit Doktor Lew Sergejewitsch Lesjawa, seinem Jugendfreund Lew, mit dem er studiert hatte und der später bei Energia sein Chef gewesen war. Vor fünf Jahren hatte er ihn zum letzten Mal gesehen, als ihre Oktjabr-Rakete beim Start explodiert und die ganze Abteilung bei Energia, die unter Lews Leitung gestanden hatte, ihrer Aufgabe enthoben worden war. Lew war damals in den Süden verschwunden, Sascha nach Osten.
»Ljowka?« stotterte er.
Der Mann schaute ihn mit großen Augen an, überrascht und erschrocken. Die Waffe in seiner Hand zitterte, und Sokolow sah, wie er zögerte und versuchte, seiner Verwirrung Herr zu werden. Dann ging er an Sokolow vorbei und bog in die Rechow Roni ein.
Sokolow blieb stehen. Er hörte die Schritte des Mannes, aber er wagte nicht, sich umzudrehen. Er wußte ganz sicher, daß er Ljowka gesehen hatte; daher blieb kein anderer Schluß übrig als der, daß er wohl verrückt geworden sein mußte.
Denn es war unmöglich, daß dies hier Ljowka gewesen war. Es war unmöglich, daß er Zeuge eines Mordes geworden war. Es war unmöglich, daß er hier als Straßenkehrer in Tel Aviv stand.
2
Ein Hund schlich mit hängendem Rücken an glühendheißen Autos vorbei zur Leiche vor dem Gasthaus, angelockt vom Blut, das auf den Asphalt floß. Blut ist für fromme Juden tabu. Geschlachtete Tiere sind erst dann rein, wenn sie gänzlich ausgeblutet sind. Frauen sind erst eine Woche nach der Menstruation rein.
Sokolows Eltern waren Kinder von Juden, also war auch er nach der Halachah, dem rabbinischen Gesetz, Jude, aber er hatte es bis zu seinem zehnten Lebensjahr nicht gewußt. Er hatte Schweinefleisch und Blutwurst gegessen. Die Blutlache des Ermordeten verursachte ihm eine leichte Übelkeit.
Es dauerte eine halbe Minute, bis Sokolow sich wieder rührte. Dann merkte er, daß er noch immer den Besen in die Höhe hielt. Er ließ den breiten Strohwisch vor seine Plastikschuhe sacken. Er hatte Lew zum letzten Mal am Ende der zweiten Untersuchungswoche gesehen, die auf die Katastrophe der Oktjabr folgte, am 30. Juni 1985. Getroffen hatte er ihn zum ersten Mal in der Klasse 8 der Höheren Schule Nr. 79. Damals waren beide fünfzehn Jahre alt gewesen.
Sascha Sokolow hatte in den ersten sieben Klassen jedes Jahr die besten Noten gehabt, fast immer eine fünf oder eine fünf plus, in allen Fächern. Er war ein ernstes Kind und ein fleißiger Schüler. Seine Begabung für Mathematik, Physik und Chemie war nicht zu übersehen, deshalb wurde er nach sieben Jahren zur Höheren Schule Nr. 79 zugelassen, wo man die besten Schüler Moskaus zu den allerbesten der ganzen Sowjetunion ausbildete. Dort wurde er nach ein paar Monaten mit einem ebenbürtigen Schüler konfrontiert, einem Neuen, der mit seinen Eltern von Wolgagrad nach Moskau umgezogen war.
Es war ein frecher Junge, hinter dessen pubertärer Übertreibungssucht und Lässigkeit Sascha anfangs keinen brillanten Geist entdecken konnte. Lew Lesjawa rauchte wie ein Schlot, und nach zehn Tagen schweigender Anwesenheit (er hatte noch keine Freunde gefunden und würdigte niemanden auch nur eines Blickes) zog er demonstrativ im Waschraum bei den Toiletten einen Flachmann mit Wodka heraus. Die Jungen der Höheren Schule Nr. 79, ernsthafte und akkurate Kinder, hatten so etwas noch nicht erlebt, und sie vermuteten, Lews sonderbares Betragen habe etwas mit seiner georgischen Herkunft zu tun, denn Lesjawa war klar und deutlich ein georgischer Name. Georgier waren sonderbar, schlitzohrig, oft verrückt. Sie hatten ihm ängstlich bewundernd zugesehen. Lew hustete nicht, verschluckte sich nicht, als die brennende Substanz in seinen Hals floß, nein, er schluckte den ganzen Wodka hinunter und wischte sich dann, den Blick starr auf das Fläschchen gerichtet, als ob ihn dessen Form interessierte, mit dem Handrücken den Mund ab.
»Gleich haben wir Geschichte der Sowjetunion«, sagte er trocken und stocknüchtern, »auf diese Art wird sie ein bißchen amüsanter.«
Das waren seine ersten öffentlich geäußerten Worte, und sie machten auf die bravsten und besten Schüler von Moskau gewaltigen Eindruck. Keiner verriet ihn, niemand hinterbrachte der Schulleitung, daß er eine antisozialistische Bemerkung gemacht hatte, und doch wußten alle Schüler innerhalb eines einzigen Tages, was im Waschraum vor sich gegangen war. Eine Legende war geboren.
Ein paar Wochen später war Lew der unbestrittene Anführer des achten Jahrgangs und eigentlich auch des Jahrgangs darüber. Die Schüler der zehnten und höchsten Klasse respektierten ihn, als ob er einer der ihren wäre, spätestens seit bekannt wurde, daß Lew sich mit kaum fünfzehn Jahren schon fast täglich rasierte, direkte Folge seiner südlichen Abstammung.
In seiner alten Schule hatte Sascha vor diesem Typ Jungen ausschließlich im Turnunterricht den Hut gezogen (obwohl er selber ein hervorragender Volleyballspieler war), und diese verschwanden dann auch, nachdem ihr Mangel an Denk- und Durchsetzungsvermögen offenbar geworden war, in irgendeiner Berufsschule, wo sie zu Schweißern oder Schlossern ausgebildet wurden, den Idealberufen der Sowjetbürger. Dieser Junge hier benahm sich wie ein lärmender Querulant, der zum Vorarbeiter im Reich der Werktätigen geradezu prädestiniert schien, aber er hatte einen scharfen Verstand, der Saschas Überlegenheit zum ersten Mal ernsthaft bedrohte. In der Klasse der Besten waren sie die Allerbesten. Sie waren einander ziemlich ebenbürtig, auch wenn sie verschiedene Spezialgebiete hatten: Sascha hatte einen kleinen Vorsprung in Chemie, Lew in Mathematik.
Das beste Zeugnis, die Tabelle mit den meisten Punkten, wurde am Ende ihres ersten gemeinsamen Jahres von Sascha erobert. Er hatte sich mit noch mehr Einsatz und Entschlossenheit auf seine Hausaufgaben gestürzt und war schließlich vor Lew mit einem Vorsprung von sage und schreibe einem halben Punkt Sieger geworden.
Nach der Preisverleihung und der Rede des Direktors, der ihnen lehrreiche und nützliche Sommerferien in einem Pionierlager wünschte, sagte Lew beim Verlassen des Saals: »Du hast es verdient.« Sascha hatte ihn verwundert angeschaut und in Lews Miene nach Anzeichen für Neid gesucht, den er doch empfinden mußte. Aber Lew lachte ihm nur sorglos zu. Sascha selbst hatte Nächte wach gelegen beim Gedanken, er könnte dieses Jahr nicht Klassenbester werden. Er war ehrgeizig. Er verlangte von sich, daß er alles begriff, was je ein anderer begriffen hatte, und sowie er von der Schule nach Hause kam, schlug er seine Bücher auf und lernte, bis sich die Fakten und Erkenntnisse seinem Gehirn eingeprägt hatten. Viel später hörte er von seiner Mutter, daß sein Großvater in Rumänien Talmudgelehrter gewesen war. Die Liebe zu Büchern hatte er von ihm geerbt.
»Danke schön«, hatte Sascha geantwortet. Er pflegte Lew zu meiden, hatte Angst vor seiner Schärfe und seinem »amerikanischen« Benehmen.
»Du arbeitest ja auch dafür«, fügte Lew seinem Lob an.
Sascha spürte das Gift in dieser Bemerkung, die Lews übermenschliche Selbstbeherrschung auf normale Proportionen reduzierte, und er konnte es sich nicht verkneifen, seinerseits mit einer herausfordernden Bemerkung zu kontern:
»Und du, kannst du alles im Schlaf?«
»Ja«, antwortete Lew.
»Du lernst nicht?«
»Nicht nennenswert.«
Ein Wort wie nennenswert war ein Paradebeispiel für den unverfälschten, bestürzenden, überlegenen Lewkianismus, wie seine Bewunderer in der achten Klasse es ausdrückten. Lew brachte es fertig, an unerwarteten Stellen ein archaisches oder vornehmes Wort in den Satz einzuflechten, wodurch man, wenn man mit ihm diskutierte, allein durch die eigene armselige Wortwahl ins Hintertreffen geriet.
»Ich soll also annehmen, daß du zu Hause nichts tust?«
»Ich blättere die Bücher nur durch«, sagte Lew. »Das genügt.«
»Das glaube ich dir nicht.«
Klassenkameraden blieben stehen, als sie merkten, daß ihre beiden Kanonen aneinandergeraten waren. Die Heftigkeit, mit der sie einander beschossen, versprach endgültige Klärung. Sascha, im Besitz des eindrucksvollsten Zeugnisses, hatte Angst, die Klasse betrachte dennoch Lew als den Besten, mochte er auch um einen halben Punkt zurückliegen.
»Ich habe ein fotografisches Gedächtnis«, erklärte Lew laut und versammelte damit noch mehr Schüler, und es gelang ihm, seinen herausfordernden Satz ohne Großtuerei auszusprechen.
»Ach ja?«
»Wetten?« fragte Lew.
»Ja.«
»Was ist dein Einsatz?«
Sascha winkelte ein Bein an und stellte seine Mappe drauf. Er öffnete die Klappe und holte sie heraus, braune Lederhandschuhe, gefüttert mit beigem Pelz, Handschuhe, die James Dean auf seinem Motorrad getragen haben könnte. In der Schule zirkulierten Fotos von James Dean, dem amerikanischen Schauspieler, den jeder kannte, aber noch keiner in einem Film gesehen hatte. Er war Lews großes Vorbild.
Der warme Moskauer Sommer hatte schon begonnen, aber Sascha hatte sie gestern von seinen Eltern als Belohnung für sein phantastisches Zeugnis bekommen. Sobald die Temperaturen unter zehn Grad Celsius sanken, wurden Saschas Finger taub, und er hatte dann das schreckliche Gefühl, seine Hände wären gelähmt. Er litt schon seit ein paar Jahren an Blutarmut. Nachdem seine Mutter unzählige Paar Wollhandschuhe gestrickt und geflickt hatte, beschloß sie, Handschuhe anzuschaffen, die dem Zahn der Zeit Widerstand leisteten, und Sascha hatte begriffen, daß sie diese Handschuhe nach wochenlanger mütterlicher Detektivarbeit für den Preis eines vollen Monatsgehalts und dem Versprechen, dem Sohn des Schwarzhändlers ein Jahr lang kostenlos Nachhilfeunterricht zu geben (sie war Französischlehrerin), in die geräumige Dreizimmerwohnung der Familie Sokolow hatte mitnehmen dürfen. Seine Eltern waren treue Parteimitglieder mit »Beziehungen«, aber solche Handschuhe bekam man nicht einmal in den Kreisen der selbstbewußten und, falls der richtige Preis geboten wurde, sogar flexiblen Bürokraten.
Die Handschuhe waren Saschas wertvollster Besitz, und er hatte sie trotz des schönen Wetters mit in die Schule genommen. Im sozialistischen Moskau wurde nicht eingebrochen, aber er wollte sie in der Nähe haben, damit er sie berühren konnte, sobald der Gedanke in ihm aufkam, er habe nur von ihnen geträumt.
Lew betrachtete das weiche Leder mit Bewunderung.
»Elegant«, sagte er.
Das waren sie auch, sie sahen aus wie die Handschuhe eines französischen Millionärs, und Lews Andeutung klang für alle genauso präzise, als würde eine Stimmgabel angeschlagen.
Das Herz klopfte ihm bis zum Hals, aber er zeigte Haltung. Er hatte die Tasche in einer jähen Anwandlung geöffnet, und erst jetzt wurde ihm klar, daß er die Handschuhe auch verlieren konnte.
»Also, sag schon«, sagte er.
»Wir gehen in die Bibliothek«, sagte Lew ganz entspannt, »wir nehmen ein Buch …«
»Nein, ein anderer nimmt es, ein Unparteiischer«, schlug Sascha vor.
»Von mir aus gern. Und wir lesen beide denselben Abschnitt, und eine Jury stellt uns Fragen.«
Das war ein simpler Vorschlag. Sascha wollte Lews Bluff bestrafen und sagte: »Ich kriege eine Stunde dafür, und du, weil du ja behauptest, daß du sie nur durchblätterst, bekommst die Hälfte. Derjenige, der zuerst eine Frage falsch beantwortet, hat verloren.«
»Fünf Minuten«, sagte Lew.
»Wie bitte?« fragte Sascha beunruhigt.
»Ich brauche dafür keine halbe Stunde. Fünf Minuten reichen.«
Bewunderung seitens der Umstehenden. Sascha spürte, wie er rot wurde. Soviel Lewkiansches Selbstvertrauen mußte zerschmettert werden.
»Gut«, flüsterte Sascha.
»Willst du nicht wissen, was du kriegst, wenn du gewinnst?«
»Doch.«
Ruhig holte Lew einen kleinen Gegenstand aus der Hosentasche und hielt ihn Sascha in der geschlossenen Faust ein paar Sekunden vor die Nase. Es sah aus, als würde Lew solche Gesten einstudieren, es waren theatralische Sekunden, die länger dauerten, als die Uhr angab.
Als er seine Hand umdrehte und die Faust öffnete, präsentierte er auf seiner Handfläche ein echtes Ronson-Feuerzeug.
Sascha rann ein Schauer über den Rücken. Das glänzende Feuerzeug, aerodynamisch geformt wie ein amerikanisches Auto, ein Studebaker oder Cadillac, war mindestens genauso wertvoll wie die Handschuhe. Die Klassenkameraden schauten mit angehaltenem Atem zu.
»In einer Stunde«, sagte Lew, »in der Smolenski-Anlage. Das ist schön dramatisch, so zwischen den Häusern, findest du nicht? Der Rote sucht sie aus, in Ordnung?«
Der Rote stand ganz vorne. Karottenschopf, hellblaue Augen und braune Sommersprossen auf bleicher Haut. In jeder Unterrichtsstunde sperrte er den Mund weit auf, voller Staunen über die vielen Wunder, die die Welt zu bieten hatte, und auch jetzt ließ er seine großen Zähne sehen. Er nickte und rannte in die Bibliothek.
Lew streckte sportlich die Hand aus.
»That the best may win«, sprach James Dean.
Sascha nahm die Hand an. Er versuchte zu lächeln.
Eine Stunde später wartete die Klasse bei den Parkbänken zwischen den Mietskasernen. Sie hatten sich um Lew geschart, der, auf der Rückenlehne sitzend, alt und weise von seinem Helden erzählte, als ob er ihn persönlich gekannt hätte.
»Er hieß mit vollem Namen James Byron Dean, aber in Amerika verwenden sie den Vatersnamen nicht, und deshalb fiel der Pseudoadelsname Byron weg«, hörte Sascha, als er sich der Gruppe näherte.
»Wie viele Filme hat er denn gemacht?« fragte eines der Mädchen. Wie alle ihre Klassenkameradinnen himmelte sie Lew an.
»Drei. Jenseits von Eden, Denn sie wissen nicht, was sie tun und Giganten. Aber er hat sie nicht gemacht, er hat nur darin gespielt. Er hat das Zeitliche gesegnet, als er vierundzwanzig war.«
»Warum?« fragte sie erschrocken.
»Autounfall. Man sagt, die CIA steckte dahinter. Er wurde zu beliebt, der Bourgeois fühlte sich bedroht. Ah, da ist ja mein Widersacher.«
Sascha ging schüchtern in den Kreis. Der Rote trat vor und holte zwei Bücher aus einer Tasche. Beide bekamen je ein Exemplar der Übersicht über die ersten sechs Fünfjahrespläne, kleingedruckt und faustdick.
»He, war da nichts Interessanteres?« fragte Lew und zog ein Gesicht, als ob er in eine saure Gurke gebissen hätte.
»Es war das einzige, wovon sie zwei Exemplare hatten«, antwortete der Rote.
»Na schön, dann los.«
Sascha fragte: »Benennen wir jetzt die Jury?«
Jeder wählte seinen eigenen Juror, und in einer plötzlichen Anwandlung wählte Sascha nicht seinen Freund Igor Jasow, sondern Nadja Schadanowa, ein dünnes feuriges Mädchen, das Dichterin werden wollte. Sie nickte mit niedergeschlagenen Augen, als er sie darum bat. Er war in sie verliebt, hätte sich aber lieber die Zunge abgebissen, als ihr seine Liebe zu gestehen, denn er war überzeugt, sie würde ihm glatt ins Gesicht lachen. Was ihn so anzog, war ihre Entschlossenheit, mit der sie daranging, das Geheimnis der Dichtkunst zu entschleiern. »Das ist mein Ziel«, hatte sie der Klasse in einem Referat erklärt, »mit weniger gebe ich mich nicht zufrieden.« Sascha war mit weniger als der Erkenntnis an sich und den Grundgeheimnissen der Natur auch nicht zufrieden. Bei besagtem Referat vor drei Monaten verliebte er sich prompt in Nadja. Er hoffte, Igor würde seine Entscheidung nicht als Kränkung ihrer Freundschaft auffassen.
Zusammen mit dem Roten wählten Nadja und Lews Juror aus der Übersicht ein Kapitel aus, das letzte und lästigste, das alle vorhergehenden zusammenfaßte.
»Hör mal«, sagte Lew, »du kriegst deine Zeit, und wenn fünfundfünfzig Minuten um sind, dann schau ich rein, gut?«
In der vergangenen Stunde hatte Sascha darüber nachgedacht und war zu dem Schluß gekommen, daß er diese Differenz nicht hätte vorschlagen dürfen. Er antwortete: »Ich brauche auch nur fünf Minuten.«
Igor versuchte, ihm das auszureden, aber Sascha blieb fest. »Ich kann es. Wirklich.« Nadja zuckte mit den Schultern. »Tu, was du für richtig hältst«, sagte sie.
»Sollen wir dann anfangen?« fragte Lew.
Sie schlugen das Buch bei dem bewußten Kapitel auf, und der Rote schaute auf die Uhr. Er fing an zu zählen.
Saschas Augen schossen über die fünfzehn Seiten, er las die Information und hörte, wie seine innere Stimme die Sätze wiederholte. Er konnte sich vollkommen konzentrieren, vergaß die Zuschauer um sich herum, und sein geübtes Gehirn nahm die Ziffern und Zahlen glatt in sich auf. Als der Rote »Bücher schließen!« rief, hatte er das Ende des Kapitels erreicht. Sie gaben ihre Bücher der Jury.
Sascha warf einen Blick auf seinen Gegner, in der Hoffnung, ein Zeichen von Schwäche zu entdecken, aber Lew schaute entspannt auf die beiden Juroren. Nichts ließ erkennen, daß er eine Niederlage in Betracht zog. Sie standen in einem Kreis von Schulkameraden mitten auf der Fläche zwischen den Mietshäusern rund um die Smolenski-Anlage, und Sascha begriff: Dies war ein Duell, wie es auch im vorigen Jahrhundert ausgetragen wurde. Puschkin zum Beispiel war dabei tödlich getroffen worden. Und wenn er und Lew auch nur Kugeln aus Sprache abschossen, sie waren genauso verheerend wie die aus Blei.
Gespannt sahen die Klassenkameraden zu, und dankbar nahm Sascha Igors ermutigendes Kopfnicken wahr. Er nickte zurück, zum Zeichen, daß er sich seiner Sache sicher wäre, und Igor grinste breit, überzeugt davon, daß sein Freund gewinnen würde. Tiefe freundschaftliche Gefühle wogten durch Saschas Brust. Nadja wich seinem Blick aus.
»Soll ich die erste Frage nehmen?« fragte Lew.
»Nein, ich nehme die erste«, sagte Sascha stolz.
»Wie du willst.«
Lews Juror war auch ein Mädchen, Olga, mollig, mit großen Brüsten. Sie sagte: »Meine Frage lautet: Wann fing der zweite Fünfjahresplan an, und welche zwei Eisenwerke wurden damals gebaut?«
»Das sind zwei Fragen«, rief Igor entrüstet.
»1934«, antwortete Sascha ruhig, »und die Eisenwerke, das waren Magnitogorsk und Stalinsk.«
Igor johlte begeistert, andere fielen ein.
Als die Jubelschreie auf dem Platz verklungen waren, fragte Nadja Lew: »Wie hoch war die Indexsteigerung im Jahr 1950 gegenüber 1940?«
Sascha erschrak über ihre Frage, die der Wind auf dem Platz zerstreute, denn er wußte die Antwort nicht und sah mit großen Augen auf Lew, der kühl sagte: »1940 wurde der Index auf hundert gestellt, zehn Jahre später betrug er hundertdreiundsiebzig.«
Es blieb kurze Zeit still. Genau wie alle anderen Klassenkameraden spürte Sascha die Kraft von Lews phänomenalem Gedächtnis. Die Angst fuhr ihm in die Glieder, und er biß die Zähne zusammen, damit sie nicht aufeinanderschlugen. Dann schrien die Umstehenden ihre Bewunderung heraus. Ängstlich schaute Igor zu Sascha hinüber, der noch einmal munter lachte, mit zitternden Lippen.
Olga fragte: »Wann wurde der sechste Fünfjahresplan revidiert?«
Auf einer der Seiten hatte Sascha es gesehen, und in Gedanken blätterte er zu dieser Stelle. Er sah alles vor sich, das Layout der Seite, die Absätze, aber gerade die entscheidende Zeile war wie ausradiert. Er wußte fast sicher, daß es unten rechts auf dieser Seite stand, er konnte es beschwören, aber sein geistiges Auge bekam die Buchstaben nicht scharf. Der sechste Fünfjahresplan war derjenige, der 1955 in Kraft trat, nachdem man ihn auf dem Zwanzigsten Parteitag verabschiedet hatte. Chruschtschow hatte damals dem Stalinismus den Garaus gemacht und die Gosplan, die Planungskommission, in zwei Kommissionen aufgeteilt, eine für die kürzeren und eine für die längeren Zeiträume.
Das war erst seine zweite Frage, und schon jetzt fiel er durch. Sein Leben stand auf dem Spiel, er drohte vor der versammelten Klasse schmählich unterzugehen. Aber plötzlich fragte er sich: War der sechste Fünfjahresplan überhaupt revidiert worden? War die Frage nicht eine Fangfrage? Er spürte, wie eine erlösende Sicherheit seinen Magen entkrampfte. »Er wurde nicht revidiert«, sagte er, über alle Zweifel erhaben, und wartete zuversichtlich, daß Olga vom Buch aufsehen und ihm recht geben würde. Aber sie sagte nichts und drehte den Kopf fragend zu Lew.
»Am 20. Dezember 1956«, sagte der.
3
Eine Polizeisirene schallte über die Dächer des Hatikwah-Viertels. Sokolow steckte schnell den Besen in den Sack und verließ den merkwürdigen Ort, der ihm einen Mord und die Begegnung mit dem Täter beschert hatte. Er ging eilig in Richtung Rechow Iwri, die hundertfünfzig Meter weiter die verwitterte Häuserreihe der Rechow Etsel unterbrach.
Man durfte ihn nicht in der Nähe der Leiche sehen. Er wollte auf keinen Fall vernommen werden. Vernehmungen waren die Stolpersteine seines Lebens. Immer wenn ihm eine Autorität gegenübersaß, wurde Sokolow von der Angst überwältigt, nun werde er demaskiert. Er wußte, daß das mit einem unbedeutenden Vorfall aus seiner Jugend zu tun hatte, kurz nachdem er entdeckt hatte, daß seine Eltern eigentlich Juden waren, aber dieses Wissen konnte seine Angst nicht beschwichtigen. Die Mütze eines Klassenkameraden war gestohlen worden, und er errötete bis zum Hals, als die Lehrerin jedes Kind mit strengem Blick musterte. Als der richtige Täter zwei Tage später gefunden wurde, litt Sascha unter dem Gedanken, er sei zwar nicht der wirkliche, wohl aber ein potentieller Dieb. Denn er hatte beim Anblick der schönen farbigen Mütze im stillen den Wunsch gehegt, sie zu stehlen, und die Lehrerin hatte das gesehen, so wie sie sicher auch gesehen hatte, daß seine Eltern in Wirklichkeit Juden waren, und er daher auch.
Mit schweren Beinen schob er den Karren an den geschlossenen Restaurants vorbei zu der Gasse, in der er wohnte. Der Schweiß rann ihm die Schläfen hinunter. Noch immer lag die Straße verlassen da. Die Lautstärke der Sirene blieb konstant, das Polizeiauto kam also nicht in seine Richtung, aber er wollte nichts riskieren und beschleunigte seine Schritte. Wenn er vernommen würde, käme er wieder in eine Situation, in der seine unvollständigen, unbeholfenen Antworten als Verdrehungen und Verleumdungen aufgefaßt werden konnten. Nach der Katastrophe der Oktjabr hatte der KGB ihn vernommen, und vor ein paar Monaten – am 27. Mai 1990 – hatte er hier in Israel Bekanntschaft mit dem Lügendetektor gemacht, dem Polygraphen, der benutzt wurde, wenn jemand sich für eine Stelle bewarb, die Zugang zu militärischen Geheimnissen gab. Beim Polygraphen wurden Fragen gestellt, die man nur mit Ja oder Nein beantworten konnte, und der Apparat reagierte auf minimale Veränderungen der Körpertätigkeit. Aber in Sokolows Leben schimmerte hinter einem Ja manchmal auch ein Vielleicht oder ein Vermutlich durch, und ein einziges Mal stand schamlos ein Nein daneben.
Nach dreieinhalb Monaten in seinem Apartment in Herzlia, täglich berauscht vom magischen Terrassenausblick auf das Meer sowie von großen Mengen Stolitschnaja, hatte Sokolow sein erstes Vorstellungsgespräch vereinbart. Er hatte sich erkundigt, wo jemand mit seinen Spezialkenntnissen eine Anstellung finden konnte, und verfaßte selbstbewußte Briefe in tadellosem Iwrith. Er bekam lauter Absagen, bis auf eine Zuschrift von der Israel Aerospace Corporation. Der Chef der Forschungsabteilung teilte mit, daß eine Stelle freigeworden wäre, und lud Sokolow zu einem Gespräch ein. Der Brief war von Ilan Ben-Zwi unterschrieben, der in kyrillischer Schrift seinen russischen Namen dazugesetzt hatte: Jascha Tschomjakow.
Juden, die in der Sowjetunion studieren wollten, bekamen keinen Studienplatz, wenn sie nahe Verwandte im Ausland hatten. Jascha hatte nur im Inland Familie und durfte studieren, auch wenn er unübersehbar jüdisch aussah, provokant jüdisch sogar: Er trug einen orthodoxen Kinnbart mit auffallend langen Koteletten, hielt die Feiertage ein, bedeckte den Kopf mit einer Mütze. Wenige Wochen nach dem Ende des Sechstagekrieges beantragte er ein Ausreisevisum nach Israel. Unmittelbar darauf fiel er durch seine Examina und verlor die Propiska, die Aufenthaltsgenehmigung für Moskau. Eines schönen Tages war Jascha verschwunden. Dreiundzwanzig Jahre später beantwortete er Sokolows Bewerbungsschreiben.
Während Sokolow mit seinem Karren die Rechow Etsel überquerte und aufmerksam den Lärm der Polizeisirene verfolgte, dachte er, daß es keine Vergangenheit gab, alles war ein einziges großes Heute, in dem er herumtrieb, und das Gefühl, daß es auch ein Jetzt gab, wurde nur von Wellen verursacht, die ihn mitnahmen und einen Moment lang emporhoben. Zeit war nicht einmal relativ, Zeit war nichtexistent, wenn er die Heftigkeit dessen, was in seinem Gedächtnis stattfand, mit dem verglich, was er in Tel Aviv auf der Straße erlebte. Wo lebte er? Im Jetzt dieses Mordes und seiner Arbeit rund um einen Müllkarren, oder im Damals tief in seinem Kopf?
Nach Jaschas Antwort hatte Sokolow erwartungsvoll den Bus nach Haifa genommen, zu den Hangars der IAC. Am Abend zuvor hatte er getrunken, aber in Maßen, und als er sich beim Portier meldete, war sein Kopf klar.
Die IAC war ein moderner Betrieb, wo Boden-Boden- und Boden-Luft-Raketen entwickelt wurden, Verteidigungswaffen, die mit den schweren Transport- und Forschungsraketen, an denen er im ›Sternenstädtchen‹ gearbeitet hatte, wenig gemein hatten, aber seine Kenntnisse der Metallurgie und seine Erfahrung in den Entwicklungsteams von Energia konnten auch für kleinere Systeme nützlich sein.
Jascha alias Ilan war ein Mann mit leiser Stimme und empfindsamen Augen. Er war klein und bewegte sich wie ein Knabe im Wachstum, eckig und vorsichtig. Sein Bart war mit grauen Strähnen durchsetzt, sein Käppchen lag auf einem kahlen Schädel, und er trug ein Hemd mit einem Schillerkragen, wie ein Pionier. Er brachte Sokolow ehrerbietig ins Direktionszimmer und stellte ihn als bedeutenden Gelehrten vor, der in die Alijah gegangen war und für die IAC einen enormen Gewinn bedeuten würde. Den Vormittag verbrachten sie zusammen in den Montagehallen und vor allem in der Forschungsabteilung, wo Sokolow Apparate vorfand, die im ›Sternenstädtchen‹ auf der Wunschliste gestanden hatten, aber immer wieder unter das amerikanische Embargo fielen, denn für strategisch wichtige Güter bestand ja Exportverbot. Während sie zu Mittag aßen, wies Ben-Zwi mit Nachdruck auf den geheimen Charakter der Arbeit bei IAC hin.
»Ich habe sechs Jahre im ›Sternenstädtchen‹ gearbeitet«, antwortete Sokolow, »ich weiß, was Geheimhaltung bedeutet.«
Sie aßen in einem weißen Raum, einer Werkskantine, die allen Arbeitnehmern der IAC offenstand. In der Sowjetunion hatte jede hierarchische Stufe eine eigene Kantine, die nach oben, zur Spitze hin, immer geräumiger und besser wurde.
»Wir wissen, daß du eine schlimme Zeit hinter dir hast«, sagte Ben-Zwi, »es muß unangenehm gewesen sein, nach dem Unglück.«
»Ach, halb so schlimm«, antwortete Sokolow. Er hatte unter dem Wegzug aus dem ›Sternenstädtchen‹ gelitten, seine Karriere hatte einen Knick bekommen, aber er war nicht der einzige. »Andere mußten ins Gefängnis.«
»Was ist eigentlich mit Lesjawa passiert? Ich bin seinem Namen seither nie mehr begegnet.«
»Sie haben ihn verhaftet. Nach ein paar Monaten haben sie ihn laufenlassen. Ich habe ihn gesucht und getan, was ich konnte, aber seit 1985 habe ich von ihm nichts mehr gehört noch gesehen.«
In seiner hilflosen Stimme lag echtes Bedauern und das anhaltende Gefühl, versagt zu haben. Er hatte geschrieben, aber seine Briefe ungeöffnet zurückbekommen. Er selbst machte damals eine schwierige Zeit durch, trank zuviel und kämpfte nach dem Weggang seiner Frau mit der Einsamkeit. Und mit dem Schuldgefühl, das er Lew gegenüber empfand, einer Riesenmenge Schuld, genug, um vom Umfang her die Milchstraße auszufüllen. Den Rest seines Universums nahm die Trauer über den Verlust seiner Tochter ein, die bei seiner Exfrau in Leningrad aufwuchs.
Ben-Zwi fragte nach den Ursachen für das Unglück der Oktjabr, über das er überraschend viel wußte, und Sokolow erzählte von der neuen Trägerrakete, die die bemannte Nachfolgerin der unbemannten Progress hätte werden sollen; nach der Panne mit der Oktjabr blieb sie Trägerrakete für die Raumstation Saljut. An Bord der Oktjabr hatten sich zwei Kosmonauten befunden, die bei der Zündung der zweiten Stufe bei lebendigem Leib verbrannt waren. Die Rakete war in vollem Flug explodiert, die Trümmer lagen auf einem Gebiet von fast dreißig Quadratkilometern verstreut.
»Es ging das Gerücht um, es wäre Sabotage gewesen«, sagte Ben-Zwi.
»Das ist nie bewiesen worden.«
»Ein Konstruktionsfehler?«
»Nein«, sagte Sokolow bestimmt. »Alles, nur das nicht.«
»Ich muß dir was erklären«, sagte Ben-Zwi.
Sokolow beugte sich aufmerksam zu ihm hinüber.
»Wir bitten jeden, der sich hier bewirbt, einen Test mit dem Polygraphen zu machen.«
»Was ist das?«
»Ein Lügendetektor.«
Sokolow lachte. »Lügendetektor? Das ist nicht dein Ernst! Wie in Amerika?«
Ben-Zwis Lächeln war eine Entschuldigung: »Ja.«
»Glaubt ihr daran?«
»Wir haben den Polygraphen hier in Israel verfeinert. Er ist zuverlässig, glaub mir. Es ist reine Routine, wir stellen ein paar Fragen, und dann wissen wir genug.«
Sokolow schüttelte verwundert den Kopf. »Das sieht mir ganz nach mittelalterlicher Hexenprobe aus. Du wirfst eine Person gefesselt in den Fluß, und wenn sie ertrinkt, war sie keine Hexe. Toller Test.«
»Der Polygraph mißt Transpiration, Blutdruck, Herzschlag und Hautwiderstand. Es ist kein Unsinn, glaub mir.«
»Ich halte es aber für Unsinn.«
»Ich kann nur sagen, es wäre sehr wichtig, daß du ihn machst.«
»Aber es ist ein veraltetes Prinzip!« sagte Sokolow mit Nachdruck. Er war verwirrt und fürchtete das unbekannte Ding. Ein Lügendetektor war etwas, wovor er unweigerlich versagen würde. Die Angst, die er vor dem Apparat empfand, war irrational und magisch: als würde dieser seine tiefsten Ängste und Zweifel, die er selbst nicht kennen wollte, aufdecken. Er stimmte nur deshalb zu, weil Ben-Zwi ihn darauf hinwies, daß keinerlei Aussicht auf den Job bestand, wenn er sich verweigerte.
Es wurde ein Fiasko.
Sokolow schob seinen Karren in die Rechow Iwri. Er schaute kurz zurück und sah das Blaulicht eines Polizeiwagens, der in die Rechow Etsel raste. Die Rechow Iwri war der reinste Nahe Osten. Rechts und links der ungepflasterten Straßen standen ärmliche Häuserreihen, dazwischen lagen unbebaute, unter Müll und Autowracks begrabene Grundstücke. Verschlissene Wäsche hing auf ungestrichenen Balkonen. Kein Luftzug regte sich. Später, wenn die Siesta vorbei war, würde er wieder hören, wie Hausfrauen mit vollen Einkaufstaschen vergeblich ihre Sprößlinge (Kinder mit altklugen Augen und schmutzigen Händen) zur Ordnung riefen. Wenn er dann selbst einkaufen ging, sah er, wie hinter weit geöffneten Fenstern arbeitslose Biertrinker mit glasigem Blick in den Fernseher starrten. Hinter ihm gellte die Polizeisirene durch die Rechow Etsel.
Ben-Zwi hatte ihm eigenhändig geschrieben und sich für die Ablehnung entschuldigt, aber es gehöre zu den strengen Grundsätzen des Betriebs, niemanden einzustellen, den der Lügendetektor nervös gemacht hatte. Er schickte ihm eine Liste mit Firmen, die einen Metallurgen vielleicht gebrauchen konnten. Sokolow hatte wieder Briefe geschrieben und nur eine einzige Aufforderung zu einem Gespräch bekommen. Alle anderen sagten mit höflichen Vordrucken ab.
Die Aufforderung kam von einer Firma mit Flugzeugteilen in Aschdod. Er hatte den Bus über Tel Aviv genommen.
Die Firma hieß All Seasons Parts und war in drei großen Hangars beim Hafen untergebracht. Der Besitzer war ein kleiner Mann mit dickem Hals und kugelrundem Kopf, David Kusnadse. Er trug ein Hemd mit kurzen Ärmeln und kurze Hosen, deren Ränder in die fetten Schenkel schnitten, sowie Plastiksandalen. Das Zifferblatt seiner Rolex war mit kleinen Diamanten besetzt.
Sokolow wurde von Kusnadse respektvoll im Büro empfangen, aber das änderte nichts an dem Eindruck, er sei bei einem Schrotthändler zu Gast. Es war das erste Mal, daß er mit einem Tschaktschak in Berührung kam. Schwitzend erzählte Sokolow von seiner Ausbildung und seinen Berufserfahrungen und zeigte dem Mann seine Diplome.
»Sehr schön, Herr Sokolow.« Damit schob ihm Kusnadse eine Schachtel mit Papiertüchern hinüber.
»Danke. Und was stellt Ihr Betrieb nun genau her?«
»Flugzeuge. Flugzeugteile. Wir kaufen alte Maschinen, zerlegen sie in transportable Brocken und bringen sie mit dem Schiff hierher. Dann nehmen wir sie weiter auseinander, überholen die einzelnen Teile und verkaufen die wieder weiter. Einen Mann wie Sie, einen erfahrenen Techniker, können wir in unserer Mannschaft gut gebrauchen. Sollen wir mal?«
Kusnadse machte eine einladende Bewegung in Richtung Tür. Während sie zur ersten Halle gingen, erzählte der Mann, daß seine Firma zwanzig Leute beschäftigte, hauptsächlich Verschrotter, und daß er zusammen mit seiner Frau den Verkauf leitete.
»An wen verkaufen Sie denn?« wollte Sokolow wissen.
»Afrikaner, manchmal Asiaten, auch Südamerikaner. Die Fluggesellschaften in Europa und Nordamerika wollen keine gebrauchten Teile. Oder sie haben ihre eigenen Maschinen stehen, die sie ausweiden, wenn sie schnell Ersatzteile brauchen. Wir sind hier auf die Kleinen angewiesen, wie Ghana Blue, Congo National, Tropique Charter. Die fliegen mit Kisten, die noch ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel haben als unsere Sachen. Hier.«
In einer alten Fischhalle lagerten Teile einer DC-8, vom intensiven Gebrauch, vom Wetter und von den großen Temperaturunterschieden zwischen Landebahn und Flughöhe verschlissen. Größtenteils waren sie rostbraun, und fünf Männer waren dabei, die Stücke noch weiter auseinanderzunehmen. Das pneumatische Sirren der elektrischen Schraubenzieher dröhnte durch die Halle. Die Verschrotter, dicke Männer mit Tätowierungen auf den muskulösen Armen und dicken Fingern, die noch nie eine Buchseite umgeschlagen hatten, standen mit entblößtem Oberkörper an breiten Werkbänken oder beugten sich über die größeren Teile, die auf dem Fußboden lagen. Salzige Meeresluft hing zwischen den Wänden.
Er ging mit Kusnadse zu einer anderen Halle, wo die Ersatzteile, manchmal ganze Flügelteile, in Lagergerüsten aufbewahrt wurden.
»Dies hier wird Ihre Abteilung. Ich will genau wissen, was mit meinen Sachen los ist, verstehen Sie? Schauen Sie, das meiste davon kann gleich wieder aus dem Haus, wie diese Flügelspitze da, sehen Sie? Von einer Iljuschin, müßte Ihnen eigentlich bekannt vorkommen. Aber es gibt Grenzfälle. Zum Beispiel hier.«
Sie blieben bei einer kaputten Hochdrucktür stehen.
»Die ist von einer 727. Was sollen wir damit machen?«
»Reparieren«, antwortete Sokolow.
»Wie?«
»Schauen Sie, das Metall da ist ramponiert. Das müssen Sie ersetzen.«
»Nein. Wir brauchen gerade jemanden, der uns sagen kann, wie wir das auf andere Art hinkriegen. Eine neue Platte einsetzen kann jeder, aber dann wird die Tür so teuer, daß der Kunde woandershin geht oder sich eine neue besorgt. Ich will eine billigere Lösung.«
»Ich sehe eigentlich keine anderen Lösungen.«
»Sie sind Experte auf dem Gebiet von Metall und Hochdruck, haben Sie mir geschrieben. Sie müssen uns doch sagen können, wie wir diese Geschichte mit einem einfachen Trick wieder gut hinkriegen.«
»Wie gut, Herr Kusnadse?«
»Gut genug.«
»Mit oder ohne Risiko für das Flugzeug?«
»Ganz ohne Risiko geht es nicht. Sonst müssen sich die Leute neue Sachen anschaffen. Aber sie sollen auch nicht wie tote Fliegen vom Himmel fallen, klar.«