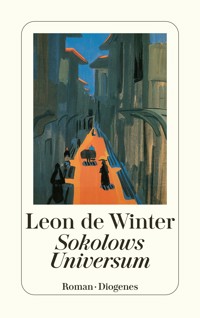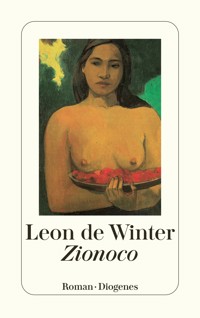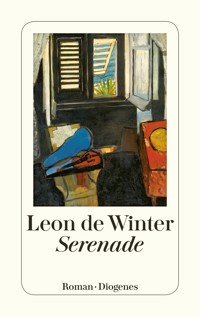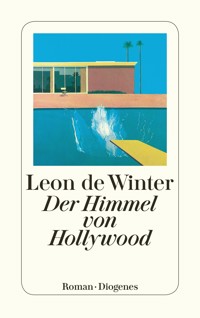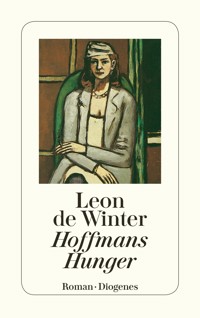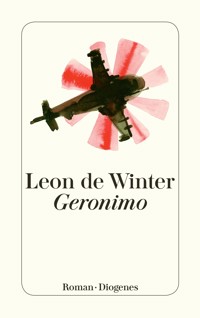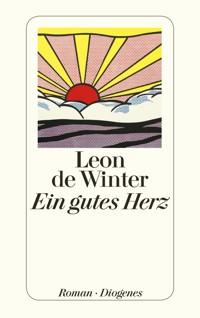
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein junges marokkanisches Fußballteam hält Amsterdam in Atem. Ein halbkrimineller jüdischer Geschäftsmann entdeckt plötzlich seine Bestimmung. Väter und Söhne finden schicksalhaft zueinander, und der ermordete Filmemacher Theo van Gogh bekommt postum den Auftrag, die Welt zu retten, da die Politik versagt. Dies alles atemberaubend miteinander verwoben im turbulenten, ironisch verspielten Roman von Leon de Winter, der gekonnt Facts und Fiction vermischt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Leon de Winter
Ein gutes Herz
Roman
Aus dem Niederländischen vonHanni Ehlers
Titel der 2012 bei
De Bezige Bij, Amsterdam,
erschienenen Originalausgabe: ›VSV‹
Die deutsche Erstausgabe erschien
2013 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration: Roy Lichtenstein,
›Sunrise‹, 1965 (Ausschnitt)
Copyright © The Roy Lichtenstein Foundation, New York/
2015, ProLitteris, Zürich für Werke von LICHTENSTEIN ROY
Foto: Copyright © akg-images
Für Moos, Moon und Jes
auf ewig
All rights reserved
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24309 3 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60364 4
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Dieser Roman nimmt zwar Ausgang von einem historischen Moment, ist aber dennoch Fiktion und von der Wirklichkeit losgelöst. Die Vermischung von Fakten und Fiktion gilt auch für die im Buch vorkommenden Personen, Firmen, Organisationen und Lokalitäten. Die beschriebenen Ereignisse, Handlungen und Gespräche sind frei erfunden.
[7] 1
THEO
All die stumpfsinnigen, schmalspurigen Märchen von der großen Abrechnung über das Leben, auf die man sich im Tod gefasst machen könne, entsprachen der Wahrheit – das erfuhr Theo van Gogh am eigenen Leib (na ja, Leib hier nur im übertragenen Sinne). Es war ihm ein Rätsel, wie die Lebenden unten auf der Erde diese Wahrheit entdeckt hatten.
Die Entscheidungsträger hier oben waren kindische Moralisten. Und sie gelangten nach jahrelangem Zögern – man konnte ihnen wahrlich nicht den Vorwurf machen, dass sie übereilte, fahrlässige Beschlüsse fassten – zu der Überzeugung, dass es an der Zeit sei, Bilanz zu ziehen. Theo fand das eigentlich auch.
Als dieser Scheißmarokkaner von einem Schuss ins Bein niedergestreckt wurde, befand sich Theo irgendwo oberhalb vom Oosterpark, rund dreißig Meter über dem Boden, einer Möwe gleich, die nahezu reglos im Wind lag. Die Bäume waren kahl, das Gras farblos. Die Polizisten sprangen vor Angst hin und her, schrien sich gegenseitig an, brüllten in Mikrophone und Handys. Theo van Goghs Mörder wollte sterben, konnte seinem Leben jedoch nicht eigenhändig ein Ende machen. Das verbot ihm sein Gott.
[8] Es war irre, das aus der Distanz wahrzunehmen. Schwerelos schwebte Theo über seiner Stadt. Noch hatte die Panik nicht vollständig Besitz von ihm ergriffen. Die Schmerzen waren unvergleichlich – allerdings hatte er zeitlebens eigentlich auch keine wirklichen körperlichen Schmerzen kennengelernt. Auf das hier war er nicht gefasst gewesen. Er hatte keine Ahnung gehabt, dass ihm so etwas zustoßen könnte.
Er war in voller Fahrt an Mohamed Boujeri vorbeigeradelt, hatte ihn aber aus dem Augenwinkel wahrgenommen und war sich der Anwesenheit dieses Bartaffen in seinem Sackkleid bewusst gewesen. Ein angehender Fanatiker mit jünglingshaftem Flachsbärtchen, der auf dem Radweg stand und auf irgendeinen anderen Bartaffen wartete – das hatte Theo im Vorüberfahren gedacht, als er einen kurzen Blick mit seinem Mörder wechselte. Ja, sie hatten sich einen Moment lang in die Augen geschaut. Aber er hatte den Bartaffen gleich wieder aus seinen Gedanken verdrängt. Es gab neuerdings zu viele von ihnen in der Stadt. Wahnsinnige, die den Umzug von der Wüste in die schmutzige Stadt nur dadurch ertragen konnten, dass sie sich den Werten und Normen von Nomaden aus dem siebten Jahrhundert unterwarfen. Okay, jedem das Seine. Aber anderer Leute Verrücktheiten duldeten diese Verrückten nicht.
Es wäre ein ziemliches Understatement, zu sagen, er müsse noch oft an diesen Tag denken, denn dieser Tag war immer gegenwärtig, ebenso wie die Erinnerung an die Schmerzen. Es war ihm in den vergangenen Jahren nicht gelungen, sich von jenem Novembermorgen zu befreien. Grau, trist, kalt. Die alten Backsteine der Gebäude in Amsterdam-Ost waren an solchen Tagen farblos. Schon [9] häufiger war ihm durch den Kopf gegangen: Wenn man hier an so einem Morgen die Augen aufschlägt, würde man sich am liebsten vom Dach stürzen. Berlin, London, Paris, New York kamen morgens ganz anders in die Gänge. Wie erwachende Riesen, die sich wohlig räkelten und streckten. Theos Stadt dagegen tauchte mit verquollenen Augen und stinkenden Achseln aus der Nacht auf. Wie ein kleiner Büroangestellter mit feuchten Wunschträumen und müffelnden Fingerspitzen, die ihn daran erinnerten, wo er sich stundenlang gekratzt hatte.
Theo musste auch ins Büro. Er hatte seinen großen Spielfilm über Pim Fortuyn geschnitten und wollte ihn dem Produzenten zeigen. Wenn er arbeitete, nahm er sich an die Kandare. Da lebte der kleine Kalvinist in ihm auf, der Spießbürger, der nichts als hart arbeiten wollte und sich freute, wenn ihm sein Kind stolz ein gutes Schulzeugnis zeigte. Seine Freunde aber nahmen ihm den Bohemien ab, den er schon sein ganzes Erwachsenenleben lang spielte, glaubten ihm, wenn er bei ihnen am Tisch unflätig über das Bürgertum pöbelte.
Vielleicht war er schon früher gestorben. Als diese somalische Prinzessin mit ihrer koketten Verletzlichkeit und ihrem opportunistischen Kampfgeist in sein Leben trat. Oder als er nicht zur Filmhochschule zugelassen wurde. Irgendwo war es schon viel früher schiefgelaufen.
Ein Scheißmarokkaner. Ein Niemand. Wusste nicht den Bruchteil dessen, was Theo wusste, als er noch auf Erden weilte. Dieser Wicht tat, was Theo sich eines Tages selbst hatte antun wollen. Dieser Ziegenficker maßte sich an, was Theo sich selbst als letzte Ehre vorbehalten hatte. Und [10] gelangte damit auf einen Schlag aus der kalten Anonymität in den Brennpunkt der Weltbühne.
Theo hatte gewusst, dass er vorzeitig sterben würde, aber so? Nicht das Rauchen wurde sein Tod, nicht das Saufen oder Koksen und auch keine Ausschweifungen mit einem Dutzend Huren, die mit irgendwelchen dreckigen Krankheiten behaftet waren (in einem Bordell in Montevideo, so hatte er sich das einmal ausgemalt), nein, ein Scheißmarokkaner mit einer Winzpistole und einem lächerlichen Zirkusmesserchen, einem sogenannten Kris, sollte ihm das Leben nehmen.
Mohamed Boujeri. Nie gehört. Er könne ganz gut schreiben, erfuhr Theo später. Quatsch. Der war doch halber Analphabet! Hatte Artikelchen für eine Nachbarschaftszeitung in Amsterdam-West geschrieben. Talentlos. Im Schatten von Eichen wie ihm dazu verdammt zu verkümmern und am Ende der Saison zu verdorren wie ein Blatt im Herbst. Aber nein. Der Wicht hatte ihm nachgestellt. War monatelang damit zugange gewesen. Theo hatte die Zeitungsberichte gesehen, die Fernsehsendungen, die offiziellen Dokumente über Boujeri und die African Princess und Theo van Gogh.
Die Explosionen aus dem Pistolenlauf rauschten in seinen Ohren. Er wollte den Bartaffen ansehen, konnte es aber nicht.
Die Kugeln in seinem Leib kümmerten ihn nicht, es durfte einfach nicht wahr sein, dass dies tatsächlich geschah. Sein Kopf sagte ihm: Keine echten Kugeln. Keine echten Schüsse. Aber er fiel. Sein Herz spielte verrückt. Seine Glieder standen in Flammen. Ihm schwanden die Sinne, wo er [11] doch hellwach bleiben wollte. Er wollte fliehen. Er hätte alles dafür gegeben, jetzt davonrennen zu können. Seine Beine wollten nicht.
Er musste einen Film über einen Helden fertig machen, über Pim Fortuyn, ermordet von einem Tierschützer mit der Kreativität eines braven Beamten. Ein guter Film. Endlich hatte er mal ein vernünftiges Budget für die Produktion gehabt. Er hatte Pläne. Er hatte Aussichten. Er hatte ein Kind.
Und da kreuzte ein Scheißmarokkaner seinen Weg.
Es war schon vorgekommen, dass er Frauen angefleht hatte. Aber nie so einen Niemand. Dieser Wicht hatte Macht über ihn, fügte ihm Schmerzen zu.
Verdammt, ihm war doch tatsächlich das Wort Gnade rausgerutscht.
Jetzt, so lange danach, hatte er den Eindruck, dass er schon tot gewesen war, bevor sein Herz aufhörte zu schlagen. Man entweicht der Welt, weil das Feuer im Körper so stark ist, dass die Sinne überlastet werden. Und irgendetwas entwich seinem Leib. War es seine Seele? Vielleicht. Er hatte eine Seele und ein Bewusstsein.
Boujeri setzte diesen rasiermesserscharfen Kris an seinen Hals, warf sich mit seinem ganzen Gewicht darauf, und die Klinge schnitt in sein Fleisch, durchtrennte seine Kehle, seine Luftröhre. Er roch sein eigenes kochendes Blut. Sein Kopf löste sich von seinem Körper. Er konnte das sehen, weil er schon seinem Körper entwichen war. Die Schmerzen waren zu groß, er musste ihnen entkommen, und das geschah auch. Als er etwa zwei Meter über seinem eigenen Körper schwebte. Er war in Panik. Unfassbar, was ihm da zustieß.
[12] Gleichzeitig blieben seine Wahrnehmung und sein Denken aktiv. Er dachte: Sieht gut aus. Wenn das ein Film gewesen wäre, hätte er zum Darsteller gesagt, dass er perfekt daliege. Genauso lotterig, wie es sich gehörte. Ohne jede Ästhetik. Leicht angewinkeltes Bein, flach auf dem Rücken, stumm. Guter Schauspieler. Nur war Theo selbst das stumme Schwein, das von dem Scheißmarokkaner abgeschlachtet wurde. Ein Seelenaustritt, das ist definitiv ein Seelenaustritt!, durchfuhr es ihn. Er glaubte nicht an Seelenaustritte. Er glaubte, dass alles aufhörte, wenn sein Körper nur noch ein Haufen verrottendes Fleisch war.
Dem war nicht so, wie er jetzt wusste. Das Denken, die Wahrnehmung und das Erleben hörten nicht auf, wenn man nicht mehr auf der Erde war. Alles ging weiter. Nur anders.
Theo konnte Boujeri nicht aufhalten. Er hatte keine Arme, keinen Mund. Niemand sah oder hörte ihn. Er musste mit ansehen, wie Boujeri ein Messer zog, einige Blatt Papier auf die Brust von Theos sterbendem Körper legte und diese mit dem Messer festpinnte. Faszinierend: Theo spürte das und zugleich auch nicht, er konnte den schneidenden Schmerz gleichsam anfassen.
Ein paar Meter weiter stand ein Mann, der ein Foto machte, das um die Welt ging: Theos großer, stummer, überflüssig gewordener Körper auf der Straße. Das Heft des Messers. Darunter der Brief an Ayaan Hirsi Ali, in dem Boujeri den Niederlanden den Krieg erklärte.
Es waren auch noch andere Leute da, die mit offenem Mund zuschauten, verstört, aber auch genüsslich. Endlich passierte mal was in Amsterdam-Ost. Da lag Theo auf dem Gehweg einer schmuddligen Straße. Hatte nichts Großes, [13] diese Straße. War keine Champs-Elysées, kein Trafalgar Square, kein Unter den Linden. Eine farblose Straße mit tristem Gehwegpflaster in einem charakterlosen Viertel, bewohnt von laxen Studenten, subventionierten Künstlern und salarymen, wie man solche Vertreter in Japan nennt, Männer, die mit abgewetzter Aktentasche am Lenker zu ihren hellgrauen Schreibtischen voller Ordner und Stempel und getrockneten Krümeln von den Butterbroten des vorigen Tages radeln.
Wenn er noch am Leben gewesen wäre und davon hätte erzählen können, hätte er gesagt: Wenn das einem anderen zugestoßen wäre, hätte ich Boujeri um ein Autogramm gebeten. Endlich geht mal was ab.
Sein Leben lang war er ein Sprücheklopfer gewesen, und im Moment der Momente hatte man ihn mundtot gemacht. Doch er sah alles. Boujeri ging seelenruhig davon beziehungsweise versuchte, Haltung zu bewahren, aber er war berauscht. Er hatte einen Menschen getötet. Er hatte es getan. Für seinen Wüstengott hatte er die ultimative Tat vollbracht. Nun würden ihn zweiundsiebzig Jungfrauen willkommen heißen. In Erwartung eines immerwährenden Orgasmus bekam er eine Erektion. Verdammt, er entfernte sich mit einem Ständer in der Hose von Theo, augenscheinlich ohne Eile, ohne Sorgen. Er wurde allerdings unruhig, als er die Blicke eines Passanten auf sich fühlte. Die Erregung schwand, und er sah den Mann herausfordernd an.
Boujeri rief: »Was guckst du?«
Der Passant war zwar ein bescheidener Salaryman, aber er traute sich, einen Kommentar abzugeben: »Das kannst du doch nicht machen!«
[14] So sagte ein Amsterdamer das. Der rief nicht: Du Schuft, du Nichtswürdiger, du Teufel! Nein, der rief: »Das kannst du doch nicht machen«, als ginge es um einen Akt von Vandalismus, der ihn irritierte.
Theo hörte, wie Boujeri ohne den geringsten Zweifel entgegnete: »Und ob ich das kann! Er hat es sich selbst zuzuschreiben!«
Der Salaryman: »Das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen!«
Boujeri: »Und ob ich das kann! Und damit wisst ihr auch gleich, was euch erwartet.«
Das ließ den Zuschauer verstummen. Und Boujeri machte sich aus dem Staub. Theo begleitete ihn, schwerelos, ein paar Meter hinter und über ihm, wie ein Luftballon, den Boujeri an einer Schnur mitzog.
Das Adrenalin schoss durch Boujeris Adern und heizte seinem Herzen ein. Er rannte in den Oosterpark, während sich die Straßen elektrisch aufzuladen schienen, als setze dieses Attentat die Stadt unter Strom. Von allen Seiten tauchte Polizei auf. Mit Autos, mit Motorrädern. Überall Sirenen. Blaulicht. Alles für Mohamed B. Alles für Theo.
Unsichtbar war Theo dort anwesend, registrierte alles, hörte alles und konnte sich nicht vorstellen, dass er dieses wahnwitzige Abenteuer nicht anschließend mit seinen Freunden besprechen würde, ein Päckchen Gauloises in Reichweite, vielleicht ein bisschen Koks in der Nase und eine oder zwei Flaschen Bordeaux im Blut. Er schwebte zwischen den Bäumen. Komische Perspektive. Gute Kran-Shots. Er würde bald in einem Krankenhausbett aufwachen und durfte nicht vergessen, sich das alles zu notieren. Er [15] tastete nach Stift und Papier, fühlte aber nichts. Er hatte ja keine Hände! Die Angst schlug bei ihm ein, und er dachte, er würde abstürzen, aber er schwebte weiterhin und blickte auf diesen jungen Bartaffen mit der Waffe in der Hand hinunter.
Boujeri begann, wild um sich zu schießen. Die Polizei erwiderte das Feuer. Die Schüsse klangen weniger echt als auf dem Geräuschband eines Films. Boujeri war völlig ungeschützt, während er schoss. Offenbar hoffte er, dass sie ihm mit einer Salve den Kopf zerfetzen würden. Oder das Herz. Aber der Gnadenschuss blieb aus. Schreiend fiel Boujeri zu Boden, als er ins Bein getroffen wurde.
Die Niederlande gedachten ihres Helden des freien Wortes. Tausende von Menschen versammelten sich auf dem Dam, um ihm und seiner freien Meinungsäußerung die Ehre zu erweisen. Nichts gegen so eine Gedenkveranstaltung, aber der Platz war voller Kleingeister. Eine Farce. Was hatte er mit freier Meinungsäußerung zu tun? Wie sie da alle rumstanden und heilig taten. Theo hatte nichts mit freier Meinungsäußerung am Hut gehabt. Er log, manipulierte, ätzte, beleidigte, pöbelte, schimpfte, betrog, verriet – und es tat ihm gut. Sein Widerwille gegen alles Mittelmäßige war so groß, dass er es als seine Pflicht empfand, die Beleidigung zur Kunstform zu erheben. Er wollte sich abreagieren. Zetern. Fluchen. Er hasste die mittelmäßige Menschheit. Warum hassten die anderen sich nicht genauso sehr, wie er sich hasste? Feige Hunde. Sie hatten Schiss davor, mit Molotowcocktails in der Hand gegen die Moscheen aufzumarschieren.
Nach seiner Ermordung wurde Theo von etwas [16] davongetragen, was sich als »der Wind« bezeichnen ließ, und er kam hier an. Es war eine Reise durch die Dimensionen, durch alle Universen. Er war in diesem Orkan aus Luft und Licht und Destruktion und Konstruktion außer Bewusstsein. Nichts war er, und doch erlebte er Geburt und Tod und Verfall und Wiederauferstehung.
Nach einer Reise, die keine Zeit kannte, gelangte er in eine Umgebung, die er am ehesten als Kaserne beschreiben konnte.
Grau wie Amsterdam an einem Novembertag. Nein, eingesperrt war er nicht. Es stand ihm frei, sich unten umzusehen. Aber er konnte nicht in die nächste Phase weiter, wie sie es hier nannten.
Die nächste Phase.
Man bekam einen Berater zugewiesen, der alles mit einem durchsprach und einem dabei half, die nächste Phase zu erreichen. Theo hatte schon ein Dutzend Berater verschlissen. Männer, Frauen, klug, dumm, sie gaben rasch auf, die Waschlappen.
Theo hockte hier nun seit November 2004 – ja, auch hier gab es die Zeit, ohne die Zeit gäbe es nichts, hatte der neue Berater (der sich scherzhaft »Bewährungshelfer« nannte) erklärt. Er war Schwarzamerikaner, und Theo kam ganz gut mit ihm aus.
Seit einigen Monaten tat es weh, nach unten zu gehen, so paradox das auch klingen mochte. Man sollte meinen, dass man sich, wenn man mal eine Weile hier oben war, von Tag zu Tag (ja, Tage gab es hier auch) immer besser mit dem Totsein abfand. Aber dem war nicht so. Es wurde immer [17] schmerzlicher, seinen Sohn zwar beobachten, ihn aber nicht berühren, ihm nicht sagen zu können, dass er ihn liebte und vermisste. Wenn er in eine nächste Phase gelangte, würde sich der Schmerz derart intensivieren, dass er sein Kind vermutlich loslassen musste. Dann wäre er noch toter als tot.
Theo schaute, wenn er unten war, auch regelmäßig nach seinem Mörder. Boujeri betete und betete in seiner Zelle. Las den Koran. Las die Geschichten über den Propheten. Und dachte, er sei auf dem Weg zu Allah und den Jungfrauen. Quatsch. Boujeri war ein Sünder, und das lastete man ihm hier oben an. Das wurde garantiert bestraft.
Theo wurde keineswegs seinem Schicksal überlassen. Wo er jetzt war, hatte »Schmerzbewältigung« einen hohen Stellenwert. Allein schon das Wort wäre ihm sauer aufgestoßen, wenn er denn noch einen Magen gehabt hätte. Aber er hatte keinen Körper mehr. Er hatte nur noch seinen entwurzelten Kopf. Dank dieses Scheißmarokkaners.
Seines Kopfes war er sich bewusst, der Rest schien zu fehlen. Ob der Körper wieder vollständig sei oder nicht, hänge davon ab, ob man es verdient habe, war ihm gesagt worden, als er sich beschwert hatte. Manche Menschen, die mit dem Auto verunglückt oder bei irgendeinem anderen Unfall verstümmelt worden seien, kämen völlig intakt und in einem Stück herein. Weil sie es gemäß den Vorschriften verdient hätten. Und ich?, wollte Theo wissen. Was habe ich denn Schlimmes getan, dass ich meinen Körper nicht erfahren kann?
Sie hatten geantwortet: Sobald du das weißt, wird sich eine Lösung auftun. Mit anderen Worten, sie reagierten wie alte Moralapostel, wie ungnädige Eltern, die ihrem [18] halbwüchsigen Sprössling eine Lektion in Bescheidenheit erteilten.
Jetzt, da er hier oben war und es ihm als Regisseur oder Schriftsteller nichts mehr einbrachte, war Theo weltberühmt. In Hollywood war sein Name jedermann ein Begriff. In Tokio, Mumbai, Jerusalem, Rom, Buenos Aires, überall wusste man, wer er war – weil ein anonymer Scheißmarokkaner ihn umgebracht hatte.
Er wäre natürlich lieber anders berühmt geworden. Er war ein couragierter, wenn auch nie sonderlich populärer Filmregisseur gewesen und hatte nie publikumswirksames Unterhaltungsfutter gemacht wie ein Paul Verhoeven. Nein, er war in dem Zwergenland, zu dem ihn der Zufall seiner Geburt verurteilt hatte, immer ein unverstandener Künstler geblieben.
Wenn er von dort, wo er sich jetzt befand, auf sein Leben zurückblickte, erschien ihm seine Schwärmerei für das schwärzeste Schwarz als totaler Stuss. Eindimensionale Lieder hatte er darüber gemacht. Und Filme. Eigentlich ging es immer um den Tod. Das sei das Einzige, worüber ein Künstler etwas zu sagen habe, hatte er gedacht. Ein Witz! Er hatte rein gar nichts darüber zu sagen. Ein Schaumschläger war er gewesen. Épater la bourgeoisie – im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert hatten dekadente französische Dichter entdeckt, dass man durch die Beleidigung von Bürgern zum bürgerlichen Antihelden werden konnte. Was er getan hatte, war nichts anderes. Beleidige, und schick eine Rechnung. Aber jetzt wusste er, was er damals nicht gewusst hatte, und wenn er es gewusst hätte, hätte er es zeitlebens nie und nimmer eingeräumt, weil er damit seine [19] Daseinsberechtigung verloren hätte. Jetzt wusste er, dass ein Künstler nur etwas über das Leben zu erzählen hatte.
Nachdem er gestorben war, kam er in einer neuen Umgebung an, und das Wundersame war, dass er dort kommunizieren konnte. Es spielte keine große Rolle, welche Sprache man sprach, hier lief alles mittels Techniken und Methoden, die er auf der Erde nicht gekannt hatte. Er fragte sich gelegentlich, wie er den Lebenden auf der Erde sein Dasein hier erklären könnte. Das würde wohl nur mit Hilfe von bildlichen Veranschaulichungen gehen. Anders ließ sich seine neue Welt nicht vermitteln.
Also beschrieb er das Ganze wie folgt: Er habe ein eigenes Zimmer mit weißen Wänden und ausgetretenem Parkettboden, der Unterkunft in einer Kaserne nicht unähnlich. Durch ein Fenster mit Eisenrahmen blicke er auf flaches, sandiges Gelände hinaus, an dessen Rändern etwas Gras sprieße. Andere Enthauptete, Leidensgenossen von ihm, liefen ohne Sinn und Verstand dort umher – na ja, laufen täten sie nicht wirklich. Sie seien dort, in ihrer ganzen hoffnungslosen Verunstaltung und ohnmächtigen Entwurzelung.
Theos jetziger Berater hieß Jimmy Davis. Er war hartnäckiger als die ganze Batterie von Vorgängern, die Theo schon verschlissen hatte. Jimmy Davis. Ein attraktiver Schwarzer. Immer hübsch postmodern in Schwarz gekleidet – so zumindest hätte Theos Urteil gelautet, wenn er sich denn einen optischen Eindruck von ihm hätte verschaffen können.
Gestern hatte Jimmy Davis gefragt: »Was willst du, Theo?«
»Meinen Körper«, hatte Theo geantwortet.
»Das schwere Ding mit all dem Fett?«
[20] »Ich mag das Fett. Es stand mir gut.«
»Ja, als Schwein hättest du eine gute Figur gemacht.«
»Lass mich doch ein Schwein sein. Das hat niemanden gestört.«
»Niemanden gestört? Wieso bist du dann hier gelandet, Theo?«
»Das war die Schuld von einem Scheißmarokkaner.«
»Hattest du es nicht selbst herausgefordert?«
Theo wurde giftig. »Ach, ich habe also selbst Schuld, dass mir das angetan wurde, ja? Komm, ich habe gegen diese religiösen Irren Stellung bezogen, und so ein religiöser Irrer hat mir aufgelauert. Es war gut, sich auf die Seite dieser somalischen Prinzessin zu schlagen. Dieser Irre hat doch genau das bestätigt, wovor ich gewarnt habe! Ist doch gut, dass ich recht behalten habe, oder?«
Er zündete sich eine Zigarette an. Auch hier rauchte er. Er rauchte immer.
Sie saßen in Theos Zimmer. Er hatte stangenweise Zigaretten, sämtliche schweren französischen Sorten. Sie gingen nie aus. Auf dem Tisch stand ein Royal Salute von Chivas Regal, mehr als fünfzig Jahre alter Whisky. 2002, zwei Jahre vor seinem Tod, hatte der Brauer zu Ehren des fünfzigjährigen Kronjubiläums von Königin Elizabeth 11. zweihundertfünfundfünfzig Flaschen von diesem exklusiven goldenen Nass abgefüllt. Theos Flasche war immer voll – so jedenfalls sein Empfinden. Unten auf der Erde kostete die Flasche siebentausend Euro. Tot zu sein hatte in dieser Kaserne durchaus seine positiven Seiten.
»Ja, du hattest recht«, sagte Jimmy. »Also bist du dank deiner Rechthaberei hier gelandet.«
[21] »Ich weiß. Scheißdeal«, antwortete Theo resigniert.
»Du hast gelebt wie ein Tier. Du hast dich benommen wie ein Tier«, sagte Jimmy.
»Was geht dich das an? Hab ich dich damit belästigt?«
»Mein lieber Theo, dass mich das etwas angeht, erschließt sich aus dem Umstand, dass wir uns hier gegenübersitzen und ich einen Bericht über deine Fortschritte schreiben soll. Deine Angelegenheiten sind meine Angelegenheiten.«
»Warum tust du das? Macht dich das glücklich?«, fragte Theo, während er Jimmy den Rauch ins Gesicht blies.
»Ja, das macht mich glücklich«, antwortete Jimmy ungerührt. Er fächelte den Rauch weg. »Hör zu, Theo… Nicht alle sind so nachgiebig wie ich. Du hast nur noch deinen Kopf, aber es gibt hier auch Vertreter, die selbst den nicht mehr haben. Die wirklich nur ihr nacktes, krankes, armseliges Selbst sind. Ich bin davon überzeugt, dass du wieder vollständig werden kannst. Nicht unten. Wer einmal oben ist, kann nicht zurück. Das ist nicht nur eine alte Regel, an die man sich hier hält, sondern das geht auch rein physisch nicht. Doch es gibt Möglichkeiten der Heilung. Wenn du Wert darauf legst, wieder eins zu werden mit deinem hässlichen Körper, wenn du dich wieder als geheilt erfahren möchtest, musst du dich dafür ins Zeug legen.«
»Was ist denn das hier für eine Klinik?«, fragte Theo heiser. »Evangelisch, buddhistisch, oder wird sie von der Krankenversicherung der Ziegenwollsockenträger finanziert?«
»Das ist das Totenreich, Theo. Akzeptier das. Wir sind hier nur der Empfang. Nach all den Jahren stehst du im Grunde noch vor der Portiersloge. Ein Verwaltungsbereich [22] ist das hier, du wirst hier durchleuchtet, und man prüft, ob und wie du weiterdarfst. Möchtest du ankommen?«
Theo nickte. Aber er war böse und missgünstig. Er wollte seinen Sohn in die Arme schließen können. Er wäre lieber bei seinem Kind gewesen. Das hatte er schon gewusst, als er noch am Leben gewesen war. Und er wusste es jetzt mit der größten Gewissheit, die es gab. Der Gewissheit eines Toten. Er vermisste sein Kind.
»Du kannst dich hier von allem Ballast befreien, Theo. Du kannst weiterkommen. Aber das musst du selbst tun.«
»Lieber Pater, das ist doch alles neoreligiöses, esoterisches Geschwätz.«
»So redet man hier, Theo. Ich muss mich auch daran gewöhnen.«
»Gibt es kein Totenreich für Typen wie mich?«, fragte Theo.
Jimmy grinste. »Nein. Wir machen keine Unterschiede zwischen den Toten. Für uns sind alle gleich.«
Jimmy Davis hätte Filmstar sein können mit seinem ebenmäßigen Gesicht und seinen klaren, ironisch blitzenden Augen.
Theo fragte: »Bist du ein Engel?«
»Nein. Die Ausbildung habe ich nicht. Ich bin wie du. Ein gestorbener Mensch.«
»Was warst du unten von Beruf?«
»Ich war Priester«, antwortete Jimmy. »Franziskaner.«
»O nein«, stöhnte Theo laut.
Jimmy musste herzlich lachen. Schöne, regelmäßige Zähne hatte er. Er sagte: »Ich habe deine Akte gelesen. Auf ›Christenhunde‹ warst du unten nicht gut zu sprechen.«
[23] »Heuchler«, sagte Theo. »Pädophile Heuchler.«
»Ich habe gesündigt«, räumte Jimmy nickend ein, »aber ich war nicht pädophil. Ich liebte Frauen.«
»Hast du mit ihnen geschlafen?«
»Ja«, gestand Jimmy.
»Das Zölibat!«, schleuderte Theo ihm ins Gesicht.
»Das war schwer.«
»Vater Jim, warum bist du Priester geworden, wenn du doch wusstest, dass du dann nicht vögeln darfst?«
»Ich wollte ein guter Mensch sein.«
»Und dafür brauchtest du eine schwarze Kutte und einen weißen Kragen? Den du jetzt im Übrigen abgelegt hast. Schönes Hemd. Seide?«
»Ja. Handgesponnen.« Jimmy rieb mit einem Finger über das feine, glatte Gewebe – im übertragenen Sinne natürlich.
Theo fragte: »Du hättest doch auch einfach nach Afrika gehen und dich dort für Aussätzige und Lahme einsetzen können. Dafür braucht man doch keinen Vatikan!«
»Ich brauchte die Kirche.« Jimmy las das Etikett auf der Flasche. »Donnerwetter, das ist ein exklusiver Whisky. Gib mir auch mal einen Schluck.«
»Zweihundert Euro pro Schluck.«
»Unten, hier nicht«, erwiderte Jimmy.
Theo schenkte ihm ein – ohne Hände. Jimmys Glas füllte sich.
Jimmy sagte: »Wir haben über dich konferiert.«
»Schön zu hören, Herr Pastor.«
»Ich bin kein Pastor.«
»Dann eben Vater Jim.«
»Nenn mich auch nicht Vater.«
[24] »Dann Franziskaner.«
»Das war ich mal. Hier bin ich dein Berater, eine Art Bewährungshelfer. Nenn mich einfach Jimmy, der Name genügt.«
»Ihr behandelt mich, als wäre ich ein Verbrecher.«
»Du warst unmoralisch.«
»Amoralisch. Das ist was anderes«, korrigierte ihn Theo.
»Unmoralisch, finden wir«, beharrte Jimmy. »Du hast das eine und andere zu berichtigen. Unten. Also gestatten wir dir zu kommunizieren.«
»Kommunizieren?«
»Du darfst Kontakt herstellen.«
»Kontakt herstellen? Zu… zu unten?«, stammelte Theo.
Jimmy nickte.
»Und unten wissen sie das?«
Jimmy schüttelte den Kopf: »Nein. Es wird eine Kommunikation geben. Aber keine direkte. Du sollst unten etwas Gutes tun.«
»Und das wird mir hier vergolten?«
»Ja. Du darfst dir deinen Körper verdienen. Das ist schon eine ganze Menge. Hast du mir zu verdanken.«
»Oh. Fein. Und was möchtest du als Gegenleistung?«
»Ich möchte, dass es dir gutgeht.«
»Vielleicht haben wir davon unterschiedliche Vorstellungen, Jimmy.«
»Aber hier zählt nur die meine, Theo.«
Theo hüpfte das nicht vorhandene Herz, als er daran dachte, dass er möglicherweise mit seinem Sohn kommunizieren konnte. Doch binnen einer Sekunde schwand diese Hoffnung. Das war keine gute Idee. Er war nicht mehr, er [25] war nach den geltenden und allen anderen Normen tot. Sein Sohn würde zu einem Medium werden, wenn Theo ihn aufsuchte, zu einem, der nicht mehr ganz dicht war, einem Spinner, der mit Geistern sprach.
Theo fragte: »Ich nehme an, dass ich nicht kommunizieren darf mit wem ich will?«
»Da liegst du ganz richtig.«
»Ihr weist mir jemanden zu?«
»Im Prinzip schon, ja. Wir können dir auch die Wahl lassen. Dann nennen wir dir drei Namen, und aus denen darfst du dir deinen Kommunikationspartner aussuchen. Ansonsten weise ich dir jemanden zu.«
»Wie geht dieses Kommunizieren vor sich?«
»Man erscheint im Traum. Man kann auch einen Gegenstand verrücken, so dass der Betreffende es nicht sieht, aber doch irgendwie wahrnimmt. Und wenn du das Glück hast, Engel zu werden, kannst du dich als Lichtblitz offenbaren.«
»Als Lichtblitz offenbaren?«, wiederholte Theo mit angeekeltem Gesicht, als habe er Essig zu sich genommen. »Warum so ein Schnickschnack und mysteriöses Getue?«
»Das Leben unten ist ein Leben, in dem man das eine und andere unter Beweis stellen muss, Theo. Engagement, gutes Benehmen, Sittlichkeit.«
»Schrecklich«, brummte Theo und schüttelte angewidert den Kopf.
Jimmy trank einen Schluck. Er schloss die Augen und biss kurz die Zähne zusammen, als er den Whisky runterschluckte.
»Wow«, ächzte er genießerisch.
»Immer eine volle Flasche«, sagte Theo einladend. »Also [26] das, was ihr Kommunizieren nennt, bedeutet, dass sie unten das Gefühl haben, sie hätten es mit einem Geist zu tun.«
»Nein. Das wäre zu viel gesagt. Es muss kleiner sein. Eine feinere Klaviatur. Jemand sitzt auf dem Sofa und hat das Empfinden, dass das Fenster offen steht, denn er verspürt einen leichten Luftzug. Aber das Fenster ist geschlossen.«
Theo fragte: »Eine Lichtspiegelung in der Fensterscheibe?«
»Das ginge.«
»Was ist der Zweck dieses Kommunizierens?« Er sprach das letzte Wort aus, als müsse er sich gleich übergeben.
»Das werde ich dir dann noch sagen. Zuerst musst du einen Lebenden auswählen.«
»Schieß los.«
Ohne Finger griff Theo zu einem Feuerzeug, um sich eine frische Zigarette anzuzünden. Er hatte keine Lunge mehr und konnte somit rauchen, so viel er wollte.
»Mit dem Rauchen ist dann Schluss, das ist dir doch klar, nicht?«, sagte Jimmy.
»Nein. Das ist mir nicht klar.«
»Wenn du in der nächsten Phase angelangt bist.«
»Dann bleibe ich hier«, sagte Theo barsch.
»Bist du dir sicher?«
»Nein.«
»Möchtest du selbst auswählen, oder soll ich dir jemanden zuweisen?«
»Selbst auswählen natürlich«, sagte Theo.
»Der erste Name ist Ayaan Hirsi Ali.«
Theo sah ihn ungläubig an. Was für ein Spielchen spielten sie hier mit ihm? Sein Tod hatte diese Frau schlagartig [27] zu einer internationalen Berühmtheit gemacht. Zuerst hatte sie in den Niederlanden ihr abenteuerliches Theaterstück aufgeführt, und dann war sie in Washington und New York in den Wandelgängen herumgeflattert, führte das Leben einer Jetsetterin und hatte Liebhaber, während Theo nur noch im Tod existierte, noch dazu körperlos. Angeblich war sie Mutter geworden.
»Ihr seid grausam«, sagte er.
»Der zweite Name ist Leon de Winter.«
»Niemals«, sagte Theo.
Ein Scharlatan. De Winter war ihm auf den ersten Blick zuwider gewesen. An die zwanzig Jahre lang hatte er gegen ihn gehetzt. In beleidigenden Kolumnen, die de Winter psychisch fertigmachen und zum Schweigen bringen sollten. Als Theo zur offiziellen Feststellung der Todesursache auf einem Seziertisch geöffnet wurde, hatte de Winter scheinheilig in einer Zeitung geschrieben, das hätte er ihm nicht gewünscht. Dabei wusste Theo ganz genau, dass de Winter im Grunde seines Herzens darüber frohlockte. Mit dem kommunizieren? Lieber in die Hölle!
»Und der Dritte?«, fragte Theo. Er trank einen Schluck. Er nahm einen Zug aus seiner Zigarette.
»Der Dritte ist dein Mörder. Mohamed Boujeri.«
Theo starrte ihn mit offenem Mund an.
»Keiner von den dreien«, murmelte er.
»Das sind die drei, unter denen du auswählen darfst«, sagte Jimmy und trank auch einen Schluck.
»Warum wollt ihr mich quälen?«
»Hätten wir die Mutter deines Kindes zur Auswahl stellen sollen? Oder einen der unzähligen, unzähligen [28] Namenlosen, die stumm unter deinen Schmähbriefen und Verwünschungen gelitten haben?«
Theo wusste nichts zu erwidern. Die Würde anderer war ihm immer schnuppe gewesen – wer nicht stark genug war, aus seinen giftigen Bechern zu trinken, hatte keine Daseinsberechtigung. Er hatte etlichen Leutchen persönliche Briefe mit verbalen Mordanschlägen geschickt. Er hatte in der Öffentlichkeit gepöbelt, aber auch privat. Sie mussten sich ihm beugen. Er betrieb seinen Briefterror nachts, wenn er betrunken war. Manchmal schämte er sich dafür, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hatte. Manchmal versuchte er, den Brief zurückzuholen, oder empfahl dem Adressaten, den Brief ungelesen zu zerreißen. Meistens freilich erreichte der Brief sein Ziel.
»Diese Kandidaten gefallen dir nicht, hm?«, sagte Jimmy. »Soll ich dir also jemanden zuweisen?«
Bevor Theo antworten konnte, kam ein Mann herein, Ernie, der wie der Franziskaner Jimmy Davis in Schwarz gekleidet war, ganz im Stil des Personals eines mondänen Hotels mit gelangweilten, koksenden Gästen. Auch er war Amerikaner, allerdings rotblond.
»Hast du mal einen Moment, Jimmy?«
Jimmy deutete mit dem Zeigefinger auf Theo, als richte er den Lauf einer Waffe auf ihn, und sagte: »Nicht weggehen.« Als wenn das möglich gewesen wäre.
Er verließ das Zimmer, und Theo hörte ihr Geflüster auf dem Gang.
Ernie sagte: »Jimmy, du wirst kurz in der Aufnahme gebraucht.«
»Wer ist reingekommen?«
[29] »Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Jim. Es ist deine Schwester.«
»Welche?«, fragte Jimmy, ohne das leiseste Schwanken der Stimme, ohne Gefühlsregung, als habe er schon damit gerechnet.
»Die ältere, Janet«, hörte Theo Ernie sagen.
Es blieb kurz still.
»Janet? Wenn, dann hätte ich Elly erwartet. Sie ist seit Jahren süchtig. Was ist Janet zugestoßen?«
»Ein Querschläger hat sie getroffen. Schießerei auf offener Straße zwischen verschiedenen Gangs. In den Kopf, sie war sofort tot.«
Jimmy fragte: »Wie geht es ihr?«
»Sie ist ziemlich mit den Nerven runter. Sie hinterlässt ja zwei kleine Kinder. Weiß nicht, wer für sie sorgen soll.«
Es blieb wieder einige Sekunden lang still. Dann steckte Jimmy den Kopf zur Tür herein.
»Ein Notfall, Theo. Ich komme später wieder, okay? Denk schon mal über deinen Kommunikationspartner nach. Die drei, die ich dir gerade vorgeschlagen habe, wolltest du nicht. Gut. Ich weise dir also einen anderen zu. Er heißt Max Kohn. Ein Landsmann von dir. Ehemaliger Drogenboss.«
Theo hob sein Glas und nickte. Zumindest kam es ihm so vor, als nicke er, denn im Grunde war er ja nur Kopf. Er zündete sich die nächste Zigarette an. Max Kohn? Er war ihm mal in der Amsterdamer Kneipen- und Clubszene begegnet. Gerissener, schwer zu fassender Bursche aus der Unterwelt. Was hatte Jimmy Davis mit Max Kohn?
[30] 2
MAX
Erst der vierte Taxifahrer, den Max Kohn anhielt, erklärte sich bereit, ihn nach South Central Los Angeles zu bringen. Die ersten beiden hatten sofort abgelehnt, der dritte überlegte es sich nach dreißig Metern anders, aber dieser vierte war für das in Aussicht gestellte Trinkgeld von fünfzig Dollar empfänglich.
Kohn war am Tag zuvor aus Phoenix, Arizona, gekommen. Nach einem Jahr im rauhen Klima von Rochester, Minnesota, wo man ihm ein kostbares neues Herz in den Brustkorb montiert hatte, wohnte er nun seit kurzem in der Wüste des Südwestens.
Kohn liebte die trockene Luft der amerikanischen Wüsten. Er hatte jahrelang Striplokale und Callgirl-Agenturen in Las Vegas betrieben und wusste die reinigende Wirkung von Trockenheit und alles durchdringender Hitze zu schätzen. Sein Geld war auf Konten in den amerikanischen Bundesstaaten mit der geringsten Besteuerung deponiert, und so hatte er sich unweit der Mayo Clinic in Scottsdale ein geräumiges Haus auf ockerfarbener Erde kaufen können. In der Mayo Clinic in Rochester war die Transplantation vorgenommen worden, und als sich nach einem Jahr erwiesen hatte, dass sich das Herz bei ihm vollkommen zu Hause [31] fühlte, hatte er Abschied von seinen Kardiologen genommen und den Umzug gewagt.
Der Flug nach Los Angeles dauerte nur anderthalb Stunden. Kohn stieg in einem Hotel am immer belebten Sunset Strip ab. In den Straßencafés sah er junge Frauen mit nackten Schultern, langbeinig, prachtvoll, aber unsicher. Breitschultrige junge Männer mit prallem Bizeps, Sonnenbrille im glänzenden Haar, spielten lässig mit dem Schlüssel ihres Porsche oder Ferrari. Die Läden am Strip führten die allerteuerste Markenkleidung und schienen trotzdem guten Zulauf zu haben. Früher hatte Kohn sich genauso produziert wie die coolen Statisten auf der Glitzerbühne des Strip. Cool war in. Bloß keine Regungen zeigen. Demonstratives Gelangweiltsein machte größeren Eindruck als Neugierde oder Leidenschaft. Max Kohn kannte das alles zur Genüge.
Auch er war cool gewesen, hatte Clubs oder Restaurants früher mit nahezu unbewegter Miene betreten und zusätzlichen Eindruck mit seiner Entourage gemacht, zwei oder drei raubkatzenhaften Riesen aus Russland oder Serbien. Heute betete Kohn jeden Morgen die Sonne an.
Sobald es hell wurde, stand er auf und lauschte draußen auf der Terrasse, die Hunde um sich herum, eine Tasse grünen Tee und ein aufgeladenes iPad vor sich, den Vögeln, die auch in diesem Klima der Sonne ein Willkommenslied sangen. Er las die Online-Zeitungen, auch die niederländischen, und ein paar wissenschaftliche Sites, die für ihn verständlich waren.
Die Fahrt vom Strip nach South Central dauerte vierzig Minuten. Der Taxifahrer war ein Schwarzer, der die Rituale von South Central kannte.
[32] Kohn wusste, in was für eine Gegend er da fuhr, aber er hatte sich trotzdem förmlich gekleidet, mit dunkelblauem Anzug, weißem Oberhemd und dunkelroter Krawatte. Keine Manschettenknöpfe. Keine Ringe. Selbst in seiner allercoolsten Zeit hatte er keinen Schmuck getragen, keine Tätowierungen, keine Piercings. Er war ein Geschäftsmann gewesen, der ein legales Seximperium mit hundert Mitarbeitern lenkte. Auch wenn die Haupteinnahmequelle Sex oder die Verheißung von Sex war, musste man strenge Regeln befolgen. Keine Drogenabhängigen, keine Alkoholiker einstellen. Seine Rausschmeißer, Türsteher und Bodyguards heuerte er aus osteuropäischen Bodybuildern an, die durch die Bank loyal waren und kein Pardon kannten. Kohn herrschte auf strikt kapitalistischer Basis. Er bevorzugte niemanden, die Mädchen rührte er nicht an. In Vegas hatte er Hunderte von Bekannten, aber keine Freunde – die hatte er in den Niederlanden auch nicht gehabt, bis auf einen einzigen, einen treuen Adjutanten.
Er hatte sich gefragt, ob er der Familie Davis etwas mitbringen sollte, eine Schachtel Pralinen oder einen Strauß Blumen, doch alles, was er hätte aufbieten können, wäre im Vergleich zu dem, was ihm geschenkt worden war, lächerlich wenig gewesen. Er hatte einen Scheck bei sich, auf dem er eine beliebige Summe eintragen konnte, wenn er den Eindruck gewann, dass die Familie Hilfe benötigte. Die Wahrscheinlichkeit war groß, sie lebten in South Central, einer der ärmsten Wohngegenden Kaliforniens.
Sie überquerten den Interstate 10, den Highway, der sich von Santa Monica quer durch den Süden der USA bis hinüber zur Ostküste erstreckte. Seine Gesamtlänge betrug [33] dreitausendneunhundertneunundfünfzig Kilometer, wie Kohn irgendwo gelesen hatte. Es gab drei Highways, die noch länger waren. Südlich vom Interstate 10 nahm die Verelendung zu. Sie fuhren auf dem Crenshaw Boulevard – auch nördlich vom Highway schon nicht mehr als eine ausgefahrene, überlastete Durchgangsstraße – zu einem Distrikt, der The Jungle genannt wurde. Die dortigen Apartmenthäuser hatten früher einmal inmitten einer atemberaubenden tropischen Vegetation gestanden, umgeben von wohlriechenden Gärten mit Bananenpalmen, Avocado- und Feigenbäumen. Das war alles gefällt worden, und dieses Viertel südwestlich des Baldwin Hills Crenshaw Plaza war jetzt eines der gewalttätigsten der Stadt, seit die Black P. Stones ihr Unwesen trieben, eine ursprünglich in Chicago beheimatete Gang, die hier eine Niederlassung eingerichtet hatte. Berufsverbrecher und Kleinkriminelle hatten in Vegas zu Kohns Kundenkreis gehört, und wie man die zur Räson brachte, wenn sie die Ordnung zu stören drohten, wusste er, doch den Gangs von South Central brauchte man mit Vernunft nicht zu kommen. Ehre und Respekt, darum ging es ihnen. Kohn hatte keine andere Wahl. Er musste diese Gegend aufsuchen, dazu nötigten auch ihn Ehre und Respekt.
Sie verließen den Crenshaw Boulevard und fuhren durch eine ärmlich anmutende Seitenstraße mit niedrigen Holzhäusern, deren Fenster vergittert waren und deren Anstrich abblätterte. Autowracks standen vor halb eingefallenen Garagen. Die Vorgärten waren nicht mehr als nackte Sandkästen oder wild wuchernde Grasflächen, denen man die Vernachlässigung ansah. In den Rinnsteinen lag Abfall.
Sie bogen in eine andere Seitenstraße ein, und Kohn sah [34] durch die Windschutzscheibe einen halben Block weiter eine größere Ansammlung schwarz gekleideter Menschen. Zwei behelmte Polizisten blockierten, neben ihren weißen Motorrädern stehend, die Fahrbahn. In dieser Straße wollte Kohn seinen Besuch abstatten, und mit jeder Hausnummer wurde ihm klarer, dass sich die Leute genau bei der Adresse versammelt hatten, die ihm die Familie seines Spenders angegeben hatte.
Das Taxi wurde von den Polizisten an der Weiterfahrt gehindert und hielt.
»Das ist die Adresse, zu der Sie wollten«, sagte sein Fahrer, der Schwarze mit dem zerfurchten Gesicht und den wässrigen Augen, deren Weiß gelb verfärbt war.
»Warten Sie auf mich«, sagte Kohn.
»Wie lange bleiben Sie?«, fragte der Fahrer.
»Fünf Minuten oder eine Stunde, keine Ahnung.«
Er gab dem Mann einen Fünfzigdollarschein: »Wenn ich zurückkomme, verdopple ich das.«
Er stieg aus und ging auf die Polizisten zu. Jetzt entdeckte er, dass hinter der Mauer, die die Menschenansammlung bildete, ein weißer Leichenwagen wartete. Die Leute waren allesamt schwarz, auch die Polizisten.
Kohn überprüfte die Hausnummer und konstatierte, dass es sich tatsächlich um das Haus handelte, in dem man ihn erwartete.
Er sprach einen der Polizisten an: »Handelt es sich um jemanden von der Familie Davis?«
Der Polizist nickte, gab aber keine nähere Erläuterung.
»Ich bin mit jemandem von der Familie verabredet«, sagte Kohn.
[35] »Sie haben eine Beerdigung«, erklärte der Polizist, als begreife Kohn nicht, was hier vor sich ging.
»Ich möchte zu Janet Davis«, sagte Kohn.
Der Polizist sah ihn einige Sekunden lang an, bevor er sagte: »Das ist die Beerdigung von Janet Davis.«
Gestern hatte Kohn einen Flug von Phoenix nach Los Angeles genommen. Vor einer Woche hatte er mit Janet Davis gesprochen. Drei Wochen davor hatte er bei der Organisation, die Spender und Empfänger zusammenbrachte, ein Gesuch um Auskunft und persönlichen Kontakt eingereicht.
Kohn atmete, dachte und fühlte mit dem Herzen von Janets verstorbenem Bruder, dem katholischen Priester Jimmy Davis. Er wollte mehr über ihn erfahren und gegebenenfalls dessen Familie finanziell unterstützen, wenn Bedarf bestand.
James Clemens Davis. Er gehörte dem Orden der Franziskaner an. Geboren in Los Angeles, Kalifornien, gestorben in Rochester, Minnesota. Kohn schlug für einen Moment die Augen nieder, während er seine Enttäuschung hinunterschluckte.
Einen Tag, bevor Jimmy Davis sterben sollte, war Max Kohn mit einer Chartermaschine von Las Vegas nach Rochester geflogen. Er stand schon seit zwei Jahren auf der Dringlichkeitsliste. Sein Kardiologe hatte ihm telefonisch mitgeteilt, dass ein Patient der Mayo Clinic in Minnesota für hirntot erklärt worden sei, dessen Herz genau zu ihm passe. Normalerweise wurde das Herz zum Patienten gebracht, aber Kohn zog es vor, nach Rochester zu reisen, um dort auf die Operation vorbereitet zu werden. Er ließ sich von einem Kardiologen begleiten, den er aus eigener Tasche [36] bezahlte. Einschließlich des gecharterten Flugzeugs hatte ihn die Reise mehr als dreißigtausend Dollar gekostet.
Im Nachhinein konnte er nicht mehr sagen, wieso ihm so sehr daran gelegen war, zu dem Herzen hinzureisen. Die Reise war nicht ohne Risiken. Es mussten allerlei Apparaturen in dem schmalen Flugzeug untergebracht werden, aber er konnte ausgestreckt darin liegen. Normalerweise wäre das Herz von einem Chirurgen nach Las Vegas gebracht und dort dem Empfänger eingepflanzt worden. Kohn ließ sich sonst nicht von plötzlichen Eingebungen leiten, schon gar nicht von solchen sentimentaler Natur. Aber irgendwie war er davon überzeugt, dass er das Herz nicht reisen lassen durfte – das Herz erwartete ihn, so sein Empfinden.
Die Mayo Clinic in Rochester ging auf die Sisters of St.Francis zurück, einen 1877 gestifteten katholischen Orden. Nach einem verheerenden Tornado errichteten die Nonnen 1883 in Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen Arzt Doktor William Mayo ein erstes kleines Hospital in Rochester. Daraus ging schließlich die Mayo Clinic hervor, eines der größten Krankenhäuser in Amerika, ein Arztzentrum mit mehr als siebzehnhundert Fachärzten und Spezialisten, das allseits als eines der besten der Welt galt. Im zurückliegenden Jahr war Kohns Leben mit der Mayo Clinic sowie, indirekt, mit der Philosophie des Franz von Assisi, die man dort pflegte, verwoben worden. In seinem Leib klopfte jetzt das Herz eines Franziskaners, des Bruders von Janet, die nun selbst gestorben war.
»Wissen Sie, woran sie gestorben ist?«, fragte Kohn den Polizisten.
»Von einem Querschläger getroffen. Eine Schießerei [37] zwischen rivalisierenden Gangs. Sie stand im falschen Moment am falschen Ort.«
Kohn hatte sie nicht gekannt, aber durch das Herz ihres Bruders – ein einfacher Muskel von nicht einmal dreihundertfünfzig Gramm – fühlte er sich unerklärlich tief mit ihr verbunden. Er musste kurz mit den Tränen kämpfen, als trauere er um eine nahe Angehörige.
Er schluckte und sagte: »Können Sie mir weiterhelfen? Kennen Sie die Familie? Janet hat doch eine Schwester, Elly.«
Der Polizist nickte: »Ja, ich kenne sie. Mein Bruder ging mit Jimmy, der vor einem Jahr gestorben ist, zusammen zur Schule. Aber dann sind Sie wohl nicht wegen der Beerdigung hier, oder?«
»Ich wusste nicht, dass Janet tot ist, nein.«
Kohn blickte auf die Menschen rund um den Leichenwagen, eine Gruppe stilvoll in Schwarz gekleideter Trauernder mit Gesichtern, die starr waren vor Kummer und Wut.
Kohn fragte: »Hat man die Täter gefasst?«
»Nein. Noch nicht. Eine Frage der Zeit. Es war zwar vermutlich ein Querschläger, aber sie werden sich trotzdem damit brüsten. Wir kriegen das schon raus, die schnappen wir.«
»Kennen Sie Elly? Können Sie sie mir zeigen?«
Der Polizist schüttelte den Kopf: »Ich war vor einer Stunde schon einmal hier, und da war sie betrunken. Sie ist nicht hier draußen. Wird wohl im Haus sein.«
Kohn bedankte sich bei ihm und ging an den Trauernden vorbei zu dem Holzbungalow, dessen Veranda mit weißen Lilien und weißen Samtbändern geschmückt war. Einige ältere Leute warteten in Sesseln unter dem Vordach auf den [38] Aufbruch des Leichenzugs. Kohn war der einzige Weiße, aber niemand schenkte ihm Beachtung. Er trat ins Haus und gelangte in einen kleinen Vorraum. Auf einem Tisch brannten Dutzende weißer Kerzen. Menschen standen mit Kaffeebechern in der Hand darum herum, alle in Schwarz gekleidet. Er ging in das angrenzende Zimmer. Dort stand, mit noch geöffnetem Deckel, ein großer weißer Sarg auf einem Chromgestell mit Rädern.
An einer Wand, etwa zwei Meter vom Sarg entfernt, saßen drei Menschen, die nahe Angehörige sein mussten. Eine rundliche alte Frau mit weißem Kraushaar, im Rollstuhl sitzend, mit leerem Blick vor sich hinstarrend. An ihrer Seite ein etwa sechsjähriger Junge und ein ein, zwei Jahre jüngeres Mädchen mit überdimensionaler weißer Schleife im schwarzen Haar, beide schauten zu ihm auf. Ihre großen Augen waren vom Weinen gerötet, und ihr Blick auf ihn war voller Misstrauen, als könne er den Sarg stehlen. Vielleicht dachten sie, er sei Polizist. Er setzte ein leises, mitfühlendes Lächeln auf, aber sie reagierten nicht darauf, sondern beäugten ihn unsicher.
Ein Weißer, klein, nicht älter als vierzig, den weißen Kragen des Geistlichen um den Hals, kam auf ihn zu und sagte: »Wir haben noch ein paar Minuten, Sie können in Ruhe Abschied von Janet nehmen.«
Kohn nickte und trat an den Sarg, die Hände vor dem Bauch gefaltet, fromm, als wolle er beten.
Janet lag in einem weißen Kleid auf einem Bett aus weißer Seide, die Hände wie Kohn auf dem Bauch. Sie hatte ein schmales Gesicht mit ausgeprägten Wangenknochen. Er wusste nicht, wo sie von der Kugel getroffen worden war, [39] und er sah auch keine Wunde oder überschminkte Wunde. Janet war so schmal, dass noch jemand neben ihr Platz gehabt hätte. Im Internet hatte Kohn einige Bilder von Jimmy Davis gefunden; Janet hatte wenig Ähnlichkeit mit ihrem Bruder. Kohn konnte nicht anders, als sich vorzubeugen und sie auf die kalte, leblose Stirn zu küssen.
Als er sich wieder aufrichtete, fühlte er den Blick des Geistlichen auf sich, der nun auf der anderen Seite des Sarges stand. Sein Gesicht unter dem hellblonden Haar war erhitzt und hochrot, und er wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von den Wangen. Seine blauen Augen verrieten jungenhafte Neugierde.
»Sie kannten Janet gut?«, fragte er.
»Nein. Nicht gut. Wir haben vor einer Woche miteinander telefoniert. Und wir haben einige Mails ausgetauscht.«
Der Geistliche nickte, aber Kohn sah seine Verwirrung.
»Ich war mit ihr verabredet. Heute. Ich wusste nicht, dass…« Kohn ließ das Ende des Satzes in der Schwebe.
»Janet war einer der Pfeiler meiner Gemeinde«, sagte der Geistliche. »Ich bin Joseph Henry, Father Joseph.«
»Max Kohn.«
»Max Kohn?«, wiederholte der Geistliche. Er blinzelte, kam um den Sarg herum, reichte Kohn die Hand und schüttelte die seine lange und heftig. Father Josephs Hand war feucht.
»Max Kohn«, wiederholte der Priester. »Ach ja, Max Kohn. Janet hat mir von Ihnen erzählt. Sie hatten im Zusammenhang mit Father Jimmy Kontakt zu ihr gesucht.«
»Stimmt.«
»Sie hat das mit mir besprochen. Die Umstände und so. [40] Ist und bleibt natürlich was Seltsames. Aber sie freute sich darauf. Ich wusste nicht, dass sie sich schon fest mit Ihnen verabredet hatte. Ach, aber ich muss Sie kurz vorstellen.«
Father Joseph wandte sich der alten Frau zu. Ihre Beine waren mit fleischfarbenen Binden umwickelt, durch die irgendein Sekret gesickert war.
»Ria, ich muss dir jemanden vorstellen.«
Die Frau nickte und schaute hilflos auf. Der Geistliche zeigte auf Kohn und sagte: »Das ist der Mann, der Jimmys Herz bekommen hat. Ich habe dir von ihm erzählt. Das Herz von Jimmy, deinem Sohn, Jimmy«, wiederholte er. »Dieser Mann hat sein Herz.«
Als kenne er Kohn schon seit Jahren, erlaubte sich Father Joseph, mit dem Finger auf die Seidenkrawatte mitten auf Kohns Brust zu tippen.
Ria drehte langsam den Kopf und versuchte, sich auf den unbekannten Mann zu konzentrieren.
»Haben Sie Jimmy gekannt?«, fragte sie leise.
»Nein«, antwortete Kohn.
»Sie haben sein Herz«, erwiderte sie tonlos.
»Ja. Ich habe Jimmys Herz.«
»Er war ein Heiliger«, sagte Ria. »Mein Sohn war ein Heiliger. Er bekam ein Geschwür im Kopf. Das macht Gott mit den Menschen, die Er liebhat. Er möchte sie nah an seinem Thron.«
Sie streckte suchend die Hand aus, als wisse sie nicht genau, wo Kohn stehe. Er begriff, dass sie blind war. Wahrscheinlich Diabetes. Er hatte gelesen, dass viele Schwarze darunter litten. Sie hatte gar nicht gesehen, dass Father Joseph ihm auf die Brust getippt hatte.
[41] Er nahm ihre zerbrechliche Hand in seine Hände und fühlte zarte Knöchel unter der Pergamenthaut.
Ria fragte: »Wie fühlt es sich an, das Herz eines Heiligen?«
Kohn suchte in ihren haltlosen Augen nach einer Antwort: »Wie ein Geschenk.«
»Was haben Sie bisher mit Ihrem Leben angefangen?«
Kohn sah Father Joseph einen Moment ratsuchend an. Der Geistliche lächelte wohlwollend.
»Ich habe hart gearbeitet«, war alles, was ihm einfiel.
»Jimmy auch«, sagte sie. »Jimmy wollte Gutes verbreiten. Bis der Herr ihn zu Sich rief. Sein Herz schlägt jetzt in Ihrem Körper. Die Ärzte können heute alles. Vieles. Ich bin zuckerkrank, dafür gibt es noch keine Medizin. Aber das Herz eines Toten können sie einfach in einen anderen Toten einsetzen, und der kann dann wieder leben. Waren Sie tot, als Sie das Herz meines Sohnes bekamen?«
Kohn antwortete: »Nein. Aber ich wäre tot gewesen, wenn Jimmy nicht gestorben wäre.«
Fünf Männer mit Zylinder in der Hand – wegen der niedrigen Türen konnten sie ihn nicht aufbehalten – traten fast lautlos ins Zimmer. Der Sarg wurde jetzt abgeholt.
Kohn hielt immer noch die Hand der alten Frau.
Sie sagte: »Ich werde für Sie beten, dass Jimmy für Sie betet. Janet ist jetzt bei ihm. Sie haben sich immer gut verstanden. Jimmy hat in Afrika gearbeitet, wussten Sie das?«
»Ich habe davon gelesen.«
Sie wandte ein Ohr dem Sarg zu und konzentrierte sich auf das, was sie hörte: »Sind die Träger da?«
Father Joseph beugte sich zu ihr hinunter. »Ja. Sie sind da. Wir fahren jetzt zum Friedhof.«
[42] Sie befreite ihre Hand aus Kohns Händen.
»Kommen Sie doch noch einmal vorbei«, sagte sie. »Sie sind jederzeit willkommen. Sie sind doch schwarz, oder?«
»Nein.«
»Ein schwarzes Herz in einem weißen Körper«, spottete sie. »Das kann ja noch was werden.«
Sie musste über ihre eigenen Worte lachen.
Einer der Sargträger signalisierte Father Joseph, dass sie aufbrechen wollten, und als dieser nickte, setzte er seinen Zylinder auf und schob den schweren Rollstuhl mit der alten Frau aus dem Zimmer. Er duckte sich tief, als er durch die Tür trat. Die beiden Kinder hatten sich schon erhoben und folgten dem Rollstuhl.
Father Joseph fragte Kohn: »Was haben Sie jetzt vor?«
»Janet hatte mir Fotos versprochen und Geschichten über ihren Bruder. Vielleicht könnte ich mit ihrer Schwester sprechen?«
»Elly ist nicht ansprechbar.«
»Janet sagte vorige Woche, dass sie mir einen Umschlag mit allerlei Dingen zu ihrem Bruder geben wollte.«
»Tut mir leid, Herr Kohn, ich weiß nicht, ob sie noch dazu gekommen ist. Sie ist vor fünf Tagen gestorben, in der Auffahrt, vor der Garage. Sind Sie morgen noch in der Stadt?«
»Ja.«
»Vielleicht geht es Elly dann etwas besser. Kommen Sie mit auf den Friedhof? Im Wagen mit Oma und den Kindern ist noch Platz.«
»Die Kinder… Sind sie von Elly?«
Father Joseph warf einen Seitenblick zu dem weißen Sarg, [43] der von den Trägern geschlossen und vorsichtig aus dem Zimmer bugsiert wurde. Dann winkte er Kohn mit einer zwingenden Handbewegung näher.
Kohn beugte sich zu ihm.
Der Geistliche flüsterte: »Janet und Elly sind beide unfruchtbar. Ria hat ihre beiden Töchter von einem Onkel bekommen, der sie vergewaltigt hat. Ihr Sohn war aber von einem anderen Mann. Ihr Sohn konnte sich fortpflanzen, obwohl er als Franziskaner das Keuschheitsgelübde abgelegt hatte. Jimmy hatte gesunden Samen. Die Kinder sind von Jimmy. Janet hat sie aufgezogen.«
Er sah Kohn so durchdringend an, als wolle er ihm in den Kopf hineinschauen.
»Janet bekam jeden Monat Geld von ihrem Bruder. Nach seinem Tod hat sie seine Kunstsammlung verkauft, die er in Afrika zusammengetragen hatte, als er dort bei der Mission arbeitete. Aber das Geld war jetzt fast aufgebraucht. Das war einer der Gründe dafür, dass sie sich mit Ihnen treffen wollte. Sind Sie reich?«
»Ja«, antwortete Kohn.
»Dann haben Sie jetzt eine Verantwortung. Kommen Sie mit?«
[44] MEMO
An: Minister J. P. H. Donner
FOR YOUR EYES ONLY
Kennzeichen: Three Headed Dragon
Sehr geehrter Herr Minister,
in Bezug auf die Untersuchung des sogenannten Lichtinzidents (im Folgenden LI) darf ich Ihnen mitteilen, dass sich recht kuriose Schlussfolgerungen aufdrängen. Meiner Ansicht nach ist es daher von Belang, Sie zu einem frühen Zeitpunkt über die Fortschritte zu informieren.
Die beiden Hauptzeugen haben das Land verlassen. Ich stehe per E-Mail und Skype mit ihnen in Verbindung. Zwölfmal wurden die Zeugen befragt – »verhört« gäbe ein falsches Bild der Verhältnisse wieder. Ihre Erklärungen sind konsistent.
Im Rahmen der Ereignisse scheint dieser LI von untergeordneter Bedeutung zu sein. Meine Faszination basiert vor allem auf der Unerklärlichkeit des LI. Alle anderen Umstände konnten analysiert und auf ihren logischen oder psychologischen Kern zurückgeführt werden. Der LI nicht.
[45] Der LI ist, oberflächlich betrachtet, die Reflexion eines Lichtstrahls durch eine glatte, ebene Oberfläche. Dabei ist der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel, so das physikalische Gesetz. Siehe Graphik:
Man hat vor Ort Messungen angestellt und dabei die genaue Stelle auf der ebenen Oberfläche, die Höhe der Deckenleuchten in Bezug zu dieser Oberfläche und dem Fußboden und die Position der beiden Zeugen berücksichtigt.
Die ersten Testergebnisse scheinen zu belegen, dass die Lichtquelle (sprich: die Deckenleuchten) unmöglich in der Weise durch die ebene Oberfläche reflektiert worden sein kann, dass es zu der von den Zeugen geschilderten optischen Wahrnehmung kam.
Es gab keine anderen Lichtquellen außer drei Deckenleuchten; diese befinden sich sieben Meter dreißig über dem Fußboden. Es handelt sich hier um ein Gebäude aus dem Jahre 1895, ein ehemaliges Waisenhaus für Mädchen. Der Granitfußboden wurde 1998 aufgearbeitet und ist trotz der [46] intensiven Beanspruchung in einem hervorragenden Zustand. Eine Reflexion des Deckenlichts durch diesen Boden kann niemals zu einem LI führen, wie er von den Zeugen beschrieben wurde.
In der Hoffnung, Ihnen hiermit dienlich gewesen zu sein, mit freundlichen Grüßen
Frans van der Ven
[47] 3
SONJA
Die Trauerkarte hatte sie auf Anhieb aus der Post herausgefischt. Zwischen den üblichen Werbesendungen und Bankbriefen mit Kontoauszügen stachen Trauerkarten sofort ins Auge. Sie waren immer gleich nackt und gnadenlos. Die Karte war an ihre alte Adresse in Juan-les-Pins geschickt und nach Amsterdam weitergeleitet worden.
Sie hatte Janet kurz vor Jimmys Tod kennengelernt und danach nur noch sporadisch Kontakt mit ihr gehabt. Eine engere Beziehung hatte sich nicht zwischen ihnen entwickelt. Sie hatten beide keinen Bedarf. Janet und ihre Schwester Elly legten keinen Wert darauf, eine konkrete Bestätigung für das zu erhalten, was sie ohnehin schon wussten – dass ihr Bruder, der zölibatäre Priester, mit Frauen geschlafen hatte.
Die Beerdigung in Los Angeles fand genau in dem Moment statt, da Sonja in Amsterdam die Karte in die Hände bekam. Sie konnte jetzt höchstens noch einen Brief schreiben. Den würde Elly achtlos auf den Haufen der anderen Beileidsschreiben werfen. Und der ganze Packen würde dann nach einigen Wochen, mit einem dicken Gummiband zusammengeschnürt, in einem Schuhkarton verschwinden und unters Bett geschoben werden, bis das Haus wegen [48] Umzugs oder Versteigerung zur Tilgung von Ellys Schulden ausgeräumt wurde. Dann würde man den Karton wiederfinden und als wertlosen Plunder in einen Papiercontainer kippen.
Was Jimmy an Besitz zusammengetragen hatte – das war nicht viel, ein paar exotische Kunstobjekte aus Holz, deren Schönheit auch für Sonja ersichtlich gewesen war –, hatte er Janet hinterlassen. Janet und Elly lebten in einem Ghetto in L. A., wie Jimmy erzählt hatte. Nach Einzelheiten hatte Sonja nie gefragt. Sie hatte sich an seiner Liebe gewärmt, und sie hatte ihn geliebt, ohne je Ansprüche zu erheben – glaubte sie. Wenn sie an ihn dachte, tat sie es mit einem wehmütigen Lächeln.
Sie war bei ihm an dem Tag, als er starb. Jimmy hatte den Kontakt zu ihr aufrechterhalten, den Tumor aber verschwiegen. Janet rief sie an. Sie flog daraufhin nach Minneapolis und fuhr mit einem Leihwagen durch dichtes Schneetreiben nach Rochester. Die Heizung im Wagen lief auf Hochtouren, aber sie fror. Sie wohnte damals mit Nathan in Juan-les-Pins an der französischen Mittelmeerküste, immer noch auf der Flucht, immer noch von Alpträumen und Sehnsüchten und Wut gepeinigt. In Südfrankreich konnte es im Winter auch kalt sein, aber kein Vergleich zur Kälte von Minnesota.
Es war krankhaft, so lange um eine Liebe zu trauern, das brauchte ihr keiner zu sagen, auch wenn es eine uneingeschränkte, alles überstrahlende Liebe gewesen war. Nein, nicht zu Jimmy. Diese Liebe hatte einem anderen gehört.
Gut zehn Jahre, bevor sie Jimmy kennenlernte, hatte diese Liebe ihr Leben entzweigerissen. Ihre Erlebniswelt glich der [49] eines neurotischen Mädchens aus einem Roman des neunzehnten Jahrhunderts, fürchtete sie. Sie hatte Psychiater aufgesucht, aber geheilt war sie nach wie vor nicht. Auf der Insel war Jimmy ein Ruhepol in den Stürmen gewesen, die ständig die Türen und Fenster ihres Lebens aufstießen und die Vorhänge von ihren Haken rissen.
Ein Jahr hatte das mit Jimmy gedauert. Sein Körper unter dem schwarzen Priestergewand war stark, und der Umstand, dass er Geistlicher war, machte den Sex umso heißer und ungezügelter. Sie trafen sich immer nur auf der anderen Seite der Insel, wo die Wahrscheinlichkeit, einem Schüler oder Lehrer seiner Schule zu begegnen – er unterrichtete an einer katholischen Schule –, sehr gering war. Sie hatte Geld und ließ ihn in eine Hotelsuite kommen. Er verkleidete sich als Tourist oder Surfer, immer mit Sonnenbrille und Baseballkappe, und damit unidentifizierbar für die, die den Franziskaner auf der Nordseite der Insel kannten. Wenn sie ihn heiraten wolle, würde er aus der Kirche austreten, behauptete er, wenn er befriedigt neben ihr lag und nach den in der Dominikanischen Republik hochgehaltenen alten Spielregeln eine Zigarette rauchte, während er ihren Körper betrachtete, den Körper der verbotenen Frau, der er mit größter Hingabe Genuss bescherte. Sein schwarzer Leib neben ihrem weißen – in ästhetischer Hinsicht vollkommen. Er war muskulös, ohne dass er etwas dafür zu tun brauchte. Sie musste schon etwas dafür tun, ihr Gewicht zu halten. Sie joggte frühmorgens am Strand entlang, bevor es zu heiß und jeder Schritt unter der Sonne zu einem unmöglichen Kraftakt wurde. Aber Sex ging immer. Im schattigen Hotelzimmer, unter rotierendem Ventilator, draußen das schrille [50] Hupen entrüsteter Taxifahrer und dann und wann aus einem vorüberfahrenden Auto Fetzen karibischer Musik. Manchmal schlief sie ein und wurde erst bei Sonnenuntergang wieder wach. Dann hatte Jimmy das Zimmer längst verlassen und gab in der Schule Nachhilfeunterricht, besuchte einen Kranken oder tröstete Hinterbliebene. Er war ein guter Mensch. Was du siehst, bekommst du, sagte er in aller Schlichtheit, und das war schön, denn er war lieb und zärtlich. Aber er war nicht geheimnisvoll. Er war gut, und es quälte ihn, dass er für seine Berufung zu geil war. Er war energisch und zielbewusst, wenn sie zusammen waren und schwitzend die Stellung änderten, aber sie wusste, dass ihn Schuldgefühle befielen, sowie er die Hotelzimmertür hinter sich zugezogen hatte und sich das heilige Gewicht seiner Berufung auf seine Schultern senkte. Das machte ihn in ihren Augen für eine dauerhafte Beziehung als Lebenspartner ungeeignet. Sie hätte an seiner Seite auch seinen Gott ertragen müssen, und der war letztlich der Stärkere.
Im Durchschnitt einmal die Woche. Und jedes Mal so, als würde es keine Fortsetzung geben. Sie widmeten sich dem, was sie hergeführt hatte, und trafen nie eine neue Verabredung. Doch dann rief sie an oder schickte eine SMS. Eine Stunde zusammen, dann war er weg. Beschämt, wie sie wusste. Das missfiel ihr, obwohl sie sich auch begehrt und somit mächtig fühlte.
Sie hatte ihn in der Schule kennengelernt. Nathan ging halbtags in den schuleigenen Kindergarten. Die Schule der Franziskanerinnen war die beste in der Dominikanischen Republik. Sonja war nicht katholisch. Sie glaubte zwar, dass Kräfte auf ihr Leben einwirkten, die ihre eigenen [51] überstiegen, aber sie wollte ihr Kind keiner institutionalisierten Religion aussetzen. Das sei kein Problem, hatte Padre James in amerikanischem Englisch gesagt, es sei Platz für jeden, und vielleicht werde sie ja noch zum wahren Glauben finden. Sie traf sich noch zu einem zweiten Gespräch mit ihm, und als sie ihm in die Augen sah, erkannte sie, dass er das Gleiche dachte wie sie. Sie hatte schon seit zehn Monaten keinen Mann mehr gehabt.