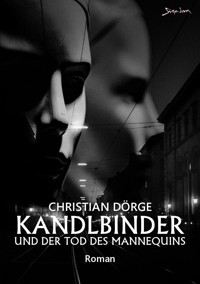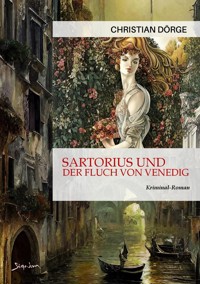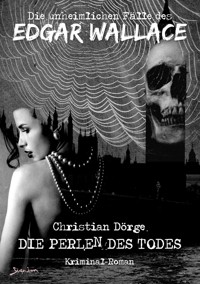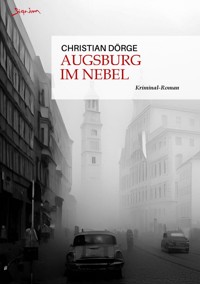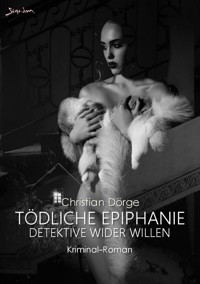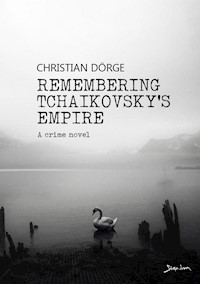9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Signum-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
London im Jahre 1965. Der Buchmacher Charles Doringham verfolgt einen skrupellos vorbereiteten und brutal in die Tat umgesetzten Raub- und Mordplan. Sein Opfer: Thalia Wigmore... 1968. Als Rechtsanwalt Siemen Friesland von einer Urlaubsreise nach Rom in die ostfriesische Kleinstadt Hagensmoor zurückkehrt, findet er in seiner Wohnung eine ihm unbekannte, spärlich bekleidete Blondine vor, die ihn augenscheinlich erwartet. Jene ungebetene (und zudem betrunkene) Besucherin loszuwerden erweist sich als ebenso schwierig wie unangenehm... München im Jahre 1964. Bei einem Jagdausflug ins Umland von Garmisch-Partenkirchen wird Remigius Jungblut, Privatdetektiv aus München, zum Augenzeugen eines dramatischen Un-glücksfalls: August Laurentius, der Sohn seiner Gastgeber, wird von einer Schrotladung getroffen und schwer verletzt... 1970: Linnet Restorick und ihr Mann Simon kommen als Sommergäste in das Haus Schwanensee – auf einer Insel an der englischen Westküste. Doch das idyllische Eiland und das düstere Haus verwandeln sich bald in eine Hölle aus Intrigen und Mord... Der Sammelband DAS SCHWARZ-WEISSE BLUT enthält vier ausgewählte Kriminal-Romane aus der Feder des Münchner Schriftstellers Christian Dörge: DIE UNHEIMLICHEN FÄLLE DES EDGAR WALLACE - SCHACH MIT DEM MÖRDER, FRIESLAND UND DAS BLONDE GIFT, DREI TAGE AUF DEM LAND und ERINNERUNGEN AN DAS REICH TSCHAIKOWSKIS. Der Autor selbst nennt seine spannenden und außergewöhnlichen Romane gern »Krimis in schwarz-weiß«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
CHRISTIAN DÖRGE
Das schwarz-weiße Blut
Vier ausgewählte Romane in einem Band
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Der Autor
1. DIE UNHEIMLICHEN FÄLLE DES EDGAR WALLACE - SCHACH MIT DEM MÖRDER
2. FRIESLAND UND DAS BLONDE GIFT
3. DREI TAGE AUF DEM LAND
4. ERINNERUNGEN AN DAS REICH TSCHAIKOWSKIS
Impressum
Copyright © 2023 by Christian Dörge/Signum-Verlag.
Lektorat: Dr. Birgit Rehberg/Nicole Pai.
Umschlag: Copyright © by Christian Dörge.
Verlag:
Signum-Verlag
Winthirstraße 11
80639 München
www.signum-literatur.com
Das Buch
London im Jahre 1965.
Der Buchmacher Charles Doringham verfolgt einen skrupellos vorbereiteten und brutal in die Tat umgesetzten Raub- und Mordplan. Sein Opfer: Thalia Wigmore...
1968.
Als Rechtsanwalt Siemen Friesland von einer Urlaubsreise nach Rom in die ostfriesische Kleinstadt Hagensmoor zurückkehrt, findet er in seiner Wohnung eine ihm unbekannte, spärlich bekleidete Blondine vor, die ihn augenscheinlich erwartet. Jene ungebetene (und zudem betrunkene) Besucherin loszuwerden erweist sich als ebenso schwierig wie unangenehm...
München im Jahre 1964.
Bei einem Jagdausflug ins Umland von Garmisch-Partenkirchen wird Remigius Jungblut, Privatdetektiv aus München, zum Augenzeugen eines dramatischen Un-glücksfalls: August Laurentius, der Sohn seiner Gastgeber, wird von einer Schrotladung getroffen und schwer verletzt...
1970:
Linnet Restorick und ihr Mann Simon kommen als Sommergäste in das Haus Schwanensee – auf einer Insel an der englischen Westküste. Doch das idyllische Eiland und das düstere Haus verwandeln sich bald in eine Hölle aus Intrigen und Mord...
Der Sammelband Das schwarz-weiße Blut enthält vier ausgewählte Kriminal-Romane aus der Federdes Münchner SchriftstellersChristian Dörge: Die unheimlichen Fälle des Edgar Wallace - Schach mit dem Mörder, Friesland und das blonde Gift, Drei Tage auf dem Land und Erinnerungen an das Reich Tschaikowskis.
Der Autor selbst nennt seine spannenden und außergewöhnlichen Romane gern »Krimis in schwarz-weiß«.
Der Autor
Christian Dörge, Jahrgang 1969.
Schriftsteller, Dramatiker, Musiker, Theater-Schauspieler und -Regisseur.
Erste Veröffentlichungen 1988 und 1989: Phenomena (Roman), Opera (Texte).
Von 1989 bis 1993 Leiter der Theatergruppe Orphée-Dramatiques und Inszenierung
eigener Werke, u.a. Eine Selbstspiegelung des Poeten (1990), Das Testament des Orpheus (1990), Das Gefängnis (1992) und Hamlet-Monologe (2014).
1988 bis 2018: Diverse Veröffentlichungen in Anthologien und Literatur-Periodika.
Veröffentlichung der Textsammlungen Automatik (1991) sowie Gift und Lichter von Paris (beide 1993).
Seit 1992 erfolgreich als Komponist und Sänger seiner Projekte Syria und Borgia Disco sowie als Spoken Words-Artist im Rahmen zahlreicher Literatur-Vertonungen; Veröffentlichung von über 60 Alben, u.a. Ozymandias Of Egypt (1994), Marrakesh Night Market (1995), Antiphon (1996), A Gift From Culture (1996), Metroland (1999), Slow Night (2003), Sixties Alien Love Story (2010), American Gothic (2011), Flower Mercy Needle Chain (2011), Analog (2010), Apotheosis (2011), Tristana 9212 (2012), On Glass (2014), The Sound Of Snow (2015), American Life (2015), Cyberpunk (2016), Ghost Of A Bad Idea – The Very Best Of Christian Dörge (2017).
Rückkehr zur Literatur im Jahr 2013: Veröffentlichung der Theaterstücke Hamlet-Monologe und Macbeth-Monologe (beide 2015) und von Kopernikus 8818 – Eine Werkausgabe (2019), einer ersten umfangreichen Werkschau seiner experimentelleren Arbeiten. Eine erweiterte Neuausgabe erscheint 2022 unter dem Titel Tristana - Eine Werkausgabe.
2021 veröffentlicht Christian Dörge mehrere Kriminal-Romane und beginnt drei Roman-Serien: Die unheimlichen Fälle des Edgar Wallace, Ein Fall für Remigius Jungblut und Friesland.
2023 erscheint sein neues Album Kafkaland.
Künstler-Homepage: www.christiandoerge.de
1. DIE UNHEIMLICHEN FÄLLE DES EDGAR WALLACE - SCHACH MIT DEM MÖRDER
Die Hauptpersonen dieses Romans
Richard – genannt Dick – Alford: Chefinspektor bei Scotland Yard, der bekannteste Ermittler seiner Zeit. Wohlbeleibt, den Genüssen des Lebens zugeneigt (und mit einer tiefen Abneigung gegen das Treppensteigen gesegnet), ein kultivierter Mann in den 50ern von freundlichem Wesen und scharfem Verstand (und mit einem beachtlichen Schnurrbart).
John Higgins: Sergeant bei Scotland Yard und Assistent von Dick Alford. 35 Jahre alt, passionierter Pfeifen-Raucher, ehrgeizig und mitunter impulsiv, aktiver Boxer und höchst kompetenter Kriminalist.
Bryan Wesby: Sergeant bei Scotland Yard, zweiter Assistent von Dick Alford. 40 Jahre alt, hochgewachsen und hager. Ein pedantischer und ausgesprochen effektiver Ermittler, verschlossen und nicht eben gesellig (was auch an seiner Vorliebe für Zigarren liegen mag).
Sir Archibald Morton: Chef von Scotland Yard und Vorgesetzter von Dick Alford. Durchaus kein hervorragender Kriminalist, pflegt er jedoch Kontakte in allerhöchste gesellschaftliche Kreise und hält große Stücke auf den Chefinspektor und dessen Fähigkeiten. Liebhaber der schönen Künste.
Mark Bannister: Constable bei Scotland Yard, Spezialist für Tatort-Ermittlungen und Spurensicherung.
Charles Doringham: ein Buchmacher im Ruhestand.
Marcus Wigmore: ein Versicherungsvertreter und leidenschaftlicher Schachspieler.
Thalia Wigmore: seine Frau.
Hagen Wigmore: der Bruder von Marcus Wigmore.
Jack Selby: Inhaber des Café Limelight mit durchaus
überschäumender Fantasie.
Derek Johnson: Kellner im Café Limelight.
Muriel Johnson: seine junge Frau.
Robert Barrett: Radiohändler und Vorsitzender des
Picton-Schach-Clubs.
Alfred Praed: ein Juwelier.
William und Margie Forset: Nachbarn der Wigmores.
Archie Moore: Constable bei der Londoner Polizei, zur
Dramatik neigend und noch reichlich grün hinter den Ohren.
Achille Havaloc und Raymond Martin:
Marcus Wigmores Rechtsanwälte.
Alexander Livingston-Cody: Staatsanwalt.
Sylvie van Dorn: Stattsanwältin.
Reginald Beauregard: Inspektor bei Scotland Yard.
Dr. Gregory Cornelius: ein Hypnotiseur.
Theresa Gosset: Zugehfrau der Wigmores.
Guy Beardmore: Pferdetrainer aus Manchester.
Dieser Roman spielt im London des Jahres 1965.
Erster Teil:
DAS BEINAHE
PERFEKTE VERBRECHEN
Erstes Kapitel
Langsam und tief in Gedanken versunken ging Charles Doringham über die Railway Street in Richtung auf das Kings Observatorium. Es war kurz vor neun Uhr abends. Trotz des leichten Regens und des dichten Nebels waren die Straßen belebt. Ein Zeitungskiosk machte gute Geschäfte. Eine kleine Gesellschaft von vier Personen stieg aus einem Auto und ging über den breiten Bürgersteig auf ein Restaurant zu. Die zwei Herren hielten ihre Regenschirme schützend über die lachenden und schwatzenden Damen.
Ohne es zu merken, rempelte Charles Doringham einen der Herren an. Er sah und hörte nichts. Achtundfünfzig Jahre lang war er ein Mann der Tat und ganz auf die Außenwelt eingestellt gewesen. Aber jetzt war er zu einem Träumer geworden, zu einem Menschen, der schnell einer Besessenheit verfiel und sich fanatisch jeder neuen Idee hingab.
Die Idee, die ihn derzeit beschäftigte, war nicht besonders hervorragend. Sie war weder profund noch originell. Es war eine fast gewöhnliche Idee, und vollkommen legal war sie auch nicht. Aber nur selten kamen Doringham wirklich originelle Gedanken. Sein Wesen wurde eher vom Gefühl als vom Denken bestimmt. So kam es, dass das, was ihn augenblicklich beschäftigte, schnell derart große Ausmaße annahm, dass es alles andere überwucherte und seinen Geist mehr und mehr trübte.
Sein heller Regenmantel war nur halb zugeknöpft, die Hände hatte er tief in den Taschen vergraben. Er war breitschultrig, groß und stark und hatte ein rotes Gesicht. Trotz seiner Jahre und des kleinen Kinns sah er gut aus. Die grünbraunen Augen standen etwas vor. Er wirkte nicht durch sein Gesicht, sondern durch seine männliche Gestalt und Haltung. Eine Schulter hatte er hochgezogen.
Nach seinem gutmütigen Gesicht mit der gebogenen Nase zu urteilen, hätte er Seemann, Landwirt oder sogar Landarzt sein können. Aber er war Buchmacher im Ruhestand und trug seine Gutmütigkeit ebenso zur Schau wie seine betonte Männlichkeit. Ein vorsichtiger Beobachter hätte dem breiten Lachen des Charles Doringham, an das seine grünbraunen Augen niemals einstimmten, nicht getraut. Ihm wäre auch der zu kleine Mund mit den dicken Lippen und den gelben Zähnen unangenehm aufgefallen. Die gebogene Nase – wie die breiten, hässlichen Hände mit den abgekauten Nägeln – verrieten Arroganz und Skrupellosigkeit. Aber wer ist schon ein so guter Beobachter, dass er all das bemerkt und die entsprechenden Schlüsse daraus gezogen hätte? Doringham war das, was man als einen echten Kerl bezeichnete, der sich mit seinen Freunden, die allesamt – wie er selbst – unverheiratet waren, gut verstand. Die Frauen, besonders die ledigen Frauen eines gewissen Alters, waren ihm durchaus zugeneigt.
Jetzt hatte er das Observatorium erreicht und damit den großen freien Platz, auf den ein halbes Dutzend Straßen mündeten. Der starke Verkehr machte ihn endlich wieder auf die Umwelt aufmerksam. Er war etwa einen halben Kilometer zu weit gegangen.
Lächelnd murmelte er vor sich hin. »Wie ein Schlafwandler...«
Er ging zurück, wandte sich dann nach rechts und befand sich bald auf der Shaftesbury Street. Hier bog er wieder rechts ab, und in den stilleren und dunkleren Straßen nahm er seine ursprünglichen Gedanken erneut auf. Mit traumwandlerischer Sicherheit erreichte er schließlich die Micawber Street.
Hier blieb er einen Augenblick stehen, zog seine große Hand aus der Manteltasche und strich sich das kleine, schlechtrasierte Kinn. »Egal«, sagte er ziemlich laut. »Ich muss für Beardmore hunderttausend Pfund beschaffen. Ja, ich brauche unbedingt hunderttausend Pfund.«
Als er das gesagt hatte, zuckte er zusammen. Aber die Straße war menschenleer. Auf der anderen Straßenseite sah er die Lichter eines kleinen Cafés und ein Neonschild, auf dem in orangefarbenen Buchstaben die Aufschrift Limelight prangte.
Charles überquerte die Straße und betrat das Café.
Das Limelight verströmte für die Bewohner dieser Gegend eine romantische Aura. In diesem Teil Londons – mit dem Observatorium, dem Hospital, der Künstlerkolonie und dem Nachtleben – war es ein besonderer Hafen, in den ziemlich merkwürdige Menschen einliefen.
Das Café bot nichts, was diesen verklärten Ruf rechtfertigte. Sein Besitzer Jack Selby hatte sich allerdings nach Kräften bemüht, diesen Ruf auszunutzen. Und was die Gäste des Cafés anging, so unterschieden sie sich in keiner Weise von anderen Bürgern: kleine Kaufleute, Angestellte, die sich lieber hier nach ihrer Arbeit bei einer Partie Schach erholten, als dass sie Kinos und Hunderennen besuchten.
Jack Selby war Romantiker und trotz seiner sechzig Jahre von geradezu rührender Kindlichkeit. Gern erzählte er von seinen Reisen und dem, was er gesehen und erlebt haben wollte. Als junger Mensch war er ein paar Jahre lang zur See gefahren und dann in Buenos Aires und Sydney Barkellner gewesen. Das bauschte er gewaltig auf. Wie ein Kind, das zum ersten Mal im Zoo war, erzählte Selby blutrünstige Geschichten von chinesischen Flusspiraten, wilden Gauchos und Gangstern mit Maschinenpistolen. Aber niemand nahm seine Geschichte ernst. Trotz seiner Größe und seiner massigen Gestalt schienen die kindlichen blauen Augen unter dem weißen Haarschopf immer wieder zu sagen: »Das ist natürlich alles Blödsinn, und niemand sollte es ernst nehmen.«
Selby hatte zwei Leidenschaften: Er dachte sich gern aufregende Abenteuergeschichten aus, und er spielte gern Schach. Aber ein Meister auf beiden Gebieten war er freilich nicht. Er verlor fast jede Partie; und sein schlechtes Gedächtnis nahm seinen Räubergeschichten jeden Hauch von Wahrscheinlichkeit. Aber dennoch hatte er an beiden seine größte Freude. Seine Gäste genossen gern seine Gesellschaft und hatten ihren Spaß an seinen naiven Geschichten.
Selby erfreute sich an seinen Gästen, aber noch mehr bedeutete ihm seine Sammlung von Fotos berühmter Schachspieler, die im Erdgeschoss des Cafés neben den Andenken an Gauchos und Gangster an den Wänden hingen. Eines der Gangster-Fotos – ein Abbild der Mafia-Patin Matilda Devine aus Sydney – war mit der Widmung Meinem lieben Freund Selby versehen. Aber was schadete es, dass die Schrift verteufelt jener des Besitzers glich? Jack war ein guter Kerl. Matilda Devine hätte das bestätigt, wenn sie Selby jemals begegnet wäre.
Das kleine Café in der Micawber Street galt also als etwas Besonderes, etwas Exklusives. Sein Besitzer war ein seltsamer Mensch mit noch seltsameren Neigungen. Er hatte unter Piraten und Gangstern gelebt. Außerdem war er auf Geld nicht gerade versessen. Das Limelight wäre sicher viel besuchter gewesen, wenn sich Selby etwas weniger um das Schachspiel gekümmert hätte.
Jeden Abend kamen die Intellektuellen in das Café und hockten dort stundenlang über den Schachbrettern wie Zauberer vor ihren Kristallkugeln. Das war vielen nicht recht. Der einfache Bürger, der ein Glas Bier trinken wollte, war enttäuscht, denn sein Geld schien ohne Bedeutung zu sein. Und zwar eines Zeitvertreibs wegen, den nur Intellektuelle als Spiel bezeichnen konnten, und der viel Ausdauer verlangte. Ein seltsames Café, in dem in erster Linie seltsame Menschen mit seltsamen Neigungen verkehrten.
Charles Doringham betrat das Café. Selby war allein im Erdgeschoss mit seinen etwa sechs Tischen. Die Tische waren unbesetzt, auch stand niemand an der kleinen Theke.
Der Wirt starrte nachdenklich vor sich hin.
»Guten Abend, Mr. Doringham«, sagte er mit breitem Lächeln. »Sie sind heute der erste.«
»Guten Abend«, erwiderte Doringham. »Erst mal was zu trinken. Ist Derek unten?«
»Ja... ja, Derek ist unten.« Seinen Gedanken entrissen, sah Selby seinen Gast vorwurfsvoll an.
Doringham nickte und ging über eine einfache Wendeltreppe nach unten.
Das Souterrain war ein schmaler, langer Raum mit achtzehn Marmortischen und einer ziemlich großen Theke. An der Wand hinter der Theke hing ein großes Foto von Jack Selby als Mexikaner, einen breitkrempigen Hut auf dem Kopf, in der einen Hand einen Revolver, in der anderen eine dicke Zigarre.
Hinter der Theke putzte Derek Johnson Gläser. Er war klein, hatte helles Haar und war blass, wie jemand, der nicht genug Schlaf mitbekommt. Sein Gesicht war rund, die Nase etwas knubbelig. Lustige, flinke Augen und wohlgeformte Hände vervollständigten das Bild. Er trug einen Ehering, das Symbol stolzer Freude. Lächelnd begrüßte er den Gast.
»Regnet es immer noch, Mr. Doringham?« Dann fügte er hinzu: »Die Club-Mitglieder lassen heute auf sich warten.«
»Wir werden sehen«, erwiderte Doringham. »Bringen Sie mir ein Glas Rum, Derek.«
Er setzte sich an einen der leeren Tische, öffnete den Regenmantel und nahm den Hut ab. Derek brachte das Glas Rum, betrachtete einen Augenblick lang Doringhams nachdenkliches Gesicht und entfernte sich.
Doringham zog ein blaues Päckchen aus der Tasche und zündete sich eine Zigarette an. Seine breiten Hände mit den abgekauten Nägeln waren hässlich, aber in ihren Bewegungen nicht unangenehm. Wieder gab er sich seinen Gedanken hin. Er musste die hunderttausend Pfund beschaffen. Beardmores Brief aus Manchester... ein tolles Geschäft, wenn’s denn klappte. Eine solche Chance bot sich nur selten. Der Durchschnittsmensch verpasste seine Chancen – erkannte sie vielleicht nicht einmal. Auch Doringham hatte schon manche Chance verpasst. Zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren hatte Beardmore ihm einen Tipp gegeben. Ein seltsamer Kerl, dieser Beardmore. Halb Franzose, halb Engländer. Puritaner und Rennstalltrainer.
Beardmore selbst wettete natürlich niemals. Gab auch meist keine Tipps. Selbst seinen besten Freunden nicht. Aber wenn er tatsächlich mal einen Tipp gab – dann war er absolut todsicher.
Doringham schlürfte seinen Rum. Seine grünbraunen Augen funkelten einen Augenblick, wurden dann wieder nachdenklich. Während der letzten fünf Jahre hatte Beardmore ihm dreimal geschrieben und einen Tipp gegeben. Und was hatte Doringham getan? Lumpige fünfhundert Pfund hatte er auf das Pferd gesetzt. So ein Wahnsinn! Dreimal hatte man ihm eine Chance geboten. Hätte er sie wahrgenommen, sein Leben wäre anders verlaufen. Er hätte es ganz neu gestaltet. Aber er hatte die Chancen nicht ausgenutzt.
Das sollte ihm nicht wieder passieren. Endlich bot sich ihm die große Gelegenheit. Raus aus England, raus aus Europa – nach Amerika. Da konnte man noch wirklich leben. Da gab es noch Freiheit und Freude. Nicht diese ewige Angst. Hier nahm der Staat einem alles ab, machte den Menschen zu einem armen Schlucker. Dauernd stiegen die Preise, und Gegenwart und Zukunft wurden zunehmend finsterer.
Aber dazu brauchte er Geld. Viel Geld. Etwa vierzehntausend Dollar oder fünf Millionen Pfund, ja, so viel müsste er mindestens haben. Und er konnte sie gewinnen. Beardmore meinte, das Pferd käme mindestens mit einer Quote von 40:1 heraus. Und Beardmore war immer sehr vorsichtig. Mit 50:1 konnte er wahrscheinlich rechnen. Schluss mit den kleinen Wetten. Endgültig Schluss damit. Drei Chancen hatte er schon verpasst. Diese vierte wollte er sich nicht entgehen lassen. Irgendwie musste er hunderttausend Pfund für die Wette auftreiben. Hunderttausend Pfund. Zweihundertachtzig Dollar – das war doch nicht viel. Manche gaben das an einem Tag aus. Viele Frauen vergeudeten diese Summe für Kleider und Schmuck. Taxi-Fahrer, Portiers, Packer hatten so viel in ihrem Sparstrumpf oder ihrer Bettmatratze. Viele, viele hatten diese Summe ohne weiteres zur Verfügung. Er aber hatte sie nicht. Nirgendwo konnte er auch nur zehntausend Pfund borgen. Und wenn er es gekonnt hätte, es wäre zwecklos gewesen. Er brauchte hunderttausend. Beardmores Tipp bedeutete entweder ein neues Leben in einem anderen Land, oder er war nur ein gemeiner Scherz. Jetzt hieß es: alles oder nichts.
Doringham leerte sein Glas, stand auf und zog den Mantel aus. »Noch einen Rum, Derek«, rief er.
»Sofort, Mr. Doringham.«
Doringham hängte Mantel und Hut an den Kleiderhaken. Neben dem Haken hing an der rosagelben Wand ein mit der Maschine geschriebener Anschlag, der für Freitagabend, neun Uhr, ein Schachturnier ansagte.
Doringham las den Anschlag. Der Picton-Club spielte gegen ein paar junge Studenten ein Spiel mit acht Partien. Als kleiner Spieler nahm Doringham an dem Turnier nicht teil, wohl aber Robert Barrett, ein vorzüglicher Spieler und Vorsitzender der Picton-Mannschaft.
Doringham las die sechzehn Namen. Die Hälfte von ihnen kannte er ebenso wenig wie die der gegnerischen Studenten. Selby spielte mit, aber nicht an erster Stelle. Nicht etwa aus Bescheidenheit, denn trotz seiner Begeisterung für Schach war sein Können auf diesem Gebiet nur gering. Doringham wollte sich gerade abwenden, als sein Auge auf einen anderen Namen fiel. Der Name war ziemlich vertippt, doch Doringham wusste, wer gemeint war. Marcus Wigmore, der Versicherungsagent. Marcus Wigmore war sein Nachbar. Er wohnte mit seiner Frau in einem der kleinen Häuser in der Gilbert Street; keine zweihundert Meter von Doringhams Haus entfernt.
Doringham starrte auf den Namen. Seine grünbraunen Augen wurden wieder nachdenklich. Sein Mund öffnete sich halb, die gelben Zähne wurden sichtbar, und die Zigarette fiel auf den Boden, ohne dass er es merkte.
»Der Rum, Mr. Doringham«, sagte Derek respektvoll.
»Was?... Ja, richtig«, erwiderte Doringham. »Vielen Dank. Trinken Sie auch ein Glas.«
Schwer ließ er sich auf einen Stuhl nieder und starrte auf die Marmorplatte des Tisches. Sein Getränk rührte er nicht an.
Fünf Minuten später kam Robert Barrett über die Wendeltreppe in das Souterrain, den neuesten Schlager der Beatles vor sich hin trällernd. Er trug einen fast weißen, eleganten Regenmantel mit Gürtel. Sein langes dunkles Haar hing ihm beinahe in die dunklen, leuchtenden Augen. Er hatte einen kleinen, dünnen Schnurrbart. Sein Kopf war nass vom Regen.
»Hallo!«, begrüßte er Doringham. »Sie sind der einzige. Herrje! Das Wetter ist nicht besonders einladend.«
Doringham nickte schweigend. Er sah, wie Barrett den Regenmantel auszog, wobei ein brauner, eleganter, auf Taille gearbeiteter Anzug mit übertrieben breiten Schultern zum Vorschein kam. Doringham konnte Barrett nicht ausstehen, er kam ihm vor wie eine Schneiderpuppe, und er hielt ihn für zu feminin. Barrett hatte einen kleinen Radiohandel in der Upper Brooke Street. Er war etwa fünfundzwanzig Jahre alt und sah bestens aus. Ein erfolgreicher Schürzenjäger – wie er selbst betonte. Dabei schlau und gerissen und der beste Spieler des Clubs.
»Was trinken wir? Rum?«, sagte er und setzte sich an Doringhams Tisch. »Derek, zwei Rum. Für mich heiß mit Zitrone.«
»Sofort, Mr. Barrett«, erwiderte Derek.
Barrett blinzelte Doringham an. »Heute bezahle ich – es gibt einen Grund zum Feiern. Hab’ eine neue Gehilfin im Geschäft. Blond ist sie.«
»Du meine Güte! Schon wieder eine? Wie machen Sie das nur?«
»Ganz einfach, Doringham. Frauen gehören dem, der sie sich zu nehmen versteht. Wer sie sich nimmt, den wollen sie auch. Das... ist das ganze Geheimnis. Die Frau will nur fühlen, dass der Mann sie begehrt. Dass dieser Mann alles tut, sie zu besitzen. Das schmeichelt ihrer Eitelkeit. Der Rest ist dann Kinderspiel.«
»Vielleicht haben Sie recht«, erwiderte Doringham.
»Natürlich habe ich recht. Ich habe die üble Angewohnheit, immer recht zu haben.«
Barrett lachte selbstgefällig und entblößte dabei seine regelmäßigen weißen Zähne. Er drehte sich auf seinem Stuhl um, als Derek die Getränke auf den Tisch stellte. »Stimmt’s nicht, Derek? Frauen gehören dem, der sie sich zu nehmen versteht!«
Derek lächelte. »Woher sollte ich das wissen, Sir?«
»Derek ist mit einer Frau gut bedient«, sagte Doringham. »Er betet sie an, Barrett.«
»Meiner Meinung nach ist Liebe eine Frage der Intensität. Oder wie Mr. Wigmore sagt: keine Frage der Quantität. Wenn Mr. Wigmore diese Worte auch nicht in Bezug auf Frauen gesagt hat, so passen sie in diesem Fall doch sehr gut.«
»Richtig, durchaus richtig«, entgegnete Barrett. »Weisheit, Doringham! Wie sie aus dem Mund von kleinen Kindern und Säuglingen tropft.« Er fingerte an seiner seidenen braunroten Krawatte, strich leicht über das Schnurrbärtchen und machte ein romantisch-trauriges Gesicht. »Jedenfalls bekommt der Mensch im Leben das, was er will, vorausgesetzt natürlich, dass er es mit aller Leidenschaft will. Er bekommt, was er will – und der Teufel ist los, wenn er’s hat.« Er seufzte theatralisch.
Derek, der respektvoll neben dem Tisch stand, begann mit schamhaft errötetem Gesicht seine Lebensauffassung zu entwickeln, während Barrett gönnerhaft zuhörte. Doringham aber hörte nicht zu. Wieder war er in seine Gedanken versunken. Und diese Gedanken nahmen immer größere Ausmaße an, füllten ihm Kopf und Herz, glichen einer Gewitterwolke an einem blauen Himmel, die wächst und wächst, bis sie die Sonne ausgelöscht hat. Immer wieder wiederholte er gedanklich Barretts Worte: Der Mensch erhält, was er will, vorausgesetzt, dass er es mit aller Leidenschaft will.
Erst, als ein neuer Gast das Souterrain betrat, erwachte Doringham aus seinem Traum. Der neue Gast war mittelgroß, hager, sein dunkles Haar schon stark angegraut. Er hatte einen schmalen Kopf mit hoher Stirn. Ein Kneifer saß vor seinen Augen, die kalt schienen, in Wirklichkeit aber nur Zurückhaltung verrieten.
Es war der Versicherungsagent Marcus Wigmore. Er trug einen steifen Hut und unter dem schwarzen Mantel ein schwarzes Wolljackett und eine dunkle, gestreifte Hose. Seine Kleidung verriet jene Sorgfalt, die sich immer mit der Armut im Kampf befindet, diesen Kampf aber mutig besteht.
Sein ernstes Gesicht verriet Pedanterie und Gewissenhaftigkeit. Ein guter Beamter, dem man aber keine große Verantwortung aufbürden konnte. Die langen schmalen Hände wiesen Flecken auf, die von Chemikalien herrührten. Der hagere Hals mit dem vorspringenden Adamsapfel ragte aus einem weißen Kragen hervor. Wie ein Dorfschulmeister sah Wigmore aus. Oder aber wie ein Künstler, der sein Ziel nicht erreicht hat. Man erzählte, er würde Violine spielen und sich mit Chemie beschäftigen. Verlegen lächelnd näherte er sich den anderen und zog seinen Mantel aus. Er war ein einsamer Mensch, der sozusagen Angst vor seinesgleichen hatte und am liebsten allein war. Er hatte das fahle Lächeln eines Priesters und trug papierne Schutzmanschetten.
»Wigmore kann uns am besten über Frauen Auskunft geben«, rief Barrett. »Er ist der Byron von Nord-London. Sagen Sie uns, wie man bei den Frauen Erfolg hat, Wigmore!«
Wigmores eingefallene Wangen röteten sich, während er den Mantel aufhängte. Er lächelte unsicher und hustete verlegen. »Auf diesem Gebiet kenne ich mich kaum aus. Wie Mr. Johnson bin auch ich glücklich verheiratet... und ich stehe in gewisser Weise sogar unter dem Pantoffel.« Er setzte sich auf einen Stuhl, der etwas abseits des Tisches stand, und begrüßte Doringham mit einer linkischen Verbeugung.
»Davon glaube ich kein einziges Wort«, entrüstete sich Barrett. »So sehen ausgerechnet Sie aus! Was meinen Sie, Doringham? Ich wette, unser Freund hat irgendwo eine feurige Geliebte versteckt. Sehen Sie, seine Augen funkeln geradezu hinter dem Kneifer, und das passt wenig zu seiner Leichenbittermiene.«
Doringham knurrte.
Wigmores Gesicht wurde noch röter. Er war nicht dumm und fühlte deutlich den Spott hinter Barretts Worten. Sein ganzes Leben lang war Wigmore für Menschen wie Barrett die Zielscheibe ihres Spottes gewesen. In der Schule hatte es angefangen. Später dann im Büro und anderswo, immer wieder war er für die gefühllosen Dummköpfe der Gegenstand beleidigenden Spotts gewesen.
»Ich glaube, Mr. Barrett«, erwiderte er zögernd, »Sie verwechseln mich mit sich selbst. Sie selbst sind doch der Byron unseres Kreises. In meinem Alter überlasse ich Liebesaffären gern Jüngeren.«
Jack Selby, der inzwischen das Souterrain betreten und Wigmores Worte gehört hatte, lachte laut. »Das hat gesessen, Mr. Barrett«, sagte er. »Lassen Sie ihn doch reden, Mr. Wigmore. Er hält Angriff für die beste Verteidigung. Er macht Jagd auf alle Mädchen in unserem Viertel. Jede Woche eine andere Aushilfe! Stimmt’s etwa nicht, Mr. Barrett?«
»Nicht jede Woche. Vielleicht alle neun Monate«, entgegnete Barrett lachend.
Wigmores Gesicht wurde puterrot. Er hustete und stotterte dann: »Zweifellos ein sehr interessantes Gespräch. Aber wie wär’s mit einer Partie Schach? Deshalb sind wir doch hier.« Während er das sagte, zog er ein Taschentuch, das nach Eukalyptus roch, aus der Tasche und betupfte sich damit die Nase.
»Sind Sie erkältet?«, fragte Derek besorgt.
Wigmore nickte. »Hoffentlich habe ich mich nicht zu früh vor die Tür gewagt«, murmelte er.
»Ein paar Tropfen Jod in ein Glas Milch«, sagte Derek. »Meine Frau behauptet...«
»Los«, unterbrach ihn Jack Selby. »Wir wollen beginnen. Ich schlage vor: Barrett spielt gegen Mr. Wigmore und ich gegen Mr. Doringham. Vielleicht komme ich zum Zug und nehme ihm einen Bauern.«
»Und ich Mr. Barrett einen Springer«, sagte Wigmore. »Aber selbst dann kann ich nicht an ihn heran.«
»Gut«, erwiderte Barrett. »Was zu trinken, Derek. Mr. Wigmore trinkt vermutlich wie gewöhnlich eine Tasse Tee...«
Charles Doringham stand auf und nahm Mantel und Hut vom Haken. »Ich muss gehen«, sagte er. »Habe noch eine Verabredung.«
Zweites Kapitel
In seinem Arbeitszimmer im ersten Stockwerk des kleinen Hauses saß Marcus Wigmore an dem Schreibtisch, den er billig auf einer Auktion gekauft hatte. Eine kleine Leselampe warf ihr Licht auf den Tisch, während das Zimmer selbst in vagem Dunkel blieb. Der Fußboden war kahl bis auf einen kleinen Teppich vor dem alten elektrischen Ofen, der nur wenig Wärme spendete.
In einer Ecke des Zimmers befanden sich eine Bank und ein Ausguss. Auf der Bank standen ein paar einfache chemische Apparate. Einige Bücherregale mit vielen Büchern verrieten die Vielfältigkeit seiner Interessen. Neben ein paar hundert billigen Klassikerausgaben von Shakespeare, Shelley, Montesquieu, ebenso populärwissenschaftliche Bücher über Chemie, Wirtschaftslehre, Versicherungswesen, Schach und Musik.
Wenn ich auch nicht studiert habe, sagte Wigmore oft zu seiner Frau, so darf ich doch einen gewissen Grad von Bildung für mich in Anspruch nehmen.
Jetzt, um sechs Uhr abends, verbrachte er eine der glücklichsten Stunden seines ruhigen Lebens. Geistige Neugierde, die harmloseste und beständigste Leidenschaft des Menschen, beherrschte ihn. Wissensdurst und Fortbildung waren Wigmores Ideale.
In diesem Augenblick blätterte er in seinem Tagebuch vom vergangenen Jahr und las dabei mehr seine Bemerkungen über gelesene Bücher als seine Eintragungen über ganz persönliche Dinge. An seinem Ellbogen stand eine Flasche mit Eukalyptus, an der er dann und wann roch. Manche seiner Eintragungen, die er vor mehreren Monaten gemacht und schon halb vergessen hatte, bereiteten ihm besondere Freude:
Augenscheinlich ist alles ständigem Wandel unterworfen. Die Härte des Stahls verändert sich stündlich. Alle sechs Stunden wandeln sich kalte Metalle wie Ebbe und Flut.
Höchstwahrscheinlich würde eine Schiffsschraube am Bug viel wirkungsvoller arbeiten als am Heck.
Hennen, deren Futter kein Mangan enthält, vernachlässigen ihre Küken.
Die Geschichte über Epiktet, der von seinem Herrn gefoltert wurde, ist großartig. Der Philosoph und Sklave sagte: »Wenn du so weitermachst, brichst du mir noch das Bein.« Etwas später sagte er mit ruhigem Lächeln: »Ich habe gleich gesagt, dass du mir das Bein brechen würdest.«
Marcus Wigmore nahm seinen Kneifer ab und putzte die Gläser mit dem Taschentuch. Das war die einzige richtige Haltung dem Leben gegenüber. Alles existierte nur im Geist. Wer seinen Geist beherrschte, beherrschte auch seine Gefühle und Launen, wurde auf diese Weise Herr des Lebens. Der wahrhaft vernünftige und moderne Mensch war beinahe ein Gott.
Ein paar Minuten lang blickte Wigmore mit abwesenden Augen in den dunklen Raum. Nicht immer hatte er seinen Geist wirksam beherrscht. Heute Morgen z. B. war er einer alten Frau gegenüber sehr ungeduldig geworden, die mit der Ausfüllung der Versicherungsformulare nicht fertig werden konnte. Als Barrett sich gestern Abend im Schach-Club über ihn lustig machte, hatte er gereizt geantwortet, anstatt ihn einfach zu überhören.
Er sah wieder in das Tagebuch, las, blätterte weiter:
Thalia erinnerte mich gestern an unseren zwanzigsten Hochzeitstag. Sie war mir immer eine gute Frau. Hoffentlich war ich ihr ein ebenso guter Gatte. Im Großen und Ganzen sind wir gut miteinander ausgekommen. Wir verstehen uns gut, wie Kameraden. Seltsam, dass wir die gleichen Neigungen haben: Musik, gute Bücher und Interesse an wissenschaftlichen Dingen. Wenn sie Schach spielen könnte, wäre sie vollkommen.
Während Wigmore vor sich hin sinnierte, wurde die Tür geöffnet, und Thalia Wigmore trat ein. Sie war eine kleine zierliche Frau, mit grauem Haar, das etwas mädchenhaft frisiert war. Sie war fünfundsechzig Jahre alt und fast ein Jahr älter als Marcus. Sie trug ein dunkles Kleid mit Spitzenbesatz an den Ärmeln und dem Halsbörtchen. Über ihren Schultern hing ein alter Regenmantel. Mrs. Wigmore blieb auf der Türschwelle stehen.
»Marcus«, sagte sie. »Hast du noch viel zu tun?«
»Ja«, erwiderte Wigmore. »Ich versuchte gerade festzustellen, ob du die vollendete, ideale Ehefrau bist.«
Das friedliche Vogelgesicht der Frau errötete. »Und zu welchem Schluss ist mein Herr und Gebieter gekommen?«, fragte sie.
»Nach gründlicher Prüfung habe ich festgestellt, dass zu deiner Vollkommenheit nur eines fehlt: das Schachspiel.«
»So ein Unsinn.«
»Siehst du! Eine sehr bedauerliche, ja fast frivole Äußerung. Du bezeichnest das königliche Spiel als Unsinn. Schade, sehr schade. Aber...«, er lächelte milde, »weshalb trägst du meinen alten Regenmantel?«
»Als ich die warme Küche verließ, fror ich. Im Flur hing dein Mantel. Ich glaube, du hast mich angesteckt, Marcus... Aber wollen wir nicht ein wenig musizieren? Ich habe im Salon den Gas-Ofen bereits angezündet.«
»Ja, ein halbes Stündchen Musik wäre mir schon recht«, erwiderte er. »Dann muss ich in den Club zum Turnier.«
»Vor einer Stunde brauchst du nicht zu gehen. Vergangenen Sonntag spielten wir das Duett von Adés. Es klappte schon einigermaßen.«
»Du spielst viel besser als ich«, erwiderte Marcus. »Hättest du mehr geübt, wäre aus dir ohne Zweifel eine große Künstlerin geworden.« Er klopfte seiner Frau liebevoll auf die Schulter.
Aus dem Regen war feuchter Nebel geworden, der die Straßenlampen und erhellten Fenster der Häuser mit einem schmutzigen Schleier verhängte und den Straßenlärm dämpfte.
Charles Doringham liebte solches Wetter. Es passte zu seinen Plänen und schien ein gutes Omen zu sein. Er trug eine Lederjacke, wie man sie oft bei Taxi-Fahrern sieht. Er schob ohne jede Hast und geräuschlos ein Fahrrad durch die stille und einsame Gilbert Street. Er hatte kein Licht am Rad, dafür aber eine Taschenlampe in der Tasche, die genügte, falls er fahren würde.
Als er etwa die Hälfte der Straße hinter sich hatte, kam er an Wigmores Haus vorbei; ein zweistöckiges Haus, mit kleinem Vor- und Hintergarten. Ein fortschrittlicher Architekt hatte kurz nach dem Ersten Weltkrieg diese Häuser gebaut. Sie stellten den Versuch dar, den Leuten das zu verschaffen, was sie sich ersehnten: ein kleines Haus gegen eine tragbare Miete. Und das Experiment war einigermaßen geglückt. Die Tatsache, dass diese Häuser keines Hausmeisters bedurften, war ein Anreiz mehr.
Während Doringham an Wigmores Haus vorbeiging, hörte er Klavier- und Geigenspiel. Die Jalousien vor dem Fenster des Frontzimmers waren nicht ganz geschlossen. Doringham blieb einen Augenblick stehen, beugte sich über den Gartenzaun und erkannte Thalia Wigmores eisgraues Haar. Die Violine unter das Kinn geklemmt, stand Wigmore mit ernstem Gesicht vor dem Notenständer.
Doringham grinste.
»Der Maestro«, murmelte er. »Das Universal-Genie, das alles kann, Ingres, Einstein und schließlich Marcus Wigmore.«
Er ging weiter bis an das Ende der Straße. Dann verlangsamte er seine Schritte. Vorsichtig blickte er um sich. Er hielt vor einer Fernsprechzelle. In der Zelle brannte kein Licht. Seit drei Tagen schon war die Beleuchtung nicht in Ordnung. Anfangs noch ein Flackern, seit gestern aber auch das nicht mehr.
Doringham war zufrieden, die stille Straße ganz für sich zu haben. Er lehnte sein Fahrrad gegen die Zelle, dann betrat er sie. Er warf eine Münze ein, nahm den Hörer ab und rief das Amt an. Kurz darauf antwortete eine unpersönliche Frauenstimme.
Doringham sprach mit verstellter Stimme. Seine natürliche Stimme war seltsam hoch und passte in keiner Weise zu seiner massigen Gestalt. Jetzt aber sprach er tief und mürrisch. Er simulierte Ungeduld, die fast an Ärger grenzte.
»Ich spreche von einer öffentlichen Fernsprechzelle aus«, sagte er. »Ich bekomme die gewünschte Nummer nicht. Es handelt sich um den Anschluss Kings Observatorium 3581. Könnten Sie mich verbinden?«
»Haben Sie die Münze eingeworfen?«
»Selbstverständlich. Ich telefoniere ja nicht zum ersten Mal...«
»Von welcher Nummer aus sprechen Sie?«
»Gilbert Street 1627.«
»Haben Sie auf den Knopf gedrückt?«
»Auch das. Alles umsonst. Bitte geben Sie mir schnell die Verbindung. Die Lichtleitung in der Zelle funktioniert nicht. Ich komme mir vor wie in einem Sarg...«
»Einen Augenblick, bitte«, erwiderte die Frau. »Ich gebe Ihnen die gewünschte Nummer.«
Doringham grinste. Kurz darauf war er mit dem Limelight verbunden. Derek Johnson war am Apparat.
Doringham sprach immer noch mit verstellter Stimme; stundenlang hatte er es geübt.
»Hallo«, sagte Doringham mürrisch. »Bin ich mit dem Café Limelight verbunden? In dem der Schach-Club tagt?«
»Ja«, erwiderte Derek.
»Ich möchte Mr. Wigmore – Mr. Marcus Wigmore – sprechen. Ist er bei Ihnen?«
»Nein. Noch nicht. Aber er wird bald kommen. Vielleicht rufen Sie noch einmal an...«
»Ausgeschlossen. Könnten Sie ihm vielleicht eine Nachricht hinterlassen?«
»Selbstverständlich. Ich habe Bleistift und Papier zur Hand. Vielleicht hole ich besser den Chef an den Apparat...«
»Ist nicht nötig. Die Nachricht ist ganz einfach. Ich heiße Asagara. Haben Sie mich verstanden? Ich buchstabiere den Namen.«
Doringham buchstabierte den Namen. Derek wiederholte ihn, zuerst falsch, dann richtig.
»Gut, und nun meine Adresse«, fuhr Doringham fort. »Portsea Street 25a. Ich wiederhole und buchstabiere die Adresse.«
Er tat es. Derek, der die Adresse aufschrieb, wiederholte sie richtig.
»Bestellen Sie bitte Mr. Wigmore«, sprach Doringham weiter, »er möchte morgen Abend um halb acht zu mir kommen. Ich möchte gern mit ihm ein Geschäft besprechen und nach Möglichkeit gleich zum Abschluss bringen.«
»Wahrscheinlich eine Versicherung«, erwiderte Derek. »Aber vielleicht ist es doch richtiger, Sie rufen in zwanzig bis dreißig Minuten noch einmal an. Dann ist Mr. Wigmore bestimmt hier. Jeden Freitagabend veranstaltet der Schach-Club ein Turnier...«
»Geht leider nicht. Richten Sie bitte die Nachricht aus. Ich habe das Haus voller Gäste. Meine Tochter feiert ihren einundzwanzigsten Geburtstag... Ich erwarte also Mr. Wigmore morgen um halb acht in der Portsea Street 25a.« Er hängte den Hörer ein.
Als Doringham die Fernsprechzelle verlassen hatte, zog er ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche seiner Lederjacke. Er nahm eine Zigarette zwischen die Lippen, zündete sie aber nicht an.
Er hörte, wie im unteren Teil der Straße eine Tür geschlossen wurde. Er erkannte eine hagere Gestalt in Regenmantel und steifem Hut. Dann vernahm er ein Hüsteln.
Doringham bestieg das Fahrrad und fuhr in Richtung auf die Micawber Street davon.
Doringham stieg vom Rad, steckte die Taschenlampe, die er statt einer Fahrradlampe benutzt hatte, ein und trug das Fahrrad ins Limelight. Im Erdgeschoss war niemand. An der Theke ein Anschlag: Heute Abend geschlossen.
Er schob das Rad in die Toilette auf der Hinterseite des Cafés und ließ es dort stehen. Dann begab er sich in das Souterrain.
Hier war schon alles für das Schachturnier vorbereitet. Auf acht Tischen standen acht Schachbretter. Hinter der Theke arbeitete Derek. An dem Tisch neben der Theke saßen fünf Studenten mit Selby beim Glas Bier. Jack Selby erzählte ihnen gerade, wie er, nur mit einem Stuhlbein bewaffnet, in Buenos Aires eine Bar von unliebsamen Gästen geräumt hatte. Die Studenten hörten Selby mit feierlicher Höflichkeit zu. Sobald Selby aber den Blick wandte, blinzelten sie sich ungläubig an.
Doringham zog die Lederjacke aus und hängte sie an den Haken. Er nickte Selby zu, ging an die Theke und bestellte ein Glas Rum.
Derek begrüßte den Gast und goss das Getränk ein.
»Haben Sie Mr. Wigmore gesehen?«, fragte Derek.
»Nein«, erwiderte Doringham.
»Ich habe eine Nachricht für ihn. Ich dachte, Sie hätten ihn vielleicht unterwegs getroffen. Eine wichtige Nachricht.«
Doringham schüttelte den Kopf. »Er wird schon noch kommen. Heute ist doch Turnier. Da fehlt er nicht.«
»Bestimmt nicht«, erwiderte Derek.
»Sie haben also eine wichtige Nachricht für ihn?«, fragte Doringham mit gleichgültiger Stimme.
»Ja, von einem gewissen Mr. Asagara. Vor ein paar Minuten hat er angerufen.«
Doringham zuckte mit den Schultern.
Ein neuer Gast kam die Wendeltreppe herunter, nickte Selby, der den Studenten immer noch seine Räubergeschichten erzählte, zu und ging an die Theke. Er war klein, gedrungen und hatte ein blasses Gesicht. Er wirkte auf beiläufige Art wohlhabend, wenn der Ausdruck seines Gesichts auch eher traurig war. Er war viel besser gekleidet als die meisten Gäste des Lokals, was auf ein gutes Einkommen schließen ließ. Trotz seines traurigen Gesichts ging etwas Selbstbewusstes von ihm aus. Er nahm den steifen Hut ab und zog den lederfarbenen Mantel aus. Sein Kopf war kahl, dafür aber hatte er einen dichten schwarzen Schnurrbart. Doringham kannte ihn. Er war der Juwelier Alfred Praed vom Gloucester Square.
»Welche Ehre!«, sagte Doringham. »Lassen Sie sich auch mal wieder sehen?«
Praed lächelte traurig. »Das Leben wird immer schwerer«, sagte er. »Man ist nicht mehr Herr seiner selbst. Kann abends kaum noch das Haus verlassen. Guten Abend, Derek. Geben Sie mir einen Cognac. Und für Mr. Doringham noch einen Rum.«
Er legte Hut und Mantel auf einen Stuhl, zog ein ledernes Zigarrenetui aus der Tasche und bot Doringham eine Zigarre an.
»Barrett hat mich gebeten, ihn heute Abend zu vertreten. Hat auch die Grippe. Scheußlich. Hals, Augen, Ohren, alles wird in Mitleidenschaft gezogen. Barrett hat dazu noch Neuralgie und Bindehautentzündung. Grauenhaft.«
»Ich kenne das«, erwiderte Doringham. »Vor vier Wochen hatte es mich auch erwischt. Zum Wohl!«
Praed nickte und hob sein Glas. »Was stellen sich diese Wissenschaftler eigentlich vor?«, sagte er gereizt. »Untersuchen unsere Nahrungsmittel, machen Atomversuche und denken wunder was sie täten. Aber gegen Erkältungen und Grippe vermögen sie nichts. Influenza. Das ist ja wohl die wissenschaftliche Bezeichnung. Sollte mich gar nicht wundern, wenn sie uns, wie im Mittelalter, mit Schröpfköpfen und Aderlass behandelten.«
»Das geschieht doch bereits.«
Doringham lachte laut, während Praed die Lippen zu einem Lächeln verzog. »Passt mir gar nicht, dass ich heute Abend Barrett vertreten soll«, stellte er klar. »Aber ich konnte nicht ablehnen. Ich als mittelmäßiger Spieler soll unseren Könner vertreten! Das gibt einen furchtbaren Reinfall. Seit Monaten habe ich nicht mehr gespielt und das bisschen, das ich konnte, längst wieder vergessen.«
»Reden Sie doch nicht«, entgegnete Doringham. »Sie sind doch einer unserer Cracks. Ein Spieler wie Sie vergisst so leicht nicht, was er kann. Ja, wenn ich...« Er sprach nicht weiter. Er vernahm Schritte hinter sich. Er drehte sich um und sah Marcus Wigmore, dessen kalte, starre Augen ihn durch den Kneifer gleichgültig ansahen.
»Guten Abend, meine Herren«, sagte Wigmore. »Guten Abend, Mr. Johnson. Bringen Sie mir bitte eine Tasse Kaffee. Hoffentlich bin ich nicht zu spät dran. Ich bin nämlich zu Fuß gekommen.«
»Wie wär’s, wenn wir beide zusammen eine Partie spielten?«, sagte Doringham.
Marcus Wigmore sah ihn überrascht an. »Leider nicht möglich. Ich spiele beim Turnier mit, das gleich beginnt.«
Drittes Kapitel
Derek schob ein Glas mit Milchkaffee über die Theke.
»Ihr Kaffee, Mr. Wigmore«, sagte er. »Ich habe eine Nachricht für Sie. Von einem Mr. Asagara.«
»Von wem?«, fragte Wigmore.
Praed lächelte.
»Ein Name. Die Telefonnummer wäre einfacher.«
»Eine wichtige Nachricht«, fuhr Derek fort. »Ich glaube, es handelt sich um eine Versicherung.« Er zog einen Zettel aus der Tasche. »Er wohnt in der Portsea Street 25a. Er möchte morgen Abend um halb acht das Geschäft mit Ihnen besprechen.«
Wigmores dünne Brauen zuckten in die Höhe. »So? Wann rief der Herr an?«
»Vor etwa einer halben Stunde«, antwortete Derek.
»Wollte er noch mal anrufen, als er hörte, dass ich nicht hier war?«
»Nein, Mr. Wigmore, Ich habe es ihm natürlich vorgeschlagen. Ich habe ihn auch gebeten, mit Mr. Selby zu sprechen. Aber Mr. Asagara hatte es sehr eilig. Ich habe ihm dann noch einmal vorgelesen, was ich notiert hatte, und ihm versprochen, die Nachricht weiterzugeben.«
»Schwindel«, sagte Praed. Er seufzte. »Das Leben ist nun einmal so. Nichts als Schwindel und Betrug.«
»Irgendwie auffallend ist die Sache schon«, erwiderte Wigmore. »Ich kenne den Herrn nicht. Seinen Namen höre ich heute zum ersten Mal. Weshalb rief er nicht noch einmal an?«
»Weil er das Haus voller Gäste hat«, erwiderte Derek. »Seine Tochter feiert ihren einundzwanzigsten Geburtstag.«
»Geben Sie mir bitte den Zettel, Mr. Johnson.«
Derek reichte Wigmore den Zettel. Wigmore putzte seinen Kneifer mit dem Taschentuch und machte ein ernstes Gesicht, während er den Zettel las. Er murmelte den Namen Asagara vor sich hin.
»Seltsamer Name«, sagte er. »Klingt irgendwie orientalisch.« Er sah Praed an.
»Brauchen mich dabei nicht anzusehen«, sagte Praed lächelnd. »Ich habe den Namen noch nie gehört. Aber das besagt natürlich nichts. Man hört so viele Namen. Ich kenne einen Mann, der Theater heißt, und eine alte Dame, die sich allen Ernstes Uremia nennt. Wahrscheinlich hat sich jemand einen üblen Scherz erlaubt. So was kommt leider öfter vor. Man sollte solche Kerle kurzerhand aufhängen. Sie stellen das Gemeinste dar, was auf Gottes Erde herumläuft.«
Er leerte sein Glas. »Wollen noch schnell einen kippen«, fügte er hinzu. »Ehe das Turnier beginnt.«
Derek brachte einen Rum und einen Cognac, Wigmore aber bestellte nichts.
»Ich hatte nicht den Eindruck, dass der Herr sich einen üblen Scherz erlaubte«, sagte Derek. »Im Gegenteil. Er sprach ganz wie ein Geschäftsmann mit viel Geld.«
»Wäre schon möglich«, sagte Doringham zu Wigmore. »Wozu lange überlegen? Vielleicht handelt es sich um ein gutes Geschäft. Vielleicht will der Mann eine Aussteuerversicherung abschließen. Und Sie bekommen doch Ihre Prozente.«
»Ja, zwanzig Prozent«, erwiderte Wigmore. »Ich lasse mir nicht gern ein Geschäft entgehen. Andererseits möchte ich aber auch niemandem auf den Leim kriechen. Mich macht nur der Name stutzig.«
»Wieso stutzig?« entgegnete Doringham. »Praed hat uns eben zwei Namen genannt, die viel seltsamer sind. Denken Sie mal nach. Sie kennen sicher Namen, die ausgefallener sind als Asagara.«
»Vielleicht haben Sie recht«, gab Wigmore zu. »Aber ich erinnere mich keines Namens, der für mich so... so abwegig klingen würde. Ich habe den Namen noch nie gehört. Oder hat einer der Herren ihn gehört? Kennen Sie den Namen, Mr. Praed?«
»Wie gesagt: nein.«
»Und Sie, Mr. Doringham?«
»Ja.«
»Wirklich?«
»Ja – so weit ich mich entsinne, ist es ein indischer Name.«
»Ja«, entgegnete Wigmore, »dann sähe die Sache schon etwas anders aus. Wenn es einen Asagara gibt, dann brauchen wir ihn nicht zu erfinden. – Aber noch eins«, fügte er hinzu. »Wo ist die Portsea Street, die als Adresse angegeben wurde?«
»In Spitalfields«, entgegnete Praed.
Doringham nickte. »Aus naheliegenden Gründen bin ich oft im Spitalfields gewesen. Vornehme Gegend, Wigmore. Vielleicht winkt Ihnen ein gutes Geschäft.«
In diesem Augenblick kamen zwei Studenten die Treppe herunter. Sie hatten sich verspätet. Ihretwegen hatte das Turnier noch nicht begonnen. Jack Selby erhob seine gewaltige Stimme.
»Meine Herren, die Kämpfer sind versammelt. Die Schlacht kann beginnen. Unsere Gäste mögen dem Kellner sagen, was sie zu trinken wünschen. Also los, meine Herren. Den besten Spielern winkt die Trophäe!«
Zweieinhalb Stunden später war das Turnier beendet. Die Studenten hatten gesiegt und verließen triumphierend das Schlachtfeld. Fünf aus der geschlagenen Mannschaft waren bereits aufgebrochen, nur Praed, Wigmore, Selby und Doringham hatten bei Derek noch ein letztes Glas bestellt.
Man sprach über das Turnier, über die Gesamt- und Einzelleistungen. Marcus Wigmore hatte gewonnen. Sein blasses Gesicht glühte, und seine Augen funkelten hinter dem Kneifer vor Freude. Man beglückwünschte ihn; nur drei vom Picton-Club hatten ihren Gegner geschlagen. Praed war mit einem Unentschieden davongekommen.
»Barrett hätte sich nicht von mir vertreten lassen sollen«, sagte er, »wenn er gespielt hätte, wären wir die Sieger.«
»Die Studenten haben gut gespielt«, sagte Selby.
»Nicht weiter verwunderlich«, bemerkte Praed. »Als ich siebzehn Jahre alt war, spielte ich blind.«
»Wigmore hat vorzüglich gespielt«, fiel Doringham ein.
Wigmores Gesicht rötete sich noch mehr. »Ich habe Glück gehabt«, wehrte er ab. »Aber ich freue mich natürlich, dass ich gewonnen habe. Wenn ich verliere, liege ich die ganze Nacht wach und überlege, wie es zu dieser Niederlage kommen konnte. Aber trotzdem werde ich auch heute Nacht nicht gut schlafen. Ich habe zu viel Kaffee getrunken und zu viel geraucht.«
Praed, den das Gespräch über das Turnier zu langweilen begann, wechselte das Thema. »Jack«, sagte er zu Selby. »Sie kennen doch die ganze Welt, wie Odysseus haben Sie viele Menschen und Städte kennengelernt.« Er blinzelte Doringham zu. »Ist Ihnen während Ihrer Reise jemals der Name Asagara begegnet?«
Selby machte ein nachdenkliches Gesicht und fuhr sich mit der Hand durch den weißen Haarschopf.
»Einen Augenblick... Ja. Mit einem Asagara bin ich mal zur See gefahren. Ich glaube, er war Inder. Ich fuhr damals als blinder Passagier auf einem britischen Frachter, der zwischen London und Bombay verkehrte. Hatte auf der Hinfahrt Gefrierfleisch geladen, auf der Rückfahrt Eier. Verdammt gute Eier. Darüber weiß ich Bescheid. Ich arbeitete als Koch in der Kombüse. Zwei Jahre waren die Eier alt – schmeckten aber, als wären sie gestern frisch gelegt. Habe ich von dieser Reise noch nicht erzählt? Die Mannschaft bestand nur aus Chinesen, und auf der Heimfahrt meuterte das Gesindel. Ich war...«
»Die Geschichte kennen wir, Jack«, unterbrach ihn Praed. »Aber wenn die Mannschaft aus Chinesen bestand und das Schiff britisch war, wie kam der Inder dann an Bord?«
»Dieser Asagara war in England aufgewachsen«, erwiderte Selby. »Ein guter Ingenieur, der lange auf dem Clyde fuhr.«
»Dann wäre ja alles klar«, entgegnete Praed. »Ich gehe nach Hause. Es ist schon spät.«
»Ich auch«, sagte Wigmore.
»Ich ebenfalls«, sagte Doringham. »Wir gehen zusammen, Wigmore, die frische Luft wird uns guttun.«
Die drei Männer verließen gemeinsam das Café. Doringham erwähnte nicht sein Fahrrad, das in der Toilette im Erdgeschoss stand. Er würde es morgen abholen. Vielleicht war es besser, dass niemand wusste, dass er per Rad ins Limelight gefahren war.
Der Nebel war inzwischen noch dichter geworden. Aber es regnete nicht mehr. In der Bathurst Street sah Praed ein Taxi und rief es zu sich.
»Soll ich Sie ein Stück mitnehmen?«, fragte er. Aber Doringham und Wigmore wollten lieber die frische Luft genießen.
»Was halten Sie von diesem geheimnisvollen Asagara?«, fragte Wigmore seinen Begleiter, als sie allein waren. »Selby kannte den Namen natürlich ebenso wenig wie ich. Sie jedoch... kennen ihn?«
»Ja, ich habe ihn mal gehört«, antwortete Doringham. »An Ihrer Stelle würde ich mir das Geschäft nicht entgehen lassen. Vielleicht eine hohe Versicherung, bei der...«
»Bei hunderttausend Pfund fielen für mich zwanzigtausend ab.«
»Hunderttausend Pfund«, sagte Doringham langsam. »Damit könnte man schon allerlei anfangen.«
»Ja. Aber ich bekäme ja nur eine Provision von zwanzigtausend. Wenn ich sie nur schon hätte...«
»Ja.«
»Kommen Sie doch noch mit rein, Mr. Doringham. Meine Frau würde sich sicher sehr freuen.«
»Nein, danke. Heute Abend nicht...« Er schüttelte den Kopf und wiederholte: »Hunderttausend Pfund. Damit könnte man schon allerlei anfangen.«
Viertes Kapitel
Es war ein herrlicher Abend. Die milde Brise ließ eher an August als an November denken. Fern, kalt und anmutig funkelten die Sterne.
Charles Doringham stand etwa dreißig Meter von Wigmores Haus entfernt auf der anderen Seite der Straße. Er trug seine Lederjacke, dazu eine Schirmmütze und einen seidenen Schal um den dicken roten Hals. Seine Finger spielten mit einem Päckchen Zigaretten in der Tasche, aber er zündete sich keine Zigarette an. Dann und wann kam jemand durch die Straße. Ein Familienvater, der noch ein wenig ausging, ein Laufbursche, der Waren ablieferte. Dann drehte Doringham sich um, ging weiter und blieb bewegungslos im Dunkel einer Platane stehen.
Es war Samstagabend, kurz nach halb sieben. In der Straße, die eine reine Wohnsiedlung war, herrschte mehr Verkehr als sonst. Doringham verfluchte diese Belebtheit der Straße, zu der das schöne Wetter viel beitrug. Ein Milchjunge ging an ihm vorbei. Er kannte den Jungen, schon oft hatte er mit ihm gesprochen. Doringham hielt sich im Dunkeln und sah, wie der Junge bei Wigmores klingelte. Ein Licht erschien in der bisher dunklen Hausfront. Thalia Wigmore nahm die Milch in Empfang und sprach mit dem Jungen ein paar Worte. Was sie sagte, konnte Doringham nicht hören. Aber sie sprach ganz wie eine feine Dame. Doringham lächelte höhnisch.
Doringham hasste diese Spießer und ihr Getue, das ihre erbärmliche Existenz nicht zu verbergen vermochte. Sie musizierten im Salon, redeten von Weiterbildung und Kultur und versuchten, eine Gesellschaftsklasse nachzuahmen, die für sie nur Hohn und Verachtung hatte. Diese kleinbürgerlichen Mätzchen waren nicht nur albern, sie waren auch ein Verrat am Volk. Apathische Hinnahme von Armut und Mittelmäßigkeit – auf die man obendrein noch stolz war. Damit leistete man der sozialen Ungerechtigkeit nur Vorschub. Ja, Gesetz und Moral, daran glaubten diese Wigmores.
Aber Charles Doringham tat das nicht. Er wollte heraus aus all dem. Der kleine Casanova Robert Barrett hatte gesagt, die Frauen gehörten dem, der sie sich zu nehmen wüsste. Welch ein Unfug! Aber vielleicht enthielten diese Worte doch ein Körnchen Wahrheit. Geld und Macht gehörten dem, der es verstand, sie sich anzueignen. Und zu Geld gehörten auch Frauen – und alles andere, ob mit oder ohne moralische Gesetze. Dieses Naturgesetz vermochten alle Wigmores der Welt nicht zu erschüttern...
Dieser Marcus Wigmore, der jeden nur mit Sir anredete! Sogar den jungen Kellner! Wigmore mit seinem pedantischen Gerede über Chemie und so weiter... Der Geige spielte und den Stoiker gab, verlegen hüstelte, nur dunkle Anzüge und verschlissene Hemden trug; der rot wurde, wenn mal von Frauen die Rede war. Welch edler Mensch! Wie vernünftig und ausgeglichen, kalt und alles wissenschaftlich analysierend. Kein Wunder, dass England ein Slum geworden war, in dem die Menschen wie die Insassen eines Arbeitshauses gehorchen mussten. Den Wigmores mochte das gefallen. Sie erfüllten ihre Pflichten der Gesellschaft gegenüber. Und wenn der Reiche sie anspuckte, dann verbeugten sie sich und sagten: »Dankeschön, Sir.«
Die Welt ist und bleibt ein Haufen Dreck. Weshalb liebt der Wolf die Schafe? Je mehr Schafe, desto besser für den Wolf. So musste man das betrachten. Man musste sich selbst seine Gesetze schaffen. Und wenn die Umstände unerträglich wurden, weg damit. Aber dazu musste man gewisse Schritte unternehmen. Und diese Schritte konnten sehr gefährlich werden, wenn man nicht aufpasste und sich erwischen ließ. Aber angenommen...
Doringham erwachte aus seinen Gedanken, denn wieder erschien Licht in Wigmores Haus. Marcus und Thalia standen im Hauseingang.
»Länger als zwei bis drei Stunden wird’s nicht dauern. Wenn du müde bist, geh zu Bett«, sagte Wigmore zu seiner Frau.
Thalias Entgegnung hörte Doringham nicht. Marcus betrat die Straße, das Licht im Hausflur erlosch, die Tür wurde geschlossen.
Marcus entfernte sich mit schnellen Schritten. Doringham beobachtete ihn aus dem Dunkel heraus. Unter dem Arm trug Wigmore eine dicke Aktenmappe, die sicher alle für eine Versicherung notwendigen Formulare enthielt.
Doringham lächelte und sah auf die Armbanduhr mit dem Leuchtzifferblatt. Sechs Minuten nach sieben. Wigmore war auf dem Wege nach Spitalfields, in dem es keine Portsea Street gab.
Plötzlich verschwand das Lächeln von Doringhams Gesicht, das eine starre, seelenlose Maske wurde. Er zitterte am ganzen Leib. Er streckte die Hände aus und hielt sich an der feuchten, rauen Rinde der Platane fest. Eine Stimme in seinem Innern schien ihm zuzuraunen: Du kannst jetzt gehen. Was bisher geschah, ist alles sehr harmlos. Ein Anruf, der als Scherz gedeutet werden kann. Noch hast du alles in der Hand. Nichts Unwiderrufliches ist geschehen. Du bist immer noch Charles Doringham, ein ungeschliffener Diamant, aber ein guter Genosse bei Trank und Spiel. Du bist immer noch ein Mensch unter Menschen. Aber wenn du jetzt die Straße überquerst, auf die Klingel drückst, dann wirst du ein anderer Mensch. Und trotz all deiner Schlauheit weißt du nicht, was dieser Wandel für dich bedeutet.
Sekunden oder Minuten, die ihm wie Stunden oder Tage vorkamen, umklammerte Charles Doringham zitternd den Baum. Dann war der Anfall vorüber. Er biss die Zähne zusammen; seine vorstehenden grünbraunen Augen verrieten wilde Entschlossenheit. Er überquerte die Straße und klingelte bei Wigmore.
Einige Augenblicke später wurde im Flur Licht gemacht. Doringham hörte zögernde Schritte und dann Thalia Wigmores Stimme.
»Wer ist da?«
»Doringham«, antwortete er, »Charles Doringham.«
Die Tür wurde geöffnet, und Thalia Wigmore stand lächelnd vor ihm. Sie trug ein dunkles Kleid mit weißem Spitzenbesatz und hatte einen alten Regenmantel um die schmalen Schultern gelegt.
»Sie, Mr. Doringham? Treten Sie ein. Marcus ist leider eben ausgegangen. Er wird es sehr bedauern... Entschuldigen Sie den Regenmantel. Ich bin etwas erkältet.«
Unterdessen hatte Doringham das Haus betreten. Er nahm seine Mütze ab und hängte sie an den Kleiderhaken. Thalia Wigmore schloss die Haustür und öffnete die Tür des kleinen Salons.
»Treten Sie bitte ein, Mr. Doringham. Ich stecke den Gas-Ofen an.«
»Hoffentlich störe ich Sie nicht, Mrs. Wigmore, das...«
»Keineswegs, ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Wir haben so wenig Umgang und leben wie die Einsiedler. Wir lesen viel, und Marcus hat außer der Musik so viele andere Interessen, an denen auch ich teilnehme...«
Während sie das sagte, knipste sie das Licht an und ließ die Jalousien herunter. Schnell blickte Doringham um sich. In der Ecke neben dem Gas-Ofen fand er, was er suchte. Eine eiserne Stange, dicker und schwerer als ein Schüreisen, stand neben dem Ofen. Mit ihr wurde der Rost des Gas-Kamins von Abfällen gesäubert.
»Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind«, sagte die Frau. »Marcus bleibt sicher ein bis zwei Stunden fort. Er hat geschäftlich mit einem Mr. Asagara zu tun, der in Spitalfields wohnt. Aber das wissen Sie wahrscheinlich schon.«
»Ja«, erwiderte Doringham. »Kann ich Ihnen behilflich sein?« Er sah, wie sie sich mit den Zugkordeln der altmodischen Jalousien abquälte. Aber sie wurde schließlich doch mit ihnen fertig. Die Jalousien klapperten herunter, und Mrs. Wigmore drehte sich triumphierend um.
»Fertig«, sagte sie. »Nun noch der Ofen. Sie dürfen ruhig rauchen. Hin und wieder rauche ich auch mal eine Zigarette... Nein, jetzt nicht, vielen Dank.«
Sie holte Streichhölzer, kniete nieder und drehte das Gas auf. Ein kleiner Knall, dann hellblaue Flammen, die sich schnell rot färbten.
»Immer wieder bekomme ich einen Schrecken. Ich reagiere so empfindlich auf Geräusche. Gott sei Dank ist diese Straße ziemlich still. Heutzutage findet man kaum noch ein ruhiges Plätzchen. Vor allem nicht in der Großstadt. Marcus ist auch diese Straße noch zu laut. Er hat abends immer viel zu schreiben.« Sie setzte sich in einen niedrigen Sessel und hielt die Hände an den Ofen. Sie schwieg. Ihr blutleeres Gesicht war friedlich... Als würde sie denken: Ich habe meine Hausfrauenpflicht getan. Jetzt sind Sie an der Reihe. Was führt Sie zu uns?
Aber Charles Doringham blieb stumm. Dann murmelte er etwas über Lärm, über Radio im Nachbarhaus. Zusammenhangloses Zeug. Die sanften Augen der Frau betrachteten sein rotes Gesicht. Vielleicht dachte sie, dass er zu viel getrunken habe. Etwas wie Ekel verzog ihren Mund.
»Marcus wird es sehr bedauern, Sie verfehlt zu haben, Mr. Doringham«, wiederholte sie.
Er nahm eine Zigarette, und seine dicken Finger spielten verlegen mit ihr. Ein heller Ton klang ihm in den Ohren, als schwirrte eine Mücke vor seinem Gesicht. Er stand plötzlich auf, zog ein Stück Papier aus der Tasche, faltete es zusammen und ging damit ans Feuer.
»Sie brauchen ein Streichholz«, sagte sie. Sie drehte sich in ihrem Sessel um.
Er steckte die Zigarette in die Tasche und ergriff die Eisenstange.
Thalia Wigmores Augen weiteten sich vor Schrecken. Leise flehte sie: »Nein!«
Er schlug auf sie ein.
Die Stange schien in ihrem Kopf zu versinken. Ohne einen Laut von sich zu geben, brach sie zusammen. Der Regenmantel glitt ihr halb von den Schultern und fiel in die Flammen. Es roch nach verbranntem Stoff. Doringham fluchte. Er packte die Frau beim Haar und zerrte sie vom Feuer fort. Dann trat er auf den brennenden Mantel.
Die Frau rührte sich nicht. Aber er schlug in blinder Wut immer wieder auf sie ein. Die Gestalt zu seinen Füßen, die eben noch ein lebendiger Mensch gewesen war, war eine Puppe aus schwarzen Lumpen geworden. Aber die schwarzen Lumpen färbten sich rot. Doringhams Gesicht war ebenso rot wie das Blut. Die Augen traten ihm aus dem Kopf; die Stirnadern schwollen an. Er keuchte, als trüge er eine schwere Last. Aber immer wieder hob sich der Arm und sauste mechanisch herab.
Auf der sonst so stillen Straße draußen floss der schwache Lärm eines Samstagabends dahin.
In dem kleinen Salon aber herrschte tiefe Stille. Hier lag eine tote Frau, und hier stand ein Mann, der zeitweilig den Verstand verloren hatte...
Fünftes Kapitel
Der Autobus bog auf den Hyde Park Square ein. Marcus Wigmore sah den Fahrer fragend an. »Muss ich hier aussteigen, Sir?«
»Ja«, erwiderte der Fahrer ungeduldig. »An der Ecke Norfolk Street müssen Sie aussteigen.«
»Vielen Dank.«
Mit der Aktentasche unter dem Arm stieg Wigmore aus und eilte über den großen Platz. Der Fahrer spuckte auf die Straße und schaute hinter seinem Fahrgast her.
»Noch ein paar von der Sorte«, sagte er zu einer Frau, die in der Nähe der Tür saß, »und ich verlange Lohnerhöhung. Innerhalb von fünf Minuten hat er mich viermal dasselbe gefragt.«
»Der Krieg«, erwiderte die Frau. »Der Kalte Krieg. So was sollte es nicht geben. Die Menschen verlieren dabei die Nerven.«
»Vielleicht haben Sie recht«, entgegnete der Fahrer.
Wigmore erreichte die Norfolk Street, blieb an einer Straßenlaterne stehen, an der auf einem Schild Abfahrtszeit und Nummer der verschiedenen Busse verzeichnet waren. Ein Arbeiter mit einer schweren Werkzeugtasche lehnte am Laternenpfahl.
»Verzeihen Sie, Sir«, sagte Wigmore, »fährt von hier ein Bus zum Chesterfield Place?«
»Ja«, erwiderte der Arbeiter. »Der 64 oder der 128.«
»Vielen Dank.«
Zwei Minuten später kam ein 64er, und Wigmore stieg ein. Er fragte wieder den Fahrer.
»Vielen Dank, Sir«, erwiderte Wigmore. »Wissen Sie vielleicht, wo die Portsea Street ist?«
»Die Portsea Street...« Er kratzte sich am Kopf. »Die Portsea Street kenne ich nicht. Sie liegt nicht auf meiner Fahrstrecke. Steigen Sie an der Horner Row aus und steigen Sie dort in den Bus 72, vielleicht kann man Ihnen dort weiterhelfen.«
»Zu liebenswürdig, Sir«, sagte Wigmore. »Sagen Sie mir bitte Bescheid, wann ich aussteigen muss. Ich bin fremd in dieser Gegend.«
Der Fahrer war gern dazu bereit. Wieder einmal hatte die Höflichkeit einen Sieg davongetragen.
Zwölf Minuten später ging Wigmore über die etwas, abschüssige Horner Row. Es war inzwischen fünfundzwanzig Minuten vor acht. Viele Menschen waren unterwegs, und die Caféterrassen waren bei dem milden Wetter besetzt. Neben zwei kleinen Kinos auf der einen Seite ein Radioladen, auf der anderen eine Music Hall. In dem einen der Kinos begann die Abendvorstellung. An den Anschlagsäulen Plakate für Theater, Opern, Konzerte und Revuen. Lichter flammten: malvenfarbig, weiß, orange. Die Leute gingen langsam vorbei, lasen die Plakate und überlegten, wohin sie gehen sollten. Oder sie drängten sich durch die Menge, eilten zu Verabredungen in einem Restaurant oder einem Theater.
Wigmore, dem jedes Gedränge zuwider war, verlangsamte seine Schritte. Wie immer betrachtete er die Menge mit Interesse und Vergnügen, aber er hielt sich lieber an ihrem Rande auf und mischte sich nicht unter sie.
An der Presbytery Lane wandte er sich nach links und begegnete einem Bobby. Wigmore zog den Hut, und der Bobby hob die Hand an die Mütze.
»Verzeihung, ich suche die Portsea Street.«
»Die Portsea Street geht als dritte oder vierte Straße von der Sentinel Street ab. Genauer weiß ich es leider nicht.«
Der Bobby, der seinen Dienst beendet zu haben schien, ging weiter. An einer Straßenecke, an der ein großes Warenhaus stand, las Wigmore ein Straßenschild mit der Aufschrift: Sentinel Street. Er ging weiter. In der breiten Straße mit den imposanten Häusern herrschte viel weniger Verkehr. Wigmore wandte sich nach rechts. In diesem Teil der Straße erhoben sich rechts und links vier- bis fünfstöckige Mietshäuser mit anscheinend großen Etagen. Jede Etage hatte einen Balkon mit schmiedeeisernem Gitter. Viele Fenster waren erhellt, aber in der Straße selbst nur wenig Menschen unterwegs.
Nun begann für Wigmore das Suchen. Anfangs machte es ihm Spaß. Als einsamer Mensch, der sich viel mit seinen Gedanken beschäftigte, sprach er gern mal mit Fremden. Seine Fragen entsprachen seiner Pedanterie. Genaue Fragen, dann Analyse der erhaltenen Antwort; die Vermutungen, die sich daraus ergaben: Nach Wigmores Meinung lernte man auf diese Weise am besten die Menschen und ihre geistige Haltung kennen. Er ging also durch die Sentinel Street, und als er die Portsea Street nicht fand, sprach er einen Krämer an.
Der Mann hatte einen arbeitsreichen Tag hinter sich. Er wollte gerade seinen Laden schließen und hatte kein Verlangen nach einer längeren Unterhaltung. Nur ungern gab er die gewünschte Auskunft. Seiner Meinung nach liege die Portsea Street in der Nähe der Sentinel Street. Aber der genaue Weg dorthin sei ihm nicht bekannt.