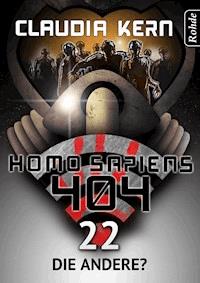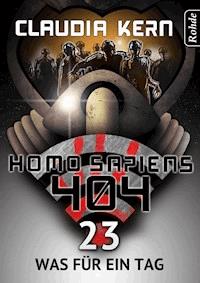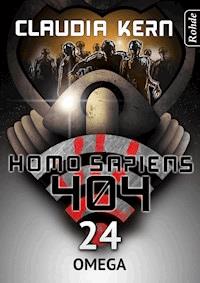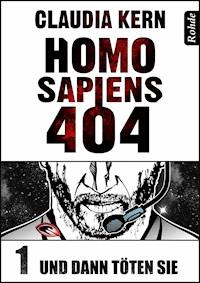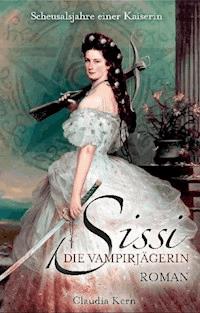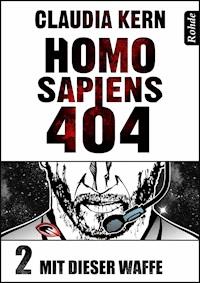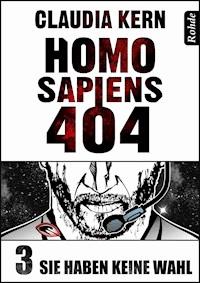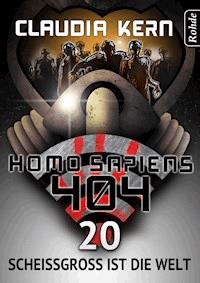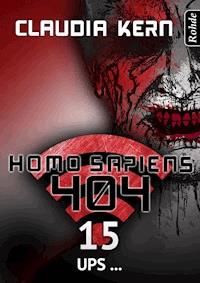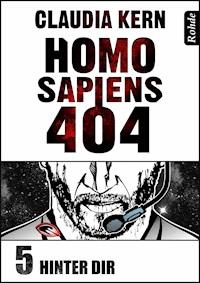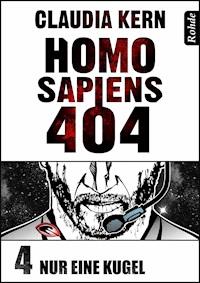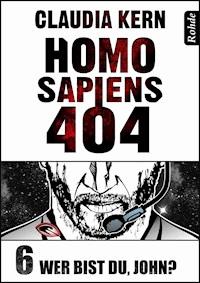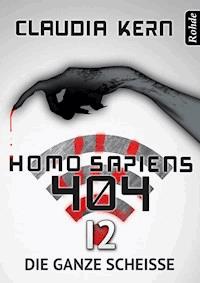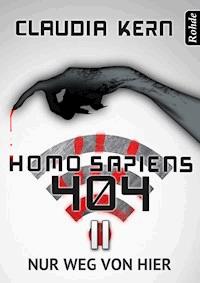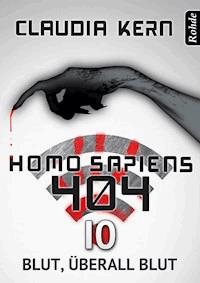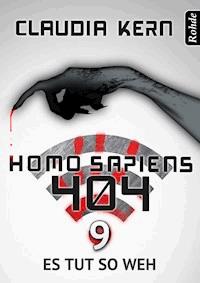8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schicksal in dunklen Zeiten
- Sprache: Deutsch
Das überwältigende Gemälde einer beinahe vergessenen Epoche.
Im Jahre 1212 taucht ein junger Schafhirte vor dem Kölner Dom auf und ruft die Armen und die Kinder zur Befreiung des Heiligen Landes auf. Tausende schließen sich ihm an, darunter auch Madlen, eine in Ungnade gefallene Magd, die ihre beiden Söhne nicht alleine ziehen lassen will. Ständig dem Hungertod nahe führt der Kreuzzug der Kinder quer durch Deutschland. Unzählige Gefahren und Intrigen sind zu überstehen, aber Madlen hält zu ihren Söhnen. Doch in den Alpen wird sie von ihnen getrennt. Wie weit kann Madlen gehen, um ihre Söhne wiederzusehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Das überwältigende Gemälde einer beinahe vergessenen Epoche.
Im Jahre 1212 taucht ein junger Schafhirte vor dem Kölner Dom auf und ruft die Armen und die Kinder zur Befreiung des Heiligen Landes auf. Tausende schließen sich ihm an, darunter auch Madlen, eine in Ungnade gefallene Magd, die ihre beiden Söhne nicht alleine ziehen lassen will. Ständig dem Hungertod nahe führt der Kreuzzug der Kinder quer durch Deutschland. Unzählige Gefahren und Intrigen sind zu überstehen, aber Madlen hält zu ihren Söhnen.
Doch in den Alpen wird sie von ihnen getrennt. Wie weit kann Madlen gehen, um ihre Söhne wiederzusehen?
Über Claudia Kern
Claudia Kern, geboren in Gummersbach, studierte Anglistik, Philosophie und Vergleichende Religionswissenschaften an der Universität Bonn und arbeitete jahrelang als Kolumnistin und Redakteurin für Fernsehen und Zeitschriften.Nach Ausflügen ins Fantasy-Genre etablierte sie sich mit dem Roman »Das Schwert und die Lämmer« als Autorin historischer Romane. Sie lebt seit 2008 mit ihrem Lebensgefährten in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Claudia Kern
Das Schwert und die Lämmer
Roman
Für die Mädels.
Ihr wisst, wer ihr seid.
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Impressum
Prolog
»Erzähl ihm deine Geschichte«, sagt er.
Ich sehe nicht auf. Der Boden unter meinen Knien ist weiß und so rein, dass ich mich schäme, ihn zu berühren. Ich verberge meine Hände in den Falten meines Umhangs, damit niemand sieht, wie schmutzig sie sind.
»Erzähl sie ihm.«
Ich höre Stoff rascheln. Jemand räuspert sich. Das Geräusch hallt durch den Saal.
Alle warten darauf, dass ich beginne, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Meine Geschichte gehört nicht nur mir, sondern allen, die an ihr beteiligt waren; Hugo und Konrad, Lena und Lukas, Richard, Ott und Erik, aber vor allem gehört sie Nicolaus, ihm vielleicht mehr als mir selbst. Für sie muss ich einen Anfang finden, den Tag, die Stunde wählen, an der die Geschichte begann, damit der, vor dem ich knie, ihr Ende schreiben kann.
Eine Hand berührt meinen Arm, beruhigend, auffordernd. Ich hebe den Kopf. Sonnenlicht strömt durch Fenster hoch wie Kirchtürme. Die Helligkeit blendet mich. Der Mann auf dem Thron ist eine dunkle Silhouette, umgeben von funkelndem, gleißendem Licht. Meine Augen beginnen zu tränen, aber ich senke den Blick nicht.
Nicht mehr.
Und dann wähle ich einen Anfang. Auf einmal ist das ganz leicht.
Ich sehe die Silhouette an und öffne den Mund. Die Luft schmeckt süß.
Kapitel 1
Wir stiegen den Berg empor an diesem Morgen, schweigend und müde, so wie immer. Gertrud ging vor, wir anderen folgten ihr in einer Reihe, denn der Pfad war zu schmal, um nebeneinander herzugehen. Gestrüpp und Bäume rahmten ihn auf beiden Seiten ein, und gelegentlich wand er sich an einem moosbedeckten Felsen vorbei.
»Wann gehst du?«, fragte Gertrud. Sie musste sich nicht umdrehen, ich wusste auch so, dass sie mit mir sprach.
»Morgen.«
»Aha.«
Mehr sagte Gertrud nicht. Die sechs Frauen, die hinter mir den Berg hinaufstiegen, atmeten und schnauften leiser als zuvor. Zweige knackten unter ihren Füßen.
Es war ein kalter, grauer Frühlingsmorgen. Nebel stieg in dünnen Schwaden zwischen den Bäumen empor. Über dem Rhein musste bereits die Sonne aufgehen, doch auf unserer Seite des Bergs war ihre Wärme noch nicht zu spüren.
»Und die Herrin weiß davon?« Gertrud klang verärgert, fast schon verletzt. Sie war die älteste Magd auf der Burg. Ihre Kinder waren erwachsen, und die erste Enkeltochter würde zum Pfingstfest heiraten. Sie hatte sich daran gewöhnt, dass jeder tat, was sie sagte, und unterließ, wovon sie abriet. Hinter ihrem Rücken nannten sie alle Mutter Oberin.
»Sie hat es mir selbst erlaubt«, sagte ich.
»Ich war dabei.« Agnes sprach zu laut, wie so oft, wenn sie aufgeregt war. Als Einzige in unserer Gruppe aus acht Mägden – normalerweise neun, aber Gerhild hatte wenige Tage zuvor einen Sohn geboren und war vom Frondienst befreit – hing kein Gebende in ihrem Gürtel. Sie war noch unverheiratet und durfte ihr Haar für alle sichtbar offen tragen. Ich beneidete sie um diese Freiheit, doch das hätte ich ihr nie gesagt, so wie sie mir nie gestanden hätte, dass ihr Gertrud Angst einjagte. Man muss nicht alles aussprechen.
Ich hob den Kopf und sah an Gertrud vorbei den Berg hinauf. Die Mauern von Burg Drachenfels schimmerten zwischen den kahlen Bäumen hindurch. Sie waren kaum näher gekommen, obwohl wir bereits die halbe Strecke zurückgelegt hatten. Seit Heinrichs Tod erschien mir der Weg länger als davor.
»Ich weiß wirklich nicht, was du da willst«, sagte Gertrud nach einem Moment. Ihr Atem ging schwer. Ich fragte mich, was ihr mehr zu schaffen machte, der Aufstieg oder ihr Ärger. »Ich habe Winetre mein ganzes Leben lang nicht verlassen«, fuhr sie fort. »Und meine Eltern und Kinder auch nicht. Onkel Humbert, ja, der meinte auch, er wäre zu Besserem berufen.«
Sie blieb abrupt stehen und drehte sich um. Der graue Wollschal, den sie um Kopf und Schultern geschlungen hatte, rahmte ihr Gesicht ein. Ihre Nase stach daraus hervor wie der Schnabel eines Falken.
»Nach Bonn wollte er.« Sie schüttelte den Kopf. »Bonn …«, sagte sie dann leiser. »Er sprach von nichts anderem, als ob er dort das Paradies finden würde.«
Einen Moment lang verlor sich ihr Blick in der Vergangenheit. Sie sprach oft von »Onkel« Humbert, dabei wusste jeder im Dorf, dass er nicht ihr Onkel gewesen war. Nur was er genau für sie gewesen war, wusste niemand.
Mit einem Blinzeln kehrte sie in die Gegenwart zurück. Der Blick ihrer blauen Augen richtete sich auf mich, und sie hob den Zeigefinger. »Nie wieder haben wir von ihm gehört. Bestimmt haben ihm Wegelagerer die Kehle durchgeschnitten und ihn in unheiligem Boden verscharrt.« Sie bekreuzigte sich. »Und du willst sogar nach Köln. Bei allen Heiligen.«
»Es ist doch nur eine Pilgerfahrt, Gertrud«, mischte sich Klara ein. Sie war so alt wie ich, hatte aber schon sechs Kinder geboren. »Mach ihr keine Angst.«
Ich nickte. »Vater Ignatius wird die ganze Zeit über bei uns sein. Wir sind fast ein Dutzend Pilger. Sogar ein Ritter ist dabei.«
Gertrud strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Auch eine andere Magd?«, fragte sie.
»Nein.«
»Aha.« Gertrud musterte mich einen Moment lang. Schamesröte stieg mir ins Gesicht. Gertrud bemerkte das anscheinend, denn ihre Mundwinkel zuckten kurz, als wolle sie lächeln, dann drehte sie sich wieder um und stieg den Berg weiter empor.
Ich folgte ihr nur, weil es keinen anderen Weg gab.
Morgennebel umgab die Burg, als wir sie erreichten. Im Schatten einiger Bäume blieb ich stehen und zog das Gebende über. Die Haube war aus einfachem Leinen und kratzte, wenn man unter ihr schwitzte. Ich zog sie so fest unter dem Kinn zusammen, dass ich den Mund kaum noch öffnen konnte. Ich wollte Gertrud nicht noch mehr reizen.
Bis auf Agnes legten auch die anderen Frauen ihr Gebende an. Wir sprachen zwar nie darüber, aber ich war mir sicher, dass wir den alten, steilen Pfad nur benutzten, damit wir es erst in der Burg tragen mussten. Auf dem Hauptweg mit all den Karren und Menschen wäre das nicht gegangen. Nur Gertrud trug ihre Haube bereits, wenn sie morgens den Hof verließ. Sie war eine fromme Frau, wahrscheinlich frommer als alle anderen Mägde. Ich versuchte zu ihr aufzusehen, so wie Vater Ignatius es mir in der Beichte geraten hatte, aber das fiel mir schwer.
»Vielleicht hat er dir deshalb diesen Rat gegeben«, hatte Klara gesagt, als ich ihr davon erzählte. »Wenn es leicht wäre, könnte ja jeder Heide fromm sein.«
Wir gingen durch das breite Eingangstor. Es stand offen, Soldaten waren keine zu sehen. Von den Türmen überblickte man das ganze Land, kein Feind konnte sich der Burg ungesehen nähern. Eine Gruppe Knechte kam uns entgegen. Sie schoben hölzerne Handkarren vor sich her, auf denen Werkzeug und in Tuch eingeschlagenes Brot lagen, das sie in der Küche bekommen hatten. Sie waren auf dem Weg zum Steinbruch unterhalb der Burg. Es waren keine alten Männer unter ihnen. Die Arbeit am Berg war hart und gefährlich.
Einer der Knechte blieb neben uns stehen, während die anderen mit gesenkten Köpfen und müdem Blick weitergingen. Er grinste. Sein Name war Matthias.
»Seid gegrüßt, Weibsvolk«, sagte er. »Was treibt ihr euch zwischen den Bäumen herum? Wissen eure Männer davon?«
Er sprach uns alle an, aber sein Blick war auf Agnes gerichtet. Sie sah zu Boden und errötete.
»Mein Mann müsste sich nie Sorgen um mich machen«, sagte sie so laut, dass sich die Pferdeknechte neben den Stallungen zu uns umdrehten. »Ich wäre ihm eine gute Frau.«
Matthias zögerte, schien nicht zu wissen, was er darauf entgegnen sollte.
Bevor er eine Entscheidung treffen konnte, mischte sich Gertrud ein. »Unser Herr gibt uns den Lohn nicht fürs Herumstehen. Kommt.«
Agnes wirkte erleichtert, Matthias enttäuscht.
»Ich habe auch noch zu tun«, sagte er. »Wir sehen uns zum Osterfest.«
»Ich werde da sein, aber nicht Madlen.« Agnes sprach etwas leiser als zuvor. »Sie geht auf Pilgerfahrt nach Köln.«
Matthias hatte sich bereits abgewandt, sah aber noch einmal zurück. »Ich weiß. Alle reden davon.«
Am liebsten hätte ich ihn gefragt, was sie redeten, stattdessen nickte ich und lächelte.
Wir gingen an Schweinen vorbei, die im angetauten Lehm nach Würmern suchten, in den kleinen Innenhof. Hühner gackerten zu unseren Füßen. Eine schwarze Katze lief von den Stallungen quer über den Hof zu einem der Vorratskeller. Sie war trächtig. Wir alle bekreuzigten uns, die schwangere Klara gleich mehrfach.
»Geh in die Kapelle und spritz etwas Weihwasser auf deinen Bauch«, sagte ihr Gertrud. »Ich will nicht, dass dir das Gleiche passiert wie Käthe.«
Joanna, eine kleine, rundliche Frau, die für fast alle im Dorf die Kleidung nähte, atmete so laut aus, dass es wie ein Stöhnen klang. Wir hatten die Geschichte von Gertruds Schwester und ihrem seelenlosen Kind schon dutzende Male gehört.
»Sie hätte es besser wissen müssen«, sagte Gertrud erwartungsgemäß. »Eine schwarze Katze gehört nicht ins Haus einer Schwangeren. Angestarrt hat das Biest sie, als das Kind kam. Käthe sagt, sie hätte Satan persönlich …« – sie bekreuzigte sich hastig, wir folgten ihrem Beispiel – »… in ihren gelben Augen gesehen. Ganz deutlich. Und dann hat sich die Katze auf die Hinterläufe aufgerichtet, ist zu einem schwarzen Mann geworden und davongelaufen. Sie hat dem kleinen Utz alles gestohlen, was der Schöpfer ihm mit auf den Weg gegeben hat. Seinen Verstand, seine Stimme und das Augenlicht. Ein Jahr hat er gelebt, bevor es Gott gefiel, ihn an seine Seite zu holen.«
Gertrud redete weiter, erzählte von dem schwarzen Mann, der Käthe bis zum Tod in ihren Träumen heimgesucht hatte, aber ich hörte nicht mehr zu. Sogar Klara, für die diese Lektion gedacht war, nickte nur noch abwesend.
Wir gingen durch einen Torbogen, über dem die Zimmer der Hausdiener lagen. Als Kind hatte ich geglaubt, eines Tages einmal dort zu wohnen, hinter dicken Mauern mit Fußböden aus Stein und einem Bett aus Holz. Mein Vater hatte gelacht, als ich ihm davon erzählt hatte, also erwähnte ich es nie wieder. Aber ich dachte immer daran, jeden Morgen, wenn ich in den großen Innenhof vor dem Haupthaus trat. Ich wusste, dass es anmaßend war und falsch, dass ich mir ein anderes Los wünschte als das, was Gott mir in seiner Gnade zugewiesen hatte, aber ich konnte nicht anders. In der Beichte brachte ich das nicht mehr zur Sprache. Hundert Rosenkränze und so viele Ave-Marias, wie es Sterne am Himmel gab, hätten an meinen Gedanken nichts geändert.
Sonnenlicht fiel auf das Banner von Burg Drachenfels. Nach dem nächtlichen Regen hing es schlaff und nass an seiner Stange über dem Haupthaus, inmitten der Zinnen und Türme. Ich hatte Geschichten darüber gehört, wie es im Inneren aussah, über die vielen Räume, die Teppiche an den Wänden, die Gemälde, Kissen, Betten, Vorhänge und die Truhen voller Gold. Wie gern hätte ich es einmal von innen gesehen, doch dafür hätte ich in den Zimmern über dem Torbogen leben müssen.
Ich wandte mich vom Haupthaus ab und folgte Gertrud zum Küchentrakt. Der Geruch von frisch gebackenem Brot hing über dem Hof, Rauch zog aus den geöffneten Türen und den Rauchabzügen im Dach. Kleine, strohgedeckte Hütten lehnten an den Mauern rund um das Gebäude. Zwischen ihnen standen Holzeimer voller Sand. Seit dem Feuer einige Jahre zuvor hatten die Köche und Bäcker, die in den Hütten lebten, darauf zu achten, dass die Eimer stets gefüllt waren. Wer das vergaß, konnte mit der Peitsche bestraft werden.
»Ich bin gleich wieder da«, sagte Klara, als Gertrud kurz Luft holte. Sie bog nach links zu der kleinen Kapelle neben der Kaserne ab, in der die Herren der Burg ihre Gebete zu sprechen pflegten. Ein Junge saß auf den Steinstufen, die zum Eingang führten, und wärmte sein Gesicht in den ersten Sonnenstrahlen des Tages. Er trug eine Mönchskutte. Ich kannte ihn nicht, schätzte aber, dass er ungefähr so alt war wie Hugo, mein Erstgeborener. Wahrscheinlich gehörte er zum Kloster Heisterbach. Die Mönche dort kümmerten sich um die Kapelle.
Der Junge sah auf, als Klara vor ihm stehen blieb. Ihr Schatten fiel über sein Gesicht, sie sagte etwas, er schüttelte den Kopf, dann zeigte sie zurück in den kleinen Innenhof, in dem wir die Katze gesehen hatten. Er hörte ihr einen Moment lang zu, dann nickte er, stand auf und betrat die Kapelle. Klara blieb draußen stehen.
Wir hatten schon fast den Küchentrakt erreicht, als der Junge mit einem Krug in der Hand zurückkehrte. Er tauchte die Finger hinein und spritzte Wasser auf Klaras Hemd, dann zog er ein Holzkreuz unter seiner Kutte hervor und legte die Hände darum. Klara fiel vor ihm auf die Knie, senkte den Kopf und faltete die Hände, als er zu beten begann. Der Junge hatte eine hohe, näselnde Stimme, die immer wieder kippte, so als glitte sie auf den lateinischen Worten aus. Er war im Stimmbruch. Ich fragte mich, ob ich Hugos Stimme wohl wiedererkennen würde, wenn er mich begrüßte. Konrads ja, er war noch zu jung für den Stimmbruch, aber Hugos? Nur einen Tag noch, vielleicht zwei, dann würde ich es erfahren. Bei dem Gedanken spürte ich ein Kribbeln im Magen.
Die anderen gingen an mir vorbei in den Küchentrakt. Laute Stimmen drangen aus den Räumen, irgendwo sang eine Frau. Ich sah zurück zu Klara. Der Mönch hatte sein Gebet beendet und saß bereits wieder auf den Stufen. Klara ging auf mich zu.
»Was hat er gesagt?«, fragte ich, als sie neben mir stehen blieb.
»Dass es richtig war, sofort zu ihm zu kommen«, antwortete sie mir, und ihre Wangen waren vor Aufregung gerötet. »Er konnte mich nicht reinlassen, weil unsere Herren gerade beichten, aber er hat Weihwasser geholt und mich gesegnet.« Sie atmete tief durch. »Ich hoffe nur, mir passiert nicht, was Käthe widerfahren ist. Kennst du die Geschichte?«
Einen Moment lang wusste ich nicht, was sie damit meinte, aber dann sah ich das Zucken in ihren Mundwinkeln.
»Ich kann ja mal Gertrud fragen.«
Wir lachten, als wir den Küchentrakt betraten. Die Wände auf beiden Seiten des schmalen Gangs waren rußbedeckt und schmierig. Es roch nach altem Fett.
Wir gingen an der Räucherkammer vorbei und betraten die Küche. Gertrud und die anderen Mägde standen im Halbkreis um die Feuerstelle und wärmten sich. Ein Topf hing an einer Eisenkette über dem Feuer. Darin kochte Haferschleim.
Helene und ihre Schwester Kunigunde saßen auf einer Bank neben dem großen Holztisch in der Mitte des Raums und zerstießen Mandeln in hölzernen Mörsern, die sie zwischen ihre Schenkel geklemmt hatten. Ihre Augen waren vom Rauch gerötet.
Köche, Bäcker und Lehrlinge eilten durch den Raum. Sie trugen Körbe mit Roggenbrot, Fässer voller Sauerkraut und Stangen, an denen geräucherte Forellen hingen.
Ich stieg über die Strohlager der Lehrlinge und streckte die Hände aus, genoss die Wärme des Feuers.
»Neunaugen, wenn Josef ein paar fängt«, sagte Helene gerade. »Die Herrschaft wollte eigentlich Aal, aber im Dorf gab es gestern keinen. Wenigstens hatte einer der Händler Trockenobst. Der Schultheiß hat zehn Fässer gekauft.«
»Zehn?« Gertrud wirkte beeindruckt.
»Schafe, Ziegen und Schweine hat er auch noch bestellt.« Helene nickte und wischte sich dann mit dem Unterarm über die verschwitzte Stirn. »Das wird ein großes Bankett am Sonntag.«
»Weiß man schon, wer kommt?«, fragte Agnes so wie immer, wenn ein Fest anstand. Sie liebte es, die Ankunft der Gäste zu beobachten und allen zu erzählen, was sie getragen und wie sie ausgesehen hatten. Vater Ignatius hatte sie deswegen einmal zurechtgewiesen, aber es war nicht Stolz, der Agnes dazu trieb, sondern das Bedürfnis, etwas Schönes zu sehen. Das war etwas anderes als meine neidvolle Sehnsucht nach den Bedienstetenzimmern.
Kunigunde schnaufte laut. Sie war jünger als Helene, wirkte jedoch älter. »Hohe Herrschaften«, sagte sie so leise, dass ich sie zwischen dem Klappern der Töpfe und den Rufen der Köche kaum verstehen konnte. »Sehr hohe Herrschaften.«
Agnes’ Augen weiteten sich. Gertrud warf mir einen kurzen Blick zu. »Schade«, sagte sie dann, »dass du das nicht miterleben wirst, Madlen. Dieses Fest werden wir bestimmt alle lange in Erinnerung behalten.«
Ich wollte ihr zustimmen und das Thema damit beenden, aber Klara kam mir zuvor. »Ich bin mir sicher, dass Madlen Köln auch lange in Erinnerung behalten wird.«
Einer der Köche unterbrach seine Arbeit. »Du reist nach Köln?«, fragte er. Der Koch war ein junger Mann mit buschigen, schwarzen Augenbrauen. Er war neu, ich kannte seinen Namen noch nicht.
»Sie geht auf Pilgerfahrt«, sagte Helene, während sie aufstand und die gestoßenen Mandeln in eine Holzschüssel kippte. »Vater Ignatius nimmt sie mit.« Sie lächelte. »Wirst du deine Söhne sehen?«
»Ich hoffe es.«
»Ich auch.« Helene schüttete eine neue Portion Mandeln in das Mörsergefäß. »Nach alldem hast du dir das verdient.«
Nach alldem. So etwas sagt man wohl zu einer Frau, die ihren Mann und zwei Töchter in nur einem Jahr verloren hat. Ich wollte darüber nicht reden und war froh, als der neue Koch erneut das Wort ergriff.
»Ich war mal in Köln«, sagte er. »Hat mir nicht gefallen. Zu viele Diebe und Taugenichtse. Selbst den anständigen Leuten kann man nicht trauen. Ich würde da nicht noch mal hingehen, selbst wenn Christus persönlich mir die Hand hielte.«
Einige lachten.
»Lästere nicht den Namen des Herrn.« Gertrud bekreuzigte sich, aber in ihren Augen lag ein zufriedener Ausdruck.
Der Koch setzte zu einer Antwort an, doch im gleichen Moment ertönte ein Pfiff unter einem der schmalen Fenster. Jeder in der Küche wusste, was das bedeutete. Der Schultheiß kam.
Die Gespräche verstummten. Agnes begann mit einem Ast im Feuer zu stochern, Klara griff nach einem Kochlöffel, und ich nahm einen leeren Korb in die Hand. Die Lehrlinge – alle bis auf den, der draußen den Pfiff ausgestoßen hatte – waren wie versteinert. Sie hatten Angst vor dem Schultheiß.
Jeder hatte Angst vor ihm.
Ich hörte die Schritte seiner Stiefel im Gang, dann sah ich seinen Schatten an der Wand. Einen Atemzug später stand er im Türrahmen. Weder grüßte er, noch wünschte er uns einen guten Morgen.
»Das Wetter ist gut«, sagte er stattdessen. »Die Arbeit türmt sich auf, also, wieso sehe ich im Hof nur Hühner und Schweine?«
Es war eine Frage, die keiner Antwort bedurfte. Mit gesenktem Kopf standen wir da, die Blicke auf den Boden gerichtet. Niemand sagte etwas.
Der Schultheiß war ein harter, hagerer Mann, der selten lächelte und niemals lachte. Sein Name war Karl, aber hinter seinem Rücken nannten wir ihn Karl der Kleine, weil er kaum über einen Pferderücken blicken konnte.
Aus den Augenwinkeln sah ich, wie er einen nach dem anderen musterte. Das Lederwams, das er fast immer trug, hing locker an seinem Körper. Unter dem schweren Wollumhang stachen die Schultern spitz hervor. Er hatte eine ungesund wirkende, gelbliche Gesichtsfarbe. Zu viele heiße und trockene Speisen dörren den Körper aus, hatte Helene mir einmal erklärt. Genauso wirkte Karl, ausgedörrt und vertrocknet.
Ich zuckte zusammen, als er weitersprach. »Du, du und du.« Mit dem Finger zeigte er scheinbar wahllos auf drei Mägde. »Ihr helft den Bauern beim Unkrautjäten auf dem Feld unten am Weiher.«
»Ja, Herr.« Die drei verließen die Küche so schnell, dass sie Rauchschwaden hinter sich herzogen.
»Du und du.« Der Finger richtete sich auf Klara und mich. »Kümmert euch um den Kräutergarten.«
»Ja, Herr.« Wir folgten den anderen. Der Eingang war so schmal, dass Klara sich mit ihrem gewölbten Bauch an Karl vorbeidrängen musste. Er beachtete sie nicht.
»Du und du …«, fuhr er fort.
Als wir den Hof betraten, stieß ich erleichtert den Atem aus. Klara hielt ihr Gesicht in den Wind und ließ den Schweiß trocknen.
»Er kennt noch nicht einmal unsere Namen, oder?«
Ich ergriff ihre Hand. »Komm, wir haben lange genug getrödelt.«
Die Gemüse- und Kräutergärten lagen hinter dem Haupthaus. Ein schulterhoher Holzzaun schützte sie vor Schweinen und Hühnern, eine Vogelscheuche vor Krähen und Raben.
Vater Ignatius hatte alle Schwarzvögel vor einigen Jahren exkommuniziert, und seitdem hielten sie sich vom Kloster fern, doch über der Burg kreisten sie immer noch Tag für Tag. Wahrscheinlich reichte unsere Frömmigkeit nicht aus, um sie zu vertreiben.
Ich zog das Tor zu den Gärten auf. Die Kräuterbeete waren nach dem Winter von Unkraut überwuchert, die Gemüsegärten bereits gesäubert. An St. Kiliani waren dort Rüben gesät worden, an St. Gregorii Erbsen. Einige Bäuerinnen aus dem Dorf zupften frisches Unkraut aus den Furchen, Kinder mit Steinschleudern hockten in der Sonne und warteten auf Krähen. Wir winkten einander zu, dann setzten die Frauen ihre Arbeit fort.
»Er kennt uns doch schon, seit wir so klein waren«, sagte Klara, als sie mir durch das Tor folgte. Sie hielt eine Hand kniehoch über den Boden.
»Wer?« Ich zog das Tor hinter ihr zu und griff nach dem Strick, mit dem man es am Pfosten befestigen konnte.
»Karl der Kleine natürlich. Sollte man da nicht meinen, dass ihm wenigstens ein paar Namen geläufig wären?«
»Er ist ein wichtiger Mann«, sagte ich, während ich den Strick festzurrte. »Unsere Namen spielen für ihn keine Rolle, außer …«
Ich unterbrach mich, als ich sah, wie der Schultheiß den Küchentrakt verließ, stehen blieb und sich umdrehte. Er sprach mit jemandem, der von der offenen Tür verdeckt wurde.
»Außer?«, fragte Klara.
Der Schultheiß schüttelte den Kopf, nicht ablehnend, eher wie jemand, der gerade von einer großen Dummheit erfahren hatte. Dann wandte er sich ab. Ich wartete einen Moment, aber die Person, mit der er gesprochen hatte, folgte ihm nicht.
»Außer was?«, wiederholte Klara.
»Außer«, begann ich, während sich eine unangenehme Kälte in meinem Magen ausbreitete, »jemand tut nicht, was er will.«
Wir arbeiteten den ganzen Vormittag, jäteten Unkraut und lockerten die Erde auf, während die Sonne unsere gekrümmten Rücken wärmte. Anfangs redeten wir noch ein wenig, doch je müder und hungriger wir wurden, desto schwerer fielen die Worte. Es war eine anstrengende Arbeit, vor allem für Klara, die sich zwischendurch immer mal wieder aufrichtete, den Rücken durchdrückte und stöhnte.
»Setz dich doch ein wenig in die Sonne«, sagte ich nach einer Weile zu ihr. »Ich kann allein weitermachen.«
»Schon gut.« Sie warf einen Blick in den Himmel. Die Sonne stand fast schon im Zenit. »Dauert ja nicht mehr lange.«
Kurz wandte sie den Kopf und sah zu den Bäuerinnen hinüber. Ich verstand sofort, was sie damit sagen wollte. Wir kannten die Bäuerinnen zwar, die im Gemüsegarten arbeiteten, aber nicht sonderlich gut. Klara wollte nicht der Faulheit bezichtigt werden, weder hinter ihrem Rücken noch vor dem Schultheiß. Also bückte sie sich wieder und zog Wurzeln aus dem Boden.
Ich versuchte keinen Neid zu empfinden, wenn ich an Klara dachte. Sechs Kinder hatte sie ihrem Mann schon geboren, keines war gestorben, das siebte würde im Sommer kommen, und niemand zweifelte daran, dass es ebenfalls überleben würde, egal, ob eine schwarze Katze seinen Weg gekreuzt hatte oder nicht. Klara war gesegnet. Auf den Feldern, die sie und ihr Mann Kurt bestellten, kam es nie zu Missernten, ihr Hof war trotz der Nähe zum Rhein im Vorjahr von den großen Überschwemmungen verschont geblieben, und selbst nach strengen Wintern hatten sie noch so viel Getreide übrig, dass sie es nicht mit Eicheln oder Bucheckern strecken mussten; ich wusste das, weil Kurt mir im Februar heimlich einen Sack Roggen vorbeigebracht hatte. Weder er noch Klara sprachen je über ihren Reichtum. Trotzdem tuschelte man im Dorf. Gelegentlich fiel sogar das Wort »Hexerei«, wenn auch nur geflüstert und begleitet von einem scheuen Lächeln, als könne man selbst nicht glauben, was man da gesagt hatte.
Das laute Knarren einer Ratsche riss mich aus den Gedanken. Ich drehte mich um. Ein kleiner Junge stand auf dem Burghof zwischen einigen Hühnern und drehte die Ratsche; ein Mönch musste es ihm aufgetragen haben. Er rief den Beginn der zwölften Stunde aus, Zeit für das Mittagsmahl.
Klara richtete sich erleichtert auf. Ihre Gebende hatte sich an Stirn und Schläfen schweißgrau verfärbt. Erde klebte an ihren Knien.
»Ich bin froh, wenn uns endlich wieder die Glocken rufen und nicht diese Ratschen. Das geht einem ja durch Mark und Bein.«
»Es ist ja nur eine Woche im Jahr«, sagte ich, während ich den Strick vom Pfosten abstreifte und das Tor öffnete. Am liebsten hätte ich noch hinzugefügt, wie falsch mir das fröhliche Läuten der Glocken zu einer Zeit vorgekommen war, in der wir uns der Leiden unseres Herrn Jesus Christus erinnerten, aber ich wollte nicht wie Gertrud klingen. Sie wies sogar die Kinder zurecht, wenn sie in diesen Tagen spielten oder lachten.
Klara schien meine Gedanken zu erraten. »Ich verstehe, warum es so sein muss«, sagte sie, »ich mag das Geräusch nur nicht.«
Sie schloss das Tor hinter sich, und gemeinsam gingen wir über den Burghof zu den beiden langen Holztischen, die vom Gesinde aufgestellt worden waren. Zwei Lehrlinge trugen Bänke aus der Küche auf den Hof. Helene und Kunigunde folgten ihnen mit großen, dampfenden Holzschüsseln auf den Armen. Mehrere Brote lagen bereits auf den Tischen.
Ich wandte den Kopf, als ich Männerstimmen hörte. Eine Gruppe Hausdiener verließ gerade einen Vorratskeller. Sie trugen blank polierte Stiefel, Beinlinge und kurze grüne Leinentuniken, und sandgelbe Wollumhänge lagen auf ihren Schultern. Es waren die Uniformen, die sie beim Bankett tragen würden. Zwischen den erdfarbenen und schmutzgrauen Knechten sahen sie aus wie Blumen im Schlamm. Schließlich verschwanden sie im Haupthaus.
»Madlen, was machst du denn da?«, rief Klara. Sie saß bereits an dem Tisch, der den Frauen vorbehalten war.
»Nichts«, sagte ich leise und eilte ihr nach.
Als alle eingetroffen waren und sich gesetzt hatten, sprach Gustav, der Stallmeister, ein kurzes Gebet. Wir senkten demütig die Köpfe und warteten, bis er sich für die Gaben des Schöpfers bedankt hatte.
Ich bemühte mich, die Bediensteten in ihrer bunten Kleidung zu vergessen und daran zu denken, wie gut ich es hatte. Trotz Heinrichs Tod und der schlechten Ernte des Vorjahres bekam ich zwei Mahlzeiten am Tag und durfte abends sogar etwas von dem Brot, das am Herrentisch übrig geblieben war, für meine Mutter und meine beiden Schwestern mitnehmen. Vater Ignatius hatte recht: Es führte zu nichts Gutem, wenn der Fisch versuchte, es den Vögeln gleichzutun. Jedes Ding auf der Welt hatte seinen Platz, und meiner war an diesem Tisch, nicht in den Zimmern über dem Torbogen.
Helene reichte Brot und einen langen Holzlöffel herum. Kohlsuppe dampfte in der Schüssel. Wir aßen nacheinander. Das Brot war hart, die Suppe sauer und scharf. Wir tranken Bier aus einem Krug und rülpsten. Es wurde nur wenig geredet. Man aß, kaute, schluckte und wartete, dass der Löffel seine Runde beendete.
Ich sah hinüber zum Tisch der Knechte. Auch sie aßen schweigend. Josef saß zwischen ihnen, ich erkannte ihn an seinem breiten Rücken und dem schütteren blonden Haar, das der Wind zerzauste. Anscheinend hatte er die Fische für das Herrschaftsmahl bereits gefangen. Er war Heinrichs Bruder, und ich würde ihn im Sommer heiraten. Wenn ich daran dachte, fühlte ich nichts.
»Der Schultheiß«, flüsterte Klara plötzlich.
Es mussten sie alle am Tisch gehört haben, aber kein Kopf wurde gehoben, und kein Blick richtete sich auf den Mann, der das Haupthaus verließ und mit raschen Schritten auf uns zustapfte. Er blieb am Kopfende hinter Helene stehen, die weder wagte, sich umzudrehen, noch, einen Schluck aus dem Bierkrug zu nehmen, den sie mit beiden Händen festhielt.
Karl der Kleine verschränkte die Hände hinter dem Rücken. Seine Schultern stachen hervor wie die Knochen eines Huhns.
»Madlen?«, fragte er.
Ich zuckte zusammen. Die Kohlsuppe brannte in meinem Mund bis in den Magen hinunter. Ich schluckte und stand auf, den Kopf gesenkt, den Blick auf den Brotkanten in meinen Händen gerichtet. »Das bin ich, Herr.«
»Ich habe erfahren, dass du auf eine Pilgerfahrt nach Köln gehen willst.«
Nervös drehte ich das Brot zwischen meinen Fingern. Es glänzte feucht, dort, wo ich davon abgebissen hatte. »Ja, Herr. Morgen.«
»Das wirst du nicht. Wir brauchen dich hier.« Er wandte sich ab.
Ich blieb stehen. Gedanken schossen mir durch den Kopf wie Blitze durch den Himmel. Ich dachte an Konrad und Hugo und Maria und Edith und Heinrich, an das in Leinentuch eingeschlagene Brot, das in unserer Hütte hing, und an den Wollumhang meiner Mutter, den sie mir mitgeben wollte, weil es vielleicht auf dem Rhein kalt sein würde. Ich dachte an die Worte der Gräfin nach dem Unfall im Steinbruch. »Ich möchte dir das Leid gern erleichtern, Madlen. Das ist meine Christenpflicht. Sag mir, ob ich etwas für dich tun kann.«
»Ich möchte nach Köln«, hatte ich geantwortet. Es war mir nicht um die Pilgerfahrt gegangen, ich hatte noch nicht einmal etwas davon gewusst. Ich wollte nur meine Söhne in die Arme schließen und ihnen vom Tod ihres Vaters und der beiden Schwestern, die sie nie gesehen hatten, erzählen. Ich wollte, dass sie mich hielten, während ich weinte.
Das Brot zerbröckelte zwischen meinen verkrampften Fingern. Krümel fielen auf den Boden, und die Hühner zu meinen Füßen begannen sich gackernd darum zu streiten.
Ich sah auf. »Die Herrin hat es erlaubt.«
Der Schultheiß blieb stehen. Langsam drehte er sich um. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihm je zuvor in die Augen geblickt hatte. Sie waren blau und kalt. Es sah aus, als wäre etwas in ihnen gestorben, vielleicht die Familie, die er Jahre zuvor bei der Seuche verloren hatte.
»Wie war das?«, fragte er.
Außer dem Gackern der Hühner war nichts zu hören. Die anderen Frauen schienen weiter von mir entfernt zu sitzen als zuvor. Es war, als rage eine Mauer zwischen ihnen und mir auf. Ich war allein.
»Die Herrin.« Ich hörte das Zittern in meiner Stimme. »Sie hat es mir erlaubt.«
»Du hast ihr Mitleid ausgenutzt, weil du dich vor der Arbeit drücken willst.« Der Schultheiß machte einen Schritt auf mich zu, und auf einmal wirkte er nicht mehr so klein. »Ich weiß doch, wie ihr seid.« Die Geste seines Arms umfasste den ganzen Tisch. »Man muss euch mit harter Hand führen, sonst wisst ihr nicht, was richtig und was falsch ist.«
Gertrud nickte zustimmend. Sie war die Einzige, die auf die Worte des Schultheiß reagierte.
»Wenn du willst«, fuhr Karl an mich gewandt fort, »gehen wir sofort zur Gräfin. Dann kannst du ihr selbst erzählen, welch unverschämten Ton du hier anschlägst und von deiner Faulheit.« Er schüttelte den Kopf. »Eine Magd, die auf große Reise wie eine Herrin geht. Und zu Ostern, wenn ein Bankett mit hundert Gästen ansteht. Wie konntest du’s wagen, darum zu bitten, Weib?«
Er schrie das letzte Wort.
Ich sah ihn schon längst nicht mehr an. Tränen liefen mir über die Wangen. Ich schämte mich dafür, fast so sehr wie für meine eigene Dummheit. Ich wusste nicht, ob er recht hatte, nur eines wusste ich sicher: Ich hatte unrecht.
»Verzeiht, Herr«, sagte ich leise.
»Was?«
Er wollte, dass ich es wiederholte. Ich hatte ihm vor allen widersprochen, da war es nur angebracht, dass ich mich auch vor allen entschuldigte.
»Bitte verzeiht mir, Herr«, wiederholte ich so laut, dass meine Stimme über den Burghof hallte. »Ich war unverschämt und dumm.« Mit dem Handrücken wischte ich die Tränen von meinen Wangen.
Der Schultheiß verzog den Mund. »Ich werde darüber nachdenken, ob mir das reicht.« Er winkte knapp. »Und jetzt an die Arbeit! Und zwar alle!«
Die Suppenschüssel war noch halb voll, aber niemand wagte es, auch nur einen Blick darauf zu werfen.
Karl beachtete uns nicht weiter. Mit langen Schritten ging er in Richtung des Haupthauses, zu seinem eigenen Mittagsmahl.
Zitternd atmete ich ein, während Helene die übrig gebliebenen Brote in Tuch einschlug und Kunigunde begann, den Tisch abzuräumen. Die anderen gingen rasch und ohne ein Wort wieder an die Arbeit. Nur Klara und Gertrud blieben zurück, die eine mit schreckgeweiteten Augen, die andere mit unlesbarem Gesichtsausdruck.
»Hab keine Sorge«, sagte Gertrud. Sie klang mitfühlend. »Wenn du’s willst, werden wir gemeinsam dafür beten, dass der Herr dir mehr Demut schenkt.«
Ich antwortete nicht. Gertrud blieb einen Moment lang ratlos stehen, dann wischte sie sich die Hände an ihrer groben Wollschürze ab und ging in den Küchentrakt.
Klara ergriff meinen Arm und zog mich auf den Kräutergarten zu. Ich wehrte mich nicht, stolperte nur zitternd und benommen hinter ihr her. Sie öffnete das Gartentor, zog mich ins Innere und schloss es wieder. Ich lehnte mich gegen das Holz. Meine Knie waren so schwach, dass ich schon befürchtete, gleich umzufallen.
Klara sah sich um. Die Bäuerinnen hatten während unserer Pause den Garten verlassen.
»Sitzt dir Satan persönlich auf der Schulter? Willst du das Osterfest hinter einer Schandmaske am Pranger verbringen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Die Gräfin hat es mir erlaubt« war das Einzige, was ich sagen, das Einzige, was ich denken konnte.
»Und du hättest dem Schultheiß davon erzählen sollen, damit er sich nicht hintergangen fühlt.« Klara nahm mich in die Arme.
Ich legte den Kopf auf ihre Schulter. Die Wolle ihres Umhangs kratzte über mein Kinn. Ich dachte, ich müsste weinen, aber die Tränen kamen nicht. In meinem dummen Stolz hatte ich angenommen, die Gräfin würde dem Schultheiß sofort befehlen, mich auf die Pilgerfahrt gehen zu lassen, als gäbe es nichts Wichtigeres, um das sich eine Frau ihrer Stellung kümmern musste.
»Stattdessen hat Gertrud ihm davon erzählt«, sagte ich. Mit ihr hatte Karl an der Tür zum Küchentrakt gesprochen. Ich hatte es geahnt, doch nun war ich mir sicher. »Neidische alte Vettel.«
Klara löste die Umarmung, trat einen Schritt zurück und sah mich an. »Vielleicht hat sie dir einen Gefallen getan. Es hätte schlimm ausgehen können, wärst du einfach gegangen, ohne dass der Schultheiß etwas davon weiß.«
»Ja«, sagte ich, ohne es zu meinen.
Sie lächelte. »Das ist nicht das Ende der Welt. In ein paar Monaten gehen wir zusammen zu Karl dem Kleinen und fragen ihn, ob du nächstes Jahr die Fahrt unternehmen darfst. Wenn wir ihm versprechen, dass deine Arbeit nicht liegen bleibt, sagt er bestimmt Ja.«
Nächstes Jahr. Die Worte fielen wie Steine auf meine Seele. Meine Großmutter hatte sie nach jedem Weihnachtsfest ausgesprochen, wenn der Sohn, den sie in die Lehre eines Schmieds gegeben hatte, nicht zurückgekehrt war. Er hatte versprochen, nach dem Ende seiner Lehre zum Heiligen Fest heimzukommen, doch das war nie geschehen. Dennoch hatte meine Großmutter bis zum Ende ihres Lebens nach jeder Weihnachtsmesse die Hände in den Schoß gelegt und »Vielleicht nächstes Jahr, bestimmt nächstes Jahr« geflüstert. Sie hatte mir leidgetan. Ich wollte nicht, dass ich einmal jemandem leidtat.
»Du tust mir so leid, Madlen«, sagte Klara. »Ich möchte …«
»Komm«, unterbrach ich sie barscher als nötig. »Das Unkraut jätet sich nicht von selbst.«
Den Rest des Nachmittags verbrachten wir schweigend.
Kapitel 2
Die Sonne ging bereits unter, aber ich wartete trotzdem, bis Klara und die anderen Mägde den Burghof verlassen hatten. Ich konnte die Vorstellung, Gertruds Gesicht sehen und ihre frommen Worte hören zu müssen, nicht ertragen.
Ich würde diese Sünde – ich war sicher, dass es eine war – Vater Ignatius bei der nächsten Messe beichten müssen. Eine von vielen. Er würde mich vor allem wegen meines Verhaltens gegenüber Karl dem Kleinen tadeln.
Ob ich ihm gestehen sollte, dass der Wunsch, meine Söhne zu sehen, für mich wichtiger gewesen war als der, vor den Gebeinen der Heiligen Drei Könige zu stehen? Vater Ignatius war ein gnädiger, mitfühlender Priester, aber auch seine Geduld kannte Grenzen.
Ich verließ den Garten. Die Türme warfen lange Schatten auf den Burghof. Die Wärme des Tages verflog mit dem aufkommenden Wind, und es wurde kalt.
Ich ging zum Küchenfenster und nahm einen der Beutel mit Brotresten, die Helene fast jeden Abend für mich und einige andere bereitstellte. Manchmal klebte noch etwas Soße an den Scheiben, wenn sie den Herrschaften als Teller gedient hatten. Ich achtete immer darauf, dass meine Mutter als Erste davon aß. Sie hatte in ihrem Leben genug gehungert.
Als ich mich umdrehte und zum Tor gehen wollte, fiel mein Blick auf das Haupthaus. Kerzenlicht flackerte in den Fenstern des Speisesaals. Der Graf, seine Familie und die Bediensteten nahmen wohl gerade das Abendmahl ein. Ich stellte mir vor, wie sie dort zusammensaßen und über Dinge redeten, von denen ich nichts verstand. Ob die Gräfin sich noch an ihr Versprechen erinnerte, oder hatte sie wirklich jenen Tag vergessen, an dem vier Männer im Steinbruch unter Felsen begraben worden waren? Wenn ich sie nur sprechen, nur ein Wort an sie richten könnte, würde sie dann nicht dem Schultheiß befehlen, mich gehen zu lassen?
Ich erschrak über meine eigene Unverschämtheit. Man hatte mir gesagt, was ich zu tun hatte. Damit hätte ich zufrieden sein müssen, denn der Schultheiß wusste sicherlich besser als ich, was richtig und was falsch war. Dennoch gaben meine Gedanken keine Ruhe. Immer neue tauchten aus dem Nichts auf wie Sternschnuppen aus tiefster Nacht, ich konnte nichts dagegen tun.
»Madlen?«
Erschrocken fuhr ich herum. Josef stand vor mir. Ich musste zu ihm aufsehen, so groß war er. In einer groben, schmutzigen Hand hielt er seine Angel, die andere war ausgestreckt, als habe er mich an der Schulter berühren wollen. Er senkte sie, fuhr damit einmal über seinen dutzendfach geflickten Wollkittel und räusperte sich.
»Ich wollte dich und die anderen Mägde ins Dorf begleiten«, sagte er, »aber du warst nicht bei ihnen.«
»Mir stand nicht der Sinn nach Gesellschaft.«
Ihm musste klar sein, weshalb ich das sagte, schließlich hatte er nur wenige Fuß entfernt gesessen, als der Schultheiß an unseren Tisch gekommen war, aber er zeigte keine Regung, weder Mitleid noch Missfallen. Sein Gesicht war so rau und grob wie die Kleidung, die er trug. Der Kinnbart, den er jeden Morgen sorgsam mit dem Messer stutzte, schien nicht dazu zu passen. Er war die einzige Eitelkeit, die er sich leistete.
»Wir sollten hier nicht so stehen«, fuhr ich nach einem Moment fort. »Wir sind allein. Das gehört sich nicht.«
»Nein, das stimmt.«
Ich hatte gedacht, er würde gehen, aber er blieb stehen und kratzte sich am Kopf. Dann glitt sein Blick zum Haupthaus hinter mir. »Wolltest du da etwa reingehen?«
»Ich?« Ich wollte lügen, aber die Worte kamen mir nicht über die Lippen. Josef war ein harter, wortkarger Mann, so anders als seine Brüder, dass wir ihn als Kinder Kuckuck genannt hatten. Doch er war auch ein guter Kerl, der seit Heinrichs Tod mit seinen Söhnen half, unseren Hof zu bestellen, und sich bereit erklärt hatte, mich zur Frau zu nehmen, obwohl meine letzten beiden Kinder tot zur Welt gekommen waren. Er hatte es nicht verdient, dass ich ihn anlog.
»Es könnte uns jemand sehen«, sagte ich, während ich bereits an ihm vorbeiging. »Ich will nicht noch mehr Ärger bekommen.«
Schweigend folgte er mir über den Burghof und hinaus durch das Tor. Die breite Straße, die hinunter zum Dorf führte, war belebt. Die Bauern, Mägde und Knechte hatten ihren Frondienst beendet und machten sich auf, um im letzten Licht des Tages noch auf ihren eigenen Feldern zu arbeiten. Wir schlossen uns ihnen an.
Mein Vergehen schien sich nicht herumgesprochen zu haben, denn niemand sagte etwas dazu, und ich bemerkte auch keine Blicke. Das würde sich ändern, spätestens zu Ostern, wenn alle zusammensaßen.
Ich lauschte den Gesprächen um mich herum, ohne selbst etwas dazu beizutragen. Sie drehten sich um das Wetter, um Saatgut, Getreide und Vieh. Kinder liefen zwischen den Erwachsenen umher, trotz des langen Tages noch voller Kraft. Einige rannten den steilen Weg hinunter, vorbei an Bäumen, deren Äste erstes Grün zeigten. Die Jungen schlugen sich mit Zweigen, die sie aus dem Unterholz zogen und in Gedanken zu Schwertern machten. Sie spielten »Kreuzzug«, aber das Spiel schlief rasch ein, da niemand ein Sarazene sein wollte. Einige Frauen trugen Kleinkinder auf dem Rücken. Ich beneidete jede von ihnen.
»Man gab mir heute viele Ratschläge«, sagte Josef plötzlich. Seit wir die Burg verlassen hatten, war er schweigend neben mir hergegangen. Nur die Angel, die er ständig zwischen den Fingern drehte, hatte angedeutet, dass ihn etwas beschäftigte.
»Zu was?«, fragte ich, obwohl ich es mir denken konnte.
»Dir.« Er sah hinauf in den dunkler werdenden Himmel. »Alle sagen, dass du eine harte Hand brauchst, so wie der Schultheiß meinte.«
Ungewollt glitt mein Blick zu seinen großen, harten Händen, mit denen er Füchse erschlug und Rehen das Genick brach, wenn er im Dienste des Grafen auf die Jagd ging.
»Heinrich hat mich nie geschlagen«, sagte ich so leise, dass nur er mich hören konnte.
Josef neigte den Kopf. »Da hat mein Bruder vielleicht was falsch gemacht.«
Ich ging schneller. Er schloss auf.
»Der Graf hatte mal diesen Jagdhund«, sagte er scheinbar zusammenhanglos. »Er fand jede Spur, war aber ansonsten zu nichts zu gebrauchen, weil er immer weglief. Der Graf wollte ihn schon ertränken, aber ich bat ihn, mir Zeit zu geben. Als ich das nächste Mal auf die Jagd ging, lief der Hund wieder weg. Ich packte ihn im Nacken, als ich ihn fand, und schlug ihn, bis er winselte. Und das machte ich bei jeder Jagd: Er lief weg, ich schlug ihn. Hat von Ostern bis Pfingsten gedauert, aber auf einmal lief er nicht mehr weg, von einem Tag auf den nächsten.« Josef versuchte mich anzusehen, aber ich wich seinem Blick aus. Er drehte die Angel zwischen den Fingern. »War danach der beste Hund, den ich je hatte. Hatte Freude an der Jagd, tat, was ich wollte, und es gefiel ihm. Vielleicht hat er nicht geglaubt, dass es ihm gefallen würde, aber es war so.«
Ich hatte Josef noch nie so viel reden hören. Mir wurde klar, dass er sich um mich sorgte, auf seine eigene Art, und dass er auf eine Antwort wartete. Aber ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich bin kein Hund, lass mich in Ruhe! Oder: Ich werde dir eine gute Frau sein und viele Kinder gebären, vielleicht sogar lebende.
Ich schrak beim letzten Gedanken zusammen. Es war entsetzlich, so etwas zu denken, es auszusprechen gänzlich unmöglich. Schlimm genug, dass Gott meine Gedanken vernommen hatte. Ich hatte mein Schicksal mit Demut anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass er mir Kinder schenkte, wenn der rechte Zeitpunkt gekommen war. Wut und Verbitterung sind ein Boden, auf dem nur die Saat des Teufels aufgehen kann. Das hatte Vater Ignatius einst gesagt.
»Verstehst du, was ich meine?«, sagte Josef schließlich.
Seine Frage erleichterte mir die Antwort. »Ja.«
Ich atmete auf, als die ersten Häuser Winetres hinter den Bäumen auftauchten. Rechts des Weges lag das große Gemeinschaftsfeld. Einige Knechte arbeiteten darauf. In der untergehenden Sonne warfen sie lange, seltsam verzerrte Schatten, die wie Geister über die Ackerfurchen glitten.
Markus, ein wohlgenährter älterer Mann und reichster Viehbauer im Dorf, stand neben seinem Pflug und erteilte den Männern lautstark Befehle. Der Ochse war bereits abgeschirrt und wühlte mit der Schnauze nach Wurzeln im Boden.
Markus winkte, als er uns sah. Das speckige Lederwams spannte sich über seinem Bauch. Trotz des Winters hatte er kein Gewicht verloren. Selbst der Ochse war gut genährt.
Alle winkten zurück, grüßten und lächelten. Markus besaß drei Pflüge, mehrere Ochsen, zahlreiche Kühe, Schweine, Ziegen und Schafe. Er war so reich, dass er zum Kirchgang am Sonntag auffallende bunte Kaufmannskleidung trug und ohne Murren die Strafen bezahlte, die der Graf für dieses Standesvergehen von ihm verlangte. Niemand mochte Markus, doch alle taten so. Es war besser, nicht der Feind eines reichen Mannes zu sein.
Hinter der Allmende, dem Feld, das vom Dorf gemeinschaftlich bewirtschaftet wurde, drängten sich die Hütten um die Kirche wie Kinder, die sich bei einem Gewitter aus Angst am Rockzipfel ihrer Mutter festhielten. Die Kirche war nicht groß, eigentlich sogar zu klein für Winetre, aber sie war das einzige aus Stein erbaute Gebäude des Dorfes. Das Baumaterial hatte der Großvater des Grafen gespendet, aus Dank, nachdem sein Sohn unversehrt aus dem Morgenland zurückgekehrt war. Wir alle waren sehr stolz auf unsere Kirche.
Ich blieb an einer kleinen Abzweigung stehen. Im Wind hörte ich das sanfte Rauschen des Rheins.
»Gehst du noch aufs Feld?«, fragte Josef.
»Ja.«
»Soll ich Hans schicken?«
Das war sein ältester Sohn. Er hatte noch keinen Bart, war aber schon fast so groß und kräftig wie sein Vater. Das Gemüt hatte er von Heinrich geerbt; er scherzte gern und verstand sich mit allen gut.
Ich warf einen Blick in den rötlichen Himmel. »Nein, es ist schon spät. Lass ihn ausruhen.«
Josef nickte. »Dann schicke ich ihn morgen.«
Er zögerte, als wolle er noch etwas sagen, wandte sich dann aber nach einem gemurmelten »Gute Nacht« ab.
Ich verabschiedete mich von den anderen und verließ die Straße. Der schmale Pfad, der zu unserem Feld führte, wand sich am Waldrand entlang. Dort war es bereits so dunkel, dass die Bäume zu einer Wand verschmolzen. Tannennadeln bedeckten den Boden, aber es gab nur wenig Unterholz. Winetre hatte es im letzten Winter verheizt.
Bäume zu fällen war verboten, denn der Wald diente dem Fürsten zur Jagd. Es gab so viel Wild, dass die Kinder im Frühjahr und Sommer die Felder bewachen mussten, damit die Rehe sie nicht kahl fraßen. Ein zweiter Wald gehörte dem Dorf, aber der lag auf der anderen Seite.
Brombeerhecken grenzten die Felder voneinander ab. Die ältesten waren so hoch gewachsen, dass ich nicht darübersehen konnte. Trotzdem fiel es mir leicht, meine Schwestern zu finden. Das lag an Trudchens vorlautem Mundwerk.
»Wann kommt denn endlich Madlen?«, hörte ich ihre schrille Stimme. Heinrich hatte immer gesagt, mit ihr könne man auch Rost vom Eisen kratzen.
»Ich bin ja schon da!«, rief ich, als ich die letzte Hecke hinter mir ließ.
Sie arbeiteten auf dem kleinsten unserer drei Felder, kaum größer als der Kräutergarten der Burg. Trudchen richtete sich auf, als sie mich sah. Schweißnasses Haar hing ihr ins Gesicht. Das Gebende trug sie am Gürtel. Weit und breit war kein Mann zu sehen, also zog ich meines auch ab und schüttelte die Haare aus. Eine Brise wirbelte sie durcheinander und kühlte meinen Kopf. Einen Moment lang fühlte ich mich frei.
»Hast du Brot?«, fragte Trudchen.
Ich hob die Hand hoch, in der ich den Beutel hielt. »Mit Soße.«
Sie lächelte breit. Hilde, meine jüngere Schwester, hockte ungerührt neben ihr am Boden und zog Wurzeln heraus. Trudchen tippte ihr auf die Schulter. Sie drehte sich um, sah mich – und den Beutel – und lächelte. Die Familienähnlichkeit war unverkennbar. Ich wusste nicht, ob auch ich so lächelte.
Ich ging am Rand des Feldes zu einem Baumstumpf, den Heinrich jahrelang hatte ausgraben wollen, öffnete den Beutel und breitete den Inhalt auf dem Baumstumpf aus.
»Wo ist Mutter?«, fragte ich, während ich mit meinem Messer die letzten Soßenreste vom Leinen kratzte und auf das Brot schmierte.
»Ich habe sie nach Hause geschickt.« Trudchen hockte sich neben mich und griff nach dem dicksten Brotkanten. »Sie ist ja schon fast umgefallen.«
Hilde kam hinzu. Dankbar berührte sie meinen Arm, dann begann auch sie zu essen. Seit einem schweren Fieber, das sie als Kleinkind beinahe umgebracht hatte, war sie taub. Sie hatte nie gelernt zu sprechen, stieß nur im Schlaf ab und zu stöhnende Laute aus. Kein Mann würde sie je heiraten, das wussten wir, obwohl wir nie darüber sprachen. Eine Mitgift hatten wir auch nicht für sie zusammengespart.
Trudchen würde noch im Frühjahr einen Gemüsebauern namens Hermann heiraten. Eine gute Partie, denn zwei unserer Felder lagen direkt neben seinen.
»Der letzte Winter war hart für Mutter«, sagte ich, während meine Schwestern aßen.
»Warte nur ab«, sagte Trudchen mit vollem Mund. Sie griff nach dem Lederschlauch, der an dem Baumstumpf lehnte, trank einen großen Schluck Bier und rülpste. »Mit der Wärme wird auch ihre Kraft zurückkehren. Sie bleibt uns noch lange erhalten.«
Trudchen hing sehr an Mutter, vielleicht weil sie ihre jüngste Tochter war. Ich war die älteste, die noch lebte.
Hilde nahm die letzten beiden Brotkanten und schlug sie wieder in das Tuch ein. Dann kehrte sie zurück zur Arbeit. Trudchen und ich folgten ihr. Uns blieb nicht mehr viel Zeit bis zur Roggenaussaat, da zählte jede Stunde.
Wir arbeiteten, bis wir kaum noch den Boden unter unseren Händen sahen, dann nahmen wir den fast leeren Schlauch und den Brotbeutel und gingen zurück ins Dorf.
Mit uns kehrten auch viele andere von ihren Feldern zurück. Man nickte sich zu, sagte aber kaum etwas. Müdigkeit drückte auf die Stimmung.
»Bist du schon aufgeregt?«, fragte Trudchen, als wir zwischen dunklen Hütten und an Kräutergärten vorbei auf die Kirche zugingen. Außer dem Meckern der Ziegen und dem Gackern der Hühner war kaum etwas zu hören.
»Weshalb?«
»Weshalb?« Sie verdrehte die Augen. »Tue nicht so weltgewandt. Wegen morgen natürlich.«
Die Pilgerfahrt. Trudchen konnte ja nicht wissen, was geschehen war.
Sie sah mich erwartungsvoll an. Ich wollte ihr vom Schultheiß erzählen, aber allein der Gedanke trieb mir die Tränen in die Augen. Schließlich nickte ich nur.
»Wann geht es los?«
»Wir treffen uns vor Sonnenaufgang an der Anlegestelle.« Die Lüge kam mir so leicht über die Lippen, dass ich mich schämte. Wieso konnte ich Trudchen nicht sagen, was geschehen war? Sie würde es doch ohnehin herausfinden, wenn sie mich am nächsten Morgen sah.
»Ich wünschte, ich könnte mitkommen.« Trudchen blickte ins Nichts. Es sah aus, als träume sie. »Köln. So weit weg.«
Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Schamesröte stieg mir ins Gesicht, aber es war so dunkel, dass weder Trudchen noch Hilde etwas davon bemerkten.
Wir überquerten den kleinen Kirchplatz mit seinem steinernen Brunnen und dem leeren Pranger und bekreuzigten uns, als wir am Friedhof vorbeigingen. Unsere Hütte lag am Dorfausgang. Morgens fiel der Schatten des Kirchturms über unseren Garten und den Hof, auf dem wir Hühner und zwei Ziegen hielten. Im Sommer folgten ihm die Tiere, bis sie der Reißigzaun, der unseren Hof von dem des Viertelhufers Klaus trennte, aufhielt. Klaus hatte sich sein Erbe mit drei anderen Brüdern teilen müssen und galt als der ärmste Bauer in ganz Winetre.
Ich zog die Tür unserer Hütte auf und schob den Wollvorhang dahinter zur Seite. Viehgeruch schlug mir entgegen. Eine Ziege meckerte leise. Ich hörte das Schnarchen meiner Mutter.
»Mama?«, fragte ich, während ich mich vorsichtig über das Stroh in den dunklen Raum tastete. Ich hatte Angst, auf ein Ei zu treten, das eines der Hühner vielleicht am Tag gelegt hatte.
Meine Mutter antwortete nicht.
»Lass sie schlafen«, flüsterte Trudchen. »Sie kann morgen früh essen.«
Ich streckte die Hand aus und fand einen der Stricke, die vom Dachbalken hingen. Ich knotete den Beutel daran fest, damit die Mäuse das Brot nicht annagten. Stroh raschelte, als sich Trudchen und Hilde hinlegten. Ich kratzte neben ihnen etwas davon zusammen und legte mich ebenfalls hin. Sie schliefen, noch bevor ich mich ganz ausgestreckt hatte. Ich lauschte ihren Atemzügen und fragte mich, was ich ihnen am nächsten Tag sagen würde. Meine Augenlider wurden schwer. Ich …
… schreckte hoch, saß plötzlich aufrecht im Stroh, als hätte mich etwas im Schlaf gestochen. Doch ich spürte keinen Schmerz, nur Unruhe. Trudchen seufzte neben mir und drehte sich auf die Seite. Die Stelle, an der mein Körper den ihren berührt hatte, wurde kalt.
Du wirst gehen!
Die Worte standen so klar in meinem Geist, dass ich mich fragte, ob es Gott selbst gewesen war, der mich mit ihnen aus dem Schlaf gerissen hatte. Er sprach manchmal direkt zu den Menschen, wenn ihm etwas wichtig war, das wusste ich. Er hatte einmal Bauer Markus verboten, eine Kuh zu schlachten, und sie hatte tatsächlich kurz darauf ein Kalb geboren, obwohl sie nicht trächtig gewesen war. Wenn Gott nun wollte, dass ich meine Söhne sah, dann …
Ich wagte es beinahe nicht, den Gedanken zu vollenden. Mein Herz schlug so schnell, dass mir übel wurde. Hatte ich nicht seinem Befehl zu folgen, so wie es sein Sohn, unser Herr getan hatte, so wie es all die Heiligen getan hatten und die Büßer, die ihren weltlichen Besitz hinter sich ließen und wie Vieh von dem lebten, was er ihnen schenkte? Gott stand über dem Schultheiß, über dem Grafen, sogar über dem König. Er war mein oberster Herr, kein anderer, schon gar nicht Karl der Kleine.
Ich richtete mich auf die Knie auf, zog den Wollumhang eng um meine Schultern und begann leise zu beten. Ich lauschte auf eine Stimme in mir, auf ein Wort, ein Zeichen, irgendetwas. Doch da war nur Stille. Was auch immer zu mir gesprochen hatte, war verschwunden.
Nach einer Weile begannen meine Knie zu schmerzen, also stand ich auf. Stroh fiel raschelnd zu Boden. Eine Maus quiekte in der Dunkelheit. Es war kalt in der Hütte. Bevor ich begriff, was ich tat, zog ich bereits den Vorhang zurück und öffnete die Tür.
Die Nacht war sternenklar und wolkenlos. Ich trat einen Schritt nach draußen und spürte kühlen Lehm unter meinen Fußsohlen. Alles wirkte seltsam gedämpft, als sei es nicht Wirklichkeit, sondern ein Traum.
Ich drehte den Kopf und sah zurück in die Hütte, erwartete schon, mich dort schlafend liegen zu sehen. Doch die Stelle neben Trudchen war leer, das Stroh zerwühlt. Ich wollte mich abwenden, als Hilde den Kopf hob. Ihr Blick traf den meinen. Im Mondlicht wirkte ihr Gesicht so rein und weiß wie die Gesichter der Heiligen, deren Bilder in der Kirche hingen.
Ich lächelte sie an. Sie sah ernst zurück, ließ den Kopf sinken und drehte sich auf die Seite.
Leise schloss ich die Tür. Das Dorf lag still und schlafend vor mir. Ich ging den breiten Weg an den Hütten vorbei, deren Schatten hart und scharf in die Nacht stachen, machte dann jedoch einen Umweg durch die Gärten, um nicht am Friedhof vorbei zu müssen. Das letzte Herbstlaub knisterte bei jedem Schritt unter meinen Füßen.
Durch die Lücken zwischen den Hütten sah ich die Kirche, den Brunnen und dann den Pranger. Gott allein würde entscheiden, ob ich daran endete. Ich versuchte nicht daran zu denken.
Das Dorf wirkte fremd und unheimlich in der nächtlichen Stille. An seinem Ende bog ich nach rechts ab. Der Rhein lag nur einen Steinwurf entfernt, ein diffuser schwarzer Gürtel, in dem sich das Mondlicht spiegelte. Boote lagen wie aufgeblähte tote Fische mit dem Kiel nach oben an seinem Ufer. Netze waren zwischen ihnen aufgespannt. Die Anlegestelle – ein paar Planken, die auf Pfählen in den Fluss hineinragten – befand sich wenige Schritte entfernt.
Ich wusste nicht, wie spät es war, aber es zeigte sich kein Streifen Licht am Horizont, kein Zeichen, dass die Nacht jemals enden würde. Kälte breitete sich vom Fluss über das Ufer aus.
Ich setzte mich zwischen zwei Booten in den Sand und wickelte mich in den Wollumhang ein. Mein Herz schlug nicht mehr so schnell wie zuvor. Ich gähnte, fühlte mich auf einmal müde und zerschlagen. Mit angezogenen Knien und unter dem Umhang verschränkten Armen lehnte ich mich an eines der Boote und betete darum, dass keiner der Pilger wusste, was sich zwischen dem Schultheiß und mir in der Burg abgespielt hatte.
Ich erwachte, als sich eine Hand auf meine Schulter legte.
»Trudchen?«, flüsterte ich und öffnete die Augen.
Im ersten Moment wusste ich nicht, wo ich war. Unter mir war kein Stroh, sondern Sand, und das Gesicht über mir war nicht das meiner Schwester, sondern das von Vater Ignatius. Ich sah die Falten um seine Augen, sein grau durchzogenes Haar, das vom Wind zerzaust wurde, und das Kupferkreuz, das vor seiner Brust hin und her schwang.
Und dann erinnerte ich mich. Es war, als träfe ein Stein meinen Magen. Ich zog die Luft so scharf ein, dass der Priester zusammenzuckte.
»Ich wollte dich nicht erschrecken«, sagte er. »Wir haben dich schlafen lassen, solang es ging, aber die Barke hat gerade angelegt. Wir müssen aufbrechen.«
Ich setzte mich auf. Sand rieselte von meinen Schultern.
»Guten Morgen, Langschläferin«, rief eine ältere Bäuerin. Ich kannte sie flüchtig. Sie stammte aus einem der Nachbardörfer.
Wilhelm, der Müller von Winetre, lachte, während er mit einem großen Beutel auf den Schultern zur Anlegestelle ging. »Hast Glück, dass wir dich zwischen den Booten gesehen haben, sonst wären wir ohne dich gefahren.«
Ich fragte mich, ob es nicht eher Pech war. Die Überzeugung, die mich in der Nacht aus der Hütte geführt hatte, war verschwunden, die Stimme in meinem Kopf halb vergessen, als hätte ich sie nur geträumt. Vielleicht stimmte das auch.
Vater Ignatius reichte mir einen Bierschlauch. Ich trank daraus. Das Bier war warm, hatte wohl neben dem Feuer gelegen, das zwei Männer gerade mit Sand löschten. Der Drachenfels ragte hinter ihnen im ersten Tageslicht auf.
Gertrud, Klara und die anderen Mägde würden sich bald auf den Weg zur Burg machen. Sie würden an meiner Hütte klopfen und von Trudchen erfahren, dass ich mich auf dem Weg nach Köln befand. Ich wusste nicht, was danach geschehen würde.
»Wo sind deine Sachen?«, fragte Vater Ignatius.
Ich sah mich um, doch dann fiel mir ein, dass ich nichts mitgenommen hatte, noch nicht einmal einen Bierschlauch.
»Verzeiht, Vater«, sagte ich. »In der Aufregung …«
Der Priester zog die Augenbrauen zusammen. Ich dachte schon, er wäre verärgert, doch dann lächelte er. »Gott wird dich schon nicht hungern lassen.«
Die Barke, die an der Anlegestelle auf uns wartete, war so lang wie der Küchentrakt auf Burg Drachenfels, aber weitaus schmaler. Schweine und Schafe standen eingezäunt darauf. Der Wind trug ihren Geruch bis zum Ufer. Ein Mast ragte in den Himmel. Zwei Matrosen rollten das Segel aus, das daran hing. Ein dritter Mann lehnte an dem langen Ruder am Heck des Schiffs und rief ihnen Befehle zu.
Die meisten Pilger waren bereits an Bord. Ich kannte sie, wenn auch nicht alle mit Namen. Es waren größtenteils wohlhabende Bauern, die sich vom Frondienst in der Burg freigekauft hatten. Ich atmete auf, als mir klar wurde, dass keiner von ihnen wissen konnte, was geschehen war.
Der Ritter, von dem Vater Ignatius gesprochen hatte, saß am Ufer auf seinem Pferd. Seine Rüstung bestand aus einem Beinteil, zwei Schulterstücken und einer verrosteten Brustplatte. Sein Schwert lag in Tücher eingewickelt hinter ihm auf dem Sattel. Er schwankte, und als ich näher kam, roch ich Wein.
»Das ist Hubert von Alen«, sagte Vater Ignatius, der meinen Blick bemerkt haben musste, leise. »Er wird uns auf unserer Reise beschützen.«
Ich knickste tief und senkte den Kopf. »Guten Morgen, werter Herr.«
Der Ritter antwortete nicht. Sein Gesicht war rot und aufgedunsen, seine Nase die eines Trinkers. Ohne mich anzusehen, gab er seinem Pferd einen kurzen Tritt in die Flanken und ritt an Bord der Barke. Vater Ignatius folgte ihm.
Ich blieb stehen, zögerte und dachte daran, dass es noch nicht zu spät war. Wenn ich mich beeilte, wenn ich wie der Wind den Berg hinauflief, würde ich die Burg erreichen, bevor Gertrud dem Schultheiß etwas erzählen konnte.
»Worauf wartest du?«, fragte der Priester neben mir. »Willst du die Heiligen Drei Könige nicht sehen?«
Ich konnte es schaffen. Alles würde weitergehen wie zuvor, und irgendwann würden Hugo und Konrad vor der Tür stehen. Wenn nicht in diesem, dann im nächsten Jahr.
Nächstes Jahr.
»Natürlich will ich sie sehen«, sagte ich und folgte Vater Ignatius an Bord.