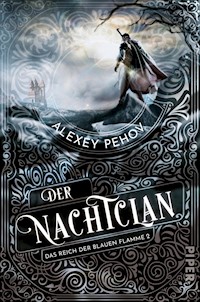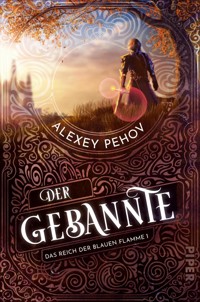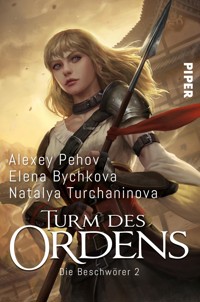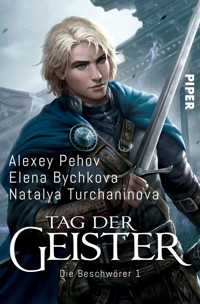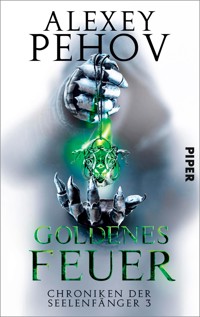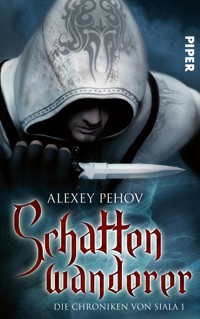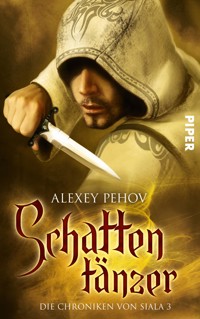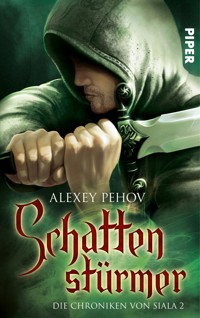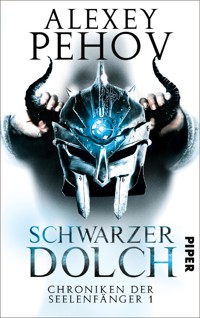9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In der altehrwürdigen Stadt Rapgar geschehen rätselhafte Morde, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. Als Till er'Cartya, Nachfahr einer alten Magierfamilie, zu Unrecht beschuldigt wird, ein Mitglied der Herrscherfamilie umgebracht zu haben, begibt er sich auf die Suche nach dem wahren Täter. Dabei begegnet er der geheimnisvollen Erin, die von finsteren Gestalten gejagt wird. Doch durch ihre Nachforschungen ziehen Till und Erin die Aufmerksamkeit der falschen Personen auf sich und stoßen zudem auf Hinweise, dass hinter den Morden eine Verschwörung steckt, die ganz Rapgar ins Verderben stürzen könnte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Übersetzung aus dem Russischen von Christiane Pöhlmann
ISBN 978-3-492-97965-8
© Alexey Pehov 2009
Titel der russischen Originalausgabe: »Peresmešnik« bei AL’FA-KNIGA, Moskau 2010
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Karte: Vladimir Bondar nach einer Vorlage von Alexey Pehov
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Lena Bycova und Nataly Turova gewidmet, die mir Erin und Bess vorgestellt haben, sowie allen, die gern in Rapgar bleiben möchten. Ihr seid herzlich willkommen!
Scham- und seelenlos die Hyäne verzehrt
das Fleisch toter Menschen, die im Grabe ruh’n;
doch den Namen der Toten sie nicht entehrt –
dieseSchändung ist menschliches Tun.
Rudyard Kipling
Haben Sie keine Angst um die Zukunft. Seien Sie wachsam, seien Sie stark, seien Sie klarsichtig, aber machen Sie sich keine Sorgen. […] Gestern stand ich auf der Kommandobrücke und beobachtete, wie dieses Schiff durch die haushohen Wellen pflügte und ihrer Wut trotzte. Da habe ich mich gefragt, warum das Schiff über die Wellen triumphiert, von denen es so viele gibt, während das Schiff auf sich allein gestellt ist. Der Grund ist der, dass das Schiff ein Ziel hat, die Wellen aber keines haben. Sie schwappen lediglich umher, unermüdlich, ohne jedoch etwas zu bewirken. Das Schiff, das ein Ziel hat, bringt uns dorthin, wo wir hinwollen.
Winston Leonard Spencer Churchill Inhalt
Inhalt
Cover & Impressum
Karte
1-Eilzug No 9
2-Im Zug nach Norden
3-Am Hauptbahnhof
4-Das Haus in der Hyazinthenstraße
5-Der Waffennarr
6-Der Empfang bei Catherine
7-Xer Scheintot
8-Ein Tupfer Grau
9-Der Direktor und der Henker
10-Dante
11-In der Arena
12-Das Duell
13-Ungebetene Gäste
14-Grub
15-Katzenhof
16-Der Kreis der Krallen
17-Die Maus der Mashetter
18-Der Greis in der Kirche
19-Die Tochter der Kinderdiebin
20-Ein volles Haus
21-Der alte Fuchs
22-Der Stadtfürst und der Direktor a. D.
23-Der Klee des Alleinzigen
24-Alissia
25-Das lodernde Schwert
26-Das Tor
1
Eilzug No 9
»Mein Junge! Hättest du vielleicht die Güte, mir zu erklären, was du dir dabei nun schon wieder gedacht hast?«, meckerte Stephan los, kaum dass ich die Kutsche verlassen und dem Mann oben auf dem Bock zum Abschied ein kleines Trinkgeld zugesteckt hatte.
»Was ich mir wobei gedacht habe?«, stellte ich mich voller Genuss dumm, während ich dem Wagen nachsah, der über die malerische Lindenallee zurück in Richtung des hinter Hügeln verborgenen Autumnhill davonfuhr. »Etwa dabei, dem Kutscher eine Anerkennung in klingender Münze zukommen zu lassen?«
»Nein! Dabei, dass wir uns jetzt eine Viertelmeile lang die Hacken wundlaufen dürfen! Beim Alleinzigen! Das überstehen meine armen Füße niemals!«
»Darf ich dich daran erinnern, dass du überhaupt keine Füße hast«, flötete ich. »Und gegebenenfalls auch gar nichts mit ihnen anzufangen wüsstest.«
»Was bist du nur für ein Banause, so eine Meinung von mir und meinen Fähigkeiten zu haben!«, brauste Stephan auf. »Was aber deine Frage angeht, ob dieser sogenannte Kutscher eine Anerkennung in klingender Münze verdient – der Bursche ist ein Dieb. In gehobenen Kreisen drückt man einem Dieb keine Münze in die Hand, sondern jagt ihn mit einem Tritt in den Allerwertesten davon.«
»Du, mein alter Freund und Gefährte, solltest doch wohl am besten wissen, dass es in gehobenen Kreisen von Dieben nur so wimmelt!«
Mit einem unzufriedenen Murren erkannte er mir diesen Treffer zu.
»Dieser Kutscher«, fuhr er dann aber beharrlich fort, »hat gestern Abend, während ihr betrunkenen Stiesel in dem jungen Eichenwäldchen auf Waldschnepfenjagd gewesen seid, einen Roséschaumwein stibitzt.«
»Meine Güte, der arme Bursche wollte sich die Kehle ebenfalls ein wenig anfeuchten«, entgegnete ich. »Sei doch nicht derart kleinkariert und knauserig!«
Während ich meinen Weg fortsetzte, sog ich die frische Luft ein. Man sollte wirklich öfter hinaus ins Grüne. Die Natur bot dem Auge nun einmal mehr als die Straßen Rapgars.
»Wenn der arme Bursche tatsächlich nur etwas hätte trinken wollen, hätte ich ihn mit Freuden auf den Fluss in seiner Nähe hingewiesen«, giftete Stephan. »Du kannst einem dreckigen Dorfbengel doch nicht durchgehen lassen, dass er seinen Durst mit Schaumwein aus den besten Provinzen Chevilles stillt. Eine einzige Flasche davon kostet vierzig Farteigns! Vierzig Farteigns, das sind viertausend Zelinen! Wo kommen wir denn da hin?! Zu Zeiten deines seligen Urgroßvaters – möge er seinen Frieden in der Urlohe gefunden haben! – hat man solche Filous ordentlich verdroschen …«
»Und ihnen bei der Gelegenheit gleich auch noch die Haut vom Leibe abgezogen«, murmelte ich. Meine aufgeräumte Stimmung war wie weggeblasen. »Wir können von Glück sagen, dass wir nicht mehr in ganz so wüsten Zeiten leben. Die Welt braucht Frieden und Eintracht, Stephan.«
»Die Welt braucht Feuer und Eisenstangen«, ereiferte sich mein guter alter Spazierstock. »Ohne diese beiden Utensilien ist es nämlich schon bald aus mit deiner Welt.«
»Da spricht mal wieder die blutdürstige Dämonenseele aus dir«, tadelte ich ihn.
Was ich schon in der nächsten Sekunde bereute.
»Wir Amnes haben keine Seele. Im Übrigen habe ich dich schon wiederholt gebeten, mich nicht Dämon zu nennen. Das ist bestenfalls beleidigend, schlimmstenfalls noch mehr!«
»Tut mir leid«, entschuldigte ich mich sofort, wollte ich es mir doch ersparen, mir die nächsten zwei Stunden weitschweifige Vorträge über den Charakter von Wesen aus der Urlohe anzuhören, die vermittels Magie in einen Gegenstand gezwängt worden waren.
»Wenn du erst einmal mein Alter erreicht hast, mein Junge …«
»Keine Sorge, das werde ich bestimmt nicht«, unterbrach ich ihn.
Nun war es an Stephan, sich auf die nicht vorhandene Zunge zu beißen.
»Ich frage mich immer noch«, wechselte er denn auch rasch das Thema, »ob es wirklich klug war, unsere ursprünglichen Pläne über Bord zu werfen. Wolltest du nicht eigentlich bis Ende der Woche in Autumnhill bleiben? Stattdessen haben wir kaum einen Tag dort verbracht und sind …«
»Die Sintreens werden das schon verstehen, obendrein habe ich mich bei ihnen für meinen überstürzten Aufbruch entschuldigt.«
»Ja – schriftlich! Der Anstand hätte jedoch verlangt, dass du das persönlich tust. So hat dein Aufbruch einer Flucht geglichen.«
Was sollte ich dazu sagen? Stephan hatte ja recht. Doch nachdem Clarissa mit ihren vermaledeiten Brüdern eingetroffen war, hatte ich es nicht eine Sekunde länger bei den Sintreens ausgehalten. Daran traf Clarissa im Grunde keine Schuld. Oder zumindest nicht die alleinige.
Die letzten anderthalb Jahre war ich dem falschen Glanz dieser höchsten Kreise Rapgars weitgehend ferngeblieben, hatte ich mir das ganze leere Geschwätz über das Wetter, Polo, Pferderennen und neu eröffnete Heilbäder erspart. Zur Strafe bedachten all die schönen Damen in ihren schwarzen Abendkleidern und die eleganten Herren in Smoking oder Frack meine bescheidene Person nun bestenfalls mit neugierigen Blicken, schlimmstenfalls jedoch mit Mitleid, Angst oder echter Verachtung. Auf Ersteres konnte ich getrost verzichten, Mittleres amüsierte mich ein wenig, Letzteres ließ mich völlig kalt. Dennoch mied ich die Zusammenkünfte dieser Herrschaften.
Mein alter Freund Dante begriff das beim besten Willen nicht, weshalb er ständig verlangte, ich solle mir Satisfaktion vom Leben holen, mich aber nicht wie ein Einsiedler zurückziehen.
»Genieße dein Leben, Till! Genieße es«, riet er mir gern, wenn er selbst in melancholischer Stimmung war.
Bei solchen Gelegenheiten verkniff ich mir stets grinsend die Bemerkung, Dante selbst verlasse seine vier Wände ja auch nicht gerade häufig und halte obendrein die Hälfte der adligen Herrschaften Rapgars für ausgemachte Grobiane. Ein echter Luxer wie er, so tönte mein Freund gern, würde in Anwesenheit dieser Pinsel unweigerlich aus der Haut fahren.
»Und ich«, hatte ich ihm einmal gestanden, »schlafe ein, wenn ich mir sämtliche Einzelheiten über den Kauf eines neuen Trabers anhören muss. Das Geschwätz über bevorstehende Bälle, die jüngsten Entwürfe der Schneider Chevilles oder den werten Herrn N., der die holde Dame N. in den Armen des elenden A. erwischt habe, weshalb am nächsten Freitag ein Duell anberaumt sei, ermüdet mich. Für sechs Jahre habe ich die Rapgarer Bühne gegen meinen Willen verlassen müssen – aber an diesen ach so geselligen Zusammenkünften hat sich nicht das Geringste geändert!«
Dante hatte daraufhin bloß geschnaubt, und unser Gespräch war damals erloschen wie die Flamme des Glaubens an den Alleinzigen im Herzen eines schwarzhäutigen Ogano …
Auf dem Weg zum Bahnhof sog ich die klare Landluft ein. Sie roch nach Herbstlaub, frischer Milch, gerösteten Kastanien und Nebel, der erst vor Kurzem in die bunten Wälder abgezogen war.
Schon als kleiner Junge hatte ich den Herbst gemocht. Trotz des Regens gab es für mich keine herrlichere Jahreszeit. Der Winter war mir zu kalt, der Frühling fegte mir zu heftig mit seiner steifen, vom Meer kommenden Brise durchs Land, der Sommer brachte mich mit seiner beklemmenden Hitze um. Im Herbst dagegen zeigte sich die Welt von ihrer schönsten Seite, wartete mit einem kristallklaren Himmel und einer atemberaubenden Farbenpracht aus Feuerrot, Gold, Orange, Gelb, Ocker und Zartblau auf.
Möglicherweise hielte diese Begeisterung keiner soliden Prüfung stand, möglicherweise hatten es mir leuchtende Farben auch erst angetan, seitdem mich die Burschen aus Squagen Chause in einer unglücklichen Frühlingsnacht vor nunmehr siebeneinhalb Jahren in ein recht graues Gemäuer verfrachtet hatten.
»Wir kommen zu spät«, nörgelte Stephan schon wieder.
Ohne innezuhalten, zog ich die an einer goldenen Kette befestigte Uhr aus der Tasche meiner Weste und ließ den mit einer aparten Gravur verzierten Deckel aufspringen.
»Falsch«, antwortete ich nach einem Blick auf die wie aus Feuer, Wasser und Luft geformten Zeiger. »Wir treffen sogar überpünktlich ein.«
»O nein, wir kommen zu spät. Wenn du nicht endlich einen Zahn zulegst, verpassen wir den Zug und müssen uns wieder in irgendeinem Wirtshaus die Zeit um die Ohren schlagen. Darf ich dich an das höchst fragwürdige Gebräu erinnern, das man in solchen Einrichtungen als Kaffee bezeichnet? Im Zug müssen wir uns dann mit allerlei Gesindel in einen Wagen zweiter Klasse zwängen, dessen Fenster nicht schließen, sodass in einem fort ekelhafter Qualm hereinweht!«
»Wir sind erst ein einziges Mal in einer solchen Situation gewesen, und das war vor zehn Jahren!«
»Dennoch erinnere ich mich daran nur zu gut, mein junger Freund, ich habe nämlich ein vorzügliches Gedächtnis! In dem ist jeder einzelne Tag der letzten fünfhundert Jahre aufbewahrt! Solange stehe ich nun nämlich schon im Dienste deiner Familie, erst bei deinem Urgroßvater, dann bei deinem Großvater und deinem Vater und nun bei dir.«
»Es werden wohl noch einige Tage hinzukommen«, murmelte ich, »denn ich habe nicht die Absicht, dich auf der Stelle in die Freiheit zu entlassen.«
»Darum habe ich ja auch gar nicht gebeten.«
Vermutlich war das nicht einmal gelogen. Einerseits konnte Stephan es gar nicht abwarten, in die Urlohe einzugehen und dort seinesgleichen, aber auch meine Vorfahren wiederzusehen, andererseits lauerte er nicht unbedingt auf meinen Tod –und nur er würde den Amnis aus dem Spazierstock freisetzen.
»Hast du gehört, wovon man gestern im Sommerhäuschen beim Fünfuhrtee gesprochen hat?«, erkundigte sich Stephan, der ein Thema jederzeit so schnell wechseln konnte wie ich meine Handschuhe.
»Hilf mir auf die Sprünge!«, verlangte ich. »Waren es Pferderennen, ein drohender Krieg, die Geschäfte in den Kolonien oder Spekulationen an der Börse? Oder ging es darum, wie man endlich Frieden zwischen den Yenalssöhnen und den Malosanniern stiftet? Denkbar wäre natürlich auch, dass man die Frage erörtert hat, wie man die Skangher ein für alle Mal aus Einöd verjagt. Oder nein – das Einbürgerungskomitee gedenkt, fortan von seinem eigenen Kopf Gebrauch zu machen und sich nicht länger vom Bürgermeister auf der Nase herumtanzen zu lassen. Hat der letzte Aufstand in Jockjump, bei dem ganze Straßenzüge verheert wurden, die Stadtherren also endlich zur Besinnung gebracht? Zeit wurde es, denn die Kagas und Mamwrase verlieren allmählich die Geduld, weil Rapgar es wieder und wieder aufschiebt, ihnen volle Bürgerrechte einzuräumen. Der Stadtrat täte mithin gut daran, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Nicht, dass Schmauch und Asch am Ende dem Erdboden gleichgemacht werden und Rapgar ohne seine Fabriken dasteht!«
»Nichts von alledem trifft auch nur annähernd zu! Nein, Thema des Tages war ein Prophet, der kürzlich in Andersartlerend aufgetaucht ist.«
»In unseren wirren Zeiten tauchen Propheten doch noch schneller auf als Mitmaker, die ein tüchtiger Regenguss aus ihrem Grab holt und von Totreich aus durch die halbe Stadt jagt.«
»Dieser Prophet, o mein weiser Freund, unterscheidet sich ein wenig von den Heerscharen der üblichen Scharlatane.«
»Und wodurch, o mein wortgewandter Amnis? Kündigt er etwa nicht die Allumfassende Finsternis an, die eintritt, sobald wir Luxer die Macht an uns gerissen haben? Unkt er etwa nicht von einem Blutregen, mordlustigen Kröten, dem Tod von Jungfrauen oder der Rückkehr aller Yenalssöhne in ihre angestammte Heimat? Verzichtet er gar auf einen Skangher, der aus irgendeinem Müllhaufen heraushuscht und dann den Stadtfürsten meuchelt?«
»Bist du jetzt fertig?«, stöhnte Stephan. »Clarissas Ankunft in Autumnhill muss dich ja ernsthaft aus der Bahn geworfen haben …«
»Eher die ihrer kreuzdämlichen Brüder. Wenn ich meinem Herzen freien Lauf gelassen hätte, dann hätten sie diesen Besuch nicht überlebt«, brummte ich, lüftete gleichzeitig aber den Hut, da eine Dame von Stand in einer offenen Kutsche in Richtung Autumnhill an mir vorbeifuhr. »Verrätst du mir nun, was es mit diesem Propheten auf sich hat?«
»Angeblich hat er die Morde in Grub bereits vor einer Woche angekündigt.«
»Spielst du auf den Tod der beiden Herren an, die dem Geviert der Wunscherfüllung einen Besuch abgestattet haben? Die Zeitungen behaupten, die Opfer seien regelrecht gemetzelt worden. Hat sich Squagen Chause eigentlich schon dieses Propheten angenommen? Was, wenn seine Unkerei gar keine ist? Was, wenn er diese Morde gar nicht im Kaffeesatz gelesen hat – sondern selbst die grausamen Taten verübt hat?«
»Denkbar wäre es«, bemerkte Stephan leichthin. »Andererseits gibt es in Rapgar viel zu viele irrsinnige Menschen, denen höchst grausame Verbrechen zuzutrauen sind. Denk nur an die ganzen Sekten und Geheimgesellschaften, die in der Stadt ihr Unwesen treiben, dazu noch das Pack aus Vierteln wie Grub und Verrost, von den Herrschaften in Einöd ganz zu schweigen.«
»Was hat dein Prophet über unsere ruhmreiche Stadt denn sonst noch so zu sagen gewusst?«
»Dass diese Morde erst der Anfang sind. Aber bevor ich mehr erfahren konnte, ist Clarissa aufgetaucht – und du bist Hals über Kopf aus dem Teepavillon gestürzt.«
»Zu dumm«, murmelte ich, während ich vom Hauptweg auf einen schmaleren Pfad einbog, eine Abkürzung zum Bahnhof.
Bis zur Abfahrt des Eilzugs No 9 blieb nun wirklich nicht mehr viel Zeit.
»Aber wenn ich alldem trauen darf, was ich bis dahin belauscht habe, müssen wir uns auf das Schlimmste gefasst machen. Denn es wird weitere Morde geben.«
»Wenn du es sagst.«
Mein Herz bestand beileibe nicht aus Stein, aber es beunruhigte mich in der Tat kaum, ob irgendein Geisteskranker, der sich an dem aus der Mondbaumwurzel gewonnenen Pulver überfressen hatte, noch ein paar Herren abschlachtete, die ihrerseits tüchtig in den sündigen Apfel der Verworfenheit gebissen hatten. Grub war und blieb nun einmal Grub. Wer sich dorthin begab, wusste, dass er Gefahr lief nicht zurückzukehren.
Sicher, in Einöd, Nichteinnichtausstadt und Stätt ging es noch weit grausamer zu, doch auch in Grub waren Mord und Totschlag an der Tagesordnung. Verwunderlich war das nicht, lebten dort doch einfach viel zu viele Wesen auf engstem Raum zusammen.
Die Schmierfinken von den Zeitungen hatten sich jedoch allesamt auf die beiden letzten Morde gestürzt, welche die gleiche Handschrift aufwiesen: Beide Male waren zwei ehrbare Bürger ins Jenseits befördert worden. Fast konnte man meinen, ein Tru Tru oder sonst irgendein Menschenfresser hätte nach einer bitteren Hungersnot zugeschlagen. Die Aufmerksamkeit der Journaille würde sich also noch ein Weilchen auf Grub konzentrieren. Bis dann die nächste Sensation zu vermelden war …
Wer freilich in Grub lebte, dürfte kaum darüber entzückt sein, dass es in den Straßen mit einem Mal von den blauen Uniformen aus Squagen Chause nur so wimmelte. Gendarmen sah man in diesem Viertel nämlich nicht besonders gern.
Mit dem Spazierstock schob ich einen Zweig zur Seite, der vor meiner Nase hing.
Die Sonne stand bereits über den malerischen Hügeln, ihre Strahlen bohrten sich hartnäckig durch das Flechtwerk der Lindenäste. Auf dem verdorrten Gras und an den Spinnennetzen schimmerten jedoch noch einzelne Tautropfen. Rechter Hand verlief eine Steinmauer, welche die dahinterliegenden Felder gegen den Pfad abschirmte. Dort hatte ein Tier, vermutlich ein streunender Hund, halbherzig versucht, einen Gang zu graben. Hinter den Ebereschen, deren Beeren bereits orange und feuerrot leuchteten, ragte die Turmspitze einer Kirche des Alleinzigen auf.
Meine Reise nach Autumnhill hatte ich in der felsenfesten Überzeugung angetreten, es würde mir guttun, das wuselige Rapgar ein Weilchen hinter mir zu lassen und die Zeit bis zum Winter auf dem Lande zu verbringen, um mich dort an der herrlichen Umgebung zu erfreuen. Doch schon beim Aufbruch hatte meine innere Stimme geunkt, dass der Plan bestimmt in die Binsen gehen würde. Rapgar war wie ein Krake, der mit seinen Tentakeln nach der Seele eines jeden grapschte. Und wen sich diese Ausgeburt der Urlohe erst einmal geschnappt hatte, den gab sie nicht wieder frei.
Rapgar war meine Heimatstadt. Ich liebte und ich hasste sie gleichermaßen. Und ich entkam ihr nicht. Gelegentlich aber, so wie eben bei diesem kleinen Ausflug, gönnte ich mir die Illusion, die Stadt besäße keine Macht über mich. Wie sagt Stephan doch immer? Um glücklich zu sein, brauchen wir ein paar Illusionen. Von Erfolg im Leben abgesehen, versteht sich.
Der leicht ansteigende Pfad brachte mich zu der Straße, die von Landswigg, einer kleinen Imkerei zwei Meilen von Autumnhill entfernt, zur Stadt führte, eine Abkürzung zum Bahnhof. Wenn ich sie nahm, würde ich den Zug auf alle Fälle erreichen. Würde ich ihn nämlich verpassen, läge mir Stephan den ganzen Tag in den Ohren, dass wir die Kutsche nicht hätten verlassen sollen.
»Wir kommen zu spät«, maulte mein Spazierstock denn auch schon wieder.
Ob er meine Gedanken gelesen hatte?
»Ein Luxer kommt nie zu spät«, hielt ich dagegen. »Eine derartige Unhöflichkeit würde er sich selbst niemals verzeihen. Deshalb ist es, wenn er am Ziel eintrifft, stets die exakt angemessene Zeit.«
Das waren Stephans Worte. Er hatte sie mir an den Kopf geknallt, als ich ein Junge von acht oder neun Jahren gewesen war. Mit seinen eigenen Waffen geschlagen, gab er vorerst Ruhe.
Auf der Straße begegnete mir niemand, sodass ich mich nicht am Rand halten musste, damit etwaige Reiter oder Wagen an mir vorbeiziehen konnten. Allerdings waren in dieser Ödnis elegante Fortbewegungsmittel wie ein Reitpferd oder eine Schlafkutsche ohnehin eine Seltenheit. Eher lief einem noch eine Kuh oder eine Ziege, vielleicht auch ein Vertreter des Kleinen Volks über den Weg …
Irgendwann sah ich vor mir abermals eine Kirche, einen düsteren Bau aus schlecht behauenem, grauem Stein mit schwarzen Dachpfannen und dreckigen Buntglasfenstern. Die siebenseitige Kirchturmspitze wurde von einem feuerroten, Tag wie Nacht brennenden Zeichen der Urlohe des Alleinzigen bekrönt.
An die Kirche schloss ein kleiner Friedhof mit auffällig gepflegten Gräbern und weißen Statuen an. Auf drei Gräbern am hinteren Ende leuchteten zwei schwarze und ein bernsteinfarbenes Licht. Hier waren Luxer gestorben, die schwarze beziehungsweise bernsteinfarbene Augen gehabt hatten. Auch rote, aschgraue, indigoblaue oder grüne Lichter wären bei uns Luxern noch denkbar, denn bei diesen Flammen handelte es sich nicht um gewöhnliche Grablichter, sondern um den Atem der Urlohe – die wiederum der Ort war, an den tote Luxer eingingen.
Gedankenversunken blieb ich kurz stehen. Dieses warme Grablicht auf einem Friedhof war das Einzige, was von Wesen wie mir nach dem Tod blieb. Nach ein paar Jahrhunderten würde auch diese Flamme erlöschen und sich wie Nebel auflösen.
»Früher hat hier ein Mitmaker gelebt«, durchbrach Stephan mein Schweigen. »Gelegentlich ist er aus dem Grab da drüben, dem bei der alten Eberesche, herausgekommen und dann, umschwirrt von zahllosen Fliegen, durch die Gegend gestreift. Er hat sich leidenschaftlich gern am Straßenrand versteckt und abends einsame Reisende erschreckt.«
»Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen daraufhin gleich scharenweise das Zeitliche gesegnet haben«, erwiderte ich grinsend. Ein Mitmaker ist eigentlich ein völlig harmloser Untoter. Doch in dieser Ödnis dürfte sein Auftritt recht effektvoll gewesen sein …
»Das haben sie, ganz recht.«
»Haben die purpurnen Uniformen aus Squagen Chause dem Treiben des Herrn Mitmaker denn kein Ende gesetzt?«
»Die hatten damals in Rapgar auch so schon alle Hände voll zu tun. Der Mitmaker ist allerdings eines Tages einem Pickler in die Arme gelaufen. Der hat den Burschen dann mit seinem elektrischen Blitz geröstet.«
»Na, da hat sich der Herr ja mit dem Richtigen angelegt. Wusste er nicht, dass Pickler nicht den geringsten Sinn für Humor haben?«
»Was verlangst du von denen auch noch Humor, wo sie doch schon über den Saft des Lebens, die Quelle des Fortschritts und der Aufklärung …«
»… mit einem Wort über Elektrizität verfügen«, fuhr ich Stephan in seine fantasievollen Umschreibungen. »Und die ist der neue Gott in Rapgar, mögen diese Worte auch noch so frevelhaft in deinen Ohren klingen.«
Schweigend setzte ich meinen Weg fort. Erst als ich die Stadt erreichte, wandte ich mich wieder an meinen Amnis: »Die Tropaeoler sind doch wirklich pfiffige Burschen«, nahm ich unser Gespräch wieder auf. »Wer sonst hätte die Talente der Pickler so für sich zu nutzen gewusst? Wenn wir in Rapgar geborene Erfinder haben, dann sie.«
»Dafür musst du dem Ururgroßvater des gegenwärtigen Stadtfürsten danken«, erwiderte Stephan, »denn er hat es diesen oberschlauen Pflanzen erlaubt, sich in der Stadt anzusiedeln. Anfangs hatte Rapgar nicht mal einen Vorteil davon, aber in den letzten einhundert Jahren hat sich das geändert, da wurden dank der Kresseköpfe enorme Fortschritte erzielt.«
»Nur geht die Welt leider dennoch den Bach runter«, konterte ich. »Deshalb werden immer mehr Stimmen laut, die verlangen, man müsse die Tropaeoler mit Stumpf und Stiel ausrotten, bevor sie womöglich eine Waffe entwickeln, mit der man die ganze Welt vernichten könnte.«
»Lass die Kinder der Reinheit ruhig krakeelen!«, ereiferte sich Stephan. »Dieser lächerlichen Sekte fehlt der Mumm, mit Hacke und Beil gegen die Tropaeoler vorzugehen!«
Dem konnte ich nicht widersprechen. Diese Kindsköpfe wollten zurück in die dunklen Jahrhunderte, in denen von Fortschritt keine Rede sein konnte und die Menschen im Einklang mit der Natur lebten, will heißen in finsteren Wäldern hausten, in dreckigen Höhlen und ohne warmes Wasser aus dem Hahn. Zum Glück zählte die Sekte aber nur wenige Mitglieder, sodass sie zwar allen mit ihrer Idee, die Tropaeoler zu vernichten, in den Ohren lag, jedoch nicht zur Tat schritt. In Sicherheit durfte man sich deswegen allerdings nicht wiegen, nicht bei uns in Rapgar. Hier fand sich irgendwann immer ein Narr, der zur Axt griff oder die Lunte an ein Pulverfass legte – und dann würden sowohl Späne als auch Köpfe durch die Luft fliegen.
Rapgar brodelte. Dem einen passten die Menschen nicht, dem anderen missfielen die Kagas, irgendjemand konnte Zavyre oder Fosissen nicht ausstehen, wieder andere hassten uns Luxer. Jeder musste ständig auf der Hut vor jedem sein und konnte nur darauf hoffen, dass der Alleinzige uns davor bewahrte aufeinander loszugehen. Denn weder die Zivilisation noch der enorme Fortschritt in den letzten Jahren hatten den Rassenhass in unserer Stadt auslöschen können. Bräche er ungehemmt aus, würde ganz Rapgar in den Abgrund stürzen.
Obwohl von den Eisenbahnschwellen der Geruch von schwarzem Teer herüberwehte, war der kleine Bahnhof ebenso in Wohlgeruch gehüllt wie eine Dame von Welt in die Duftwolke teurer Parfüms aus Cheville. An der hiesigen Uhr wanderten über ein weißes Zifferblatt lanzenartige Zeiger, welche die Zeit allerdings rückwärts maßen. Die Kagas bildeten sich enorm viel auf die Pünktlichkeit ihrer Züge ein. Tatsächlich war in der Geschichte der Dampfloks bisher keine einzige Verspätung zu vermelden gewesen.
Bis zur Abfahrt des Eilzugs No 9 blieben noch knapp zehn Minuten.
Ich lief den mit Holzbalken ausgelegten Bahnsteig zur Kasse hinunter. Zum Glück gab es keine Schlange. Am Schalter saß eine grauhaarige, in ein flauschiges weißes Schultertuch gehüllte Frau, die mir das Billett für die erste Klasse samt den besten Wünschen für eine gute Reise aushändigte.
Auf dem Bahnsteig warteten außer mir nur wenige Fahrgäste. Sie hatten sich weit vorn aufgebaut, wo die Wagen dritter Klasse anhalten würden. Bei ihnen handelte es sich ausnahmslos um Menschen.
Als der Bahnhofsvorsteher, ein Mann, der schon in die Jahre gekommen war, an mir vorbeitrottete, funkelten mich die goldenen Knöpfe seines Uniformrocks an. Kaum hatte er an der Farbe meiner Augen erkannt, dass hier ein Luxer den nächsten Zug zu besteigen gedachte, legte er zum Gruß die Hand an den lackierten Schirm seiner flachen Mütze.
Ein Schuhputzer saß, gegen den Pfahl einer Gaslaterne gelehnt, auf dem Boden und langweilte sich ganz offenkundig. Bei meinem Anblick kam jedoch Leben in ihn. Für nur wenige Zelinen säuberte er meine spitz zulaufenden Schuhe, die auf dem Weg zum Bahnhof ordentlich eingestaubt worden waren. Nach der Prozedur glänzten sie wieder derart, dass man sich in ihnen hätte spiegeln können. Anschließend erwarb ich bei einem Zeitungsjungen noch die neueste Ausgabe der Rapgarer Zeiten. Ich rollte sie zusammen und trat, von aufgeregtem Gefiepe angezogen, an den Rand des Bahnsteigs.
Auf den gusseisernen Schienen herrschte ein furchtbares Gewusel. Dort hatten sich Vertreter des Kleinen Volks versammelt, um den einfahrenden Zug zu begrüßen. Diese Wesen vergötterten den Fortschritt, auch wenn er ihnen bereits enormen Schaden zugefügt hatte. Die Dampflokomotive der Kagas hielten sie für eine Art Gottheit, der es zu huldigen galt. Noch während der Lobpreisung des donnernden Monstrums starben Dutzende der Winzlinge, wurden von dem tonnenschweren, Dampf speienden Ungeheuer schlicht platt gewalzt. Doch auf die Idee zu bremsen kam niemand …
Die männlichen Winzlinge hatten anlässlich der Dampfzughuldigung ihre Festgewänder angelegt, die aus Blumen und Kräutern geflochten waren, die weiblichen waren in ihre schönsten Kleider geschlüpft, gewebt aus Spinnennetzen und den Fetzen einer Jacke, die offenbar aus dem Besitz einer Vogelscheuche stammte. Ein lockenköpfiger Dreikäsehoch hatte in einen Tabakkarton der Sorte Magarischvanille kleine Löchlein gebohrt, durch die er nun Arme und Beine schob, um mit stolzer Miene bunte Fähnchen zu schwenken.
»Mächtiger Rauchrarauch! Schnaufender Dampfadampf!«, quiekten die Kleinen und sprangen wie wild herum. »Bebender Schienengänger! Donnernder Pffpffpff! Großer Tututu!«
»He! Ihr da!«, rief ich mit der schauerlichsten und wütendsten Stimme, die mir zu Gebote stand. »Verschwindet da! Aber ruck, zuck!«
Sofort gaben die Winzlinge Ruhe. Eine der Frauen, ein Wesen mit purpurroten Libellenflügeln, stieß einen spitzen Schrei aus und fiel von den Schienen. Die übrigen senkten sofort ihre Fähnchen, Blumen und silbernen Bonbonpapiere. Alle starrten mich mit offenem Mund an. Wie Kaninchen eine Schlange.
»Fort mit euch!«, verlangte ich abermals und funkelte sie sogar wütend an, um meinen Worten Nachdruck zu verleihen.
Ein paar dieser Däumlinge stapften wild mit den Beinen auf, ein Frauchen mit einem Rock aus gelber Birkenrinde heulte lauthals los.
»Also gut!«, lenkte der Lockenkopf im Tabakkarton schließlich ein. Offenbar hatte er hier das Sagen.
Er nieste bekräftigend, wischte sich die Stupsnase mit der Faust ab und kraxelte mühevoll von den Schienen herunter. Zeternd folgte ihm der Rest der Bande.
»Und wehe, ich erwische euch noch einmal auf den Schienen!«, brüllte ich ihnen hinterher. »Dann werdet ihr euer blaues Wunder erleben!«
Eingeschüchtert huschten die Winzlinge ins trockene Gras.
»Warum kümmerst du dich denn um dieses Kleinvieh?«, erkundigte sich Stephan leicht befremdet.
»Weil ich nicht mit ansehen möchte, wie mehr als dreißig Seelen ins Nichts befördert werden.«
»Schöne Seelen sind das«, grummelte Stephan. »Diese Flöhe! Können die sich nicht mal eine anständigere Art des Selbstmords einfallen lassen und endlich damit aufhören, sich vor einen Zug zu werfen oder auf den elektrischen Leitungen der Pickler herumzuhüpfen?!«
»Sie verstehen in ihrer Treuherzigkeit einfach nicht, welches Risiko sie mit ihren Huldigungen eingehen«, erklärte ich seufzend und trat von der Bahnsteigkante zurück.
Irgendwie hatte ich das Kleine Volk in mein Herz geschlossen. Zumindest die meisten seiner Angehörigen. Daher wollte ich mir den Anblick ersparen, wie diese Geschöpfe des Alleinzigen einen lausigen Tod starben. In den letzten Jahren war ihre Zahl schon dramatisch gesunken, was die meisten Rapgarer jedoch völlig ungerührt hinnahmen, da sie ja alle ihren ach so wichtigen Geschäften nachgehen mussten und für die Winzlinge zu ihren Füßen kaum einen Blick übrighatten.
Vor siebeneinhalb Jahren war ich nicht anders gewesen, doch nach sechs Jahren, in denen ich Tag und Nacht das Siegel der Urlohe angestiert hatte, blickte ich heute mit anderen Augen in die Welt. Meine Lektion hatte ich gelernt: In unserem Universum kam auch noch dem kleinsten Element Bedeutung zu, denn selbst ein winziger Kiesel vermochte einen riesigen Felsbrocken hinter sich her in den Abgrund zu ziehen – und damit einen Steinschlag auszulösen, der alle das Leben kostete.
Das ist ein allzu platter Vergleich? Gut möglich, das will ich gar nicht abstreiten. Aber in meinem Leben haben die Felsbrocken längst ihre Bedeutung verloren, während die Kiesel eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Und wenn ich je einen von ihnen den Hang hinunterwerfen sollte, dann will ich doch hoffen, dass der nachfolgende Steinschlag all diejenigen unter sich begräbt, die mir mein Leben kaputt gemacht haben.
Endlich tauchte der Zug auf, eine schwarze Dampflokomotive mit vier Zylindern. Ihre Seiten zierten aufgemalte purpurne Blitze. Auch die Räder waren feuerrot. Die Lok zog, schnaufend und schwarzen Kohlenrauch in die glasklare Luft ausspeiend, eine endlose Kette von Wagen hinter sich her, die je nach Klasse gelb, blau oder grün gehalten waren.
»Und er stieg herab vom Himmel, gehüllt in Dampf und Rauch«, deklamierte Stephan, »Funken sprühend und heulend, gleich einem Inferioren, welcher der Urlohe entflieht.«
»Zitierst du da gerade etwa ein verbotenes Buch?«
»Ich zitiere, mein junger Freund, die Rede des Stadtfürsten anlässlich der vorletzten Militärparade. In selbiger hat er verkündet, dass Rapgar keineswegs die Absicht habe, vor dem Scheich Malosannes zu katzbuckeln, und ihm daher ganz gewiss nicht unsere Kolonien in Übersee überlasse.«
»Aha«, murmelte ich nur, denn ich hatte schlagartig das Interesse an dem Zitat verloren.
Der Zug tuckerte inzwischen am Bahnhof ein. An den vorderen Türen las ich: Nordrapgarer Eisenbahngesellschaft. Eilzug No 9.
Schließlich hielt der Zug quietschend an. Das vordere Ende des Bahnsteigs lag in weiße Dampfwolken gehüllt. Die Menschen traten etwas zurück, damit der Mamwras aus dem Kohlenwagen klettern konnte. Der Riese war vom Scheitel bis zur Sohle mit schwarzem Staub bedeckt und stapfte schnaubend auf ein Pferdefuhrwerk zu, das mit Holzkisten beladen war. Begriffsstutzig glotzte er sie an, mahlte unentschlossen mit seinen breiten Kiefern, kratzte sich einen seiner beiden behörnten Köpfe und sah zur Lok zurück, offenbar in der Hoffnung, von dort Antwort auf seine unausgesprochene Frage zu erhalten.
Tatsächlich schob ein Kaga seine lange, an eine verfaulte, behaarte Mohrrübe erinnernde Nase aus dem Fenster des Führerhäuschens heraus, dies allerdings nur, um den Mamwras in einer Weise zusammenzustauchen, die sich gewaschen hatte. Seinem Wortschwall entnahm ich nur, dass er wohl der Ansicht war, sie müssten längst weiterfahren. Dann verschwand der Kopf des Lokführers auch schon wieder im Innern des Zugs. Der Mamwras stieß einen weiteren schweren Seufzer aus, zuckte mit sämtlichen Schultern, schnappte sich mit seinem ersten Armpaar die eine, mit dem zweiten die andere Hälfte der Fracht und stapfte, unter seiner Last ächzend, zurück zum Zug, wobei die Holzbohlen des Bahnsteigs bei jedem seiner Schritte kläglich aufheulten.
Ich begab mich zu meinem Waggon, einem der beiden gelben für die erste Klasse. An diesem Halt war ich der Einzige, der sich diese angenehme Form des Reisens spendierte.
Als mich der Schaffner, ein Murzer mit grauem Schnauzbart, sah, riss er sich sofort die Mütze vom Kopf und verbeugte sich tief.
»Xerrr!«, schnurrte er, mich mit der uns Luxern vorbehaltenen Anrede begrüßend. »Wenn Sie mirrr bitte folgen wollen, ich bringe Sie zu Ihrem Coupé.«
Als ich ihm hinterherging, bemerkte ich, dass er seinen Schwanz eingebüßt hatte. Ein Mittägler. So hießen bei den Murzern diejenigen, die aus dem Rudel geworfen worden waren. Beispielsweise weil sie einer ehrenrührigen Arbeit wie der des Schaffners nachgingen …
Im Wagen gab es sechs Coupés, meines war das mit der No 4. Der Mittägler hielt mir beflissentlich die Tür aus Nussbaum auf.
»Erlaubt derrr Xerrr, dass ich einen Blick auf sein Billett werfe?«
Nachdem ich auf der Lederbank Platz genommen hatte, hielt ich ihm schweigend den rosafarbenen Abschnitt hin, auf dem in Gold eine Neun mit Flügeln zu beiden Seiten aufgeprägt war. Daraufhin entnahm der Murzer einem an seinem Gürtel hängenden Lederetui eine silberne Zange und entwertete die Fahrkarte.
»Besten Dank, Xerrr! Wirrr erreichen den Hauptbahnhof um Viertel vorrr elf. Sollten Sie noch etwas brauchen, lassen Sie es mich wissen.«
2
Im Zug nach Norden
Kaum hatte ich es mir bequem gemacht, da blies der Bahnhofsvorsteher auch schon zur Abfahrt in sein Horn. Die Dampflok stieß ein langes Tuten aus, und der Zug setzte sich in Bewegung. Ich schaute zum Fenster hinaus. Schneller und immer schneller lösten die an mir vorbeiziehenden Bilder einander ab.
Eben hatte sich vorm Fenster noch der Bahnsteig dahingezogen, nun huschten bereits weiße Häuser mit roten Ziegeldächern sowie Gärten mit Apfelbäumen an mir vorbei, die ihrerseits von gelben und ockerfarbenen, längst abgeernteten Feldern abgelöst wurden, in die sich gelegentlich das Orangerot kleiner Waldstücke schob. Da der Eilzug No 9 auf gerader Strecke und bei ordentlicher Befeuerung ein enormes Tempo vorlegte, würde ich wesentlich früher in Rapgar eintreffen als mit der Kutsche.
Der Waggon schwankte sanft auf den Schienen hin und her, die Blumen in der kristallenen Vase, dunkelrote Astern, nickten mit ihren fedrigen Köpfchen im Takt der Räder. Das Coupé der ersten Klasse war in Nussbaum gehalten, die Täfelung golden lackiert. Auch Griffe und Knöpfe waren vergoldet, und sobald Sonnenstrahlen hereinfielen, funkelte das geschliffene Kristall der in einer Ecke untergebrachten kleinen Bar.
Zwischen den ledernen Sitzbänken zu beiden Seiten des Abteils gab es unterm Fenster einen halbrunden Tisch, auf dem eine magarische Decke lag. Eine schmale Tür führte ins Bad. Der Kleiderschrank prunkte mit geschmackvoll beschnitzten Türen. Aus purer Neugier besah ich mir die Auswahl der Getränke in der Bar. In Eichenfässern gereifter Whisky, Wein aus Kochettien und Cheville, exzellenter Kokosrum aus den Kolonien zu zwölf Farteigns die Flasche, Grappa und Calvados. Letzteren nahm ich an mich. Eine dunkelgrüne Flasche mit schmalem Hals und blau-violettem Etikett.
»Ist es nicht noch etwas früh«, brachte Stephan pikiert hervor, »um dem Alkohol zuzusprechen?«
»Keine Sorge, ich habe nicht die geringste Absicht, mir einen Schluck zu genehmigen«, versicherte ich ihm und schnippte mit dem Fingernagel des Zeigefingers gegen den versiegelten Korken. »Mich leitet rein wissenschaftliches Interesse, denn ich frage mich, wer sich diesen Calvados hat unterjubeln lassen. Er ist nicht lange genug gereift und dürfte gewaltig in der Kehle brennen.«
Ich stellte die Flasche zurück, schloss die gläserne, mit Paradiesvögeln verzierte Tür und setzte mich wieder. Stephan hatte seinen Platz in einem Stockständer neben dem Tisch gefunden.
Mein Spazierstock konnte sich wahrlich sehen lassen. Lackiertes Ebenholz, Silbereinlagen im Schaft und ein schwerer Silberknauf, gearbeitet als Kopf eines zänkischen Alten mit einem kahlen Schädel, raubtierhaften Augen, buschigen Brauen, Hakennase und spitzem Kinn. Dieses Erscheinungsbild bevorzugte Stephan, obgleich er auch ansprechendere Köpfe im Repertoire hatte. Mein Amnis mochte noch so tönen, dass ihm, einem aus der Urlohe geborenen Geist, seine körperliche Hülle völlig einerlei sei, letzten Endes legte er größten Wert auf sein Äußeres. Aus diesem Grund zwang er mich sogar regelmäßig, das Silber zu polieren. Wenn es angelaufen sei, so behauptete er, wirke er in unverzeihlicher Weise salopp.
Aber von mir aus sollte er seinen Willen haben. Ein Spazierstock, der auf sein gepflegtes Auftreten bedacht war, gehörte in unseren irrsinnigen Zeiten noch zu den normaleren Erscheinungen.
Ich erhob mich noch einmal und warf einen Blick in den Spiegel. Ein Xer von dreißig Jahren mit dunklen, für die heutige Mode vielleicht etwas zu langen Haaren und aschgrauen Augen, gewandet in einen hellgrauen Dreiteiler. Der Knoten meines seidenen Halstuchs hatte sich ein wenig gelöst, sodass ich ihn nachzog. Meine Lider waren stark gerötet. Die Fältchen um meine Augen brachten jeden auf den Gedanken, ich wäre ein ungeheurer Spaßvogel, doch zum Lachen war mir in meiner Lage höchst selten zumute.
Auf den ersten Blick hielten mich die meisten Menschen für einen anständigen Kerl mit einem Hang zur Ironie. Sobald ich den Mund aufmachte, verstärkte sich dieser Eindruck nur noch. Da ich in der Regel leise sprach, glaubte zudem jeder, der es mit mir zu tun hatte, ich wäre ein völlig harmloser und ungefährlicher Mann. Bitte, mir war das nur recht.
»Du hättest deine Sachen packen sollen«, riss mich Stephan aus meinen Gedanken. »Wenigstens die kleine Reisetasche.«
»Warum denn?«, fragte ich verwundert zurück und lehnte mich genussvoll gegen das Lederpolster in meinem Rücken. »Du weißt doch, dass ich gern ohne Gepäck reise. Wenn ich zu Hause bin, schicke ich jemanden zu den Sintreens.«
Daraufhin schlug ich die Rapgarer Zeiten auf. Im Unterschied zu den meisten meiner Zeitgenossen begann ich die Lektüre der Morgenzeitung stets auf der letzten Seite. Mit den Nachrufen. Meiner bescheidenen Meinung nach konnte jede Neuigkeit – wirklich jede, selbst die vom überraschenden Ableben des Stadtfürsten, vom x-ten Aufstand in einer Kolonie oder von der Entdeckung neuer Saphirvorkommen – warten, nicht aber die Seite mit den Todesanzeigen.
Mein Interesse speiste sich aus einem besonderen Grund. Noch immer hoffte ich, hier eines Tages die Namen der drei Brüder Clarissas zu lesen, ferner jenen der Xers Patrick er’Ghindo und Michel er’Casso sowie den der Xera Fiona er’Barhen, allesamt Angehörige des Siebenhauses. Diese Einrichtung ging auf den Stadtfürsten selbst zurück und war mithin nur ihm Rechenschaft schuldig. Da wir Luxer nicht der üblichen Gerichtsbarkeit unterstanden, entschied das Siebenhaus all unsere Streitfälle. Darüber hinaus spannte der Stadtfürst das Haus aber auch immer wieder vor seinen politischen Karren, damit es zum Aufblühen des Landes beitrug oder sich um diplomatische Beziehungen zu anderen Ländern bemühte. Dem Siebenhaus gehörten dem Namen entsprechend sieben Luxer an, die dem Rapgarer Adel entstammten. Den Weisungen des Hauses hatten sich der Bürgermeister, der Stadtrat und die graue Abteilung aus Squagen Chause zu beugen.
Auch auf die Nachrufe für die Chiefinspectoren Grey und Farbo sowie des Wärters Sholtz aus der lieblichen Unterkunft Bau und Kahn hoffte ich. Nicht zu vergessen jener namenlose Gärtner – möge der Zorn der Urlohe ihn treffen –, der all die Windröschen zerstört hatte, die seit der Gründung Rapgars rund um mein Haus gewachsen waren.
Damit dürfte die Reihe meiner Kandidaten komplett sein.
»Und?«, fragte Stephan, der genau wusste, was mich tagtäglich die Zeitung aufschlagen ließ.
»Nichts«, antwortete ich bloß, um Stephan dann einige der Anzeigen vorzulesen, wobei ich Dantes Stimme nachahmte, wenn dieser irgendetwas aus einem zutiefst langweiligen Buch vortrug: »Im Angedenken an unseren guten Sohn … meine selige Schwester … meinen treu liebenden Ehemann … Aber nicht eine dieser feigen und niederträchtigen Kreaturen hat es getroffen. Diese Herrschaften atmen noch immer Rapgars Luft ein, dies zudem in nachgerade empörenden Mengen.«
Stephan gickelte.
»Was gibt’s da zu lachen?«
»Du bist und bleibst die reinste Haplopelma, mein Junge. Nur diese Bewohner aus Weberknecht bringen eine derartige Geduld auf. Fast anderthalb Jahre sind inzwischen vergangen, aber bisher hast du nicht einmal mit den Scheren geklappert.«
»Gibt es daran etwas auszusetzen?«
»Nicht das Geringste. Ich wollte damit nur feststellen, dass du kein Spieler mehr bist, kein Hitzkopf. Heute gehst du mit Bedacht vor. Du hältst Augen und Ohren offen und rührst nicht einfach ein Fosissennest auf. Dieser neue Till gefällt mir weitaus besser als der alte, das gebe ich gern zu. Du ähnelst nun deinem Großvater. Auch er verstand es, geduldig zu warten.«
»Wenn du es sagst«, erwiderte ich und vertiefte mich wieder in die Zeitung.
»Nur verfängt diese Taktik nicht, Till«, gab Stephan keine Ruhe. »Er geht dir nicht ins Netz.«
»Welcher er bitte?«
»Jener er, der dir diese Geschichte eingebrockt hat. Der ist offenbar noch geduldiger als du.«
Ich zuckte bloß schweigend die Achseln und ließ meinen Blick weiter über die Zeilen wandern, auch wenn mir mit einem Mal alles vor Augen verschwamm. Niemals wollte und würde ich glauben, dass ich am Ende Schiffbruch erleiden würde. Mein Leben hing an der Hoffnung, diesen Dreckskerl irgendwann zu stellen. Zuweilen beschlich jedoch selbst mich beim Studium der Nachrufe ein mulmiges Gefühl. Was, wenn er sich hinter einem der Namen auf diesem billigen Papier verbarg? Hinter einem »liebevollen Vater«, einem »teuren Freund« oder einem »unerschrockenen Offizier«? Dann wüsste ich nicht einmal, dass der Widerling tot war. In solchen Momenten packte mich eine Angst, die ich sonst nicht an mir kannte.
»Darf ich dein Schweigen dahingehend auslegen«, bohrte Stephan weiter, »dass du anderer Ansicht bist? Dass du meinst, am Ende doch als Sieger dazustehen?«
»Das darfst du«, erklärte ich, den Blick auf die vorm Fenster vorbeiziehenden Schäfchenwolken und herbstlich gefärbten Bäume gerichtet. »Vor siebeneinhalb Jahren hat der Kerl bereits einmal die Geduld verloren und zugeschlagen. Deshalb suche heute nicht nur ich ihn, sondern auch der Stadtfürst. Das wiederum bedeutet, dass auch die graue Abteilung von Squagen Chause hinter ihm her ist.«
»Und diesen Fachleuten willst du zuvorkommen und ihnen eine lange Nase drehen?«
»Keinesfalls«, beteuerte ich. »Allerdings frage ich mich ernsthaft, wie sie jemanden finden wollen, wenn die Spur schon erkaltet ist, wo es ihnen nicht einmal gelungen ist, als die noch heiß war. Aber lassen wir das, ich rede nicht gern über diese Geschichte, das weißt du.«
»Ganz wie du willst.«
Ich blätterte die Zeitung wie ein Malosanne von hinten nach vorn durch.
»Steht irgendwas Interessantes drin?«, gierte Stephan nach Neuheiten.
»Die Mannschaft der Joseph-Cullshtass-Universität hat zum dritten Mal in Folge das Wettrudern gegen die Universität Marcleshtook gewonnen. Obendrein hat sie die Strecke von der Stillen Bucht durch den Kanal der Träume in Rekordzeit zurückgelegt. Nun wird sie an den studentischen Weltmeisterschaften teilnehmen und dort die Ehre Rapgars verteidigen«, las ich ihm vor, was unter dem Bild der acht sich umarmenden Ruderer stand.
»Ach ja«, ätzte Stephan. »Die Ruder schwingen – das können sie! Dabei sollten die ihre Nasen lieber mal in die Bücher stecken und was Anständiges lernen!«
»Mimst du etwa gerade den keifenden Alten?«
»Ich bin alt! Und hab du mal mein Leben auf dem Buckel, dann würdest du auch keifen! Schreiben sie was, ob sich die Studenten der beiden Universitäten wieder in Altpark vermöbeln werden?«
»Nicht ein Wort.«
»Hab ich’s mir doch gedacht! Aber glaub mir eins, Till! Heute Abend wird es hoch hergehen! Nicht eine Straßenlaterne bleibt da heil!«
»Wäre es dir vielleicht lieber, wenn statt der Laternen die Schädel dran glauben müssten? Nach den Wettbewerben im Vorjahr sind immerhin sechs oder sieben Anhänger der beiden Mannschaften gestorben.«
»Plus alle, die sich erschossen haben, weil sie auf die falsche Mannschaft gewettet haben! Das war mindestens ein Dutzend«, dozierte Stephan. »Wenn du mich fragst, gehören diese Wettkämpfe verboten! Und wenn diese Knallköpfe unbedingt aufeinander losgehen wollen, sollen sie das in der Arena machen, da hätten wenigstens alle was davon.«
Bezüglich sportiver Ereignisse vertrat Stephan eine höchst eigene Sicht.
»Apropos«, hakte er denn auch gleich nach. »Nächste Woche geht es in der Arena wieder mit den Kämpfen los. Du weißt, ich bin ein leidenschaftlicher Anhänger von Little Cha.«
»Vergib mir meine Unwissenheit – aber wer bitte ist Little Cha?«
»Was bist du bloß für ein Luxer?! Little Cha ist der neue Stern am Arenahimmel. In der langen Geschichte Rapgars hat noch nie jemand seinen Dampfriesen so zu führen gewusst wie er. Bisher hat er noch jeden Gegner fertiggemacht, seit fünf Jahren ist er daher der ungeschlagene Champion. Niemand wettet gegen ihn, obwohl man sich eine goldene Nase verdienen würde, wenn Little Cha je verlöre.«
»Und das tätest du wohl gern«, brummte ich. »Mit meinem Geld, versteht sich.«
»Das Wetten liegt uns nun einmal im Blut«, gab Stephan freiheraus zu. »Aber wie dir nicht entgangen sein dürfte, lege ich in dieser Hinsicht eine gewisse Zurückhaltung an den Tag.«
»Ganz im Unterschied zu meinem Bruder …«
»Warum sprichst du dich nicht mit ihm aus?«
»Dir brauche ich doch wohl nicht zu sagen, wie Gespräche mit dem werten Victor enden. Danach ist mein Geldbeutel immer deutlich leichter, denn er ist unübertroffen darin, seinen Verwandten ihre Farteigns abzuknöpfen und diese binnen einer Stunde auf den Kopf zu hauen.«
»Sag mal, mein guter Freund, könntest du die Lektüre der Zeitung nicht ausnahmsweise einmal von vorn aufnehmen?«, überging Stephan meine Worte. »Die wirklich wichtigen Nachrichten stehen nämlich dort.«
»Da steht bloß Gewäsch, und das weißt du! Oder verlangst du eine Kostprobe? Gut, blättere ich dir zuliebe eine Seite vor. ›Gestern hat der Stadtrat versichert, dass die Seagongs den Damm, der durch das Frühlingshochwasser und den Anstieg des Wasserspiegels im Moullavansee erheblichen Schaden davongetragen hat, vollständig erneuert haben. Die Gefahr einer Überschwemmung der westlichen Viertel Rapgars ist damit gebannt.‹ Blablabla … Es wissen doch alle, dass nicht viel gefehlt hätte, und der Damm wäre gebrochen. Dann wäre die halbe Stadt weggespült worden. Diese Katastrophe hätten höchstens Anhöh und Kaskad überstanden.«
»Was erwartest du denn vom Stadtrat?«, parierte Stephan. »Hätte er die Karten offen auf den Tisch gelegt, hätte der Bürgermeister sämtliche Mitglieder in der Luft zerrissen. Es stimmt schon, die Seagongs haben ewig für die Ausbesserungen gebraucht. Wäre der Sommer genauso verregnet gewesen wie der vor drei Jahren, hätte es vermutlich ein Unglück gegeben.«
»Nur wäre das den Seagongs glatt an den Flossen vorbeigegangen. Wasser ist ihr Element – und auf den Bürgermeister sind sie eh nicht gut zu sprechen, weil die Betriebe und Fabriken in Ruß, Sott, Schmauch und Asch nach wie vor jede Menge Dreck ins Wasser ableiten. Die Seagongs haben deswegen schon wiederholt Protest beim Stadtrat eingelegt.«
»Sollen sie doch«, schnaubte Stephan bloß. »Die Fischköpfe sind ja nicht mal vollwertige Bürger Rapgars. Wer wird auf die schon hören?«
»Die Seagongs sind keine Fische«, rieb ich Stephan unter die Nase. Inzwischen näherten wir uns der nächsten Station, sodass der Zug seine Geschwindigkeit drosselte. »Außerdem unterstützen einige Abgeordnete des Stadtrats sie, insbesondere die Andersartler, die Händler und die Vertreter der Viertel. Wenn du mich fragst, steckt hinter dem Schaden am Damm eigentlich noch mehr. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Seagongs ihn selbst beschädigt haben. Als Warnung. Was, wenn sie ihn nächstes Mal vollständig zerstören? Wird dann Katzenhof geflutet, dürften die Murzer ein derartiges Gejaule anstimmen, dass selbst die Fabrikbesitzer es nicht überhören können. Sollten sie sich dann immer noch stur stellen und ihren Dreck weiter ins Wasser leiten, dürfte der Stadtfürst eingreifen, denn er ist den Katzenmenschen wohlgesinnt. Dann dauert es mit Sicherheit nicht mehr lange, und der Dreck wird durch Salzgart in den Fluss umgeleitet.«
»Den Dreck sollte man direkt zu den Tropaeolern pumpen!«, höhnte Stephan. »Sollen sich die Kresseköpfe doch was einfallen lassen, wie sie das dreckige Wasser wieder sauber kriegen!«
Der Zug legte am Bahnhof nur einen kurzen Halt ein, dann ruckte er wieder los. Abermals versenkte ich mich ins Studium der Rapgarer Zeiten.
»Steht denn gar nichts Interessantes drin?«, platzte es eine halbe Stunde später aus Stephan raus.
»Mhm … Wie gefällt dir das? Im nächsten Monat gastiert die Chevillier Oper in Rapgar, man rechnet allgemein mit einem ausverkauften Haus.«
»Dass du einen derartigen Mumpitz überhaupt noch zur Kenntnis nimmst«, ätzte Stephan. »Nach der Geschichte mit dieser Ballerina!«
»Mich interessiert das auch nicht. Aber aus diesem Anlass soll endlich die Straßenbahn bis nach Kleinscholl weitergeführt werden. Ah! Hier haben wir was!«, stieß ich aus, nachdem ich die nächste Seite aufgeschlagen hatte. »Die diplomatischen Beziehungen zu Malosanne haben einen neuen Tiefpunkt erreicht.«
»Wegen Cyrrhus?«
»Ganz recht, wegen Cyrrhus. Die Insel hat Rapgar um Hilfe gegen die religiösen Eiferer aus Malosanne gebeten. Sie will nämlich nicht in Zukunft die Sonne anbeten müssen. Der Stadtfürst hat das 24. Infanterieregiment und die 17. Kompanie der magischen Sicherheit auf die Insel geschickt. Obendrein hat er die Zweite Flotte vor der Küste unseres Bündnispartners aufziehen lassen, darunter auch die Panzerschiffe Flamme, Glühwürmchen und Xera Maria Alexandra.«
»Tatsächlich? Ich dachte, die liegen bei Magar! Im Hafen von Calgara.«
»Das haben die Malosannier vermutlich auch geglaubt. Deshalb dürfte die Überraschung umso größer gewesen sein, als die Schiffe plötzlich aufgetaucht sind. Von dort aus können sie jederzeit eine Salve auf den Palast des Scheichs abgeben.«
»Und? Wie hat Malosanne darauf reagiert?«
»Bisher noch gar nicht«, murmelte ich, während ich den Artikel überflog, der mit der denkbar schmalzigsten Lobpreisung Rapgars endete. »Aber die Malosannier werden das mit Sicherheit nicht hinnehmen und irgendeine Gemeinheit aushecken. Cyrrhus ist ein freier Staat, nicht etwa unsere Kolonie. Da ist ein gewisses Feingefühl nötig. Ob unsere Herren Offiziere darüber verfügen, wage ich jedoch zu bezweifeln. Wenn du mich fragst, ist es daher gut möglich, dass wir bald Krieg haben.«
»Dass auf Cyrrhus der Glaube verteidigt werden muss, ist doch ein billiger Vorwand! Sowohl Rapgar als auch Malosanne sind einzig und allein auf das schwarze Blut erpicht, das im weißen Boden der Insel verborgen ist.«
Das stimmte. Cyrrhus hatte vierhundert Jahre unter der Schutzherrschaft Malosannes gestanden, bis dann der Vater unseres jetzigen Stadtfürsten den damaligen Scheich aufgefordert hatte, doch bitte in seine Wüste abzudampfen und sich dort unter Feigenbäumen seines Lebens zu erfreuen. Unsere Kolonialtruppen hatten die sturen Malosannier rasch Mores gelehrt, seitdem war Cyrrhus offiziell eine freie und unabhängige Insel, galt insgeheim jedoch als vierzehnte Kolonie Rapgars.
Vor einem Jahr wurde dann auf Cyrrhus das sogenannte schwarze Blut gefunden. Worum es sich dabei genau handelte, war mir schleierhaft, möglicherweise stammte das Zeug ja noch aus der Zeit, als einzig die Vorfahren von uns Luxern die Welt bevölkerten. Auf alle Fälle aber wurde dieses schwarze Blut nur dort entdeckt, auf jener kleinen Insel mitten im Zwischenmeer.
Danach waren sofort Gerüchte aufgekommen, dass die Tropaeoler beim Anblick des schwarzen Bluts ihre Blütezeit vertagt hätten, um sich in den Laboratorien Großkopfs zu verschanzen. Wenn sie dann ihre Kresseköpfe wieder vorstrecken würden, würden sie uns alle mit einer bahnbrechenden Entdeckung überraschen, das stand für mich fest.
Die Zauberer zeigten übrigens ebenfalls Interesse an der mysteriösen Substanz. Wie es hieß, steigere dieser stinkende Saft die Kraft einiger Zauber um das Vierfache – und zwar ausgerechnet der, die das Siebenhaus weitgehend verboten hatte, weshalb sie nur einzelne Luxer mit Sondergenehmigung sowie die purpurne Abteilung von Squagen Chause bei ihrer Verfolgung magischer Übeltäter anwenden durften.
Selbstredend wollte sich auch Malosanne das neue Wundermittel unter den Nagel reißen, sodass es unverzüglich seine Besitzansprüche an der Insel erklärte. Doch obwohl es seine Flotte gen Cyrrhus geschickt hatte, sah es bislang von einem Angriff ab und begnügte sich mit Attacken auf diplomatischem Felde.
Da mich dieses Säbelrasseln nicht die Bohne interessierte, las ich all die Äußerungen kluger Köpfe und angesehener Rapgarer gar nicht erst, sondern blätterte nun die letzte Seite um, damit ich endlich beim Aufmacher der heutigen Ausgabe landete. Fassungslos stierte ich auf eine Überschrift in riesigen Buchstaben und mit zahllosen Ausrufezeichen.
»Dein Prophet hatte recht, das war erst der Anfang«, teilte ich Stephan mit und hielt ihm die Titelseite hin. »Der Mörder ist offenbar auf den Geschmack gekommen und hat wieder zugeschlagen. Damit hat er jetzt auch seinen Namen weg: der Düsterschlächter. Heute Nacht hat er sich sein drittes Opfer geholt – und zwar nicht in Grub.«
»Sondern wo?«
»Im Osten von Salzgart. Wer auch immer er sein mag, er hat offenbar keine Lust, an einem Ort zu versauern, sondern ist zu einem kleinen Streifzug durch Rapgar aufgebrochen. Wenn die Gendarmen ihn nicht bald schnappen, schlägt er mit Sicherheit irgendwann in Firmament oder Goldflur zu. Sein drittes Opfer war übrigens von Stand, der Name wird allerdings nicht erwähnt. So viel Taktgefühl hätte ich unserer Journaille gar nicht zugetraut.«
»Vielleicht handelt es sich ja obendrein um eine stadtbekannte Persönlichkeit. Und sollte es tatsächlich noch weitere Morde geben, wird die politische Abteilung von Squagen Chause eingreifen, dann erscheint über die Todesfälle gar kein Wort mehr in den Zeitungen. Dafür werden die grauen Kittel schon sorgen. Allein damit keine Panik ausbricht.«
»Vermutlich … Ah! Hör dir das an! ›Wie aus gewöhnlich gut unterrichteter Quelle verlautet, hat der Mörder neben der Leiche eine Nachricht hinterlassen. Die Mitarbeiter der blauen Abteilung von Squagen Chause und auch der mit den Ermittlungen betraute Chiefinspector Grey haben diese Informationen jedoch nicht bestätigen wollen, dies wohl auf Geheiß von Xer Guido er’Huzepp, dem Direktor von Squagen Chause. Unser Mitarbeiter hat indes mit eigenen Augen gesehen, wie einige Gendarmen Eimer mit Wasser herangetragen haben, um die Aufschrift auf dem Straßenpflaster zu beseitigen. Offiziell heißt es aus Squagen Chause freilich, es sollte lediglich das Blut abgewaschen werden, damit die Anwohner nicht in Angst und Schrecken versetzt würden. Somit lässt sich nur mutmaßen, welche Botschaft der grausame Mörder Rapgar hat zukommen lassen wollen und warum diese unter den Teppich gekehrt werden soll.‹«
»Grey leitet die Untersuchungen? Dann wird man nicht die geringste Spur finden!«, tönte Stephan. »Im Übrigen interessiert mich weniger, was der Mörder aufs Pflaster geschmiert hat, als vielmehr die Frage, wie er die Tat verübt hat.«
»Ich sag’s ja immer wieder, du bist im höchsten Maße blutdürstig«, erwiderte ich. »Selbst unter euch Amnes gibt es keinen zweiten wie dich.«
Die Zeitung war mir inzwischen verleidet, sodass ich sie auf den Tisch warf und mich erhob, um mich in den Speisewagen zu begeben, der sich gleich neben meinem Waggon befand.
Ich hätte mir das Essen auch ins Abteil kommen lassen können, aber ich bemühte bei solchen Kleinigkeiten niemanden gern, weder Menschen noch Andersartler.
Kaum trat ich in den Gang hinaus, sah ich zwei Herren, die mit dem Tempo eines in den Abgrund schießenden Dampfzugs auf mich zurasten. Den einen wiesen seine Hakennase, die braunen Augen und schmalen Lippen als Chevillier aus. Er trug saubere, unauffällige Kleidung – was man von seinem schrankartigen Kompagnon nun gewiss nicht behaupten konnte. Ein fadenscheiniges kariertes Jackett, ein knalllilafarbenes Halstuch, ein gelbes Hemd und ein Hut, auf dem offenbar ein Mamwras herumgetrampelt war.
Der Riese hatte ein puterrotes, verschwitztes Gesicht und hätte mich buchstäblich in Grund und Boden gestampft, wenn ich mich nicht in letzter Sekunde gegen die Wand gepresst hätte. Der Bursche schien allen Ernstes enttäuscht, nicht ganz nebenbei jemanden über den Haufen gerannt zu haben, und brummte etwas Unflätiges vor sich hin. Der Chevillier, der ihm hechelnd folgte, zog wenigstens im Laufen noch seinen Hut.
»Ve’zeiht meinem F’eund, Xe’«, bat er. »E’ hat seinen Geldbeutel ve’lo’en.«
Was jedoch gar nicht zu seinem höflichen Ton passen wollte, war sein kalter Blick, der mich sofort an einen Eingekerkerten denken ließ. Während meiner eigenen Gefangenschaft hatte ich in den Augen von manch anderem Häftling die gleiche Abgebrühtheit gesehen. Hier hieß es, stets die Hände zu beobachten, sonst zertrümmerten dir diese Kerle mit einer Eisenstange die Leber, die Niere oder das Genick.
So schnell, wie die beiden aufgetaucht waren, waren sie auch wieder verschwunden. Ich zuckte bloß die Achseln, dachte nicht weiter über den Vorfall nach und begab mich in den Speisewagen. Nachdem ich einen Kaffee getrunken hatte, ging ich in mein Coupé zurück, wo Stephan ohne Umschweife erklärte, er wolle jetzt schlafen.
Plötzlich merkte ich auf. Im Schrank raschelte es. Ich runzelte die Stirn. In einem Wagen erster Klasse dürfte es eigentlich keine Ratten geben. Kurz entschlossen riss ich die Türen auf – und konnte mich gerade noch vor einem Stilett in Sicherheit bringen, das sich in meinem Hals bohren wollte. Im selben Atemzug fasste ich nach dem schmalen Handgelenk.
Ohne viel Federlesens drückte ich die Hand nach unten, gleichzeitig verdrehte ich sie. Ein kläglicher Schrei erklang. Anschließend zog ich denjenigen, der mir meinen Hemdkragen und das Fleisch darunter hatte aufschlitzen wollen, aus dem Schrank.
Eine junge Frau.
Ihr Gesicht war tränenüberströmt und von Schmerz, Verzweiflung und Angst entstellt. Sobald sie mich sah, mischte sich dieser Gemengelage noch grenzenlose Verwunderung bei.
»Beim Alleinzigen!«, hauchte sie. »Sie sind ja gar nicht die!«
»Das ist fein beobachtet«, erwiderte ich und nahm ihr das Stilett ab. »Wen auch immer Sie in meinem Schrank zu treffen gedachten, Sie dürften vergeblich warten.«
»Lassen Sie mich bitte los!«, jammerte die Frau, um dann mit zittriger Stimme hinzuzufügen: »Sie tun mir weh.«
Nach kurzer Überlegung beschloss ich, ihr die Bitte zu erfüllen, denn in ihrer winzigen Tasche dürfte allenfalls eine Nagelschere, mit Sicherheit aber keine ernst zu nehmende Waffe Platz finden.
Entkräftet sackte sie zu Boden.
»Sie packen zu wie ein Bär«, klagte sie und massierte sich das Gelenk. »Verzeihen Sie mir, Xer, auch wenn dieser Überfall nicht zu entschuldigen ist, das ist mir klar. Als ich gesehen habe, dass dieses Coupé offen stand, habe ich angenommen, es sei frei. Ich … ich … es ist wirklich nicht zu entschuldigen … Bitte lassen Sie mich trotzdem gehen …«
Sie warf einen gehetzten Blick zur Tür, die in den Gang hinausführte. Es brauchte nicht viel Menschenkenntnis, um zu begreifen, dass sie das Abteil eigentlich nicht verlassen wollte.
Kurz entschlossen forderte ich sie auf, Platz zu nehmen, und wies auf die Lederbank. »Auf dem Boden dürfte es Ihnen bald zu kalt werden.«
Unentschlossen fingerte die Frau an der als Chimäre gestalteten, roten Brosche, die den Aufschlag ihres Jacketts zierte, bis sie das Angebot schließlich annahm und sich setzte, wenn auch nur auf die Kante der Bank.
»Wer sind Sie, Xer?«
»Verzeihen Sie meine schlechten Manieren, Lady. Es wird in der Tat Zeit, mich vorzustellen.« Ich hoffte inständig, nicht einen Hauch von Ironie in meine Worte gelegt zu haben. »Mein Name ist Till er’Cartya.«
»Erin.«
»Erin?«, fragte ich zurück und zog eine Augenbraue hoch. Da müsste doch eigentlich noch etwas folgen.
»Erin, mehr nicht«, versicherte sie und brach erneut in Tränen aus.
Ja wunderbar! In Anwesenheit weinender Frauen komme ich mir stets wie der letzte Tölpel vor.
Ich hielt ihr mein Taschentuch hin und läutete nach dem Schaffner. Bevor der Murzer eintrat, schob ich rasch das Stilett unter die Zeitung. Irritiert sah der Katzenmann auf die schluchzende Frau hinunter, richtete den Blick dann aber auf mich, offenbar in Erwartung einer Erklärung.
»Die Lady ist mein Gast. Bringen Sie ihr bitte einen Tee und etwas Gebäck!«
Immerhin besaß er so viel Takt, nicht nach ihrer Fahrkarte zu fragen. Kurz darauf kehrte der Katzenmensch mit einem Tablett in der Hand zurück. Darauf standen eine Teekanne, eine Schale mit Gebäck, ein Kännchen mit Milch, eine Zuckerdose und ein Teller mit etwas Luftigem, das mit Creme gefüllt war, offenbar ein weiteres Kleinod aus der Küche Chevilles.
Die Farteigns, die ich dem Murzer daraufhin in die Hand drückte, zauberten ein zufriedenes Grinsen auf das kätzische Gesicht. Im Rückwärtsgang entfernte er sich und schloss die Tür.
»Trinken Sie etwas«, empfahl ich Erin, nachdem ich ihr den Tee eingeschenkt hatte. »Dann geht es Ihnen gleich besser.«
Erin lächelte mich dankbar an. Es war ein bezauberndes Lächeln. Überhaupt sollte ich der Frau trotz ihres aufgelösten Zustands Gerechtigkeit widerfahren lassen: Sie war äußerst attraktiv. Ein feines Gesicht mit einer schmalen Nase, vollen karminroten Lippen, großen blauen Augen und dichten Wimpern, an denen immer noch Tränen glitzerten. Ihre prachtvollen kastanienbraunen Locken fielen ihr unter einem charmanten Hut in die Stirn.
Sie war eher klein, die ausgesuchte Kleidung unterstrich ihre schöne Figur vortrefflich. Der lange, schmale Rock umspannte ihre Hüften und erweiterte sich zu ihren Füßen hin. Ein klassisches Jackett ließ ihre Taille schmal erscheinen und betonte die Brust. Um den hohen Kragen der eng anliegenden Bluse hatte sie ein cremefarbenes Halstuch geschlungen. Eine elegante Lady, deren Erscheinung der Fantasie freien Lauf ließ. Meiner beispielsweise.
»Wenn ich mir vorstelle, dass ich Sie beinahe getötet hätte, Xer …«, brachte sie heraus, wobei sie bei jedem Wort zitterte, als fröre sie in eisigem Wind. »Niemals hätte ich in dieses Abteil eindringen dürfen!«
»Vor wem verstecken Sie sich denn?«
»Vor den Freunden meines Bräutigams. Vielmehr meines ehemaligen Bräutigams. Ich habe das Verlöbnis gelöst und bin einen Tag vor der Hochzeit fortgelaufen. Seine Freunde haben daraufhin geschworen, mich vor den Altar zu schleifen.«
Hört, hört … Immerhin war sie eine charmante Lügnerin, denn selbstverständlich glaubte ich ihr kein Wort, daran änderten nicht einmal ihre großen, unschuldigen Augen etwas. Das Einzige, was ich der schönen Erin mit viel Großmut abkaufte, war ihr Bedauern, mit dem Stilett auf mich losgegangen zu sein. Die Geschichte mit ihrem Bräutigam war aber nicht einmal den Flügel einer Fosisse wert. Denn wenn jede entlaufene Braut einem Freund ihres vormals Auserwählten eine Klinge in den Leib rammen würde, wäre die männliche Bevölkerung Rapgars binnen eines Jahres ausgestorben.
»Doch machen Sie sich keine Sorgen, Xer er’Cartya«, fuhr sie fort, »ich werde Ihnen nicht zur Last fallen und steige an der nächsten Station sofort aus.«
Als ich gerade versichern wollte, ihre Gesellschaft sei mir keine Last, wurde die Tür aufgerissen – und zwar derart heftig, dass sie fast aus den Angeln gesprungen wäre.
Erin schrie auf und wich auf der Bank zurück. In der Tür stand der Riese mit der verschwitzten roten Visage, hinter ihm machte ich den Chevillier aus, dazu noch einen bärtigen Finsterling, der mich irgendwie an ein Frettchen erinnerte.
»Da hätten wir das Vögelchen ja!«, geiferte der Rotgesichtige.
Er zog ein Messer und stürzte sich auf Erin. Mich übersah er geflissentlich.
Schon als kleiner Junge hatte ich Grobiane nicht leiden können, und selbst heute brachte mich ihre primitive Unverfrorenheit, gepaart mit der festen Überzeugung, jederzeit überall ungefragt eindringen zu dürfen, noch auf die Palme. In diesem Coupé war ich der Herr, weshalb es allein mir zustand darüber zu befinden, wen ich einlud und wen ich hinausbeförderte.