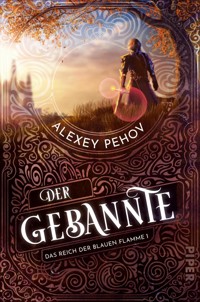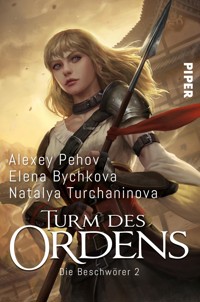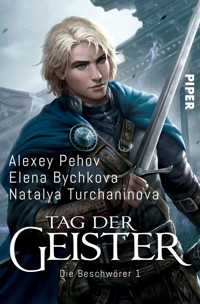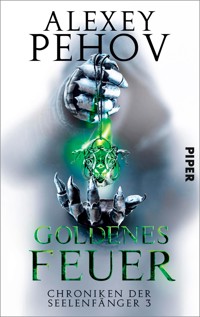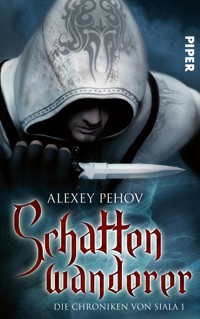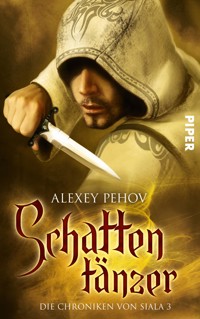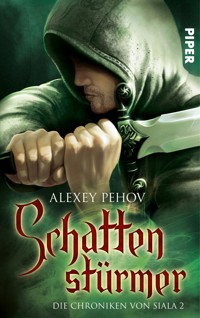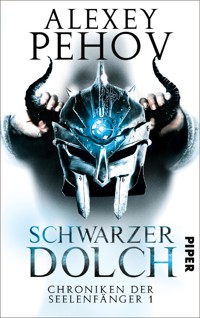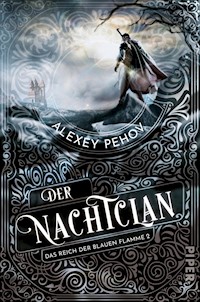
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Theo und seine Gefährten müssen den legendären Kriegshelden Thion finden, um die alte Magie in die Welt zurückzuholen und den Gebannten, der nur noch als Geist existiert, zu besiegen. Doch ihre Suche gestaltet sich immer mehr als Wettlauf gegen die Zeit. Theo erkennt, dass er durch das magische Zeichen auf seiner Schulter dem Tod geweiht ist. Er bemerkt die Veränderungen, die er durchlebt, als das Zeichen von ihm Besitz ergreift. Und die Assassinen des Nachtclans sind ihm dicht auf den Fersen, um Rache zu üben und ein finsteres Ritual zu vollziehen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy.
www.Piper-Fantasy.de
Übersetzung aus dem Russischen von Christiane Pöhlmann
© Alexey Pehov 2015
Titel der russischen Originalausgabe:
»Sinjeje plamja« bei AL’FA-KNIGA, Moskau 2015
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Karte: Alexey Pehov
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: Stephanie Gauger, Guter Punkt, unter Verwendung von Motiven von GettyImages
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Karte
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 1
Das leere Haus
Ich rate Dir dringend davon ab, Dich mit ihr einzulassen. Solltest Du sie wirklich in den Bergen, in denen sie beheimatet ist, aufsuchen, wäre das für Dich von großem Nachteil, denn dort bist Du schwach. Lass Dich nicht durch ihr Äußeres täuschen! Mag sie auch zerbrechlich scheinen, sie weiß ihre eigenen Waffen, ihren Verstand und ihren Willen, vorzüglich einzusetzen. Noch ehe Du überhaupt begreifst, dass das Spiel begonnen hat, wirst Du die Partie bereits verloren haben. Denn das Opfer, das sie zu bringen willens ist, hat noch kein Mann bringen wollen.
Aus einem Schreiben des Gebannten an Cam, in dem er sich über Arila auslässtEin Jahr vor dem Krieg des Zorns
Die Dienerin schluchzte in einem fort. Blanca Erbett vermochte ihren Zorn kaum mehr zu zügeln. Am liebsten hätte sie diesem jammernden Weibsbild eine Ohrfeige verpasst. Die würde in ihrem leeren Schädel sicher ein prachtvolles Echo auslösen …
Doch selbstverständlich beherrschte sich Blanca.
In ihren dunklen Augen lag sogar ein Hauch von Zuneigung, als sie der Dienerin ihr Spitzentaschentuch hinhielt. Dankbar nahm die junge Frau es an und schnäuzte sich geräuschvoll hinein.
Für dieses ungebührliche Verhalten hätte Blanca ihr nur zu gern eine Standpauke gehalten, doch auch diesmal wandte sie sich nur schweigend ab und trat ans Fenster.
Die Erbin Yasev Erbetts war eine Frau von betörender Schönheit. Ein schlanker Hals, eine schmale Taille und blasse rotgoldene Haare. Als ihr Vater nach zahllosen Anträgen schließlich dem Werben eines Mannes nachgegeben hatte, da hatte er sich von dieser Partie für die gesamte Familie eine Menge versprochen.
Blanca hatte an dem Gatten leider einiges auszusetzen gehabt. Er war dreißig Jahre älter als sie und interessierte sich ausschließlich für die Jagd, seine Hunde und guten Wein. Seine junge Frau beliebte er nur zur Kenntnis zu nehmen, wenn ihm einfiel, dass er einen rechtmäßigen Erben brauchte, prahlte der Widerling doch damit, dass sich sein Geschlecht bis in die Zeit vor dem Kataklysmus zurückverfolgen lasse.
Sobald er sich jedoch mit ihr langweilte, wurde er schier unerträglich. Mit ihren achtzehn Jahren hatte Blanca sehr klare Vorstellungen davon, was sie vom Leben wollte. Ihre Jugend an einen versoffenen Fettsack zu verschwenden, der mit seinen längst verreckten Vorfahren angab, gehörte ganz entschieden nicht dazu, mochte das ihrem Vater nun passen oder nicht.
Zu Beginn ihrer Ehe hatte sie noch gezögert, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, doch nachdem ihr Mann sie grün und blau geschlagen und der Heiler ihr eröffnet hatte, dass sie niemals einem Kind das Leben schenken würde, waren jegliche Zweifel von ihr gewichen. Da galt es zu handeln, bevor der holde Gatte verstanden hatte, dass sie für ihn nicht länger von Wert war.
Blanca war eine Erbett. Die Tochter ihres Vaters. Mit einem klugen Kopf, einem festen Willen und einem harten Herzen. Niemals würde sie sich diesem ekelhaften Trunkenbold unterordnen. Sie bereitete alles bestens vor, er schluckte sämtliche Köder. Die Falle schnappte zu, und der werte Herr Gemahl wurde bei einem Festgelage erdolcht. Nachdem die Angelegenheit gründlich untersucht worden war, hatte die Stadtwache sechs vermeintliche Verschwörer in Gewahrsam genommen. Auf die arme Witwe fiel dagegen nicht einmal der Schatten eines Verdachts …
Selbst ihr Vater hatte nicht geahnt, dass sie hinter allem steckte. Lediglich Rynster hatte sie durchschaut. Aber er war ja schon immer klüger als sie gewesen, auch wenn sie an der Universität studiert hatte, nicht er.
Und jetzt war ihr Bruder tot. Genau wie ihre beiden anderen Geschwister. Und ihr Vater.
Ihr Elternhaus war buchstäblich ausgestorben. Noch konnte Blanca das kaum glauben.
»Anna!«, brachte sie eindringlich hervor, während sie vom Fenster zurücktrat. »Du musst dich daran erinnern! Das ist sehr wichtig!«
»Es war alles so schrecklich, Herrin.« Die Dienerin schluchzte neuerlich auf. »All das Blut … Dieser … der hat sie alle …«
Der Rest wurde von Gewimmer geschluckt. Blanca nahm der Frau behutsam das durchnässte Taschentuch aus den kraftlosen Händen, lächelte sanft – und verpasste ihr eine schallende Ohrfeige. Den fassungslosen Ausdruck in Annas Augen nahm sie mit Genugtuung zur Kenntnis.
Obendrein hatte das Geschluchze nun ein Ende. Anna sah sie stumm an und zog ein paarmal die Nase hoch.
»Reiß dich zusammen!« Blancas Worte flogen durch den Raum wie Fledermäuse, stießen gegen die Decke und klirrten geradezu in Annas Ohren. »Du bist die Einzige, die ihn gesehen hat! Beschreib ihn mir also gefälligst!«
»Aber ich habe wirklich kaum einen Blick auf ihn geworfen, denn ich musste ja den Tisch decken. Irgendwann ist Davek hereingekommen und hat gesagt, ein Mann wünsche den Herrn zu sehen. Dann bin ich aus dem Raum gegangen, und als ich zurückgekehrt bin, da war der Kampf schon in vollem Gange. Der Mann war schnell wie der Blitz! Eben noch stand er am Tisch, aber schon im nächsten Augenblick oben auf der Galerie. Alle haben geschrien. Herr Celg hat nach seiner Axt gegriffen und … und … Das konnte ich nicht mit ansehen. Ich bin einfach davongestürzt! Überhaupt haben sich alle in Sicherheit gebracht. Niemand hat versucht, diesen Mörder aufzuhalten, nicht einmal Nevek, und Ihr wisst, wie stark und tapfer er war.«
»Du willst mir also weismachen, dass ein einziger Mann meine gesamte Familie umgebracht hat?! Ebenso wie alle anderen Männer im Haus? Dass er Celg, der mühelos ein Pferd hochheben konnte, ausgeschaltet hat?! Und auch Nevek, diesen alten und erfahrenen Soldaten?«
»Jedenfalls habe ich niemand sonst gesehen! Nur ihn! Er muss mit der anderen Seite im Bunde stehen! Vielleicht war es sogar ein Schahuter …«
Mit dieser Närrin verschwende ich bloß meine Zeit, schoss es Blanca durch den Kopf. Verängstigt, wie sie war, hätte sie nicht einmal mitbekommen, wenn eine ganze Armee in ihrem eigenen Bett über sie hergefallen wäre!
»Erinnerst du dich an seinen Namen?«
Anna schüttelte den Kopf.
»Dann beschreibe mir jetzt, wie er ausgesehen hat!«
»Sehr gut … Aua!«
Anna rieb sich die Wange.
»Reiß dich jetzt endlich zusammen!«, fuhr Blanca sie an. »Dass er sehr gut aussah, hilft mir nicht weiter! Wie groß war er? Was für eine Haarfarbe hatte er? Woher kam er?«
»Er war sehr groß und sah …« Sie verstummte, ihr verängstigter Blick huschte zu ihrer Herrin hinüber. »Mit braun gebrannter Haut, also wahrscheinlich ein Mann aus dem Süden. Seine Augen waren von leuchtendem Blau! Er sah wirklich …«
»Woher genau war er? Aus Dagewar vielleicht? Aus Solanka oder Trettin?«
»So leid es mir tut, Herrin, aber das weiß ich wirklich nicht.«
Blanca verließ der Mut. Das war doch aussichtslos. Völlig. Wie sollte sie etwas aus einer Frau herausbringen, deren Hirn nicht einmal die Größe einer Ameise aufwies?
»Gut, du kannst jetzt gehen. Falls dir noch etwas einfällt, lass es mich sofort wissen.«
Anna nickte nur schweigend und zog sich eilig zurück. Nicht einmal die Tür schloss sie hinter sich …
Blanca drehte sich wieder ihrem Leibwächter zu, Grenn, einem Mann, dem sie vorbehaltlos vertraute. Die blasse Haut wies ihn auf den ersten Blick als Alagorier aus. Obwohl er mittlerweile etwas in die Jahre gekommen war, hatte er sich seine muskulöse Erscheinung bewahrt. Die grauen, von geröteten Lidern halb verhangenen Augen ruhten in Erwartung eines Befehls auf ihr. Nevek hatte diesen Mann auf Bitten ihres Vaters ausgesucht, damit Blanca nichts geschah, wenn sie von ihrem ehelichen Gut zu ihrem Elternhaus zurückkehrte.
In all der Zeit war ihr Grenn zum unersetzbaren Gefährten geworden, und sie war froh, den einstigen Soldaten an ihrer Seite zu wissen.
»Kein Name. Nicht einmal eine brauchbare Beschreibung, wie der Kerl ausgesehen hat, geschweige denn ein Hinweis darauf, was er von meinem Vater wollte. Ich habe nicht einen einzigen Anhaltspunkt! Was hört man denn in den Straßen?«
»Niemand weiß, warum Euer Vater und Eure Brüder getötet worden sind, Herrin. Die Leute verbreiten bloß Gerüchte, von denen eines stets dümmer ist als das vorherige.«
»Und welches von diesen Gerüchten erfreut sich der größten Beliebtheit?«
»Dass ein Schahuter Eure Familie heimgesucht hat.«
Blanca presste die Lippen aufeinander. Sie hasste solch Gerede ebenso wie all die Narren, die darauf hereinfielen. Sicher, auch sie hatte sich als kleines Mädchen davor gefürchtet, am Stadtrand durch die Ruinen unmittelbar hinterm Steinbruch zu streifen. Ian hatte sie deswegen immer ausgelacht. Wie lange das jetzt her war … Nun war Ian tot, war bei einer Auseinandersetzung mit irgendeinem Kerl vom Zirkus vom Dach gestürzt. Er war immer leichtsinnig gewesen und hatte gern einen über den Durst getrunken, aber dieses Schicksal hatte er nicht verdient. Und auch Rynster nicht. Sogar um Celg, den sie nie besonders in ihr Herz geschlossen hatte, tat es ihr leid.
»Hätte ein einziger Mann mit den Leuten meines Vaters fertig werden können?«
»Wenn ich in den langen Jahren, in denen ich meinen Dienst an der Grenze zu Dagewar abgeleistet habe, eines begriffen habe, dann wohl, dass sich stets ein noch tüchtigerer Mann als man selbst findet«, erwiderte Grenn. »Oder ein verschlagenerer, ganz wie Ihr es sehen wollt, Herrin.«
Blanca ließ sich in den Sessel fallen, griff nach dem goldumrandeten Kristallpokal und trank einen Schluck Wasser.
»Mein Vater hatte ein Händchen dafür, die richtigen Männer für sich auszuwählen. Nevek, Davek und all die anderen waren unübertroffen in ihrem Metier. Glaubst du wirklich, ein einzelner Mann wäre gegen sie angekommen?«
»Es gibt nichts, was es nicht gibt, Herrin. Wenn er aus dem Süden kommt …«, Grenn konnte niemanden aus diesem Teil der Welt leiden, »… könnte er durchaus mit gezinkten Karten spielen.«
»Wir müssen mit den Veonts sprechen. Am besten beraumen wir sofort ein Treffen an.« Der Vorschlag trug ihr einen ungläubigen Blick Grenns ein. »Spar dir besser jede Bemerkung! Mir ist ohnehin klar, was du sagen willst.«
»Euer Vater hat mir aufgetragen, für Eure Sicherheit zu sorgen, Herrin. Wenn Ihr Euch jetzt zu seinem Erzfeind begeben wollt … Das werde ich nicht zulassen.«
Sie stellte den Pokal ab, erhob sich, strich ihren Rock glatt, trat dicht an Grenn heran und legte den Kopf in den Nacken, um zu seinem Gesicht hochzusehen.
»Das wirst du nicht zulassen?«, zischte sie. »Deine Treue meiner Familie gegenüber ist bekannt. Deshalb stelle ich dich jetzt vor eine schlichte Wahl: Entweder du tust, was ich verlange, oder du musst dir eine neue Herrin suchen.«
»Gut, Herrin«, erwiderte er nach kurzem Zögern. »Ich werde Veont sofort eine Nachricht zukommen lassen. Wie viele Männer wünscht Ihr zu Eurer Begleitung?«
»Nur dich.« Abermals spiegelte sich in seiner Miene Unglauben wider. »Man sollte einen Wolf nicht reizen, denn dann bleibt er bestimmt nicht friedlich.«
Als Grenn absaß, klirrten sein Kettenhemd, seine Sporen und seine Klinge viel zu laut, als dass er noch darauf hätte hoffen dürfen, unbemerkt einzutreffen.
Der rotgesichtige, nahezu kahl geschorene Kraftbolzen am Eingang trug ein breites Messer am Gürtel und starrte Grenn mit offener Feindseligkeit an. Blanca gegenüber ließ er immerhin die gebührende Höflichkeit walten. Eine kalte Höflichkeit freilich. Ihr Besuch gab in diesem Hause niemandem Anlass zur Freude. Wundern tat Blanca das nicht. Die Erbetts und die Veonts führten seit zwei Generationen eine bittere Fehde gegeneinander. Bisher hatten die Veonts das Nachsehen gehabt, während Blancas Vater als Herr in Taver geherrscht hatte.
Nachdem sie das Haus betreten hatten, lief Grenn einige Schritte vor seiner Herrin her, um in die angrenzenden Zimmer hineinzuspähen. Den Abschluss der kleinen Prozession bildeten drei waffenstarrende Männer Veonts.
»Euer Diener muss vor der Tür warten, Mylady, denn unser Herr wünscht, Euch unter vier Augen zu sprechen.«
»Einverstanden.« Sie drehte sich Grenn zu. »Warte hier!«
In Grenns Augen flackerte es beunruhigt auf, doch in Anwesenheit Dritter verzichtete er auf jedes Widerwort. Mit finsterer Miene bezog er neben der Tür an der Wand Posten, eine Hand am Schwert.
Einer von Veonts Männern rief eine schon ältere Frau in einem schwarzen Kleid.
»Mein Herr bittet um Nachsicht«, sagte er zu Blanca, »doch er muss sich vergewissern, dass Ihr keine Waffe bei Euch tragt.«
»Sollte Herr Veont die Absicht haben, mich zu beleidigen, dann …«
»Nichts läge ihm ferner, Mylady.«
»Dann vergeude bitte nicht meine Zeit.«
»Verzeiht mir, Mylady, aber leider sehe ich mich gezwungen, Euch in Erinnerung zu rufen, dass Ihr um diese Begegnung gebeten habt.«
»Übermittelt Eurem Herrn bitte, dass ich nicht die Absicht habe, seine Taschen von meinen Dienern durchwühlen zu lassen, sollte er eines Tages mich aufsuchen. Deshalb werde ich jetzt auch nicht gestatten, dass seine Magd meinen Rock befingert.«
»Wenn Mylady es wünscht, werde ich diese Worte selbstverständlich übermitteln.« Er verschwand hinter einer Tür, tauchte jedoch rasch wieder auf. »Ihr könnt eintreten, Mylady.«
Blanca bedeutete dem Mann mit einem Nicken, dass der kleine Zwischenfall damit vergessen sei. Als sie an ihm vorbeistolzierte, musste sie jedoch insgeheim grinsen. An ihrem Schenkel hatte sie eine Scheide festgeschnürt, in der ein giftgetränktes Stilett steckte. Sie hegte zwar nicht die Absicht, es zum Einsatz zu bringen, vertrat allerdings die Auffassung, es stünde ihr ebenso zu, eine Waffe zu tragen, wie all den aufgeblasenen Nichtsnutzen, die um Veont herumschwirrten.
Thomas Veont war im gleichen Jahr geboren worden wie ihr Vater, hatte sich aber deutlich besser gehalten. Mit dem kräftigen Körper und der aufrechten Haltung wirkte er glatt fünfzehn Jahre jünger, als er war. Seine kalten Augen behielten Blanca wachsam im Blick, als diese an ausgestopften Bären und Hirschen vorbei auf ihn zuhielt. Sein von Pockennarben übersätes Gesicht verriet keine einzige Regung. Lediglich seine heruntergezogenen Mundwinkel gaben Aufschluss über seine Empfindungen: Es fiel ihm nicht leicht, die Tochter seines Erzfeindes zu empfangen.
»Mylady Blanca.« Veont erachtete es nicht für nötig, sich zu erheben, um seine Besucherin zu begrüßen. Mit einer Geste forderte er sie auf, ihm gegenüber Platz zu nehmen. »Lasst mich Euch mein Mitgefühl angesichts der Tragödie aussprechen, die Eure Familie getroffen hat.«
»Habt Dank! Mein Vater hat Euch mir stets als höflichen Mann geschildert.« Sie lächelte, um ihre nächsten Worte abzumildern. »Doch wir beide wissen, dass Ihr selbst schon immer mit Freuden Erde auf die Leichen meiner Verwandten geschaufelt und den schwersten Stein auf ihr Grab gelegt hättet.«
»Wenn wir schon derart offen miteinander reden wollen«, erwiderte Veont gelassen, »dann will ich gern zugeben, dass ich ihnen wohl auch noch einen Pfahl aus Espenholz in die Brust gerammt hätte. Euer Vater war nämlich nicht viel besser als manch Ausgeburt der anderen Seite.«
»Das fasse ich als Kompliment auf.«
»Ihr sollt ja dem Vernehmen nach der klügste Kopf der Familie sein, doch möchte mir scheinen, dies sind nur haltlose Gerüchte. Wäret Ihr wirklich eine Frau von Verstand, hättet Ihr mich sicher nicht nur in Begleitung eines einzigen Mannes aufgesucht. Das hieße nämlich, dass Ihr mich sträflich unterschätzt. Oder Eurer selbst allzu gewiss seid.«
»Mein Vater weilt nicht länger unter uns«, erwiderte Blanca voller Bedacht. »Das Gleiche gilt für meine Brüder. Ich jedoch bin nur eine schwache Frau. Meint Ihr nicht auch, wir sollten unsere Feindschaft unter diesen Umständen … vergessen?«
»Ihr schlagt einen Waffenstillstand vor?«
»Ich biete Euch die Stadt an. Meine Besitzungen befinden sich am anderen Ende des Landes, daher ist mir Taver völlig einerlei.«
»Wie ausgesprochen reizend von Euch!«, brachte Veont unter schallendem Gelächter hervor. »Aber Ihr bietet mir da etwas an, das ohnehin bereits mir gehört. Mit dem Tod Eures Vaters habt Ihr jeden Anspruch auf Taver verloren.«
»Hier herrschen immer noch die Erbetts.«
»Die Erbetts sind tot. Und Ihr solltet im Übrigen darauf achten, Euer Leben nicht ebenso schnell einzubüßen, wie es Euren Brüdern widerfahren ist.«
»Muss ein Gast in Eurem Hause etwa um sein Leben bangen?«
Daraufhin senkte Veont nur beschämt den Blick. Er war ein Mann alter Schule, der viel auf Traditionen gab.
Vorübergehend war im Raum lediglich das Knistern des Feuers im Kamin zu vernehmen.
»Selbst wenn ich stürbe«, durchbrach Blanca das Schweigen, »würden die Bürger Tavers Euch die Stadt nicht auf dem silbernen Tablett servieren, das wisst Ihr genau, sonst hättet Ihr nämlich nicht in dieses Gespräch eingewilligt. Die Menschen stehen Veränderungen nicht unbedingt aufgeschlossen gegenüber, und in dieser Stadt ist viel mit meiner Familie verbunden. Mein Tod brächte Euch also keinen Vorteil, schließlich sähen sich nicht nur die Veonts gern als die Herren Tavers. Die Marks und die Gertys sind ebenfalls auf diese Rolle erpicht. Glaubt Ihr etwa, sie würden Euch ohne Weiteres den Vortritt überlassen?«
»Sollten sie einen Krieg gegen mich anzetteln, würden sie mit Schimpf und Schande untergehen.«
»Ohne Frage«, bestätigte Blanca sofort. »Freilich erst in zehn Jahren. Bestenfalls. Denn wer weiß schon, ob sich der Kampf nicht über Generationen hinziehen würde. In jedem Fall wird viel Blut fließen. Ihr habt zwei Söhne. Von ihnen ist nur einer imstande, Euer Erbe anzutreten. Nur einer. Das solltet Ihr stets im Hinterkopf behalten, wenn Ihr mit dem Gedanken an blutige Auseinandersetzungen spielt. Mein Vater hat mir wieder und wieder versichert, Ihr würdet das Leben Eures Erben nie leichtfertig aufs Spiel setzen. Verlöret Ihr ihn, verlöret Ihr alles!«
»Dem möchte ich entgegenhalten, dass drei Kinder Eures Vaters tot sind, während ich noch …«
»Das beweist nur, wie schnell sich das Blatt wenden kann«, fiel Blanca ihm ins Wort. »Im Übrigen solltet Ihr nicht vergessen, dass eine Auseinandersetzung zwischen zwei Adelshäusern nicht nur Folgen für das einfache Volk hat, sondern auch andere Herrscher aufhorchen lässt. Herzog Nyster aus Varen könnte in diesem Fall seinen Blick begehrlich auf uns lenken. Sollte er das alte Recht noch kennen, wird er einen seiner Neffen herschicken …« Blanca schnalzte schmerzerfüllt mit der Zunge. »Was wolltet Ihr ihm dann entgegensetzen?«
»Diese Überlegungen sind nicht von der Hand zu weisen.« Veont ließ sich gegen die Lehne sacken und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ihr wisst Kopf und Zunge zu gebrauchen, das ganz ohne Frage. Beenden wir also das Gespräch darüber, ob Ihr in meinem Hause zu Tode kommt oder nicht, und wenden uns stattdessen lieber dem Grund zu, der Euch hierhergeführt hat.«
»Habt Ihr die Männer angeheuert, die meinen Vater getötet haben?«
»Wenn ich das getan hätte, würde ich es Euch gegenüber mit Sicherheit nicht zugeben, Mylady«, schnaubte Veont. »Das dürfte Euch doch wohl klar sein. Würde ich hinter diesen Morden stehen, müsste ich die Angelegenheit jetzt … zu Ende bringen.«
»Mein Vater hat mir immer wieder beteuert, dass Ihr nicht leichtfertig handeln würdet«, sagte Blanca und lächelte erneut. »Aber er meinte auch, dass die Männer in Euren Diensten Ihre Ohren überall haben.«
Schweigend wartete Veont darauf, dass Blanca fortfuhr.
»Ich bin mir sicher, dass Ihr einige Anstrengungen unternommen habt, um in Erfahrung zu bringen, was in meinem Elternhaus geschehen ist. Und sei es nur, um sicher zu sein, dass diese Burschen nicht auch Euch einen Besuch abstatten.«
»Ihr wollt wissen, wer den Mord in Auftrag gegeben hat?«
»Unbedingt.«
»Warum heuert Ihr dann nicht selbst ein paar Männer an, die das für Euch herausfinden?«
»Weil das viel Zeit kostet.«
»Wollt Ihr Euch rächen?«
»Ich bin die Tochter meines Vaters. Oder glaubt Ihr womöglich, das Recht auf Rache sei allein Männern vorbehalten?«
»Etliche Erscheinungen unserer Zeit behagen mir nicht. In der Tat, ich halte Rache für eine Männersache.«
Blanca erhob sich und ging mit raschelnden Rockschößen durch den Raum.
»Nur erlaubt sich das Schicksal gelegentlich einen bitteren Scherz mit uns und raubt uns sämtliche Männer«, stieß sie aus. »Dann bleiben allein wir schwachen Frauen übrig. Daher frage ich noch einmal: Könnt Ihr mir sagen, was im Haus meines Vaters geschehen ist und wer die Verantwortung dafür trägt?«
»Setzt Euch wieder«, bat Veont in etwas schärferem Ton als beabsichtigt, weshalb er noch einmal freundlicher wiederholte: »Setzt Euch bitte, Mylady.«
Folgsam nahm sie wieder Platz und bettete ihre Hände ganz wie eine brave Schülerin auf die Knie.
»Warum sollte ich Euch behilflich sein?«
»Wegen Taver. Wenn Ihr mir helft, überlasse ich Euch die Stadt.«
»Damit wären wir wieder am Anfang unseres Gesprächs.«
»Weshalb ich gern noch einmal wiederhole, dass Taver nach wie vor den Erbetts gehört. Der Stadtrat, die Soldaten in der Stadtwache, Absprachen mit den Gilden, die herzoglichen Steuereintreiber … sie alle sind meiner Familie verpflichtet. Solltet Ihr Euch mit den Marks überwerfen, würde dieses erprobte Netz zerreißen. Die Arbeit von Jahren wäre zunichtegemacht. Helft Ihr mir aber, sorge ich dafür, dass Taver an Euch geht. Unbeschadet.«
»Wie wollte eine Frau, die in den letzten vier Jahren überhaupt nicht in Taver gelebt hat, das zuwege bringen?«
»Mein Vater hat es sehr gut verstanden, den Menschen Gehorsam und Treue einzubläuen. Ich bin eine geborene Erbett. Mir liegen seine Unterlagen vor, deshalb weiß ich, wo Geld hingeflossen ist und welche schmutzige Wäsche in dieser Stadt gewaschen wird. Glaubt mir, man wird mir den nötigen Gehorsam entgegenbringen. Und diese Macht bin ich bereit abzutreten. An Euch.«
Veont ließ sich die Worte eine ganze Weile durch den Kopf gehen. Sie drängte ihn nicht zu einer Entscheidung, sondern sah zum Fenster hinaus und beobachtete, wie die Schneeflocken zu Boden fielen, all dies in der unumstößlichen Gewissheit, dass Veont ihren Vorschlag annehmen würde.
»Die Stadt ist reich. Trotzdem wollt Ihr sie mir einfach …«
»Wenn ich so zu meiner Rache komme? Nichts lieber als das!«, fiel Blanca ihm ins Wort. »Im Übrigen erhaltet Ihr lediglich die Stadt, nicht mein Erbe. Durch meinen verstorbenen Mann verfüge ich über ein Vermögen, das mir einen sorglosen Lebensabend bescheren wird. Zu herrschen ist hingegen eine Aufgabe, die mich nicht reizt und meine Kräfte eh übersteigt.«
Veont verzog die Lippen zu einem schiefen Grinsen, das zweifelsfrei verriet, dass er sie keineswegs für eine schwache Frau hielt. O nein, sie würde mit Bravour herrschen.
»Die Sache hat freilich einen Haken, Mylady. Euch wird man gehorchen. Aber mir? Die alten Freunde Eures Vaters werden sicher nicht mit fliegenden Fahnen zu mir überlaufen. Ich wäre also keinen Schritt weiter, wenn ich mich auf Euren Vorschlag einließe.«
Blanca spürte Wut in sich aufsteigen. Was musste dieser alte Stinkmolch noch feilschen? Sie überreichte ihm hier hübsch verpackt Schlüssel, Schloss und Stadttor …
»Wenn ich Euch offiziell die Rechte meines Vaters überlasse, werden Euch alle folgen, auch die Freunde meines Vaters.«
Vater würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, könnte er mich hören, schoss es ihr durch den Kopf. Aber sei’s drum! Wenn ich ihm erst mal seinen Mörder liefere, kann er seine Wut an ihm austoben. Wo auch immer die beiden sich begegnen mögen …
»Offiziell?«, hakte Veont nach. »Was versteht Ihr darunter? Eine Eheschließung? In dem Fall möchte ich Euch daran erinnern, dass ich bereits eine Gattin habe.«
Offenbar hielt er sich für unwiderstehlich.
»Ihr habt einen Sohn.«
»Quett ist ebenfalls bereits verheiratet.«
»Das ist mir durchaus bekannt«, erwiderte Blanca und lachte leise auf. »Ich spreche von dem anderen.«
»Melin ist …«
»… ein ausgemachtes Stumpfhirn. Auch das weiß ich. Aber daran dürften sich die Erhabenen Sechs kaum stören, denn vor den Göttern sind alle gleich. Deshalb kann sich eine Frau jeden Tollkopf zum Mann nehmen.«
»Und das beabsichtigt Ihr zu tun?«
»Hätte ich es sonst vorgeschlagen?«
Erneut hüllte sich Veont in Schweigen.
»Und Ihr würdet die Hochzeit auch vollziehen?«, fragte er nach einer Weile.
»Ihr spielt auf die Hochzeitsnacht an? Da müsste ich Euch enttäuschen. Mit Eurem Sohn auch das Bett zu teilen, diese Absicht habe ich nun wirklich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Ihr diesbezüglich Abhilfe schaffen könntet. In Eurer Küche wimmelt es ja nur so von dienstbaren Mägden. Der Junge wird den Unterschied kaum bemerken. Was ist? Seid Ihr einverstanden?«
»Das bin ich«, sagte Veont und streckte ihr seine Hand entgegen.
Blanca las ein Buch, das in alter Sprache abgefasst war, die sie noch an der Universität gelernt hatte. In diesem Augenblick brachte ihr Grenn ein Schreiben. Er verübelte ihr noch immer, dass sie sich auf diesen Handel mit Veont eingelassen hatte, und das stand ihm deutlich auf die Stirn geschrieben. Blanca riss den Umschlag ungeduldig auf und warf ihn zur Seite, ohne auch nur einen Blick auf das Siegel geworfen zu haben. Sie wusste ohnehin, wer ihn geschrieben hatte.
Rasch überflog sie die Zeilen, runzelte die Stirn und las die Mitteilung erneut, diesmal deutlich langsamer.
Grenn wartete geduldig.
»Viel ist es nicht, eine Beschreibung des Mannes, der dem Vernehmen nach das Haus meines Vaters aufgesucht hat. Die Diener in der Herberge haben sich an ihn erinnert und ihn später noch mal auf der Straße gesehen. Er hat Taver offenbar am selben Tag wieder verlassen. Und anscheinend ist er wirklich aus dem Süden.«
»Trotzdem hege ich meine Zweifel, dass es der Mann ist, den Ihr sucht, Mylady.«
»Herr Veont beteuert, dass dieser Shreff in enger Verbindung mit dem Nachtclan steht.«
Das immerhin entlockte Grenn einen Pfiff.
»Hat er Beweise dafür?«, fragte er dann.
»Nein. Aber dieser Shreff wurde gesehen, wie er mit einem dicken Mann und einer schwarzhaarigen Frau gesprochen hat. Diese beiden wiederum sind in der Herberge Zur Motte abgestiegen. Mein Vater hat immer behauptet, es sei die einzige Einrichtung, von der wir kein Geld eintreiben. Du kannst dir denken, warum nicht.«
»Weil sie dem Nachtclan untersteht.«
»Richtig.«
»Aber das bedeutet nicht, dass Shreff zu dieser Bande gehört.«
»Schließt es aber auch nicht aus. Immerhin haben wir nun eine Spur. Die müssen wir verfolgen.«
»Aber mit aller gebotenen Vorsicht, Mylady.«
»Keine Sorge, das werden wir. Die Pferdeknechte in der Herberge, in der dieser Shreff abgestiegen ist, haben ein Gespräch belauscht. Er wollte nach Grant. Da hast du doch früher gelebt, oder?«
»Ja.«
»Und wenn ich mich nicht irre, kennst du jemanden aus dem Nachtclan …«
Grenn nickte widerwillig. Blanca hielt ihm den Brief hin.
»Dann erkläre mir mal, warum der Kerl meine Familie ermordet hat! Und wie?! Mein Vater hat sich nie mit dieser Bande aus Pubyr angelegt, geschweige denn, sie gegen sich aufgebracht. In was für eine Geschichte ist er da hineingeraten? Wir müssen diesen Shreff finden und aus ihm herauspressen, was er weiß.«
»Und dann?«
»Dann werde ich ihn töten«, erwiderte Blanca leichthin. »Aber zuvor muss ich noch meine Schuld begleichen. Übermorgen heirate ich.«
Kapitel 2
Wolfshauer
Die alten Familien Trettins, deren Wurzeln bis in das Zeitalter der Blüte zurückreichen, kennen zahlreiche Gesetze der Ehre, von denen nicht wenige durch ihr Pathos, ihre Unverständlichkeit und Absonderlichkeit verwundern. Das ist den Menschen im Süden indes leicht nachzusehen, denn notfalls kämpfen sie wie Tiere. Aus diesem Grunde würde ich Mylord nachdrücklich empfehlen, für die Leibwache Männer aus dieser Gegend zu rekrutieren.
Aus einem Schreiben des Ersten Beraters des Herzogs von Tarasch
Laviany verengte die fahlblauen, wässrigen Augen zu Schlitzen und lauschte. Wind pfiff. Obwohl es erst Mittag war, sorgten die tief hängenden Wolken und der starke Schneefall bereits für ein trübes Zwielicht, das an die hereinbrechende Nacht denken ließ. Es gab Anheimelnderes, als bei solchem Wetter das Haus zu verlassen.
Große Schneeflocken landeten auf Lavianys unbedecktem Kopf, der neuen, mit Hundefell gefütterten Jacke und den zusammengezogenen Augenbrauen. Die nahen Berge hatten sich in konturlose Gebilde verwandelt, doch noch immer war kein Wetterwechsel in Sicht. Im Gegenteil, alles deutete darauf hin, dass gegen Abend ein regelrechter Schneesturm aufziehen würde.
Vor zwei Tagen hatte sich – so war es jedenfalls in der Herberge zu hören gewesen – irgendein Narr nur kurz in die Büsche schlagen wollen, wurde dann aber erst am nächsten Morgen wiedergefunden. Er hatte sich verirrt und war schlicht und ergreifend in einer Schneewehe erfroren.
Was für ein dämlicher Tod! Aber vermutlich hatte dieses Schmalhirn nichts Besseres verdient. Bei einem derartigen Sauwetter verrecken nun mal auch Menschen wie die Fliegen, deshalb muss man notfalls eine volle Blase ertragen.
Wenn doch nur Theo schon zurück wäre, dachte sie einmal mehr. Diese Gefühlsduselei verübelte sie sich selbst, sie konnte aber nichts dagegen unternehmen. Der Hochseilartist war ihr ans Herz gewachsen, ob sie wollte oder nicht. Genau wie Scheron, die junge Kämpferin gegen Verirrte Seelen.
Selbstverständlich war es dumm, sich in dieser Weise auf fremde Menschen einzulassen, aber nach Jahren der Einsamkeit genoss sie es, zur Abwechslung zusammen mit anderen ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.
Zumindest dann, wenn diese beiden Kindsköpfe sie nicht mit ihrer grenzenlosen Einfalt in den Wahnsinn trieben oder mit dem blinden Vertrauen erschütterten, das sie jedem dahergelaufenen Fremdling entgegenbrachten.
Bei dem Gedanken an Scheron musste Laviany unwillkürlich seufzen. Ihre Finger zogen sich um den Hals des immer noch warmen Huhns zusammen. Das Tier war so mager, dass es selbst Laviany die Tränen in die Augen trieb. Unter den Federn verbargen sich lediglich Knochen.
Laviany stemmte sich mit aller Kraft gegen die schwere Tür der Herberge, um sie zu öffnen. Sobald sie den Raum betrat, schlugen ihr Wärme, der Geruch von Fleischbrühe und von bitterem, schlecht gebrautem Bier entgegen. Die Gäste an den Tischen drehten den Kopf zur Tür, doch kaum erkannten sie Laviany, gingen sie weiter unverdrossen ihrem Nichtstun nach.
Laviany wischte den Schnee von den Schultern, stampfte ein paarmal auf und zog die Jacke aus. Eines konnte man dem Wirt mit Sicherheit nicht vorwerfen: An Brennholz sparte er nicht.
In der kleinen Küche fand sich außer ihm niemand. Seine Frau und seine Tochter brachten gerade das Essen an die Tische, er selbst gönnte sich ein Bier aus einem zerkratzten Tonkrug und aß etwas Hammelbrühe.
»He, Frau!«, rief er, als Laviany eintrat. »Die Küche ist für dich verboten!«
Sie warf das Huhn auf den Tisch, auf dem schon etliche Zwiebeln lagen.
»Ich habe gefunden, was ich gesucht habe«, sagte sie nur.
Ein Blick auf sein Eigentum genügte, und der Mann glühte rot vor Wut.
»Hast du jetzt völlig den Verstand verloren?!«, brüllte er. »Wer hat dir erlaubt …?«
»Du selbst!«, fiel sie ihm genüsslich ins Wort. »Heute Morgen hast du mir versprochen, wir würden ins Geschäft kommen, wenn ich ein Huhn auftreibe. Das habe ich getan. In deinem Stall.«
»Du verschwindest jetzt sofort aus meiner Küche!«, zischte er. »Noch besser, gleich aus meinem Haus! Zusammen mit deinen werten Freunden! Übernachtet doch in der nächsten Schneewehe!«
Schon in der nächsten Sekunde stand Laviany unmittelbar vor ihm. Ihre stahlharten Finger schlossen sich um seine Oberarme, noch ehe er überhaupt begriff, wie ihm geschah. Schnaufend krümmte sich der Wirt vor Schmerz. Viel fehlte nicht, und er wäre vor ihr in die Knie gegangen. Ohne ihren Griff zu lockern, beugte sich Laviany zu seinem Ohr vor.
»Ich brauche nur noch ein bisschen fester zuzudrücken«, raunte sie, »und deine Knochen werden splittern, du gieriger Hund! Von mir aus können wir gern auf diese Behandlung verzichten, denn allein der Gebannte weiß, wie lange wir hier noch in deinem Nest feststecken. Wir sollten also irgendwie miteinander auskommen. Aber wenn du mir gegenüber nicht sofort einen anderen Ton anschlägst, dann werde ich sehr böse werden, das schwöre ich dir bei allen elenden Streifenfischen dieser Welt.«
Der Mann stieß nur ein unverständliches Gebrumm aus.
»Du hast dieses magere Federvieh anscheinend sehr in dein Herz geschlossen. Gut, aber ich brauche Brühe. Eine Hühnerbrühe, um genau zu sein. Die wirst du mir jetzt zubereiten, und zwar schnellstens. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?«
Auch diesmal stöhnte der Wirt nur. Laviany lockerte ihren Griff ein wenig, gab den Mann jedoch nicht frei. Sollte er sich irgendeine Dummheit einfallen lassen, würde ihn das teuer zu stehen kommen.
»Den Vogel bezahle ich dir. Wenn du allerdings noch einmal damit drohst, uns rauszuschmeißen, dann … Du malst dir nicht einmal aus, welche Schwierigkeiten eine verdrehte und fiese Alte wie ich dir einbrocken kann.«
Nach diesen Worten hielt sie ihm einen Silberling unter die Nase, der am Rand etwas eingekerbt war. Sie trennte sich nur ungern von dieser Münze, doch die Umstände zwangen sie dazu. Sonst hätten sie am Ende tatsächlich kein Dach mehr über dem Kopf … Ihr würde das nicht viel ausmachen. Scheron aber schon. Und so seltsam das auch klang, neuerdings dachte Laviany an andere.
Der Wirt starrte das Geldstück lange an, bevor sein Blick zu Laviany zurückwanderte.
»Das ist für den Vogel. Und eine kleine Wiedergutmachung, weil es zu diesem Missverständnis zwischen uns gekommen ist.«
Sie rang sich ein Lächeln ab, auch wenn sie den Wirt am liebsten kopfüber in den Kessel mit kochender Brühe gestopft hätte. Dieser Mistkerl hatte ihr völlig die Stimmung verhagelt.
Nachdem der Wirt den Silberling an sich genommen hatte, biss er misstrauisch auf ihn, um dann mit ernster Miene zu nicken.
»Einverstanden«, brummte er. »Wir vergessen das kleine Missverständnis. Hättest mir halt gleich sagen sollen, dass du unbedingt Hühnerbrühe brauchst.«
Es kostete Laviany ihre ganze Geduld, den Kerl nicht anzuranzen, schließlich hatte sie ihm von Anfang an vorgeschlagen, ihn gut für das Huhn zu bezahlen.
»Mach mir jetzt endlich die Brühe!«, erwiderte sie nur. »Und bring uns Kohlen aufs Zimmer. Meine Gefährtin ist krank.«
»Wird erledigt. Dauert aber ein Weilchen.«
Daraufhin ging Laviany hinaus, nahm an einem der Tische Platz, fegte mit dem Ärmel die Krümel vom letzten Essen weg und lauschte auf die Gespräche der anderen im Raum. In der Herberge war ein buntes Völkchen zusammengekommen. Junge Leute auf dem Weg nach Alagorien, ein älterer Soldat, drei Kaufleute und einige Bauern. Am Morgen war ein Bote aus einer kleinen Stadt etwas unterhalb der großen Straße eingetroffen. Er saß nun auf einem Stuhl, der leicht wackelte, und schlürfte Fleischbrühe. Zwischen den einzelnen Löffeln gab er bereitwillig die Gerüchte wieder, die er unterwegs aufgeschnappt hatte.
»Im Hügelherzogtum hat sich ein furchtbares Unglück ereignet. Aber davon habt ihr vermutlich schon gehört … Nicht? Die beiden ältesten Söhne des Herzogs wurden tot aufgefunden.«
»Diese Schwätzer aus Karyph!«, brummte einer der Kaufleute, die links von Laviany saßen, dem schwarzen Bart nach zu urteilen ein Dagewarer. »Dass die nicht einmal ihren Mund halten können!«
»Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand aus Dagewar einen Mann aus Karyph ins Herz geschlossen hat«, bemerkte der Bote. »Aber kein Wunder! Euer Wappentier ist die Schlange, unseres der Greif! Und der schnappt sich dieses Reptil nun einmal mühelos!«
»Der Herrscher im Hügelherzogtum hätte halt nicht die Enkelin des Esh-Tali zur Frau nehmen sollen! Der Kerl heißt schließlich nicht ohne Grund Mörder von hundert Frauen!«
»Pah!«, schnaubte der grauhaarige Soldat und legte die faltigen Hände auf den Tisch. »Mittlerweile sind siebzig Jahre ins Land gezogen, aber ihr in Dagewar erinnert euch noch immer daran, wie dieser Mann euch eingeheizt hat. Dabei habt ihr euch das alles selbst zuzuschreiben. Hättet ihr nicht die Grenzstädte in Karyph gebrandschatzt, wäre der Herzog nie gegen euch zu Felde gezogen. Ihr habt also nur eure verdiente Strafe erhalten. Und über die Herzogin solltest du auch nicht so abfällig sprechen. Im Hügelherzogtum wird sie nämlich außerordentlich geschätzt. Da tritt jeder für sie ein. Und säße jetzt einer der Männer von dort hier im Raum, würde er dir eine gewaltige Tracht Prügel verpassen, unabhängig von deiner Aufmachung!«
Der Kaufmann blickte ihn finster an, verzichtete jedoch auf einen Streit. Offenbar hielt er den Soldaten trotz seines Alters für einen gefährlichen Gegner. Nach einem letzten Blick auf das Schwert drehte er sich zur anderen Seite.
»Weiß man, wer die beiden Söhne des Herzogs getötet hat?«, fragte ein junger Mann, der sich mit sechs Gefährten ein kleines Zimmer teilte.
»Außer Gerüchten ist nichts bekannt«, antwortete der Bote und leckte nachdenklich den Löffel ab. »Etliche behaupten, es habe eine Verschwörung gegeben. Wundern tät mich das nicht, das ist bei Adligen ja üblich. Dann schlitzen sie sich gegenseitig die Kehle auf wie die übelsten Strauchdiebe. Der Herzog hat sich schon vor Zeiten mit seinem Vetter überworfen, der ihn nur zu gern vom Löwenthron stoßen würde … Dann wieder heißt es, das Wintergrimmen wüte. Diese Seuche kann mühelos jeden erwachsenen Mann umbringen … Und schließlich wollen einige sogar wissen, dass Schahuter in die Burg eingedrungen sind. Die Biester hätten die Leibwächter und das Gesinde gemeuchelt und danach die beiden älteren Söhne richtiggehend abgeschlachtet. Der jüngste Sohn ist wohl nur deshalb noch am Leben, weil er zu diesem Zeitpunkt mit seinem Vater im Jagdschloss weilte.«
»Was ist mit der Herzogin?«, wollte die Tochter des Wirtes wissen.
»Über sie weiß man nichts.«
Der Kaufmann brummte nur, er selbst hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn die Schahuter den Herzog aus Karyph endlich aus der Welt schaffen würden, sprach aber so leise, dass nur Laviany ihn hörte.
»So ein Unsinn! Schahuter!«, schnaubte ein hagerer Mann in abgetragenen Stiefeln, der neben dem Kamin saß. »Als Nächstes posaunt bestimmt noch jemand herum, dass der Gebannte im Hügelherzogtum eingefallen ist!«
»Hüte deine Zunge besser!«, empfahl ihm der Kaufmann. »Schahuter sind schließlich kein Hirngespinst!«
»Klar doch!«
»Nur weil dir noch nie eine Verirrte Seele begegnet ist«, streute der Soldat ein, »bedeutet das nicht, dass es sie nicht gibt. Wenn du jedoch einmal in Lethos gewesen bist, dann weißt du, warum die Menschen sich dort nachts in ihren Häusern einschließen. Abgesehen davon, habe ich in den letzten vier Wochen schon zweimal Geschichten von Schahutern gehört. In Iriasta sollen sie ein ganzes Dorf dem Erdboden gleichgemacht haben. Und im Norden sind plötzlich Melgen aufgetaucht. Offenbar halten sie auf Nakun zu.«
»Melgen? Aber die leben doch weit, weit weg! In Ödien«, stieß der junge Mann fassungslos aus. »Und wie haben sie es überhaupt geschafft, die Grenze …?«
»Die Grenze erstreckt sich über Hunderte von Leagues«, fiel ihm der Soldat ins Wort. »Da finden diese Biester mühelos irgendein Schlupfloch. Das macht man sich hier bei uns im Westen bloß nicht klar, weil wir unsere eigenen Sorgen haben.«
»Uns stehen schwere Zeiten bevor«, murmelte der Bote. »Das sollte euch allen klar sein!«
»Lass diese Unkerei!«, knurrte der Kaufmann.
»Würd ich ja gern. Aber hier braut sich nun mal etwas zusammen!«
Laviany hatte genug gehört. Sobald der Wirt eine Schale mit dampfender Hühnerbrühe vor sie stellte, stand sie auf, schnappte sich das Essen und ging durch einen langen Gang in ihr Zimmer.
In dem kleinen Raum standen zwei schmale Betten. Scheron schlief, unter Decken begraben und dicht an die Wand geschmiegt. Laviany stellte die Schale ab, entnahm ihrer Tasche einige Kräuter, die sie noch vor Einbruch der ersten Fröste gesammelt hatte, und zerrieb die getrockneten Blätter zwischen ihren Handflächen. Ein würziger, wenn auch etwas bitterer Duft stieg ihr in die Nase.
Diese Kräuter würden Scheron rasch helfen. Behutsam ließ sie die Krümel in die Brühe rieseln, um ihre Gefährtin anschließend sanft zu wecken. Das blasse Gesicht der jungen Frau glänzte vor Schweiß.
»Tut mir leid«, murmelte sie. »Ich bin wohl eingeschlafen.«
»Schlaf ist das beste Heilmittel«, erwiderte Laviany und hielt ihr die Schale mit der Brühe hin. »Iss das.«
Scheron schluckte. Kaum nahm sie den Essensgeruch wahr, wurde sie noch bleicher.
»Ich glaube, das ist kein guter Gedanke«, meinte sie.
»Es ist kein guter Gedanke, meinen Rat nicht zu befolgen«, widersprach Laviany. »Du fieberst, dagegen müssen wir etwas unternehmen. Und du siehst fürchterlich aus. Wenn der Wirt dich sieht, glaubt er glatt, du hättest dir das Wintergrimmen eingefangen. Dann schmeißt er uns mit Sicherheit raus. Du weißt, wie sehr sich die Menschen vor dieser Krankheit fürchten.«
»Ich habe aber nicht das Wintergrimmen.«
»Natürlich nicht, denn deine Pupillen sind nicht blau und deine Haare nicht weiß. Aber das würde den Menschen in ihrer Angst überhaupt nicht mehr auffallen. Deshalb sollten wir das Fieber schnellstens vertreiben. Solange du nicht wieder bei Kräften bist, hängen wir hier fest. Und unser alter Freund Thion wird sich nicht hierherbequemen, obwohl wir ihn doch dringend zu sprechen wünschen …«
Angewidert stierte Scheron auf die Schale, begann dann aber, die Suppe bis zum letzten Löffel aufzuessen. Wiederholt stieg Übelkeit in ihr auf.
»Braves Mädchen«, lobte Laviany sie, als sie ihr die leere Schale abnahm. »Und jetzt schlaf noch ein bisschen.«
»Ist Theo inzwischen zurück?«, fragte Scheron.
»Du solltest keine Fragen stellen, sondern dich ausschlafen«, knurrte Laviany und drückte sie aufs Kissen.
Schon in der nächsten Sekunde fiel Scheron in einen unruhigen Schlaf.
Das Wetter hatte sich keinen Deut gebessert. Wind fegte, die Straße war unter Schnee begraben. Laviany trotzte all dieser Unbill mit Schneeschuhen und einer Kapuze, die sie sich tief in die Stirn gezogen hatte. Obwohl sie sich, weit nach vorn gebeugt, vorwärtskämpfte, peitschten ihr immer wieder Böen über die bereits aufgerissenen Lippen. Der Abend war längst heraufgezogen, aber noch immer ließ Theo sich nicht blicken, weshalb sie die Sorge um den Jungen aus dem Haus getrieben hatte. Er wollte doch bloß zur nächsten Stadt, das war nur eine Stunde Weges.
Nach ihrer Rückkehr aus Taloris waren sie gen Osten gezogen. Zwei Herzogtümer hatten sie durchquert und nun, im letzten Herbstmonat, die Mausberge erreicht. Ein langer Winter stand bevor. Da hätten sie sich eine feste Bleibe suchen sollen, statt sich über einen Pass inmitten riesiger Felsgiganten zu schlagen. Doch sie hatten keine Wahl. Die Zeit lief ihnen davon …
Denn bei Theo zählte jeder Tag. In Taloris hatte Laviany zwar noch etliche Blumen gesammelt, deren Aufguss dem Jungen auch half, sodass dieses vermaledeite Mal auf seiner linken Schulter deutlich langsamer wuchs. Albträume suchten ihn auch nicht mehr heim. Dennoch gab sich Laviany keinen falschen Hoffnungen hin: Theo wurde mehr und mehr zur Hülse.
Ebendeshalb begleitete sie Scheron und Theo. Wenn der Junge irgendwann an der Gabelung von Licht und Dunkel stehen würde, musste sie an seiner Seite sein. Um zu verhindern, dass er sich endgültig in eine schreckliche Kreatur verwandelte, die einzig den Tod brachte. Das war nur auf eine Weise möglich: Sie würde Theo töten müssen.
Verzweifelt spähte Laviany die Straße hinunter. Es schneite so stark, dass sie eine weiße Wand vor sich zu haben meinte. In weiter Ferne heulten ein paar Wölfe. Fluchend beschleunigte Laviany ihren Schritt.
Da schälten sich gleichsam aus dem Nichts zwei dunkle Gestalten heraus. Fast wäre sie in die beiden hineingestolpert. Auf den Schultern der Männer lagerten regelrechte Schneeberge. Ohne Frage wollten sie noch vor Einbruch der Nacht die Herberge erreichen.
Beinahe in derselben Sekunde wurde Lavianys Kopf regelrecht von einer stählernen Zange zusammengepresst. Unbändiger Hass kochte in ihr hoch.
»Da sollen mich doch die Erhabenen Sechs holen!«, stieß einer der beiden Männer da auch schon aus. Theo. Die Schmerzen waren untrüglich. »Was tust du denn hier?«
»Bei allen elenden Streifenfischen!«, brummte sie, war aber dennoch erleichtert, dass Theo nichts geschehen war. »Selbstverständlich halte ich nach deiner erstarrten Leiche Ausschau! Wo bitte hast du gesteckt?!«
»Der Schnee hat mich aufgehalten«, antwortete er. »Ich hatte zunächst noch gehofft, es würde bald aufhören zu schneien, aber das war leider ein Irrtum. Deshalb sind wir schließlich doch aufgebrochen.«
Nach diesen Worten richtete Laviany ihren Blick auf Theos Gefährten. Er hatte sich die Fellmütze tief in die Stirn geschoben und seinen grauen Schal fast bis zur Nase hochgewickelt. Sie konnte also nur die Augen erkennen. Strahlend grüne Augen, aus denen nicht mal das lausige Wetter das verschmitzte Funkeln vertrieb. Über einer zugeknöpften Jacke trug er noch einen dicken Mantel mit einem warmen Kragen aus Dachshaar. In seinem Rücken ragte der Griff eines Langschwerts auf.
Damit wusste Laviany, wen sie vor sich hatte.
»Fenico …«, stieß sie aus.
»Die Syora erinnert sich an den Namen meiner Klinge«, erwiderte Milvio.
»Den würde die Syora selbst nach ihrem Tod nicht vergessen«, fuhr Laviany ihn an. »Was hast du hier verloren?«
»Jenseits der Mausberge liegt Nakun. Und offenbar bin ich nicht der Einzige, der die Absicht hat, über den Pass zu gehen.«
Laviany presste die Zähne fest aufeinander und versengte Theo mit ihrem Blick. Sollten ihn sich doch am besten gleich alle Schahuter der Gegend holen! Warum musste er jedem Nichtsnutz von ihren Plänen erzählen?!
Doch weder Theo noch Milvio schienen zu ahnen, dass Laviany sie am liebsten in die nächste Schneewehe geschmissen hätte. Abermals heulten in der Ferne Wölfe, und nun erhielten sie Antwort von einem Rudel westlich von ihnen. Alle drei spitzten die Ohren. Das Gejaule siegte mühelos über den Wind und breitete sich im ganzen Wald aus.
»Wir sollten von hier verschwinden«, bemerkte Milvio. »Wenn das ein großes Rudel ist, könnte es uns ernsthaft Schwierigkeiten bereiten.«
»Immerhin hast du etwas Hirn im Kopf«, zischte Laviany. »Während an euren Füßen allerdings einiges fehlt. Wieso tragt ihr keine Schneeschuhe?«
»Weil wir keine auftreiben konnten«, antwortete Theo. »Ganz im Gegensatz zu dir.«
»Das war ein Kinderspiel«, erklärte Laviany. »Ich bin an einen etwas unbedarften Herrn geraten, der es nicht für nötig hielt, sein Eigentum im Auge zu behalten. Sein Hab und Gut ist bei mir fraglos besser aufgehoben.«
»Fraglos«, wiederholte Milvio. »Leider ist uns kein derartiger Einfaltspinsel begegnet. Und jetzt sollten wir schnellstens weiterziehen, sonst hat der Schnee am Ende alle Spuren unter sich begraben.«
»Keine Sorge«, fauchte Laviany, »den Weg finde ich auch bei diesem Wetter.«
Obwohl es eigentlich nur noch ein Katzensprung bis zur Herberge war, mussten sie sich über eine Stunde durch das Gestöber kämpfen. Schon bald heulten die Wölfe wieder, diesmal jedoch nicht mehr in so großer Ferne. Sofort zog Milvio sein Schwert aus der Scheide.
»Nun mal sachte«, verlangte Laviany.
»Hier stimmt etwas nicht«, entgegnete Milvio. »Diese Wölfe wollen nicht uns jagen, die werden selbst gejagt.«
»Haben sie dir das erzählt, bevor wir uns getroffen haben?«
»Das sind nicht die ersten Wölfe, die mir begegnen. Diese Tiere sind verängstigt, und sie setzen alle, die ihr Heulen zu deuten wissen, von einer Gefahr in Kenntnis.«
»Wir sind keine Wölfe«, stieß Laviany barsch aus. »Wir sind Menschen. Die Ängste dieser Biester können uns gestohlen bleiben! Sollen sie sich von mir aus die Eingeweide auskotzen oder den eigenen Schwanz abbeißen, unser Ziel ist die Herberge. Meines jedenfalls. Und auch das von Theo. Falls du aber noch ein Weilchen dem lieblichen Wolfsgesang lauschen möchtest, nur zu!«
»Du solltest das nicht auf die leichte Schulter nehmen.«
»Und warum nicht?«
»Die Wölfe sind die Herren dieses Waldes. Wenn jemand hinter ihnen her ist, würde der auch uns mit Freuden verschmausen.«
Da hatte er recht, das musste sogar Laviany zugeben. Woher wollte sie wissen, wer sich in dieser elenden Gegend herumtrieb? Seit dem Kataklysmus war allerlei Getier herangewachsen. In der Regel blieben die Biester ja in ihren Höhlen. In der Regel …
»Dann sollten wir erst recht nicht länger hier rumstehen, sondern zusehen, dass wir in die Herberge gelangen!«
»Scheint mir ein kluger Vorschlag zu sein«, mischte sich nun auch Theo ein.
Daraufhin traten sie den Rückweg an. Mühevoll pflügten sie sich durch das Schneegestöber und die zunehmende Dunkelheit.
Obwohl das Wolfsgeheul hinter ihnen zurückblieb, fiel selbst Laviany ein Stein vom Herzen, als sie die ersten Häuser ausmachte. Vor der Tür zur Herberge band sie die Schneeschuhe los und versteckte sie unter dem missbilligenden Blick Theos in einer der weißen Wehen, während Milvio schon Zuflucht im Warmen suchte.
Als Laviany und Theo zu ihm stießen, hatte er seinen Schal bereits abgewickelt. Seine Wangen und sein Kinn überzog ein Stoppelbart.
Der Wirt steckte den Kopf zur Küchentür heraus. Milvio fragte ihn gleich, ob es noch ein Zimmer für ihn gebe. Das war der Fall. Bevor er sich zurückzog, drückte er Theo noch die Hand und nickte Laviany zu. Diese erwiderte den Gruß nicht, sondern packte Theo am Arm, um ihn in eine ruhige Ecke zu ziehen.
»Was bei allen Schahutern hast du dir dabei gedacht, diesen Kerl anzuschleppen?«, fuhr sie ihn an.
»Ich habe ihn rein zufällig in der Stadt getroffen. Was hast du denn gegen ihn?«
»Rein zufällig also, ja?! Erst in Lethos und jetzt hier …!«
»Nun mach mal nicht so einen Wirbel! Menschen begegnen sich halt öfter und sogar rein zufällig, das darfst du einem Mann, der sein ganzes Leben auf der Straße verbracht hat, getrost glauben.«
»Und du darfst getrost einer Frau glauben, die ihr ganzes Leben beim Nachtclan verbracht hat, dass solche Begegnungen kein Zufall sind!«
»Deine Vorsicht in allen …«
»Meine Vorsicht hat dir schon mehr als einmal das Leben gerettet!«, fiel sie ihm ins Wort. »Ich traue diesem Kerl nicht.«
»Warum eigentlich nicht?«
»Kann ich dir nicht sagen!«
»Mir hast du anfangs auch nicht getraut«, bemerkte er. »Und Scheron ebenso wenig. Das ist deine Art. Welchen Grund sollte Milvio denn haben, uns zu verfolgen? Irgendjemand hat Erbett ermordet, der kann also niemand mehr einen Lohn für meinen Kopf zahlen. Damit sind wir eine Sorge los. Übrigens sind das deine eigenen Worte. Bleibt der Nachtclan. Vielleicht wäre das ja der geeignete Zeitpunkt, mir zu erzählen, warum deine reizenden Freunde dich eigentlich so schrecklich gern wiedersehen möchten.«
Schon in der nächsten Sekunde bohrte sich Lavianys Zeigefinger in einen Punkt unter seinem Brustbein. Theo stöhnte auf.
»Vergiss es!«, fuhr sie ihn an. »Je weniger du weißt, desto sicherer lebst du. Dieser Bursche ist nicht aus Pubyr, das stimmt. Trotzdem gefällt er mir nicht.«
»Da kriege ich ja eher einen Melgen dazu, sich ausschließlich von Gras zu ernähren«, knurrte Theo, »als dass ich dich von deiner Überzeugung abbringe.«
»Wie hat er dich aufgespürt?«
»Gar nicht. Ich habe ihn zuerst gesehen.«
»Verstehe«, murmelte Laviany. »Und in deiner treuherzigen Art bist du dann sofort auf ihn zugestürmt, um ihn zu begrüßen … Aber gut, hoffen wir, dass sich unsere Wege in den nächsten Tagen wieder trennen. Du darfst mir dann auch unter die Nase reiben, wie sehr ich mich in deinem neuen Freund getäuscht habe. Hast du besorgt, worum ich dich gebeten habe?«
»Ja. Der Apotheker hat mich allerdings etwas seltsam gemustert, als er die Liste mit deinen Wünschen gesehen hat. Kannst du mir verraten, warum?«
»Das hättest du wirklich ihn fragen müssen«, erwiderte Laviany, als sie Theo die sorgsam verschnürten Päckchen abnahm. »Woher soll ich wissen, was im Hirn dieses Mannes vor sich geht? Denn er wird doch wohl nicht annehmen, ich wollte dieses Pulverchen hier mit jenem dort vermischen und anschließend in warmem Wasser auflösen. Damit könnte ich ja glatt die ganze Herberge vergiften …«
»Und das soll Scheron helfen?«
»O ja! Keine Sorge, mein Junge, ich weiß genau, was ich in welcher Menge womit zusammengeben muss. Unsere Scheron wird schon in den nächsten Tagen wieder auf den Beinen sein. Ein paar dieser Mittelchen brauche ich allerdings auch für andere Zwecke …«
»Und welche bitte?«, hakte Theo sofort nach. »Du heckst doch nicht wieder eine so hübsche kleine Überraschung aus wie letzte Woche?«
Sie starrte ihn verständnislos an. Nach einer Weile begriff sie, worauf er anspielte.
»Da ist mir ein Fehler unterlaufen«, brummte sie. »Das gebe ich gern zu.«
»Der uns alle beinahe das Leben gekostet hätte.«
»Wir brauchten Geld!«, fuhr sie ihn an. »Und dieser hochnäsige Kohlkopf von einem Adligen hatte davon mehr als genug!«
»Weshalb seine Leute die ganze Stadt nach dir durchgekämmt haben!«
»Na und? Gefunden haben sie mich nicht!«
»Aber wir haben wertvolle Tage verloren!«
»Eben! Ich hätte den alten Geldsack umbringen sollen. Dass ich ihn am Leben gelassen habe, werde ich mir nie verzeihen! Als Leiche hätte er uns weniger Schwierigkeiten bereitet.«
»Das hätte ich nun selbst dir nicht zugetraut.«
»Wie soll ich das verstehen? Als Anerkennung oder als Missbilligung?«, fragte sie. »Im Übrigen bereitet mir deine Gesellschaft Kopfschmerzen. Buchstäblich. Geh also schlafen! Ich werde einen Sud aus deinen Kräutern ansetzen und Scheron etwas davon einflößen. Das Mädchen muss zu Kräften kommen, wenn wir euren Thion finden wollen.«
Es war tief in der Nacht, das Feuer im Kohlebecken fast heruntergebrannt. Lediglich ein kleiner Kreis des Fußbodens und Scherons Bett wurden von seinem schwachen rubinroten Widerschein der Dunkelheit entrissen.
Laviany beugte sich über ihre junge Gefährtin und lauschte deren gleichmäßigen Atemzügen. Nachdem sie Scheron abermals etwas von dem Sud gegeben hatte, schlief diese nun tief und fest. Selbst als Laviany ihr die durchgeschwitzte Kleidung auszog, wachte sie nicht auf. Laviany wickelte sie fest in ein trockenes Laken und mehrere Decken.
Morgen, spätestens übermorgen können wir unsere Reise fortsetzen, mein Mädchen, versicherte Laviany Scheron in Gedanken. Da gehe ich jede Wette ein.
Schon im nächsten Augenblick kündete ein stechender Schmerz in ihrer Brust von Theos Nähe. Der Junge war im Nachbarzimmer untergebracht.
Bring ihn um!, raunte ihr eine Stimme zu. Bring ihn um! Bring ihn um!
Das Mal der Leere auf seiner Schulter übte auf sie den gleichen Reiz aus wie das Rascheln einer Maus auf eine Katze. Sie wollte nur töten.
Auf der Stelle.
Und mit jedem Tag wurde es schlimmer, denn das Mal gewann an Kraft. Theo veränderte sich. Er lachte weniger und trug häufig eine verschlossene Miene zur Schau. Es fehlte nicht mehr viel, und er würde zur Hülse werden.
Nach wie vor heulte der Wind, fegte ein Schneegestöber.
Mit einem Mal nahm sie aus den Augenwinkeln etwas wahr, das sie zwang, sich zum Kohlenbecken umzudrehen. Über eine Minute starrte sie auf die rubinrot glühenden Kohlen. Da! Einige weiße Funken stoben auf …
Unmittelbar darauf zerriss ein Schrei in der Ferne die Stille der Nacht. Rasch trat sie an das Fenster, gleichzeitig lief jemand durch den Gang vor ihrem Zimmer. Laviany eilte zur Tür und spähte hinaus.
Milvio stand mit dem Schwert in der Hand vor der Tür zum Schankraum, ein Hund, der auf jedes Geräusch lauschte. Nach einer Weile durchquerte er den Raum. Die Eingangstür quietschte in den Angeln. Kalter Wind wehte herein.
Sofort schlüpfte Laviany in ihre Jacke, griff nach ihrem Lanzenschwert und huschte ebenfalls hinaus. Als sie die Tür der Herberge hinter sich zuzog, hoffte sie inständig, es möge niemand aufwachen und den Riegel wieder vorschieben, bevor sie zurück war.
Aufmerksam schaute sie sich um. Die Spuren Milvios zeichneten sich als dunkle Flecken im Schnee ab. Sie führten zu den Wirtschaftsbauten, wo auch die Straße begann.
»Bei allen elenden Streifenfischen«, stieß Laviany aus.
Sie grub ihre Schneeschuhe wieder aus, legte sie an und eilte durch den wilden Flockensturm zur Scheune. Vorsichtig spähte sie um die Ecke.
Zwei zerfetzte Leichen und Schatten von Wölfen. Außerdem Milvio. Laviany verharrte, wo sie war. Für die beiden Toten kam eh jede Hilfe zu spät.
Sieben ausgewachsene Tiere verschlangen das heiße Fleisch, nur ein Wolf bemerkte Milvio. Als er sich auf ihn stürzte, holte dieser lediglich aus und hieb dem Biest den Kopf ab.
Trotzdem fletschte dieser Widerling weiterhin die Zähne.
Nun rissen auch seine Artgenossen die blutverschmierten Schnauzen herum. Milvio dürfte gleich wirklich gefordert sein, schoss es Laviany durch den Kopf. Er steckt knietief im Schnee, und die Wölfe umstreichen ihn. Wie will er einen Angriff von mehreren Seiten abwehren?
»Aber der Syor muss ja mir nichts, dir nichts aus der Herberge rennen«, brummte sie, um dann die Finger an die Lippen zu legen und einen scharfen Pfiff auszustoßen.
Sofort stürzten zwei Wölfe auf Laviany zu. Nach kurzem Zögern schloss sich ihnen ein dritter an.
Laviany wich hinter die Scheune zurück. Ihr Lanzenschwert hielt sie fest gepackt. Als das erste Biest sie ansprang, spießte sie es mit der Spitze ihrer Klinge auf. Dabei wäre sie selbst beinahe umgekippt, so schwer war das Tier. Ungerührt schob sie ihren Angreifer in die nächste Schneewehe und zog die Klinge heraus.
Schon holte das zweite Viech mit der Pfote nach ihrer Kehle aus. Laviany duckte sich, machte einen Ausfallschritt und schlitzte dem Burschen den Bauch auf.
Da griff bereits der nächste Gegner an – zusammen mit dem Wolf, den sie gerade in die Schneewehe befördert hatte.
»Soll der Gebannte euch doch holen!«
In ihrer Stimme lag mehr Erstaunen als Wut.
Im Eifer des Gefechts war ihr entgangen, dass es sowohl an der Schneide ihrer Waffe als auch im Schnee kaum Blut gab. Obendrein waren die Wolfsaugen fahlweiß …
Tot.
Und so rappelte sich auch der Wolf, dem sie den Bauch aufgeschlitzt hatte, wieder hoch und hielt auf sie zu, seine Eingeweide dabei hinter sich herziehend.
Als das Tier sich auf sie stürzte, um ihr das Gesicht aufzuschlitzen, bohrte sie ihm mit einem Aufschrei ihre Waffe in den Leib und nagelte es an die Bretterwand der Scheune. Den nächsten Wolf wollte sie mit dem Fuß abwehren, doch als ihre Hacke seinen Schädel traf, nahm nur ihr Schneeschuh Schaden. Im Nu zog sie ein Messer unter der Jacke hervor und warf sich auf das Tier. Mit ihrer linken Hand packte sie sein Fell so fest, dass er ihr seine Hauer nicht mehr ins Fleisch rammen konnte.
Während sie das Biest enthauptete, huschte ihr Blick kurz zu dem Wolf mit dem aufgeschlitzten Bauch. Der war noch mit sich selbst beschäftigt. Sie schleuderte den Schädel fort und stand auf.
Sofort versank sie mit dem rechten Bein tief im Schnee.
Fluchend löste sie den Riemen des linken Schuhs, humpeln wollte sie schließlich nicht. Noch während sie sich bückte, bohrten sich ihr Krallen in den Rücken, die ihre derbe Jacke mühelos aufrissen. Der Wolf mit dem aufgeschlitzten Bauch hatte sie erreicht.
Gleichzeitig näherte sich von vorn ein weiteres Tier, das deutlich gefährlicher wirkte.
Laviany zog den Kopf ein, presste das Kinn auf die Brust, spannte sämtliche Muskeln an und katapultierte sich zusammen mit dem Wolf auf ihrem Rücken in die Höhe.
»Bleib stehen!«, erklang da dicht an ihrem Ohr ein Schrei.
Mit einem Hieb seines Schwerts fegte Milvio den Wolf von ihrem Rücken. Ohne zu zögern, setzte er dem Tier nach und hackte ihm die Pfoten ab. Laviany durchwühlte mit bloßen Händen den Schnee.
»Suchst du das?«, fragte Milvio und hielt Laviany ihr Messer hin.
Wortlos nahm sie es an sich und drehte sich zu dem Wolf um, den sie mit ihrem Lanzenschwert an die Scheune genagelt hatte. Durch die aufgerissene Jacke fuhr ein eisiger Wind und versengte ihr den Rücken.
»Wir müssen dieses Drecksbiest vernichten«, stieß sie aus.
»Lass mich das erledigen«, erwiderte Milvio und holte bereits zum Schlag aus.
Doch er sollte nicht mehr zuhauen.
Ein Flirren ging durch die Luft, dann schien diese wie die allzu stark gespannte Saite eines Streichinstruments zu zerreißen. Noch im selben Augenblick fiel der Wolf an der Bretterwand in sich zusammen. Die Kraft, die ihn bisher am Leben gehalten hatte, war verpufft.
»Was ist nur aus unserer Welt geworden? Schahuter ziehen durch verlassene Straßen, Tote leben weiter …«, bemerkte Milvio nachdenklich. »Bisher hatte ich angenommen, dergleichen gebe es nur in Lethos.«
»Da bist du nicht der Einzige, der einem Irrtum aufgesessen ist«, gab Laviany zu und zog ihr Lanzenschwert aus der Scheunenwand. Der tote Wolf fiel in den Schnee. »Gestern hast du behauptet, jemand würde Jagd auf diese Wölfe machen. Anscheinend hat er sie erwischt.«
»Nein«, widersprach Milvio. »Das sind andere Tiere. Alte. Sie haben lange unter dem Schnee gelegen, bevor jemand sie wieder zum Leben erweckt hat.«
»Ein Mensch war das aber nicht!«, erklärte Laviany. »Wenn du mich fragst, war das der erste eisige Atemzug eines neuen Kataklysmus.«
»Das glaube ich nicht. Dem Kataklysmus verdanken wir die Verirrten Seelen und die blaue Flamme«, sagte Milvio. »Aber ich habe eine Kerze mit einer weißen Flamme gesehen.«
»Wenn du dir das mal nicht bloß eingebildet hast«, entgegnete sie sorglos, auch wenn sie innerlich erschauderte.
»Angeblich brennt eine Kerze nur mit weißer Flamme, wenn ein Nekromant in der Nähe ist. Oder eine Nekromantin.«
Daraufhin brach Laviany in ein schallendes Gelächter aus, von dem sie inständig hoffte, es möge nicht zu aufgesetzt klingen.
»Dann späh lieber rasch unter dein Bett«, brachte sie heraus. »Womöglich liegt da ja ein Nekromant. In inniger Umarmung mit einem Schahuter.«
»Theo hat mir gesagt, dass Scheron bei euch ist.«
»Was hat das Mädchen damit zu tun?«
»Sie ist eine Kämpferin gegen Verirrte Seelen. Und damit eine Nachfahrin von Nekromanten. Meinetwegen brauchst du dir keine Sorgen zu machen, ich werde kein Wort darüber verlieren. Aber sie muss wissen, was heute Nacht vorgefallen ist.«
»Das Mädchen hat mit alldem nichts zu tun, schreib dir das gefälligst hinter die Ohren! Eine Kämpferin gegen Verirrte Seelen beschützt die Menschen vor den Toten! Sie erweckt diese also ganz bestimmt nicht zum Leben!«
Milvios grüne Augen wirkten jetzt schwärzer als die Nacht, die sie beide umhüllte.
»Sorge dafür, dass sie es erfährt«, verlangte er, drehte sich um und enthauptete den Wolf.
Ihr Blick bohrte sich in seinen ungeschützten Rücken. Sie spuckte aus und eilte davon.
Zurück zur Herberge.
Die Kohlen im Kamin glommen kaum noch. Laviany gab einige Birkenscheite hinzu, zog ihre Jacke aus und setzte sich an einen Tisch. Fluchend starrte sie auf den Riss. Doch letzten Endes konnte sie noch von Glück sagen, dass ihr das Biest nicht das Rückgrat gebrochen hatte.