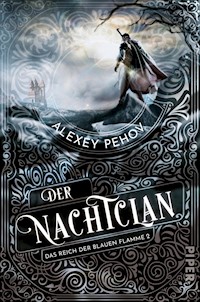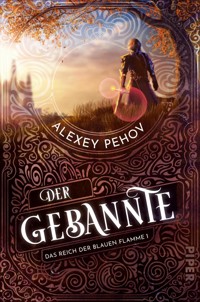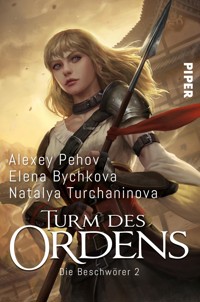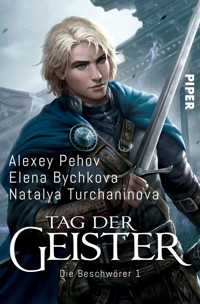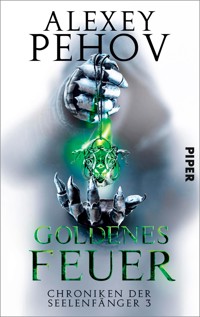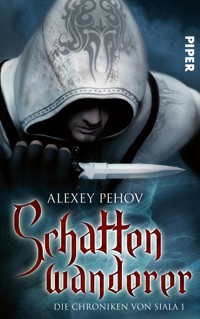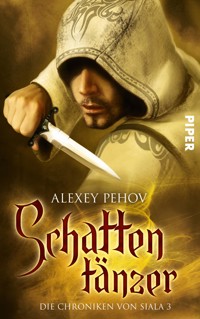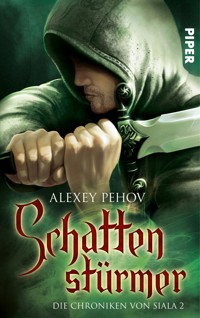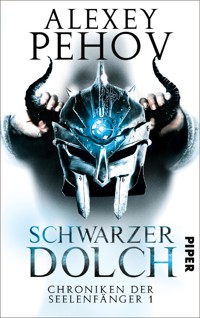9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In Fürstentümern, in verlassenen Dörfern, im Dunkelwald und am Ufer des Meeres treiben düstere Seelen ihr Unwesen. Gerüchte über eine schicksalhafte Urteilsverkündung geraten in Umlauf. Ludwig van Normayenn und die Bruderschaft der Seelenfänger sind die letzte Hoffnung der Menschen – nur sie können das Land noch vor der Dunkelheit bewahren. Doch Ludwig ist lebensgefährlich verwundet worden. Wird die Bruderschaft scheitern und die Welt zugrunde gehen? Alexey Pehov gehört zu den erfolgreichsten russischen Autoren unserer Zeit. Seine epischen Chroniken von »Siala« und »Hara« wurden zu internationalen Bestsellern, und die neue Serie des Autors, »Die Chroniken der Seelenfänger«, steht ihren Vorgängern auch in Band 2 in nichts nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Übersetzung aus dem Russischen von Christiane Pöhlmann
ISBN 978-3-492-97520-9
Oktober 2016
© 2011 Alexey Pehov
Die russische Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Autodafe« bei AL'FA KNIGA, Moskau.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Karte: Vladimir Bondar nach einer Vorlage von Alexey Pehov
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
1
Der Dunkelwald
An meine Eltern hatte ich kaum Erinnerungen. Nicht daran, wie sie aussahen, nicht daran, wie ihre Stimmen klangen. Worüber sie lachten, wovon sie träumten – ich weiß es nicht.
Das Einzige, woran ich mich erinnerte, war das Wiegenlied, das meine Mutter mir vorsang, damals, bevor ich ins Waisenhaus kam. Auf einem Tisch mit einer weißen Spitzendecke darüber stand eine Wachskerze, die ein sanftes Licht spendete. Die Flamme spiegelte sich in dem kleinen Fenster, durch das die verschneite Straße zu sehen war. Im Ofen prasselte Feuer, das für wohlige Wärme sorgte. Bereits einschlummernd, lauschte ich dem Lied meiner Mutter.
Seitdem waren wer weiß wie viele Jahre vergangen. Trotzdem träumte ich häufig von diesem Lied, wachte jedoch jedes Mal auf, bevor meine Mutter es zu Ende gesungen hatte. Danach lag ich stets wach, starrte an die Decke irgendeines Zimmers in irgendeiner Schenke oder auf die niedrig hängenden Äste von Ahornbäumen samt den Sternen am Himmel und versuchte, mich an das ganze Lied zu erinnern. Doch mein Gedächtnis kannte kein Erbarmen, stellte mir den Rest des Textes nie zur Verfügung, geschweige denn die Stimme meiner Mutter.
Als ich Apostel einmal gestand, wie sehr ich mich an den Schluss des Liedes und die Stimme meiner Mutter zu erinnern wünschte, hatte er bloß die Schultern gezuckt und gemurmelt, alle Menschen würden ihre Kindheit irgendwann vergessen.
Aber warum erinnerte ich mich dann an die verschneite Straße und die Kerze auf dem Tisch? Warum erinnerte ich mich an das von Grauen gezeichnete Gesicht unserer Nachbarin, als die ersten Menschen in Ardenau vom Justirfieber erfasst wurden. An die unter Schnee begrabenen Leichen, den Aufstand, Schießereien und gehenkte Menschen. Nur an den vollständigen Text des Wiegenliedes und die Art, wie meine Mutter gestorben war, erinnerte ich mich eben nicht.
Zu der Zeit, als ich die Beichte noch für recht bedeutsam hielt und sie folglich regelmäßig ablegte, hatte mir ein Kirchenmann einmal gesagt, Gott würde mich auf diese Weise auf die Probe stellen. Meine Demut solle dann im Paradiese vergolten werden, wo mir Engel besagtes Wiegenlied vorsingen würden. Aber in dem Punkt waren sich die Herren der Kirche ja durch die Bank einig: Im Jenseits würde sich alles glücklich fügen, weshalb man hienieden jedes Leid ertragen müsse – und bloß nicht vergessen dürfe, den Ablass zu entrichten.
Doch als Scheuch mich damals im Frühjahr auf der schmutzigen Landstraße geschultert hatte, mein Blut zu Boden getropft und ich fest davon überzeugt gewesen war zu sterben, da hatte ich keine Lieder gehört. Überhaupt nichts hatte ich da gehört. Keine Stimmen, keine Harfen. Mir war auch weder der Duft von Feldblumen oder Obstbäumen noch Schwefelgestank aufgefallen. Ich hatte irgendwo zwischen Himmel und Hölle gebaumelt, gefangen im Dunkel des Vergessens, und nicht einmal mehr gewusst, wer ich war, geschweige denn, wie das Wiegenlied in meiner Kindheit endete.
Irgendwann hatte mich Schlaf überwältigt, unendlich süßer Schlaf. Am liebsten hätte ich, gebettet in warme Schwanenfedern, ewig weitergeschlafen. Damit ich an nichts mehr denken musste. In diesem Zustand, weder tot noch lebendig, hatte ich mir eine Schwäche erlaubt, die ich mir seit Jahren versagt hatte: Ich hatte mein Schicksal in fremde Hände gelegt.
Hatte mich aufgegeben, auch nicht mehr an all diejenigen gedacht, denen ich etwas bedeutete. Sämtliche Entscheidungen über mein Leben hatte jemand anders getroffen …
Es war tief in der Nacht, bis zur Morgendämmerung schien es noch eine Ewigkeit hin zu sein. Allein der Gedanke, je wieder hinauf in die strahlende Sonne zu blicken, nahm sich absurd aus. Ich lag auf dem Rücken, unmittelbar auf dem erstaunlich warmen, wenn auch etwas rauen Boden, der gleichmäßig unter mir atmete. Dicht über mir zogen Sterne dahin. Kalte Sterne, die an die unablässig schlagenden Herzen von Menschen erinnerten. Und die sich allem gegenüber gleichgültig zeigten.
Völlig ungerührt.
Ich starrte wie gebannt auf sie, bis mir irgendwann die Augen tränten, bis mir ein messerscharfer Schmerz in die Hand fuhr und in meiner Brust eine Flamme explodierte, die sich im Nu zu einem wahren Feuersturm auswuchs. Meine Eingeweide verwandelten sich in Kohle, mein Blut in flüssiges Feuer, das durch die Adern brauste. Die Sterne drehten sich wie irr und büßten ihre klaren Linien ein. In meiner unmittelbaren Nähe fauchte es. Als ich mich abstützen und aufstehen wollte, spürte ich die kalte Haut eines Drachen unter mir. Außerdem verhinderten Stricke, mit denen ich gefesselt war, dass ich meinen Plan in die Tat umsetzte. Immerhin gewannen die Sterne ihre alte Gestalt zurück, wurden wieder zu den kalten Gebilden, als die ich sie kannte. Und auch der Drache gab Ruhe.
Eine Frau mit silbrigen Augen beugte sich über mich, legte mir ihre eisige Hand auf die Stirn und sah mich eindringlich an.
»Alles wird gut«, versicherte sie lächelnd.
»Bin ich denn nicht tot?«, stellte ich mit letzter Kraft die dümmste aller denkbaren Frage.
»Nein, Ludwig, das bist du nicht. Aber schlaf lieber weiter, denn die Zeit aufzuwachen ist noch nicht gekommen. Noch bist du zu schwach«, flüsterte die Frau. »Vertraue Brandbart, er bringt uns nach Hause. Dort kommst du wieder zu Kräften.«
»In mir drin …«, hauchte ich, »da brennt alles.«
»Schlafe nur! Es wird alles gut.«
Sie presste mir ihre schlanken Finger gegen die Schläfen. Die silbrigen Augen entfernten sich, die pumpenden Herzen der Sterne erloschen.
»Bei allen heiligen Duckmäusern! Dieser Teufelsspuk jagt mir einfach eine Heidenangst ein! Was also haben wir hier verloren?!« Apostel hockte auf dem Rand des mit Heilwasser gefüllten Beckens und hatte, wie ich im Licht der durch die Luft schwebenden Waldglüher bestens erkennen konnte, so ziemlich das miesepetrigste Gesicht aufgesetzt, zu dem er imstande war. Und das wollte einiges heißen.
»Du machst dir doch bloß Sorgen um Scheuch«, erwiderte ich gelassen, während mich, obwohl ich ausgestreckt im Becken lag, ein stechender Schmerz in der Seite plagte.
»So weit kommt’s noch, dass ich mir um den Herrn Vogelschreck Sorgen mache. Aber das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, da war er von Kopf bis Fuß mit deinem Blut beschmiert und hatte ein wahnsinniges Funkeln in den Augen. Ich muss dir nicht sagen, welche Rolle Blut bei allen möglichen Ritualen in der dunklen Magie spielt. Um es einmal drastisch auszudrücken: Unser Animatus dürfte da in jeder Hinsicht Blut geleckt haben.«
»Nur hat er mir damals nicht ein Härchen gekrümmt«, hielt ich dagegen.
»Als ob du der Einzige wärst, den er aufschlitzen kann«, knurrte Apostel. »Außerdem hast du ohnehin schon genug Löcher im Körper gehabt. Weshalb hätte er also noch seine Sichel zücken sollen? Wenn ich an all die Wunden denke, ist mir schleierhaft, wieso du damals nicht deinen letzten Atemzug getan hast. Im Übrigen warte ich immer noch auf ein Dankeschön dafür, dass wir dir das Leben gerettet haben!«
»Danke schön«, sagte ich brav. »Und nun hör auf, dir Sorgen zu machen.«
»Wie stellst du dir das denn bitte vor?! Jetzt ist Ende April. Im März haben wir dich gefunden. Damit haben wir fast einen Monat nichts mehr von Scheuch gehört. Sobald damals Hilfe gekommen ist, hat er sich verdrückt. Dabei hatte ich ihn doch inständig gebeten, bei uns zu bleiben!«
»Ehrlich gesagt, hätte ich beim Anblick eines schwarzen Drachen wohl auch Fersengeld gegeben.«
»Aber Scheuch streift jetzt völlig unbeaufsichtigt auf dem Festland umher, während wir hier auf dieser Insel festsitzen.«
»Im Unterschied zu mir kannst du jederzeit von hier verschwinden«, rief ich ihm in Erinnerung. »Wenn du willst, besteige das nächste Schiff und mach dich auf die Suche nach Scheuch.«
Er wischte sich bedächtig das Blut ab, das unablässig aus seiner eingeschlagenen Schläfe strömte.
»Ich soll dich hier auf dieser Teufelsinsel allein lassen?! Wo es mehr böse Geister gibt als bei jedem Hexensabbat in der Christenwelt? Glaub mir, Ludwig, an manchen Tagen würde ich nichts lieber tun als das. Aber Scheuch würde ja eh nicht auf mich hören. Bekanntlich hält er es doch für unter seiner Würde, mit mir auch nur ein Wort zu wechseln. Deshalb werde ich ihn kaum davon überzeugen können, mich zu dir zurückzubegleiten.«
»Er wird schon von selbst kommen, sobald er sein Roggenfeld satthat. So, wie ich ihn mit Blut getränkt habe, muss er in den nächsten Monaten wohl auch nicht auf Nahrungssuche gehen. Seinetwegen brauchst du dir also keine Gedanken zu machen.«
»Dein Wort in Gottes Ohr, Ludwig! Bleibt jedoch die Tatsache, dass auf dieser vermaledeiten Insel in jedem Baum und jedem Strauch irgendein Teufelsspross haust! Wie dir nicht entgangen sein dürfte, haben diese Kreaturen wenig mit guten Christen gemein.«
»Gute Christen triffst du ausschließlich im Paradies oder bei den Predigten von Dorfpriestern. Mitunter frage ich mich sogar, ob es in unserer Welt überhaupt noch gute Menschen gibt, mögen sie nun Christen sein oder nicht.«
»Der Markgraf muss dir ja tüchtig eins über den Schädel gezogen haben, als er dich gefangen gehalten hat«, ätzte meine gute alte, ruhelose Seele. »Anders kann ich mir den Unsinn, den du von dir gibst, nämlich nicht erklären. Gute Menschen trifft man an jeder Ecke. Wenn du mir nicht glaubst, sieh halt in den Spiegel!«
Ich brach in schallendes Gelächter aus.
»Spar dir deine Ironie, mein Freund«, rief ich Apostel dann zur Ordnung.
»Ich werde dir deine düstere Sicht großherzig verzeihen, schließlich kannst du bereits im nächsten Augenblick zu deinen Vorvätern abberufen werden.«
»Du verstehst es, einem Mann Hoffnung einzuflößen«, knurrte ich, denn ich verspürte nicht den geringsten Wunsch, ein so heikles Thema wie meine körperliche Verfassung zu erörtern.
»Nichts leichter und lieber als das«, parierte Apostel. »Ich werde beim Herrn ein gutes Wort für dich einlegen, damit er dich nicht vor der Zeit in seine paradiesischen Gefilde ruft. Unserem Scheuch wollen wir einstweilen sein Vergnügen gönnen. Soll er ruhig ein paar Angehörige des Ordens der Gerechtigkeit aufschlitzen. Diesen Dreckskerl – mag der Herr mir verzeihen, dass ich seine Schöpfung einmal nicht preise –, dem du deinen Aufenthalt in Burg Fleckenstein zu verdanken hast, hat Scheuch jedenfalls aufs Schönste zerhäckselt.«
»Mir ist schon seit geraumer Zeit aufgefallen, dass Scheuch eine besondere Vorliebe für die Ordensmitglieder hegt, wenn er seine Sichel zum Einsatz bringt«, gestand ich. »Allerdings habe ich nicht die geringste Ahnung, worauf sie zurückgeht.«
»Wenn du mich fragst, sitzt ihm die Sichel ja grundsätzlich recht locker. Aber lassen wir das«, sagte er, um dann anzukündigen: »Ich schlendere mal ein wenig runter zum Strand.«
Apostel konnte sich wie ein Kind über das kalte stählerne Meer, das Krachen der Wellen und die Brandung freuen, weshalb er mitunter tagelang am Strand entlangstreifte. Sobald er mich verlassen hatte, schaute ich nachdenklich zu den Waldglühern hoch, die über dem blauen nach Tannen duftendem Wasser schwebten.
Nach einer Weile verwandelten sie sich von gelben Lichtpunkten in hellgrüne und erloschen, worauf die ohnehin dunkle Nacht noch undurchdringlicher anmutete, während die Sterne ungleich heller zu strahlen schienen.
Als ich eine Bewegung in meinem Rücken wahrnahm, sah ich über die Schulter zu den kohlschwarzen Silhouetten der Bäume zurück. Das Blut rauschte mir in den Ohren, in meinen Adern loderte ein Feuer auf, das mein Fleisch schmolz. Kurz entschlossen tauchte ich unter Wasser, um diesen Brand zu löschen.
Als ich wieder auftauchte, kroch aus dem Wald eine riesige silbrige Schlange heran. Kurz vor dem Becken hielt sie inne, damit sich unsere Blicke kreuzen konnten, danach glitt sie geschmeidig ins Wasser. Es war ein gigantisches Reptil, weshalb der geschuppte Körper sich noch immer nicht vollständig aus dem Wald herausgeschlängelt hatte, obwohl der dreieckige Schlangenkopf längst vor meiner Nase aufragte. Das Tier zischte, ließ die gespaltene Zunge hervorschnellen, riss das Maul auf und rammte mir die Zähne in die Schulter.
Stünde dieser Schlange der Sinn danach, könnte sie mir mit einem einzigen Biss den Arm abtrennen. Ach was, sie könnte jedem Ochsen die Knochen zermalmen. Insofern musste ich mich glücklich schätzen, dass sie in mir keine Beute sah.
Ihr Gift drang wie geschmolzenes Metall in mein ohnehin verseuchtes Blut und brachte es noch stärker zum Brodeln. In meiner Brust brach ein Feuersturm los, der mich bei lebendigem Leibe zu verbrennen drohte.
Der Schmerz ließ mich stöhnen. Wahrscheinlich wäre ich untergegangen, hätte ich mich nicht an dem kräftigen Schlangenkörper festklammern können. Meine Arme um den Leib des Tieres geschlungen, schnappte ich nach Luft. Behutsam, ja, geradezu zärtlich wand sich das Reptil um mich.
»Es geht schon wieder«, versicherte ich, sobald der Anfall überstanden war.
Sofort gab Sophia mich frei, hielt sich aber bereit, mich jederzeit zu packen, sollte ich doch untergehen.
»Wirklich?«, fragte sie nach und sah mir fest in die Augen.
»Bestimmt.« Es kostete mich gewaltige Anstrengung, meine Stimme fest klingen zu lassen. »Ich bin wohlauf.«
Ich lehnte mich gegen den Beckenrand und wartete darauf, dass das Gift in meine Muskeln eindrang.
»Deine Genesung nimmt längst nicht den Verlauf, den sie nehmen sollte«, stellte Sophia mit einem schweren Seufzer fest. »Das Gift der Oculla und meine … meine Medizin liefern sich in deinem Körper einen unerbittlichen Kampf. Das nächste Mal sollte ich dir deswegen wohl eine geringere Dosis zukommen lassen.«
»Besser nicht, sonst hocke ich noch bis zum Jüngsten Gericht hier«, widersprach ich. »Das kann ich mir aber nicht leisten, denn auf mich wartet ein Haufen Arbeit.«
Das klang weitaus gröber als beabsichtigt.
»Tut mir leid, Sophia«, entschuldigte ich mich deshalb sofort. »Deine … deine Medizin hilft natürlich. Trotzdem lässt sich wohl niemand gern Schlangenzähne in den Körper rammen.«
Die Worte entlockten ihr ein glockenhelles Lachen. Abermals schwebten die Waldglüher heran und kreisten über unseren Köpfen.
»Glaub mir, Ludwig, diese Art der Behandlung gefällt niemandem.«
Über ihre nackte Haut rannen Wassertropfen. Ich achtete strikt darauf, ihr ausschließlich ins Gesicht zu sehen. Sie lächelte, als hätte sie meine Gedanken gelesen, und wrang die nassen, glitzernden Haare aus.
»Wann werde ich wieder ganz der Alte sein?«, fragte ich leise.
»Ich weiß, dass die Behandlung schmerzhaft ist, aber wie ich bereits gesagt habe, ist dein Zustand weit schlimmer, als ich angenommen habe. Noch mindestens zwei Wochen, würde ich daher meinen.«
Ich stieß einen Fluch aus. Wunderbar. Damit würde ich diese Insel erst Mitte Mai wieder verlassen.
»Ich will ganz gewiss nicht behaupten, dass ich deiner Gesellschaft überdrüssig wäre, schon gar nicht, wenn du nicht gerade meine Krankenschwester spielst«, versicherte ich und erntete die Andeutung eines Lächelns. »Aber ich bin ein Seelenfänger, ich habe mich um …«
»Deine dunklen Seelen müssen halt noch etwas auf dich warten.«
»Das kannst du doch nicht ernst meinen!«
»Jetzt hör mir mal zu!« Zum ersten Mal, seit wir uns kannten, erhob sie in meiner Gegenwart die Stimme. »Die Bruderschaft wird schon noch ein Weilchen ohne dich auskommen. Das hat sie vor deiner Zeit ganz gut geschafft, das wird sie auch jetzt hinkriegen. Du wirst exakt so lange in den Genuss meiner Gastfreundschaft kommen, wie ich es sage, und mich erst verlassen, wenn ich – und nur ich! – es dir erlaube. Falls du dich nicht daran hältst, kommst du vielleicht von unserer Insel weg – dann aber auch sehr schnell ums Leben! Habe ich mich klar genug ausgedrückt?«
»Ja, hast du.«
»Sehr schön«, erwiderte sie nun wieder in dem sanften Ton, den ich von ihr kannte. »Denn wir müssen dein Blut reinigen. Früher oder später wird mein Gift das der Oculla zersetzen. Du wirst selbst als Erster merken, wenn es so weit ist.«
»Tut mir leid, dass ich immer wieder vergesse, dass mit dieser Sache nicht zu spaßen ist. Wir Seelenfänger sind halt einfach nicht daran gewöhnt, krank zu sein.«
»Du bist auch nicht krank, sondern von einer Oculla verletzt worden. Wenn du nur die üblichen Wunden davongetragen hättest, dann würde das Waldwasser sie in wenigen Stunden heilen. Aber deine Wunden sind noch immer besorgniserregend.«
In diesem Moment stieß irgendwo im Wald ein Uhu einen lauten und durchdringenden Schrei aus.
»Für mich wird es Zeit«, sagte Sophia. »Bis nachher, Ludwig!«
»Bis nachher, Sophia!«
»Ach ja, ich habe gehört, dass Zif frech zu dir war. Wenn er es zu doll treibt, darfst du ihm gern eins hinter die Löffel geben.«
Zif hatte mir gestern irgendein Mistzeug in den Tee gegeben, das mich eine geschlagene Stunde hatte sabbern lassen. Zum unsagbaren Vergnügen dieses Burschen, versteht sich, der aus sicherem Abstand schallend über mich gelacht hatte.
»Das werd ich machen«, versicherte ich.
Sophia schwamm zum Beckenrand, stützte sich mit beiden Händen daran ab und zog sich hoch. Obwohl sie nackt war, zeigte sie keinerlei Befangenheit, als sie ihr Gewand aus dem Gras hob.
»Guervo hat noch ein Anliegen an dich«, teilte sie mir mit.
»Mhm.«
Sophia lächelte mir noch einmal zu, dann wurde sie vom Dunkel der Nacht geschluckt.
Trotzdem sah ich ihr noch lange nach.
»Glaubst du eigentlich«, wandte ich mich dann an Apostel, »sie merkt nicht, wie du sie begaffst, du alter Lustmolch?«
Meine gute alte, ruhelose Seele knurrte etwas in ihrem Versteck, dann verschwand auch sie.
Nach dem Biss schmerzte mein Arm furchtbar. Die Oculla, die mir in Burg Fleckenstein so zugesetzt hatte, war nicht gerade knickrig gewesen, als es darum ging, meinen Körper mit Gift vollzupumpen. Vielleicht hätten Reliquien uns im Kampf gegen das Gift dieser dunklen Seele gute Dienste geleistet, doch die waren auf der Insel ebenso wenig aufzutreiben wie ein Drache im Rathaus von Ardenau.
Allerdings barg der Dunkelwald auf diesem Eiland am westlichen Ende der Welt ein noch stärkeres Gegengift. Dafür musste ich Sophia und ihrer Magie dankbar sein. Im Grunde machte meine Genesung auch ganz gute Fortschritte, schließlich brauchte ich das Bett schon lange nicht mehr zu hüten.
Da der eisige Nachtwind mich frösteln ließ, zog ich mich rasch an. Die Waldglüher waren fast alle wieder davongeflogen, nur einer war geblieben und sorgte dafür, dass ich nicht völlig im Dunkeln dastand.
Nachdem ich auch noch den Gürtel mit meinem schwarzen Dolch angelegt hatte, schlenderte ich einen mit perlmuttfarbenen Muscheln gesäumten Weg zu Guervos Haus entlang. Der Waldglüher schwebte unmittelbar hinter mir, eine Fürsorge, für die ich ihm äußerst dankbar war, wäre es doch kein Vergnügen, durch die Finsternis zu tapsen. Grob gesprochen hätte es dabei zu gewissen Missverständnissen zwischen mir und der hiesigen Bevölkerung kommen können. Einmal war mir das schon passiert, da hatten mich ein paar Rugarus mit ihrer Nachtmahlzeit verwechselt und beinahe in Hacksteaks verwandelt. Diese Anderswesen waren nämlich völlig nachtblind.
Deshalb achtete ich inzwischen darauf, nie allein unterwegs zu sein. Nachts begleitete mich ein Waldglüher, tagsüber Zif, ein echter Kauz, der sich bei Guervo durchschmarotzte. Ob er irgendeine Aufgabe hatte, war mir nach wie vor ein Rätsel. Er schlief unterm Dach, futterte wie ein Scheunendrescher und fing wegen jeder Kleinigkeit Streit an. Ich an Guervos Stelle hätte diesen nichtsnutzigen Spitzbuben längst achtkantig rausgeworfen.
Erst vor ein paar Tagen war mir mal wieder die Hutschnur geplatzt, als Zif darüber gejammert hatte, dass am Fleisch Salz fehle. Da hatte ich ihm in aller Deutlichkeit ausgemalt, was ein Kirchenmann auf dem Festland mit einem wie ihm anstellen würde: Mit Weihwasser übergießen würde er ihn, auf den Scheiterhaufen werfen oder den Schlägermönchen vom Caliquerorden überlassen.
»Dann kann ich ja nur von Glück sagen, dass ich bei Guervo gelandet bin«, hatte er daraufhin völlig unbekümmert erwidert. »Das Fleisch ist zwar echt zähe Kost, aber solltest du es nicht wollen, würde ich mich deiner Portion erbarmen.«
Auf dieser weitläufigen Insel, die so groß war wie das Fürstentum Vierwalden oder das Königreich Broberger, konnte sich der alte Zif in der Tat sicher fühlen, denn im Dunkelwald richtete die Magie der Kirchenleute nichts aus. Selbst wenn der Heilige Vater samt seiner ganzen heiligen Gefolgschaft oder die Apostel des Herrn persönlich einmal im Dunkelwald auftauchen würden, wären sie außerstande, auch nur den harmlosesten Zauber zu wirken. Ob es ihnen schmeckte oder nicht – sie würden sich durch nichts mehr von gewöhnlichen Menschen unterscheiden.
Dennoch hatte die Kirche wiederholt versucht, auch im Dunkelwald Fuß zu fassen, war aber mit diesen grandiosen Plänen jedes Mal fulminant gescheitert. Dem Heiligen Stuhl wurde derart eingeheizt, dass er fürderhin darauf verzichtete, auf dieser Insel zu landen. Die Zauberer, Hexen und Anderswesen, die in diesen düsteren Wäldern hausten, hatten nämlich einen ganz unbestreitbaren Vorteil auf ihrer Seite: Ihre Magie klappte hier noch. Ganz hervorragend sogar.
Die Kirche erklärte den Dunkelwald daraufhin zu einem verfluchten Gebiet und verbot es allen Menschen der aufgeklärten Welt unter Androhung der Exkommunikation, diese Insel zu besuchen. Der Dunkelwald, dieses letzte Bollwerk alter Magie, hatte damit fast achthundert Jahre lang seine Ruhe. Hier überdauerte eine ursprüngliche Kraft, die von der Kirche nicht gebilligt wurde, hier tummelten sich die letzten Anderswesen, die früher auch auf dem Festland anzutreffen gewesen waren und dort Seite an Seite mit den Menschen gelebt hatten.
Es hatten angeblich auch immer wieder Menschen versucht, auf die Insel zu fliehen, bedauernswerte Zeitgenossen, die hier vor der Inquisition Schutz suchen wollten, ehe ihnen der Prozess wegen Zauberei, dem Besitz verbotener Bücher, Leichenöffnung zum Zwecke anatomischer Studien, Verbreitung alter heidnischer Lehren oder der Vivisektion von Fröschen auf Grundlage chagzhidischer Lehrwerke gemacht wurde. Sie wurden jedoch nur selten mit offenen Armen empfangen, meist wies man sie trotz inständiger Bitten, doch bleiben zu dürfen, ab.
Ich hatte Sophia einmal danach gefragt, wer eigentlich entscheide, ob man auf der Insel bleiben dürfe oder sie wieder verlassen müsse.
»Der Dunkelwald selbst«, hatte sie geantwortet. »Sein Herz. Wir halten uns stets an seine Entscheidung.«
»Was ist mit mir? Hat über mich auch der Dunkelwald entschieden?«
»Einigen wir uns darauf, dass du mein persönlicher Gast bist«, hatte sie erwidert. »Weil mir so gut gefallen hat, wie du auf dem Ball beim Hexensabbat das Tanzbein geschwungen hast.«
Deutlicher hätte sie mir nicht zu verstehen geben können, dass sie über das Thema eigentlich nicht reden wollte …
»Quten Abend, qute Nacht, von Requen bequacht«, trällerte eine alte Kröte mit einem Hut aus feiner Spitze und rosafarbener Hemdbrust. Diese possierliche Kreatur hatte ich schon öfters im Wald getroffen, sodass wir mittlerweile als gute Bekannte gelten durften.
»Vielen Dank für die Warnung!«
Meine Bekannte nickte mir hoheitsvoll zu, ließ die Zunge hervorschnellen und erhaschte einen großen Nachtkäfer, den sie rasch in ihrem Maul barg.
Vom Hauptweg zweigten zwar etliche schmale Pfade ab, die ich jedoch tunlichst mied. Solange ich mich in Sophias oder Guervos Waldabschnitt aufhielt, durfte ich mich weitgehend sicher fühlen. Die Hinterwäldler außerhalb dieses Bereichs könnten aber durchaus auf die Idee kommen, mir das Fell zu gerben.
Denn Menschen mochte man auf dieser Insel nicht besonders. Man duldete sie, mehr aber auch nicht.
Daher wurde es selbst auf dem Hauptweg gelegentlich brenzlig. Gerade kam mir beispielsweise ein Geschöpf auf vier zweigartigen Pfoten entgegen, das sich eine Art Katzenfell übergeworfen hatte. Es stierte mich mit roten Augen an, dann wanderte sein Blick weiter zu dem Waldglüher. Die Kreatur stieß einen lauten Rülpser aus, klaubte mit einer ihrer Pfoten in ihrem Sabbermaul herum, offenbar auf der Suche nach etwas, seufzte enttäuscht und verschwand wieder hinter den Bäumen. Erst jetzt bemerkte ich, dass dieses Geschöpf einen Fuchs mit eingeschlagenem Schädel am Schwanz gepackt hielt und hinter sich herzog, dabei eine blutige Spur zurücklassend.
An der nächsten Abzweigung hatten sich unter der alten Kiefer ein paar Pickler versammelt, dünne Burschen mit zottigem Bart, in dem sich mehr Perlen fanden als Flöhe auf einem Straßenköter. Sie klärten gerade, wer morgen die Tannenzapfen einsammeln solle. Als einer dieser hageren Wichte mich entdeckte, lüpfte er höflich den aus einem Pilz geschnitzten Hut. Ich nickte ihm zu, obwohl wir uns zum ersten Mal begegneten. Der Rest der Bande war inzwischen bereits damit beschäftigt herauszufinden, wer von ihnen den längsten Bart hatte, ein Unternehmen, das ihre ungeteilte Aufmerksamkeit verlangte.
Vorbei an einem plätschernden Bach gelangte ich zu einem schmalen Waldfluss mit erstaunlich schneller Strömung. Die Weiden am Ufer neigten ihre Zweige weit über das Wasser. In ihnen schaukelten morgens gern Aquinen, flinke junge Frauen mit Haifischzähnen, denen es unermessliches Vergnügen bereitete, die Trunkler zu einem Wettschwimmen durch den Fluss herauszufordern. Zuweilen versuchten die Aquinen, mich in ihr gefährliches Spiel miteinzubeziehen, ein Wunsch, den ich ihnen zu ihrem Bedauern nicht erfüllte. Aber wie wollte ich – ein einfacher Mensch ohne Schwimmflossen – denn bitte mit diesen Wesen mithalten?!
Jetzt am Abend hatte es sich jedoch niemand in den Zweigen gemütlich gemacht, sodass einzig der Wind und das dahinströmende Wasser sie bewegten. Allerdings huschten überall Waldglüher hin und her. Tagsüber verkrochen sie sich gern in Guervos Herd, sobald sich aber die Nacht herabsenkte, streiften sie durch die Gegend.
Ein Dutzend dieser Funken stürzte mir mit lustigem Geflacker entgegen. Nur zu gern hätten sie mich von meinem Weg gelockt.
»Die alte Kröte hat mir verraten, dass es bald regnet«, teilte ich ihnen mit. »Passt also auf, dass ihr nicht erlöscht.«
Als Nächstes kam ich zu einer windschiefen, halb eingefallenen Hütte, die an eine tote Weide gebaut war. Darin lebte irgendein Hutzelwesen, von dem ich mich möglichst fernhielt, denn jedes Mal, wenn es mich bemerkte, stimmte es ein Gezeter an, das durch den ganzen Wald hallte. Im Übrigen besaß diese Kreatur grundsätzlich einen recht sonderbaren Charakter und pflegte allerlei Grillen. Beispielsweise die, Schädel auf den Zaun vor der Hütte zu spießen oder Fensterläden und die Tür mit menschlicher Haut zu bespannen.
Selbst der Waldglüher in meiner Begleitung dämpfte sein Licht, als ich mich am Vorgarten vorbeischlich. In diesem wuchsen Kräuter, die das Bewusstsein eines Menschen vernebelten, aber auch Menschenköpfe, die lautlos den Mund aufsperrten und mit ihren blinden Augen rollten. Als Apostel dieses Beet das erste Mal gesehen hatte, war ihm derart schlecht geworden, dass er stehenden Fußes kehrtgemacht hatte und erst nach drei Tagen wieder aufgetaucht war.
»Ludwig!«, rief mich jemand, sobald ich den Abschnitt mit den Eichen erreicht hatte.
Die alte Stimme kam aus einer Baumkrone. Ich legte den Kopf in den Nacken und spähte in das Blattwerk hinauf.
»Was ist?«, fragte ich.
»Kannst du mir einen Bernstein besorgen?«
»Warum suchst du nicht selbst danach?«
»Weil ich nicht zum Meer gehen kann. Aber ich brauche den Stein wirklich dringend. Besorgst du mir einen? Niemand sonst will mir helfen. Es spricht nicht einmal jemand mit mir.«
»Gut, wenn ich einen Bernstein finde, bringe ich ihn dir mit«, versprach ich.
Die alte Agathana war ein harmloses Geschöpf, auch wenn bei ihr im Oberstübchen nicht alles stimmte. Sie lebte völlig zurückgezogen auf ihrem Baum, vermutlich in einem großen Astloch, und legte ungeheuren Wert darauf, dass niemand sie zu Gesicht bekam.
Hinter ihrem Baum begann Guervos Revier, das dieser, wie ich von Sophia wusste, eigenhändig angelegt hatte, indem er aus anderen Teilen des Walds Eicheln herangeschafft und hier in den Boden gesteckt hatte. Daraus waren längst mächtige Bäume entstanden. Sein Spitzdachhäuschen konnte man nur sehen, wenn Guervo es einem erlaubte. Das Gleiche galt übrigens für die Grotte mit dem kristallklaren Wasserfall, in die Sophia sich gern zurückzog.
Auf den Stufen vorm Haus schlummerte, in ein Bärenfell gehüllt, Zif. Da ihm der Mund ein wenig offen stand, wirkte sein ohnehin grobes Gesicht noch abstoßender. Als ich an ihm vorbeiging, stieß er einen lauten Schnarcher aus, öffnete eines seiner roten Augen, grummelte einen Fluch, drehte sich auf die andere Seite und zog sich das Fell über den Kopf.
Bei Guervo selbst handelte es sich um einen Viengo, also ein Anderswesen, über das man gern Freundlichkeiten à la »Wer einen Viengo beklaut, den kostet es die Haut« oder »Haust übers Ohr du einen Viengo, drischt im Nu er dich zu Stroh!« zu berichten wusste. Diese Weisheiten waren nicht ganz aus der Luft gegriffen, denn Viengos taten sich gern durch Angriffsfreude und Blutrünstigkeit hervor. Von Guervo konnte ich dergleichen jedoch nicht behaupten, er hatte sich mir stets von seiner freundlichen Seite gezeigt, ruhig und zurückhaltend und immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Auch hatte ich nie gesehen, dass er seine Tiergestalt annahm, was diese Anderswesen nämlich konnten.
Als ich jetzt ins Haus eintrat, saß Guervo auf einem Holzklotz, der ihm als Sessel diente, vor dem Kamin und las in der Heiligen Schrift.
»Guten Abend, Ludwig!«, begrüßte er mich strahlend. »Tut mir leid, dass ich dich so spät noch mit einem Anliegen behellige. Ich hoffe, es kommt dir nicht allzu ungelegen?«
»Bestimmt nicht«, versicherte ich.
Sophia hatte uns einander erst hier auf der Insel vorgestellt, doch begegnet war mir Guervo bereits vorher. Sogar auf dem Festland, genauer beim Ball der Hexen in Burg Cobnac. Und einen Viengo vergaß man nicht so schnell, schließlich lief einem nicht jeden Tag ein Wesen mit Hirschhörnern über den Weg. Das Geweih sollte ja über erstaunliche Heilfähigkeiten verfügen. Menschen kamen an die Dinger aber kaum heran. Um es ganz unmissverständlich zu sagen: Es war wesentlich einfacher, in die Höhle eines hungrigen Bären zu krauchen, als einen Viengo zu erlegen. In der Regel tauschten Jäger und Gejagter nämlich schon nach kürzester Zeit die Rollen – und der erbeutete Menschenkopf fand Verwendung als Zierrat im Heim des Viengo.
Nebenbei bemerkt blickte Guervo voll Stolz auf eine stattliche Sammlung: Eine ganze Wand in der Diele war mit Menschenschädeln behangen, ein etwas gewöhnungsbedürftiger Anblick, der meiner Meinung nach so gar nicht zu der sonstigen anheimelnden Einrichtung passen wollte. Doch Apostel hatte behauptet, Scheuch würde den Gegensatz sicher zu schätzen wissen.
»Was hältst du von einem kleinen Spaziergang, mein ajergo?«, fragte er mich, wobei er mir die Ehre zuteilwerden ließ, mich in seiner Sprache als Freund anzusprechen.
»Jetzt gleich?«, wollte ich wissen.
»Wenn du es einrichten könntest«, antwortete er lächelnd. Doch seine Augen blickten sehr ernst drein.
»Gut«, willigte ich ein. »Soll mir recht sein.«
»Hervorragend!«
Er legte ein Lesezeichen in die Bibel und erhob sich. Nun überragte er mich um einen Kopf. Seine aus Moos und Flechten gefertigte Latzhose verwandelte sich prompt in einen Umhang, während sein Hirschgeweih, das bis eben noch ein silbernes Licht gespendet hatte, zunächst verblasste, dann erlosch.
»Es ist nicht weit«, beruhigte mich Guervo. »So etwas hast du gewiss noch nie gesehen.«
»Jetzt machst du mich wirklich neugierig.«
Guervo nahm einen gewaltigen Bogen aus goldschimmerndem Holz an sich, spannte ihn mit einiger Anstrengung und warf sich einen Köcher über die Schulter, in dem lange, befiederte Pfeile steckten.
»Dann lass uns aufbrechen!«
Zif wachte abermals auf und bedachte uns mit einem finsteren Blick.
»Mitten in der Nacht noch draußen rumzustreifen!«, grummelte er. »Ratzen solltet ihr! Hat jemand was dagegen, wenn ich jetzt ins Haus umziehe?«
»Wag es ja nicht, dich in meinem Bett aufs Ohr zu hauen!«, erwiderte Guervo. »Du kannst es dir vor dem Kamin gemütlich machen. Und du bleibst hier!«
Die letzten Worte galten dem Waldglüher, der mich eben hierher begleitet hatte.
Sobald wir Agathanas Baum erreicht hatten – sie bat mich bei der Gelegenheit gleich abermals, ihr einen Bernstein zu besorgen –, verließ Guervo den Pfad und schlug sich in den Wald.
Er bewegte sich lautlos und geschmeidig wie ein Gespenst, sodass er nicht einmal mit dem riesigen Geweih an Ästen hängen blieb. In Stärke und Entschlossenheit stand er einem Edelhirsch in nichts nach. Aus Rücksicht auf mich verlangsamte er aber bald seinen Schritt und blieb immer wieder stehen, damit ich zu ihm aufschließen konnte.
Nach einer Weile hatten sich meine Augen endlich an die Dunkelheit gewöhnt, sodass ich nun Schatten zu unterscheiden oder Einzelheiten zu erkennen vermochte. Um uns herum schimmerten zahllose bläuliche Farne. Auf einer Lichtung versanken meine Füße in weichem Moos, das einen angenehmen Duft verströmte. Jahrhundertealte Bäume waren von Bartflechten bewachsen, die von Faltern mit flammend gelben Flügeln und von funkelnden Glühwürmchen umschwirrt wurden.
Irgendwo in der Dunkelheit verströmten alte Baumstümpfe ein kaltes, fahlgrünes Licht, und immer wieder blitzten in den Zweigen die roten Augen der hiesigen Bewohner auf. Einmal schoss auch ein geflügelter Schatten mit unverhältnismäßig großem Kopf und langem Hals lautlos über uns hinweg.
In den Baumkronen raschelte der Wind, Nachtvögel gaben ihre klagenden Schreie von sich, in der Ferne erklang ein Weinen, das an das Lachen von Hyänen erinnerte. Zahllose Wesen huschten durchs Unterholz, flohen über Wurzeln, kicherten in den Ästen, keuchten im Gebüsch und brachen sich knackend ihren Weg. Ruhig war es in diesen Wäldern selbst nachts nicht.
Unser Erscheinen sorgte selbstverständlich für weiteren Aufruhr. Wir schreckten einige Wesen auf, die dann unter mürrischem Gefiepe davonstürzten. Eine Art zitronengelber Riesentausendfüßler mit leuchtenden Beinchen und Barthaaren krabbelte geschwind über einen alten Baumstamm davon. Was wohl geschähe, wenn der Bursche jemandem in den Ausschnitt schlüpfte?
Einmal wandte sich ein Wesen in einer mir unbekannten Sprache an Guervo, der zu meiner Überraschung in ausgesprochen scharfem Ton antwortete. Als ich ihn darauf ansprach, um was es gegangen sei, erklärte er mir: »Er hätte dich gern mit mir geteilt, ajergo.«
»Bitte?!«
»Er hat dich für mein Abendbrot gehalten und deshalb um ein wenig Fleisch gebeten. Ich kann diesen Nichtsnutz und Hungerleider partout nicht ausstehen. Dieser Wald bietet genug Nahrung für uns alle, aber der Bursche ist einfach zu faul, seine Höhle zu verlassen und auf die Jagd zu gehen.«
Schon schälte sich ein weiteres Wesen aus der Dunkelheit, eine hochaufgeschossene Gestalt, die mich anknurrte. Ein Blick von Guervo genügte jedoch, und das Geschöpf presste ein »Oh, Verzeihung!« heraus und verschwand wieder, bevor ich auch nur in Panik geraten konnte.
»Du bist wahrlich ein König des Waldes«, bemerkte ich.
»Das ist ein alter Bekannter«, erwiderte Guervo lächelnd. »Da er nicht besonders gut sieht, unterläuft ihm immer wieder mal ein Fehler bei der Wahl seines Essens. Vermutlich ist dir der Schreck in die Glieder gefahren. Aber keine Sorge, wenn wir wieder zu Hause sind, gibt es für uns beide erst einmal einen kräftigen Schluck Glühwürmchenwein.«
»Klingt verlockend«, murmelte ich. »Aber ich will nicht hoffen, dass er tatsächlich aus Glühwürmchen gemacht wird …«
»Ganz bestimmt nicht.«
Je weiter wir liefen, desto stärker roch es nach Salz und Meer, während der Duft von Tannennadeln, Blättern, Moos, feuchtem Wald, Pilzen und bitteren Beeren immer stärker in den Hintergrund gedrängt wurde. Irgendwann hörte ich das erste Krachen.
Kurz darauf gelangten wir ans offene Meer. Am Ufer pfiff ein eisiger Wind. Die Brandung toste. Wir standen auf einem Granitfelsen. Der Weg hinunter zum Wasser stellte eine gewisse Herausforderung dar.
»Müssen wir da runter?«, fragte ich Guervo etwas kleinlaut.
»Nein«, antwortete dieser lächelnd und deutete auf einen schmalen Spalt in der Wand aus Weißdornsträuchern. »Wir müssen hier entlang.«
Guervo führte mich in eine Schlucht, in der ich mich nur noch tastend vorwärtsbewegen konnte.
»Pass auf, wo du hintrittst, ajergo«, warnte er mich.
Die Schlucht mit einem kleinen Bach darin zog sich am Ufer entlang. Obwohl die Felsen immer höher wurden, konnten wir das Krachen der Wellen nach wie vor deutlich hören. Guervo bewegte sich unverändert geschickt und behände vorwärts, ich dagegen war mittlerweile rechtschaffen müde, obendrein plagte mich die Wunde in meiner Seite. Meine miserable Verfassung blieb Guervo nicht lange verborgen, sodass er mir erst einmal eine kurze Verschnaufpause gönnte. Neugierig sah ich mich um. Am anderen Ende der Schlucht erhob sich ein kohlschwarzer Hügel.
Plötzlich ließ ein tiefes Brüllen die Erde beben. Mir sträubten sich unweigerlich die Nackenhaare. Sofort griff ich nach meinem Dolch.
Und dann setzte sich der Hügel in Bewegung. Mit der Geschmeidigkeit einer Schlange drehte er sich zu uns um. Ein langer Schwanenhals mit einem gewaltigen Kopf schob sich aus dem Steinmassiv. Violette Augen funkelten uns zornig an.
»Ganz ruhig, Brandbart«, sprach Guervo das Wesen an. »Erkennst du mich denn nicht?«
Brandbart, der vermutlich den halben Marktplatz in Ardenau einnehmen würde, erinnerte mit seiner glänzenden schwarzen Farbe ein wenig an einen Aal, wenn auch an einen, über dessen Nacken sich ein gezackter Kamm zog. Flügel fehlten ihm – was ihn freilich, wie ich aus eigener Erfahrung wusste, nicht daran hinderte, sich in die Lüfte aufzuschwingen.
Brandbart linste begehrlich zu mir herüber, seufzte schwer und zog den Kopf etwas zurück, damit wir uns ihm nähern konnten.
»Danke schön, dass du mich in den Dunkelwald gebracht hast«, wandte ich mich an den Drachen. »Sophia hat mir gesagt, dass ich ohne deine Hilfe gestorben wäre.«
Brandbart kniff die Augen zusammen, stieß eine Fontäne himbeerroter Funken aus den Nüstern und gab mit feiner Stimme ein paar Worte von sich.
»Er sagt, dass du dich jederzeit für diese Gefälligkeit erkenntlich zeigen kannst«, teilte mir Guervo mit.
»Wie das?«
»Ganz einfach, ajergo. Siehst du das da drüben?«
»Ich traue meinen Augen nicht«, flüsterte ich.
»Das darfst du getrost.«
Zwanzig Meter vor mir lagen in einem Steinkreis sechs bernsteinfarbene Eier, die etwa die Größe eines Menschen hatten. In ihnen schien eine Flamme zu züngeln.
»Sie sind wunderschön«, stieß ich ergriffen aus.
»Aber leider werden aus ihnen keine kleinen Drachen schlüpfen. Kurz bevor es so weit ist, geht das Gelege ein.«
Brandbart stieß abermals etwas in seiner Sprache aus. Guervo hob beschwichtigend die Hand und sprach leise auf ihn ein.
»In ein paar Tagen werden die Eier zerstört werden«, erklärte er mir dann. »Etwas entzieht ihnen das Feuer des Lebens, sodass nur die Schale übrig bleibt. Anfangs haben wir vermutet, es stecke Magie oder ein Fluch dahinter. Aber wir sind auf keinen Hinweis gestoßen, der diese Überlegung bestätigt hätte. Sophia und ich befürchten nun, eine dunkle Seele habe hier ihre Finger im Spiel.«
Dieser Gedanke überraschte mich. Dunkle Seelen scherten sich eigentlich nicht um Drachen, Wölfe oder Feldmäuse. Ihr ganzes Sinnen und Trachten galt Menschen, ihrer wichtigsten Nahrungsquelle.
»Deshalb hat Brandbart mich also in den Dunkelwald gebracht«, sagte ich. »Wie viele Gelege hat er schon verloren?«
»Etliche.«
»Warum habt ihr dann erst jetzt einen Seelenfänger zu Hilfe geholt?«
»Weil es nicht immer einfach ist, Menschen zu uns einzuladen, ajergo.«
»Die Flamme in den Eiern erlischt immer in der Nacht, bevor die Drachen schlüpfen würden? Nie früher?«
»Richtig.«
»Hat schon mal jemand versucht, die Eier von der Insel fortzubringen? Nach Neuhort, wo kein Fremder einen Fuß hinsetzen darf? Oder nach Rowalien, wo es keine dunklen Seelen gibt?«
»Das geht leider nicht. Die Zeiten der Vergangenheit sind vorbei, heute können Drachen ausschließlich im Dunkelwald ausgebrütet werden, denn nur hier gibt es die Magie, die sie zum Leben und Wachsen benötigen. Hätte eure Kirche nicht alle heiligen Bäume, aus denen Hexen und Zauberer ihre Kraft beziehen, auf dem Festland gefällt, sähe die Sache anders aus. Was hältst du von unserer Vermutung, dahinter stecke eine dunkle Seele?«
»Um dir diese Frage zu beantworten, müsste ich näher an das Gelege herantreten und mir die Eier genau ansehen.«
Brandbart stieß eine Rauchwolke aus und fauchte wütend.
»Das verstehe ich auch ohne deine Hilfe«, brummte ich. »Sollte ich den Schatz des Herrn Drachen anfassen, macht er Kleinholz aus mir.«
Guervo rang sich ein entschuldigendes Lächeln ab. Schritt für Schritt näherte ich mich unter Brandbarts misstrauischem Blick dem Gelege. Der Drache schob seinen Kopf über mich und brutzelte mich fast mit seinem heißen Atem.
»Wenn du auf meine Hilfe hoffst, dann solltest du mich wenigstens einen Blick auf die Eier werfen lassen«, sagte ich ihm – was mir glatt einen weiteren finsteren Blick eintrug. »Guervo, besteht die Schale der Eier wirklich aus Bernstein?«
»Kennst du etwa die Sage nicht, dass es sich bei dem Bernstein im Meer um Splitter der Schalen von Dracheneiern handelt?«
»Aber das ist nur eine Sage«, entgegnete ich, während ich versuchte, Hinweise auf eine ruhelose Seele zu entdecken. »Ich brauche Tatsachen. Also – ist das Bernstein?«
»Ja. Und zwar richtiger Bernstein, nicht das erbärmliche Zeug aus Bäumen. Warum ist das für dich so bedeutsam?«
Brandbart lauschte unserem Gespräch aufmerksam.
»Weil manche ruhelosen Seelen nicht nur von Blut angelockt werden, sondern auch von seltenen Materialien. Von Gräsern oder Gestein. Einige Seelen sind auch ganz erpicht auf Bernstein. Allerdings sind sie völlig harmlos und fügen niemandem Schaden zu. An diesen Eiern kann ich im Übrigen keinen Hinweis darauf feststellen, dass eine dunkle Seele hier ihren Schabernack treibt. Ich habe eine Figur gewirkt. Das ist Magie von uns Seelenfängern. Sie würde es mir verraten, wenn eine dunkle Seele in der Nähe wäre. Das ist aber nicht der Fall.«
»Dann trügt deine Magie. Irgendeine dunkle Seele verhindert, dass diese Drachen ausgebrütet werden. Deshalb brauchen wir ja auch deine Hilfe.«
Mein Blick wanderte zwischen Guervo und Brandbart hin und her.
»Natürlich werde ich euch helfen«, setzte ich vorsichtig an. »Versprechen kann ich aber nichts.«
Vom Meer waren schon vor einiger Zeit Wolken herangezogen, jetzt setzte feiner Nieselregen ein. Genau wie die alte Kröte es vorausgesagt hatte.
»Wir sollten uns besser auf den Rückweg machen«, murmelte Guervo. »Die weiteren Einzelheiten besprechen wir bei einem Becher Glühwürmchenwein.«
»Ich könnte eine Figur wirken, die das Gelege schützt. Wenn wirklich eine dunkle Seele ihre Finger im Spiel hat, würde sie damit von den Eiern ferngehalten. Dafür müsste ich jetzt aber meinen Dolch ziehen.«
Ich sah den Drachen fragend an. Dieser seufzte und trat einen winzigen Schritt zurück.
»Wenn Brandbart das Gelege bewacht«, wandte ich mich an Guervo, »wo steckt dann eigentlich die Mutter?«
»Sie hält sich so lange in der Luft auf, bis die Jungen geschlüpft sind. Wenn sie denn schlüpfen …«
»Ich werde tun, was in meinen Kräften steht, damit das geschieht.«
Bei dem Glühwürmchenwein handelte es sich um grünen Rebensaft. Er funkelte in den feinen Kristallgläsern geradezu und schmeckte leicht nach Pfefferminz. Guervo und ich sprachen dem Getränk begeistert zu. Dabei erzählte mir der Viengo mehr über das Schicksal der Gelege.
Inzwischen schüttete es wie aus Eimern. Zif, der neugierig einen Fuß vor die Tür gesetzt hatte, kam bis auf die Knochen durchnässt wieder herein. Dabei stank er derart nach nassem Fell, dass Guervo ihn bat, sich erst einmal zu waschen, ehe er es sich vorm Kamin gemütlich machte. Das lehnte dieser Nichtsnutz jedoch kategorisch ab. Stattdessen verzog er sich auf den Dachboden und haute sich dort aufs Ohr.
Ich wäre eigentlich auch ganz gern schlafen gegangen, beschloss aber, auf Sophia zu warten, um zu hören, was sie zu dem Tod der Drachenjungen meinte.
Als sie endlich Guervos Haus betrat, trug sie den Geruch von Zedernharz herein. Ihr kurzes silbernes Obergewand klebte an ihrem schlanken Körper. Guervo gab noch etwas Holz ins Kaminfeuer und holte warme Kleidung. Sobald Sophia sich umgezogen und im Sessel Platz genommen hatte, öffnete er eine neue Flasche Wein.
»Dass du deine Gewohnheiten aber auch nie änderst, vaelja«, knurrte Guervo, milderte seine Worte jedoch, indem er Sophia höflich mit dem Titel Sehende ansprach. »Sobald es regnet, musst du draußen herumstreifen.«
»Weil der Regen meine Gabe als Seherin wegspült, mein Freund. Deshalb kann ich in solchen Momenten völlig allein mit mir sein. Für mich sind das die kostbarsten Augenblicke, die ich mir nur denken kann. Hast du Ludwig das Gelege gezeigt?«
»Ja.«
»Hast du ihm auch gesagt, dass wir mit jedem Drachen, der stirbt, schwächer werden?«
»Nein.«
»Die Drachen lebten schon im Dunkelwald, als es hier noch keine Menschen gab«, erklärte mir Sophia daraufhin. »Sie sind ein Teil der Magie, die du in dieser Welt findest. Sobald einer von ihnen stirbt, nimmt auch unser Können ab. Gibt es erst einmal überhaupt keine Drachen mehr, wird die Menschen nichts daran hindern, unsere Insel zu erobern. Wenn ich aber eines nicht will, dann dass die Männer der Kirche bei uns landen. Dann würden sie unsere Magie auch hier auslöschen, ganz genau wie auf dem Festland. Aber der Dunkelwald ist die letzte Zufluchtsstätte für Geschöpfe wie mich. Deshalb müssen diese Küken schlüpfen. Die Zahl der schwarzen Drachen in dieser Welt ist ohnehin schon beängstigend klein.«
»Ich habe Guervo diese Frage schon gestellt, jetzt wiederhole ich sie: Warum habt ihr nicht schon früher einen Seelenfänger um Hilfe gebeten?«
»Aber das haben wir! Die Bruderschaft hat uns jedoch abgewiesen.«
»Bitte? Die Magister haben sich geweigert, eine dunkle Seele auszulöschen?«
»Sie wollten die Beziehungen zum Heiligen Stuhl nicht aufs Spiel setzen. Angesichts all der Probleme mit dem Orden der Gerechtigkeit kann deine Bruderschaft getrost auf Schwierigkeiten mit den Kirchenleuten verzichten.«
»Und dass sie nichts von meinem Aufenthalt hier weiß, kommt euch ganz gelegen, um es einmal so auszudrücken …«
»Dir aber auch«, erwiderte Guervo mit freundlichem Lächeln. »Denn wenn irgendjemand auf dem Festland davon erführe, hättest du vermutlich keine einzige ruhige Minute mehr. Man würde dir zusetzen, um herauszubekommen, was du hier gesehen hast, mit wem du gesprochen hast und mit welchem bösen Geist du dich vergnügt hast. So aber kommt niemand auf die Idee, dich mit unnötigen Fragen zu belästigen.«
»Welch rührende Sorge«, bemerkte ich grinsend. »Aber natürlich helfe ich euch. Es ist das Mindeste, was ich tun kann, um mich dafür erkenntlich zu zeigen, dass ihr mir das Leben gerettet und mich so gastfreundlich bei euch aufgenommen habt. Zunächst müssen wir jedoch unbedingt klären, ob wirklich eine dunkle Seele dahintersteckt. Diese Kreaturen tauchen ja nur auf, wenn ein Mensch stirbt. Aber seit ich auf der Insel bin, habe ich keinen einzigen Menschen zu Gesicht bekommen.«
»Du hast dich nur noch nicht gründlich umgesehen, ajergo. Zwei Stunden von hier entfernt gibt es ein Dorf von Victen.«
»Von einem solchen Volk habe ich noch nie gehört.«
»Es sind Barbaren, die eigentlich auf den Wolfsinseln leben«, teilte Guervo mir mit. »Als ihr Land vor etwa einhundert Jahren vom Justirfieber heimgesucht wurde, haben sie bei uns Zuflucht gesucht. Die Seuche hatten übrigens Händler aus Neuhort zu ihnen gebracht.«
»Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich daran«, murmelte ich gedankenversunken. »Ist das Dorf der einzige Ort auf der Insel, wo Menschen leben?«
»Am Westufer schon. Im Osten gibt es aber noch weitere Dörfer. Bis zu ihnen bräuchtest du allerdings etliche Tage.«
»Dann sollte ich diesem Dorf wohl tatsächlich einen Besuch abstatten und feststellen, ob es dort dunkle Seelen gibt.«
»Keine gute Idee, denn dort zieht man dir bei lebendigem Leib die Haut von den Knochen. In diesem Dorf hat man für Fremde nämlich nichts übrig.«
»Das hat man nirgends. Verrate mir also lieber, wie ich dort hinkomme!«
»Zif dulden sie«, warf Sophia ein. »Mehr noch, sie verehren ihn sogar.«
»Stimmt«, bestätigte Guervo. »Offenbar ähnelt er ihrem Gott der Fruchtbarkeit und Ausschweifung, ein Umstand, den sich unserer Pfiffikus nur zu gut zunutze macht.«
»Bisher hat sich Zif nicht gerade zuvorkommend mir gegenüber verhalten«, setzte ich vorsichtig an. »Sollte er sich jetzt aber für mich verwenden …«
»Oh, das wird er. Zif kennt mich genau. Wenn dir irgendein Unheil widerfahren sollte, würde ich sehr böse werden.«
»Dann kann ich mir ja in dem tröstlichen Wissen, dass du Zif tüchtig die Leviten liest, von den Victen das Fell gerben lassen.«
»Wir müssen uns auf Zif verlassen, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.«
»Wisst ihr zufällig, ob die Victen noch eine Rechnung mit den Drachen offenhaben?«
»Du hast doch Brandbart gesehen! Welcher Mensch sollte mit ihm noch eine Rechnung offenhaben?!«
»Hat er sie vielleicht irgendwie gegen sich aufgebracht?«
»Menschen interessieren ihn nicht, jedenfalls nicht, solange sie sich von seinem Gelege fernhalten. Meine Hand würde ich für ihn allerdings nicht ins Feuer legen. Deshalb werde ich ihn fragen, ob es Spannungen zwischen ihm und den Victen gibt.«
»Das Ganze gefällt mir nicht«, stieß ich müde aus. »Sophia, du kannst doch in die Zukunft blicken …«
»Nicht, wenn Drachen im Spiel sind«, fiel sie mir ins Wort. »Denn sie können selbst in die Zukunft sehen. Auch meine Magie hilft mir bei diesen Geschöpfen nicht weiter. Was auch immer ich versucht habe, um denjenigen zu finden, der die Gelege zerstört, ist gescheitert. Deshalb sind diese Eier, die du heute gesehen hast, nach wie vor in Gefahr. Selbst als ich mich unter den illustren Gästen des Balls in Burg Cobnac umgehört habe, konnte mir niemand etwas Aufschlussreiches sagen. Nicht einmal die alten Hexen oder Universitätsgelehrten wissen etwas. Deshalb ruht all unsere Hoffnung auf dir. Vielleicht findest du ja etwas heraus …«
Sophia versuchte zwar, ihre Verzweiflung und ihren Schmerz vor mir zu verbergen, doch das wollte ihr nicht so recht glücken. Guervo war ihr in dieser Disziplin weit überlegen.
»Obwohl es zahllose dunkle Seelen gibt, habe ich noch nie von einer Art gehört, die Drachen oder ihren Gelegen Schaden zugefügt hätte«, hielt ich fest. »Ich verspreche euch aber zu tun, was in meinen Kräften steht, um dieses Rätsel zu lösen. Wenn wirklich eine dunkle Seele dahintersteckt, komme ich ihr auf die Spur.«
Ich wurde auf höchst unangenehme Art und Weise aus dem Schlaf gerissen: Jemand trat mir ohne viel Federlesens in die Rippen. Und zwar mit voller Wucht. Bevor Zif zum nächsten Tritt ausholen konnte, packte ich schlaftrunken sein Bein und zog es zur Seite, sodass Zif mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufschlug.
»Du Mistkerl!«, keifte er.
»Auch dir einen wunderschönen Morgen«, knurrte ich und rieb mir durch das Hemd die schmerzende Seite. »Du hast wirklich eine unverwechselbare Art, Menschen zu wecken. Hast du dir mal überlegt, was geschieht, wenn du jemanden aus dem Schlaf trittst, der nicht so gutherzig ist wie ich? Glaub mir, für manch einen wäre es höchst reizvoll, dir einen Dolch in deinen Wanst zu bohren!«
»Du hast es gerade nötig! Statt mir dankbar zu sein, dass ich dir weder einen Giftmolch noch ein Hornissennest ins Bett gesteckt habe, quittierst du einen freundschaftlichen Knuff damit, dass du mich zu Boden schmeißt! Was meinst du denn, was mir jetzt für eine Beule wächst?! Und nun raus aus den Federn, Seelenfänger! Je eher wir unseren Auftrag erledigt haben, desto schneller bin ich dich wieder los.« Nach diesen Worten stapfte Zif aus meinem Zimmer, sich dabei wütend unter der Achsel kratzend.
Bei Zif handelte es sich um einen Beelzegeist, ein Anderswesen, das häufig mit Teufeln verwechselt wurde. Meiner Ansicht nach ging das allerdings auf den bekannten Kupferstich Die Teufel bringen einen Mörder in ihre Küche, um ihn im Ofen zu schmoren zurück, bei dem der Künstler einen der Teufel durch einen Beelzegeist ersetzt hatte. Wie auch immer, die Folge davon war, dass diese Kreaturen auf dem Festland vollständig ausgerottet worden waren.
Zifs Erscheinung war zugegebenermaßen bestens geeignet, jeden gottesfürchtigen Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen: Hufe an den Füßen, dicke befellte Schenkel, ein lederner Lendenschurz, rosafarbener Rattenschwanz und ein behaarter Bauch, bekrallte Finger, ein fratzenhaftes Gesicht mit einem gewaltigen Zinken, runden gelben Augen und kleinen Hörnern, die aus der störrischen Mähne herausragten. Hinzu kam sein hinterhältiges Wesen. Das Einzige, was ihm zum echten Teufel noch fehlte, war eine Mistgabel, mit der er einen armen Sünder in der Pfanne wendete, damit er auch ja von allen Seiten schön knusprig wurde.
»Du hättest mich ruhig warnen können«, knurrte ich Apostel an.
»Oh, keine Sorge, das hätte ich getan, wenn dir ernsthaft Gefahr von dem Burschen gedroht hätte«, versicherte er. »Aber Zif will doch nur ein wenig Spaß haben. Bei der Gelegenheit! Hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass die meisten Bewohner dieser Insel gar nicht gut auf dich zu sprechen sind? Als Guervo Zif gebeten hat, dich zu begleiten, wollte dieser erst ablehnen. Aber da hättest du den Viengo mal hören sollen!«
»Damit wäre auch geklärt, welche Laus Zif heute morgen über die Leber gelaufen ist«, murmelte ich. »Und was ist mit dir? Warum schaust du so finster drein und verpestest mit deiner Stinklaune die Luft eine Meile gegen den Wind? Gibt es ein bestimmtes Wesen, das deinen Groll erregt hat?«
»Durchaus«, antwortete meine ruhelose Seele mit schwerem Seufzer. »Das gibt es. Dich nämlich.«
»Womit habe ich dich denn verärgert, während ich süß und selig geschlafen habe?«
»Damit, dass du zugestimmt hast, dieses Drachengelege zu retten.«
»Wenn Brandbart mich nicht hergebracht hätte, wäre ich vermutlich irgendwo im Süden Vierwaldens verblutet.«
»Und geworfen wurde der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt«, parierte Apostel mal wieder mit einem Spruch aus den heiligen Büchern, »geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen.«
»Erspar mir diesen Unsinn!« Ich schnallte den Gürtel um und rückte die Scheide zurecht. »Du weißt ganz genau, dass Drachen nicht mit dem Satan im Bunde stehen. Der Höllenfürst verfolgt seine Ziele, die Drachen ihre, beide verbindet nichts. Und mit Sicherheit werde ich nicht in der Hölle landen, weil ich meine Arbeit erledige und eine dunkle Seele auslösche.«
»Pass lieber auf, dass du nicht selbst ausgelöscht wirst. Jeden Abend leidest du in diesem verfluchten Heilwasser Höllenqualen. Dein Blut ist inzwischen voller Gift. Wer weiß, ob du dadurch nicht irgendeinen bleibenden Schaden davongetragen hast. Deshalb solltest du, wenn du mich fragst, so schnell wie möglich von hier weg. Du würdest doch unterwegs nicht schlappmachen, oder?«
»Ich fürchte, genau das würde ich. Außerdem würde ich Sophia damit kränken.«
»Eine etwaige Kränkung dieser Dame ist nun wahrlich das Letzte, was mich schert«, grummelte Apostel und ließ sich aufs Bett fallen. »Kränkungen von Hexen kümmern mich grundsätzlich nicht. Aber gut, dein Wille ist dein Himmelreich, schließlich geht es hier um deine Seele. Aber erwarte von mir keine Hilfe, wenn dich dieser Drache aus lauter Dankbarkeit zusammen mit deinem wunderbaren Dolch verschmaust.«
Kopfschüttelnd verließ ich das Zimmer. Apostel hatte sich heute wahrlich selbst übertroffen, was seine Miesepetrigkeit anging. Seit wir vor zwei Jahren wegen eines Hochwassers im Frühling in Hungien festgesteckt hatten, hatte ich bei ihm nicht mehr eine solche Stinklaune erlebt. Damals hatte sein einziges Vergnügen darin bestanden, auf einem Dach zu hocken und den Leichen nachzusehen, die aus frischen Gräbern gespült wurden und an ihm vorbeitrieben.
»Mit wem palaverst du da, Seelenfänger?«, wollte Zif wissen, der es sich auf Guervos Holzklotzsessel gemütlich gemacht hatte.
Der Viengo musste das Haus also schon verlassen haben, sonst hätte sich der Beelzegeist nie so ungezwungen herumgelümmelt.
»Mit meiner ruhelosen Seele.«
»Guervo hat dir Frühstück gemacht. Und er hat mich gebeten, dich zum Dorf dieser Victen zu bringen. Also, trödle nicht rum, ich hab keine Lust, den ganzen Tag mit dir zu verplempern.«
»Geht das vielleicht auch etwas freundlicher?«
Daraufhin verzog er bloß das Gesicht, schnappte sich eine Scheibe Roggenbrot, stopfte sie sich in den Mund und beobachtete kauend, wie ich mich an den Tisch setzte und mich über das Essen hermachte.
Apostel war immer noch nicht aus meinem Zimmer gekommen. Aber gut, wenn er nicht mitwollte, war das seine Entscheidung.
Nach dem Regen in der letzten Nacht hing ein satter Geruch von feuchter Erde und jungem Grün in der Luft. Die Wiese war noch nass, von den Blättern der Bäume fielen die letzten Tropfen. Die grauen Regenwolken waren allerdings längst weit über das Meer gezogen.
»Mieses Wetter!«, knurrte Zif. »Da stinkt mein Fell wieder den ganzen Tag.«
»Wasch dich halt!«
»Heißes Wasser und Seife kann ich nicht ausstehen, davon brennen mir die Augen.«
»Sophia hat gesagt, wir bräuchten zwei Stunden.«
»Mit dir brauchen wir mindestens drei.«
»Warum das?«
»Weil ich mit dir nicht durch den Wald laufen kann. Das wäre nämlich, als ob ich an einem Hundezwinger vorbeigehe und ein rohes Stück Fleisch an einer Schnur hinter mir herziehe. Im besten Fall würden die Biester bei der Schnur haltmachen, im schlimmsten knabbern sie mir auch noch die Hand an. Guervo hat in seinem Teil das Sagen, nicht aber im ganzen Dunkelwald. Außerdem kommt man im Wald mit einem Menschen sowieso nur langsam voran. Inzwischen würde ich ja alt und grau werden, während meine Kinder heranwachsen und die ersten Enkel das Licht der Welt erblicken …«
»Du hast doch gar keine Kinder.«
»Ich hätte welche, wenn ich nicht ständig auf dich aufpassen müsste. Aber was soll ich machen, wo Guervo mich darum gebeten hat …«
»Du hättest ihm den Wunsch ja abschlagen können.«
»Leider nicht, ich schulde ihm nämlich noch einen kleinen Gefallen. Er hat mich mal aus dem Sabbermaul von irgendeinem Mistviech gezogen, dafür hat er noch was bei mir gut. Deshalb bringe ich dich zu den Victen. Und da du wie ein Blinder durch den Wald tapsen würdest, spazieren wir besser am Meer entlang. Das geht schneller.« Dann wanderte sein Blick zu meinem Dolch. »Hast du noch was Solideres als diesen Zahnstocher dabei?«, fragte Zif mit einem Blick auf meinen Dolch.
»Nein.«
»Na, das lässt sich ändern.«
Er ging noch einmal ins Haus und kam mit einem langen Schwert aus dem letzten Jahrhundert zurück. Der Griff war aufwendig gearbeitet, die Klinge übermäßig breit.
»Hier«, sagte er und hielt mir die Stichwaffe hin.
»Wo hast du denn dieses uralte Ding her?«
»Das stammt von einem Jäger, der zu gern Guervos Geweih an sich gebracht hätte. Stattdessen hängt jetzt allerdings sein Dez an Guervos Wand. Zweite Reihe, dritter Schädel von links, wenn ich mich nicht täusche.«
»Wäre es nicht etwas unklug, bei den Victen mit diesem Ungetüm aufzutauchen?«`
»Meiner Ansicht nach wäre nur eins unklug: ohne Schwert bei ihnen aufzutauchen.«
»Dann sieh zu, dass du etwas Passenderes für mich findest!«
»Glaubst du etwa, Guervo hat im Keller eine Waffenkammer?«, entgegnete Zif. »Echt! Er kann auf Klingen nun wirklich verzichten! Dieses Schwert habe ich ins Haus gebracht.«
»Dann darfst du es jetzt auch tragen.«
»Zum Teufel mit dir, Seelenfänger, dann tauch doch mit deiner Stricknadel bei den Victen auf. In dem Fall mach dich aber darauf gefasst, dass sie dich auslachen und mit dem Finger auf dich zeigen. Vermutlich fordern sie dich auch auf, die Hosen runterzulassen, damit sie sich überzeugen können, dass sie tatsächlich einen Kerl vor sich haben, kein Weibsbild. Tu ihnen also den Gefallen und befriedige ihre Neugier, sonst reden sie kein Wort mit dir.«
»Nun mach mal halblang«, entgegnete ich lachend. »Die Victen halten dich für einen Gott, dem sie fruchtbaren Boden und eine gute Ernte zu verdanken haben. Wenn du sie darum bittest, mit mir zu reden, dann tun sie das auch.«
»Weißt du was?«, knurrte Zif. »Du gehst mir jetzt schon auf die Nerven! Wie also soll ich da die nächsten Stunden mit dir überstehen?«
Nach diesen Worten warf er das Schwert auf die Stufen vorm Haus und stapfte entschlossenen Schrittes los, ohne sich auch nur einmal nach mir umzusehen.
Das Meer lag ruhig wie ein müder Riese da, der sich in einer schweren Schlacht verausgabt hatte. Das graue, noch frühlingshaft kalte Wasser hatte sich weit vom Ufer zurückgezogen und umspülte nur noch einige pilzförmige Felsen am Horizont. Vor uns sahen wir nur von braunen Algen durchzogenen Schlamm.
Darin tat sich jedoch einiges. In Pfützen dümpelten Fische, auf die nun etliche Wesen aus den Wäldern und anliegenden Bergen Jagd machten. Dicke Krabben brachten sich unter panischem Geklapper ihrer Scheren in schmalen Ritzen in Sicherheit. Ein paar Kreaturen, die aussahen wie Waschbären, denen man statt des Fells versehentlich purpurrotes und grünes Gefieder verpasst hatte, versuchten unter lautem Gekicher die armen Krabben mit Stöcken wieder aus ihren Verstecken zu locken.
Schmächtige türkisfarbene Wesen in rosafarbenen und grünen spitzen Muscheln nutzten die Gelegenheit, um ungezwungen miteinander zu plaudern und Duftstäbchen zu rauchen. Als wir recht nahe an einer dieser offenen Schalen vorbeikamen, duckte sich der Bewohner sofort, schrie uns wütend etwas in seiner Sprache hinterher und klappte sein Dach zu.
»Klappe, du Muschelhauser!«, zischte Zif, der offenbar verstanden hatte, was der Bursche uns an den Kopf geworfen hatte. Wütend trat er mit dem Huf ein Loch in die perlmuttfarbene Muschel. »Wenn ich das noch mal höre, schleppe ich dich vom Wasser weg und werf dich den Ameisen zum Fraß vor, du Meeresgewürm!«
Aus der Muschel kam kein Ton mehr. Auch in den benachbarten Schalen warf man vorsichtshalber die Duftstäbchen weg, um sich in die Behausung zurückzuziehen.
»Was für eine Brut!«, stieß Zif aus, spuckte auf eine Muschel, sammelte die rauchenden Duftstäbchen ein und steckte sie mit dem glühenden Ende in den feuchten Sand.
Damit schien sein Rachedurst gestillt zu sein, was ihn jedoch nicht daran hinderte, eine noch größere Stinklaune zu verbreiten als bisher.
»Und zugleich!« Eine Horde von Springnagern versuchte ein ledriges Wesen zurück ins Meer zu schleppen. Dieses gab sich alle Mühe, auch aus eigener Kraft auf das rettende Nass zuzukriechen, damit seine Retter es wenigstens etwas leichter hatten, kam jedoch nicht das winzigste Stückchen vorwärts.
»He!«, schrie uns einer der Springnager zu. »Helft uns mal!«
Ich nahm natürlich an, Zif würde ihm eine Abfuhr erteilen, die sich gewaschen hatte.
»Komm, lass uns mal sehen, ob wir diesen Brocken nicht irgendwie vom Fleck bewegen können«, wandte er sich jedoch zu meiner Überraschung an mich. »Ohne Wasser geht er ein.« Dann wandte er sich einigen pferdgroßen Kreaturen zu, die an riesige Heuschrecken erinnerten und im Schlamm miteinander spielten. »He, ihr! Schluss mit lustig, eure Hilfe wird gebraucht!«
Die riesigen Insekten mit den Facettenaugen trotteten auf uns zu, um den gestrandeten Unglückswurm wieder ins Wasser zu ziehen. Zif, die Springnager und ich halfen, indem wir ihn von hinten anschoben.