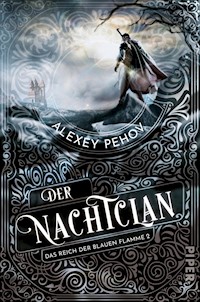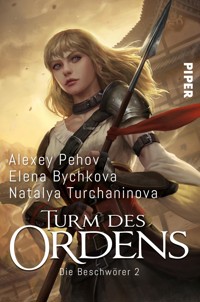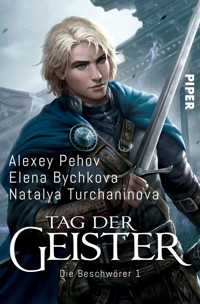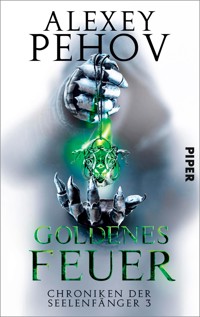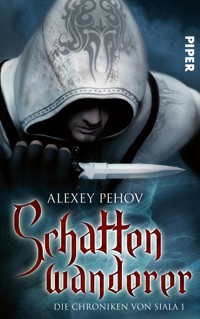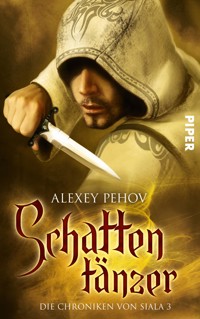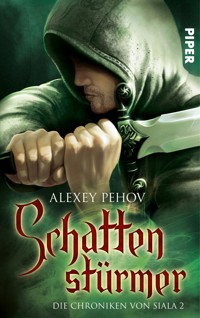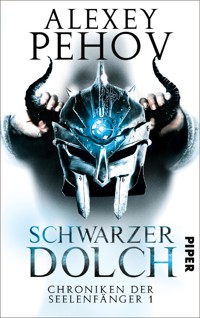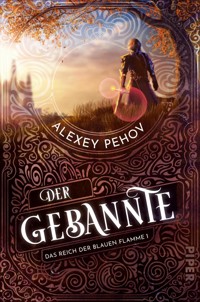
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Sage nach hat einst ein legendärer Magier seinen Lehrmeister, den Gebannten, in einem großen magischen Krieg besiegt. Seit dem Ende des Krieges ist die Magie aus der Welt verbannt, gemunkelt wird aber, dass sie immer noch im Untergrund schlummert. Theo verdingt sich auf dem Schwarzmarkt als Verkäufer von mystischen Artefakten. Als er eine Statue veräußern will, gerät er in einen Hinterhalt – die Statue erwacht zum Leben und eine magische blaue Flamme entzündet sich. Bei der Flucht vor seinen Feinden trifft Theo auf Laviany, Angehörige des Nachtclans. Sie hat sich mit ihrer Assassinengilde überworfen und wird ebenfalls verfolgt. Scheinbar hat ihr Jäger es auf Theos Statue abgesehen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy.
www.Piper-Fantasy.de
Übersetzung aus dem Russischen von Christiane Pöhlmann
© Alexey Pehov 2014
Titel der russischen Originalausgabe:
»Letos« bei AL'FA-KNIGA, Moskau 2014
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Karte: Alexey Pehov
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: Stephanie Gauger, Guter Punkt, unter Verwendung von Motiven von GettyImages
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Karte
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Dem Angedenken Andrej Schirjajews
Prolog
Peinigende Stille breitete sich im noch unversehrten Kern der Stadt aus wie Milch, die jemand aus einer gigantischen Kanne auf den Boden goss.
Langsam, aber unerbittlich schwappte sie in jedes Haus, flutete jede Straße, jedes Viertel. Niemand entkam ihr. Die prachtvollen, in ihrem Gold funkelnden Paläste samt ihrer Türme aus blauem Marmor kapitulierten vor ihr ebenso wie die Kirschgärten mit ihrem weißen Blütenmeer, die elfenbeinernen Brücken, die breiten, sonnengetränkten Terrassen aus warmem Sandstein, die herrlichen Springbrunnen, die imposanten Statuen der Helden aus der Vergangenheit oder die Obelisken mit den Darstellungen von Albatrossen.
Die Albatrosse mit ihren gespreizten Flügeln ...
Über sie fiel die Stille zuallerletzt her. Dann aber vermochten nicht einmal mehr diese magischen Geschöpfe, die dem Land vor Hunderten von Jahren ihren ewigen Schutz zugesichert hatten, dieser Kraft etwas entgegenzusetzen. Waren gefallen. Ihre Augen brachen, das von ihrem Gefieder ausgehende Licht erlosch.
Nunmehr für immer.
Vom Hafenviertel angefangen bis hin zur Festung hoch oben am Hang auf den steilen Klippen hatte sich in der gesamten Stadt eisiges Schweigen ausgebreitet.
Kein Vogel sang, denn Vögel gab es nicht mehr. Kein Hund bellte, denn der letzte Vierbeiner war noch vor Anbruch der allmächtigen Lautlosigkeit gestorben. Zusammen mit seinem Herrn. Kein Kind lachte, kein Kind spielte vergnügt. Vom Hafen drang kein Gelärm mehr heran ...
Die Springbrunnen versiegten, das türkisfarbene Wasser ergoss sich nicht länger in die prachtvollen Becken aus rosafarbenem Perlmutt. Der Wind verstummte, müde des vergeblichen Brüllens, das nie das Ohr der Erhabenen Sechs erreichte. Sogar das Meer schwieg, eingeschüchtert vom eigenen Wüten. Als schämte es sich dieses Rasens, zu dem es sich hatte hinreißen lassen, hatte es sich zurückgezogen. Im graubraunen Schlamm zappelten Fische, umschlungen von Algen, im Todeskampf, den Mund zu einem lautlosen Schrei der Agonie geöffnet, während glutrote Krabben auf die Spalten in den Meeresklippen zuflitzten, der kochend heiße Schlick indes obsiegte.
Die Steine barsten nicht mehr, rangen nicht mehr wie Lebewesen nach Atem. Auf ihnen gerannen Basaltströme zu großen Tränen.
Die Stille eroberte die Stadt und richtete sich in ihr ein, als wollte sie nie wieder weichen.
Doch dann wurde sie aufgestört.
In einem Gang mit rosafarbenen Säulen, der zu dem Tempel der Erhabenen Sechs am Fuße eines Hügels führte, waren Schritte zu vernehmen. Sie begleitete ein leises melodisches Pfeifen.
Im dichten Schatten bewegte sich ein Mann. Sobald er ins Sonnenlicht hinaustrat, musste er blinzeln. Einige Sekunden verharrte er reglos, damit sich seine Augen an die Helligkeit gewöhnten.
Er atmete die heiße, würzige Luft ein. Dann wandte er sich nach Westen um. In weiter Ferne, unmittelbar am Horizont, hinter dem sich das Meer versteckt hatte, waren als stahlgraue Legion Wolken aufgezogen, die der ohnehin dem Untergang geweihten Stadt einen weiteren verhängnisvollen Schlag versetzen wollten.
Eine tiefe Falte durchfurchte die Stirn des Mannes. Was sich hier zusammenbraute, missfiel ihm. Das schienen die Wolken zu spüren, denn sie rückten nicht weiter gegen die Stadt vor. Blitze zuckten. Vermutlich donnerte es auch, doch das vermochte der Mann nicht wahrzunehmen, dazu war das Gewitter viel zu weit weg.
Und näher kam es nun nicht mehr ...
Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen und mit Neugier im Blick setzte der Mann seinen Weg fort.
Von dem runden Bau der Bibliothek führte ein schmaler Weg aus schwarzen und weißen Steinplatten um wenige Bäume herum zu einer breiten Treppe. Links und rechts davon standen Löwen aus schneeweißem Stein, die sich auf die Hinterbeine aufgerichtet hatten. Leichten Schrittes erklomm der Mann die Stufen. Erneut pfiff er sein Liedchen vor sich hin. Trotz des langen Anstiegs geriet er nicht außer Atem.
Dann erreichte er die Säule aus dem seltenen dunkelblauen Marmor. Ihre Spitze krönte ein weiterer gigantischer Albatros.
Der Blick des Mannes suchte die Augen des Vogels. Er zog sein stutzerhaftes Barett von kornblumenblauer Farbe vom Kopf und vollführte vor dem Denkmal eine fast spöttische Verbeugung.
Heute konnte er über diese Statue lachen. Das war jedoch nicht immer so gewesen. Noch vor Kurzem hatten diese Vögel, die Hüter der Stadt, ihm unsagbare Angst eingeflößt, hatten ihm jeden Mut genommen und ihn verzagt sein lassen. Hatten seinem Feind geholfen ...
»Aber das ist jetzt vorbei.«
Natürlich antwortete der Vogel ihm nicht.
Nun richtete der Mann seine Aufmerksamkeit auf den Springbrunnen mit den marmornen Delfinen, auf deren Rücken barbusige junge Frauen mit goldenem Haar ritten. Am Rand des Brunnens lag ein toter Star. Seine Flügel waren verbrannt. Aus einer Laune heraus beugte sich der Mann über den Vogel, nahm ihn behutsam auf und pustete sanft auf den bereits starren Körper. Anschließend warf er die kleine Leiche wie einen Stein hoch in die Luft, woraufhin der Star mit den Flügeln zu flattern begann und im Nu davonflog.
»So gefällst du mir schon besser«, murmelte der Mann lächelnd.
Als er weiterging, stellte er fest, dass die Kuppel der prachtvollen Kaserne für die herzogliche Garde eingestürzt war und alle Männer, die sich darin befunden hatten, unter sich begraben hatte.
Die Ruinen zwangen ihn zu einem Umweg, was es ihm jedoch erlaubte, mehr von der Stadt zu sehen, die einstmals sein Zuhause gewesen war.
In der Straße der Tränenperlen, die im ganzen Norden für ihre Goldschmiede bekannt war, herrschte gähnende Leere. Man hatte hier furchtbar gewütet. Die Geschmeide lagen auf dem Pflaster, darunter auch die legendären Goldperlen aus Lethos. Das allerdings beeindruckte den Mann kaum. Diese Kostbarkeiten würdigte er keines Blickes. Er lief an ihnen vorbei, als handelte es sich um Kieselsteine.
Schließlich erreichte er die Apfelgärten, die den Palast säumten. Dieser schien aus Sonnenlicht geschaffen, aus Meeresgischt und aus Türkisen. Er galt als der schönste Bau, der je erbaut worden war. Das behaupteten sogar die Eywen, die schon mancherlei gesehen hatten, von dem die Menschen nicht einmal etwas ahnten. Selbst sie waren aus ihren Wäldern gekommen und Tausende von Leagues gewandert, um dieses Wunder der Astoré in Augenschein zu nehmen.
Der Mann jedoch hatte nicht einmal für dieses Meisterwerk einen Blick übrig, denn es verkörperte alles, was er zu hassen gelernt hatte.
Die Bäume trieben dieser Tage die ersten Knospen. Der Mann berührte einen Ast. Die Zeit, die durch diesen floss, raste nun dahin, und kurz darauf hing am Zweig eine saftige Frucht mit leuchtend roter, leicht wächserner Schale.
Er pflückte den Apfel, rieb ihn am Ärmel seiner Wildlederjacke ab und biss hinein. Kauend lief er den schattigen Weg hinunter, der zum Palast führte. Das Halbrund davor säumten Statuen. Die Figuren waren allerdings von ihren Sockeln gestürzt und lagen zersplittert am Boden. Der Kopf eines wunderschönen jungen Bogenschützen fand sich weit vom Hals entfernt. Die steinernen Augen betrachteten den Mann mit einem gewissen Vorwurf, fast als hielte er ihn für schuldig an dem, was hier geschehen war.
Das Palasttor steckte zwar nicht mehr in den Angeln, doch der Zutritt war durch eine Ranke umwunden, die dick wie der Arm eines erwachsenen Mannes war. Als der ungebetene Gast sich näherte, spannte sie sich, dehnte sich und stellte die giftigen, gleichsam stählernen Dornen auf.
»Du kämpfst für jemanden«, sagte der Mann, »der die Schlacht verloren hat.«
Die Ranke erzitterte, schwankte von einer Seite zur anderen, als wöge sie die richtige Entscheidung ab: Sollte sie den Zugang zu den legendären Sälen, die mit ihrem zarten Rosa an Meeresmuscheln erinnerten, freigeben oder nicht?
Schließlich wich sie knackend und knisternd zur Seite.
Eine leichte Brise strich durch die eingeschlagenen Fenster und trug den süßen Duft von Pfirsichen in die Räume. Nur gelegentlich zog dieser Wind den beißenden Geruch von Feuer, Blut und Magie hinter sich her, der von den Geschehnissen kündete, die sich hier zugetragen hatten.
Mühelos fand der Mann seinen Weg durch die Säle, Gänge und Hallen, doch das war kein Wunder, schließlich kannte er ihn auswendig. Unzählige Male hatte er inzwischen davon geträumt, wie er seine Schritte durch das leere Gebäude lenken würde. Nun genoss er jede Sekunde seines bitteren Triumphs, den niemand sonst zu würdigen vermochte.
Irgendwann erreichte er das oberste Stockwerk und betrat einen großen Raum. Im Krieg war der Fußboden aufgerissen worden, während die prachtvolle Deckenbemalung sich in einen gewaltigen, buntscheckigen Fleck verwandelt hatte, der aussah, als hätte jemand allerlei Farben in einen Eimer gegeben und diese dann kräftig verrührt.
Auch hier fehlte in den hohen Fenstern das bunte Glas. Seine spitzen Splitter bedeckten den Boden und erinnerten an mit Blut gesprenkelte Eiskristalle. Die Vorhänge waren verkohlt, die Statuen zerstört. Die Wand gegenüber der Tür dräute in Rußschwarz, an einer Stelle klaffte sogar ein Loch in ihr. Durch dieses fiel ein lanzenscharfer Sonnenstrahl in den Raum. In seinem Licht wirbelten in ungestümem Tanz Schneeflocken.
Sie kamen aus dem Nichts, sie verschwanden im Nichts. Sie verwandelten die Luft in ein eisiges, gut geschärftes Messer.
Einzig der Thron, geschnitzt aus einem Kristallblock von wundersamer Form, war noch unversehrt und protzte mit seinem aufwendigen Ornament. Ein Mann saß darin, die Unterarme auf den hohen Armlehnen. Seine linke Hand war völlig mit dem Sitzmöbel verschmolzen, sodass er keinen Zauber mehr wirken konnte. Noch längst kein Greis, hatte der Mann flachsblondes Haar, blaue Augen und einen gepflegten Bart, der an der Spitze in zwei gleich große Hälften geteilt war. Und trotz der Müdigkeit, die sich in seinem Gesicht spiegelte, trug er einen entschlossenen Ausdruck zur Schau.
Mit einem langen Blick maß er den Eindringling.
»Meinen Glückwunsch«, stieß er nach einer Weile voller Wut aus.
Sein ungebetener Gast rammte die weißen Zähne in den Apfel. Ein finsterer Schatten legte sich über seine bisher freundliche Miene, das Lächeln kroch von seinen Lippen, in seinen Augen blitzte es böse auf.
»Da bin ich also«, sagte er. »Genau wie ich es versprochen habe.«
»Du hast dir mit deinem Erscheinen reichlich Zeit gelassen«, erwiderte der Mann, der an den Thron gebannt war. »Aber immerhin hast du es geschafft, ganz im Gegensatz zu deinen einstigen Weggefährten. Wir sind nämlich die beiden Einzigen, die übrig geblieben sind.«
Der junge Mann schnaubte bloß und durchquerte den Saal. Die Glasscherben knirschten unter seinen Füßen.
»Die Schahuter sind geschlagen und in alle Himmelsrichtungen davongestoben. Jetzt sollen sie sich in Ödien verschanzt haben«, hielt er dann fest. »Sie werden dir nicht mehr dienen. Doch ohne diese Geschöpfe ... Ich habe dich wirklich für stärker gehalten.«
»Das habe ich auch«, brachte der Mann auf dem Thron hervor. Allein der Gedanke, dass er den Kampf verloren hatte, bereitete ihm geradezu körperliche Schmerzen. »Die Astoré haben dich gut dressiert.«
»Hättest du auf diesen einen Mord verzichtet, hätte ich mich niemals auf das Bündnis mit ihnen eingelassen. All das hast du dir also selbst zuzuschreiben.«
»Sie war unsere Feindin. Eine Astoré. Für dieses Volk ist in unserer Welt kein Platz. Und erst recht nicht in meiner Schule! Nur Menschen dürfen in Magie unterwiesen werden!«
»Einige von ihnen hatten ein größeres Recht, sich Mensch zu nennen als du und ich.«
»Ihre Worte sind Gift«, erwiderte der andere unter schallendem Gelächter. »Und dieses Gift ist in dich eingedrungen. Die Astoré sind verlogene Geschöpfe und tun alles, um erneut über echte Magie gebieten zu können. Ja, sie zögern nicht einmal, einem meiner Schüler eine ihrer Dirnen unterzuschieben, um endlich ans Ziel zu gelangen.«
Ein weiterer lanzenscharfer Sonnenstrahl drang durch einen Spalt im Gemäuer ein, erlosch aber sofort. Bedrohliche Schatten ballten sich in den Ecken. Tiefschwarze Rauchwolken, in denen sich die Umrisse von knienden Menschen erkennen ließen. Kaum dass sie sich erhoben, lösten sie sich freilich auf. Da verschwand auch der Zorn wieder aus dem Gesicht des jungen Mannes.
»Du solltest nicht in dieser Weise von ihr sprechen ... Lehrer.«
»Ich bin nicht mehr dein Lehrer, denn du bist längst mein Feind«, erwiderte der Mann auf dem Thron. »Du hast mich und meine Kunst verkauft. Um ein Paar schöner Augen willen hast du einen Krieg gegen mich angefangen. Eine Frage gestatte mir aber: Wie soll ich denn deiner Meinung nach von ihr reden?«
»Wie von deiner Schülerin, das war sie schließlich.«
»Das war sie nur so lange, bis ich die Wahrheit erfahren habe! Durch ihre Adern fließt das Blut dieser widerwärtigen Kreaturen! Denen ist es verboten, sich unser Wissen anzueignen! Die Erhabenen Sechs ...!«
»… sind ausgemachte Dummköpfe!«, spie der junge Mann aus. »Allein ihre Verbote haben zu diesem Krieg geführt! Bedenke doch bloß, wie viele Leben ihre Fehler uns alle gekostet haben!«
»Es steht dir nicht zu, über diese Dinge zu urteilen! Sie hat mich getäuscht! Sie hat mein Brot gegessen, unter meinem Dach gelebt und meine Gastfreundschaft genossen! Vor allem aber hat sie sich von mir in Dingen unterweisen lassen, deren Kenntnis ihr eigentlich verboten ist. Deshalb habe ich getan, was deine Aufgabe gewesen wäre! Arila und Neysi durften mein Können nicht an ihresgleichen weitergeben!«
»Du hast eine derart abgrundtiefe Angst vor dem Dunkel, das alten Legenden und Sagen zufolge auf Geheiß der Astoré eintreten kann, dass du es schließlich selbst in unsere Welt gelassen hast.«
Er hob einen schwarzen Eisenhandschuh vom Boden auf. Der Rand war scharfkantig, darunter quoll dunkler Rauch auf. Einen ausgedehnten Moment lang betrachteten beide Männer das Stück, dann steckte der Jüngere es in die Tasche über seiner Schulter.
»Du hast gehandelt wie ein dummer Junge«, fuhr er fort. »Und damit schlimmes Unheil angerichtet. Indem du dich auf einen Handel mit den Schahutern eingelassen hast, hast du mich förmlich in die Arme der Astoré getrieben. Doch nur ein Narr lässt in seiner Angst vor dem Fuchs einen Leoparden in den Hühnerstall. Schahuter kennen nur sich, aber keine Verbündeten. Am Ende bist du dem Dunkel weit näher als ich.«
»Was hast du mit dem Handschuh vor?«, fragte der Mann auf dem Thron.
»Ich werde ihn in etwas Schönes verwandeln und anschließend so gut verstecken, dass niemand ihn je wiederfindet. Wie hast du Neysi davon überzeugen können, von ihm Gebrauch zu machen?«
»Schmerz ist ein gewichtiges Argument.«
Sein einstiger Schüler nickte bloß, während sein Blick den Schneeflocken folgte, die erneut durch den Raum wirbelten.
»Die Astoré ...«, brachte der Mann auf dem Thron dann endlich heraus. »Sie haben dich nur benutzt.«
»Ich bin mit Sicherheit nicht ihre Marionette.«
»Mach dir doch nichts vor!« Der Mann auf dem Thron ballte in hilfloser Wut die rechte Hand zur Faust. »Sie haben dich auf die Idee gebracht hierherzukommen.«
»Und wer hat dich auf die Idee gebracht, die Schahuter von der anderen Seite herbeizurufen? In deiner Angst vor den Astoré hast du schier den Verstand verloren und das Dunkel am Ende selbst geweckt. Die Schahuter hatten ihre Macht nach der Schlacht der Schatten eingebüßt! Sie sind damals in den lichtlosen Niederungen von Daul genauso bezwungen worden wie der Dunkle Reiter. Nun hast du ihnen erneut Macht gegeben! Diese Wesen sind wieder bei uns eingefallen! Die Städte im Süden ertrinken bereits in Blut! Wie konntest du nur so dumm sein und einen Vertrag mit diesen Kreaturen schließen?! Dämonen halten sich nie an Absprachen! Du hast diese Welt zerstört! Du hast gemordet! Neysi, Quint, Cam, Voyez und Lavenda sind tot! Und all das nur wegen deiner Ängste!«
Der junge Mann trat einen Schritt vor und grinste unschön. Sein Gesicht nahm sich nun regelrecht abstoßend aus.
»Was bildest du dir ein?!«, zischte der Mann auf dem Thron. »Die Magie der anderen Seite brodelt auch in deinem Blut! Du bist also keinen Deut besser als ich! Bleibt die Frage, wie du dich verhältst, wenn die dunkle Magie alle Kraft aus dir herausgesaugt hat und Tribut von dir verlangt! Wir wollen doch mal sehen, ob am Ende nicht du unserer Welt den Todesstoß versetzt!«
»Du hast recht, auch mich verzehrt das Dunkel ...«
»Wenigstens etwas ...«
»Dass dich das freut, glaube ich unbesehen.«
»O ja! Deshalb werden wir beide nicht mehr lange leben!«
»Da irrst du, Lehrer. Wenn wir beide miteinander fertig sind, werde ich jeder Magie abschwören.«
»Du ...?« Der Mann auf dem Thron starrte seinen einstigen Schüler ungläubig an. »Du willst dich von dir selbst lossagen?«
»Damit folge ich nur dem Beispiel der Erhabenen Sechs«, erwiderte sein einstiger Schüler lachend. »Sie kannten nur ein Ziel, und das bestand darin, die Astoré auszulöschen. Dafür haben sie mit eigenen Händen die Schahuter geschaffen. Als ihnen die Tragweite dieses Schrittes bewusst geworden ist, haben sie sich immerhin dazu durchgerungen, sich von jeder Magie loszusagen. Das werde ich auch tun. Weder ein Schahuter noch ein Astoré soll Macht über mich erlangen. Magier vermögen die Welt nämlich weit schneller zu vernichten als Dämonen. Ich aber liebe die Welt ... jedenfalls das, was von ihr geblieben ist. Verschließe daher nicht länger die Augen vor der Wahrheit! Die Magie ...« Er fuhr mit der Hand durch die Luft, die daraufhin zu vibrieren anfing. »Sie ist längst nicht so viel wert wie das Leben einer einzigen Frau. Deshalb sei diese Kraft ebenso verflucht wie du, denn sie hat uns Tod und Leid gebracht. Meine Freunde, meine Familie, mein Glauben – all das ist wegen deiner Angst ausgelöscht worden.«
Der Mann auf dem Thron ließ sich die Worte durch den Kopf gehen.
»Damit ist mein Lebenswerk hinfällig«, sagte er nach einer Weile. »Du bist mein letzter Schüler gewesen. Wenn ich diese Welt verlasse und du der Magie abschwörst, wird auch die Gabe verkümmern, die uns die Erhabenen Sechs hinterlassen haben.«
»Diese Sechs haben die Magie den Astoré gestohlen, nun nehme ich sie den Menschen wieder weg. Allen, die wie du und ich sind. Wir werden keine Rolle mehr spielen, sondern zu einer Legende werden. Zu einem Mythos, womöglich aber auch zu einem Schauermärchen.«
»Wag das ja nicht!«
»Du hast mir nichts mehr zu sagen«, erwiderte der junge Mann mit bitterem Lachen. »Wer noch über die Gabe verfügt, wird sterben. Nur dann kann die Welt leben!«
»Wer aber wird dann die Geschöpfe aufhalten, die von der anderen Seite her bei uns einfallen? Die Astoré? Zwischen ihnen und den Schahutern besteht schon seit Langem kein Unterschied mehr. Wenn du die Magie vernichtest, wird niemand mehr diese Kreaturen aufhalten können! Besinne dich also eines Besseren! Nichts wird mehr so werden, wie es einst war!«
»Sieh einmal zum Fenster hinaus, Lehrer. Die Welt ist längst eine andere, und das nur deinetwegen! Das Geeinte Königreich ist zerschlagen. Das Zeitalter der Blüte ist vorüber, nun beginnt das Zeitalter des Vergessens. Die Welt indes muss leben, sie muss frei atmen. Deshalb habe ich getan, was du nicht vermochtest. Ich habe ihr diese Freiheit gegeben.«
»Freiheit!«, spie der Mann auf dem Thron aus. »Du hast ihr lediglich Schmerz, Leid und Angst vor der Zukunft gegeben.«
»All dies ist Teil des Lebens. Das habe ich verstanden, als du sie getötet hast. Doch heute klopft dein Tod an die Tür. Hörst du ihn?«
Nach diesen Worten ging er fort. Seine Schritte verhallten in der Stille, die sich wieder ausbreitete. Vielleicht würde sie eine Minute währen, vielleicht aber auch eine Stunde. In jedem Fall aber würde sie weichen, sobald das Meer abermals durch die Stadt branden würde.
Das Wasser würde das Ende der alten Welt mit sich bringen. Und den Beginn einer neuen Zeit.
Kapitel 1
Der Hochseilartist
Eins nur will der Menge Liebling, der Akrobat:
Auf dem Hochseil vollführ’n Schritt, Sprung und Spagat,
In Stadt und Land, in den Lüften hoch droben
Will vor verzückter Schar er sich austoben.
Lied der Zirkusleute im Herzogtum Solanka
»Geh mir aus dem Weg!«, knurrte Kyn, der so meisterlich mit schweren Gewichten zu jonglieren verstand, als Theo sich vor ihm aufbaute.
»Das werde ich nicht«, erwiderte der schwarzhaarige Hochseilartist mit freundlichem Lächeln. »Und dafür solltest du mir dankbar sein.«
»Ach ja?«, entgegnete Kyn und ballte seine Pranken zu Fäusten. »Glaubst du allen Ernstes, du könntest mich aufhalten?«
Theo war ein großer, drahtiger Bursche, kaum zu vergleichen mit den meisten anderen, eher gedrungenen Akrobaten des Wanderzirkus. Allerdings war er nicht nur geschmeidig, sondern auch kräftig, sodass er seinen Worten jederzeit den nötigen Nachdruck verleihen konnte. Kyn schüchterte er indes nicht ein. Dieses Kraftpaket hatte schon oft kranke Kämpfer ersetzt und es dabei allein gegen drei Zuschauer aufgenommen.
»Was ich allen Ernstes glaube«, erwiderte Theo gelassen, »ist, dass Suvy uns beobachtet.«
»Der Gebannte soll dich holen!«
Wenn Suvy, seine Frau, von diesem Streit erführe, würde sie ihm das Leben zur Hölle machen.
»Mit Fäusten wirst du nichts lösen«, redete Theo auf ihn ein. »Das heißt nicht, dass er kein Schweinehund ist. Das bestreitet nun wirklich niemand.«
»Da hat er völlig recht«, mischte sich Henryn ein. Theos Freund, der drahtige schwarzhaarige Zauberer mit dem feinen Schnauzbart, trat an die beiden heran und fuhr nun mit dem Akzent der Menschen aus dem Süden Darjens fort. »Es wäre überaus dumm, ihm die Fresse zu polieren.«
»Was glaubst du denn, warum unser Direktor zu seinem Schutz nicht irgendwen, sondern ehemalige Sträflinge gedungen hat?«, ergriff Theo wieder das Wort. Sein sonst so offenes, stets lächelndes Gesicht verfinsterte sich. »Diese Kerle sind zu allem fähig. Die würden sogar ihre eigene Mutter ohne viel Federlesens umbringen. Oder hast du schon vergessen, was mit dem Puppenspieler geschehen ist, als er versucht hat, aus Mallos Wagen einen silbernen Kerzenhalter zu stibitzen?«
Das hatte Kyn natürlich nicht vergessen. Dem armen Jungen waren mit diesem Kerzenhalter beide Hände zertrümmert worden, anschließend hatten die Schläger ihn davongejagt, hinaus in einen furchtbaren Schneesturm, während ihre Wagen weitergezogen waren.
»Aber ich bin nicht der Puppenspieler«, hielt Kyn dagegen, schielte dabei aber aufmerksam zu seinem Wagen hinüber. »Der bestand ja auch bloß aus Haut und Knochen. Wenn mir einer von diesen Dreckskerlen querkommt, hau ich ihm den Schädel ein.«
»Du willst sie töten?«, hakte Theo nach.
»Wenn’s sein muss.«
»Aber dir ist schon klar, dass wir in einer Stadt sind? Hier kommst du nicht ungeschoren davon, sondern landest in irgendeinem feuchten Loch. Dort hockst du, bis man dich am Ende aufhängt. Deine Frau wäre darüber bestimmt ausgesprochen glücklich ...«
Dieser Einwand war nicht von der Hand zu weisen.
»Hol euch doch der Gebannte!«, strich Kyn die Segel und ließ die mächtigen Schultern sacken. »Verflucht sei der Tag, an dem ich mich auf diesen elenden Schweinehund eingelassen habe! Ich habe eine Familie zu ernähren! Und er ... Aber bitte, da ist er! Hören wir uns also in aller Ruhe an, was er zu sagen hat!«
Daraufhin stapfte Kyn an Theo vorbei, der sich ihm aber zusammen mit Henryn sofort an die Fersen heftete.
Vor einem großen, flammend roten Wagen – dem prachtvollsten im ganzen Zirkus – hatten sich im Licht von Laternen etliche Artisten versammelt. Gerade kam Direktor Mallo auf sie zu. Er war noch nicht sehr alt und hatte einen gewaltigen Bauch, doch an seinen Schläfen schimmerte das goldene Haar nur noch spärlich.
»Ihr bekommt heute kein Geld!«, teilte er seinen Leuten mit. »Deshalb braucht ihr hier auch gar nicht rumzulungern!«
»Was soll das heißen?!«, fuhr ihn die Hochseilartistin Tilla an, eine bereits ältere Frau, mit der Theo vor drei Jahren häufig zusammen aufgetreten war. Damals, als sie im Sommer durch die Städte im nördlichen Solanka gezogen waren ... »Das Publikum war von unserer Vorstellung begeistert. Was ist denn aus dem Eintrittsgeld geworden, das es bezahlt hat?«
»Du solltest weniger die Zuschauer zählen als vielmehr die Münzen, die sie in die Manege geworfen haben. Und das waren sehr wenige!«
»Der Bürgermeister von Taver hat die Vorstellung persönlich bezahlt!«, erklärte Caleb, der neue Puppenspieler. »Aus Anlass des heutigen Festtages!«
»Und was ist mit den Steuern?!«, blaffte Mallo ihn an. »Dafür, dass wir überhaupt in die Stadt eingelassen wurden?! Dafür, dass wir einen guten Platz erhalten haben?! An die denkt ihr wohl gar nicht, oder?! Dann verlangt die Gilde der Straßenkehrer ihren Anteil, damit sie hinter uns aufräumen. Die hiesigen Ganoven müssen bestochen werden, damit sie uns in Ruhe lassen! Das Futter für die Löwen und Pferde ...«
»Das reicht, Mallo!«, unterbrach Theo den Direktor und trat unter zustimmendem Gemurmel einen Schritt vor. »Wir wissen genau, wer und was alles bezahlt werden muss. Eingenommen hast du aber viel mehr. Wir hätten ja nicht einmal etwas gesagt, wenn du uns zum ersten Mal geprellt hättest. Aber hinter uns liegen bereits fünf Vorstellungen, ohne dass du uns ein einziges Mal bezahlt hast. Wir wollen nichts mehr davon hören, dass die Löwen und Pferde ihr Futter brauchen, wir wollen endlich auch selbst einmal etwas essen!«
»Bist du der Direktor oder ich?«, fuhr Mallo ihn an. »Muss ich mich vor dir etwa rechtfertigen?«
»Das musst du vor uns allen!«, erklärte Henryn. »Es wäre nicht schlecht, wenn du deine Truppe zur Abwechslung mal beglückst und ihre Taschen füllst.«
»Das ist ein Zirkus der Monster! Die Menschen kommen in erster Linie zu uns, um diese Kreaturen zu sehen. Dann wegen der Tiere. Ihr mit euren Kunststückchen folgt erst an dritter Stelle.«
»Deine Monster schwimmen in Fässern mit Alkohol und kennen keinen Hunger!«, brüllte Kyn, in dem die Wut schon wieder hochkochte. »Meine Frau und meine Kinder aber schon. Was schlägst du denn vor, womit ich sie füttern soll?! Mit deinen Homunkuli, Mumien und Puppen?!«
In Mallos Rücken tauchten nun seine drei Leibwächter auf.
»Wenn deine Monster das Wichtigste in diesem Zirkus sind, dann sollen sie halt die Menge zum Lachen bringen, Lieder singen, Messer werfen oder jonglieren«, schlug Theo vor. »An unserer Stelle, denn wir sind ja offenbar überflüssig.«
Seine Worte wurden mit lautem Gejohle aufgenommen.
»Ihr alle habt einen Vertrag unterschrieben!«, giftete Mallo.
»In dem auch steht, dass wir nach jeder Vorstellung unser Geld kriegen«, rief ihm Tilla in Erinnerung. »Theo hat recht! Wenn du uns nicht gibst, was uns zusteht, sollen sich eben deine Monster ins Zeug legen!«
»Und ich habe immer gedacht, dass wir alle eine Familie sind«, mimte Mallo die beleidigte Leberwurst. »Ich habe wirklich angenommen, dass es euch etwas bedeutet, wenn ihr mit euren Auftritten das Publikum unterhaltet.«
Er erntete nur abfälliges Gelächter.
»Du hast uns erst am Ende des Winters angeheuert. In derart kurzer Zeit wächst man nicht zu einer Familie zusammen. Schon gar nicht, wenn einige Verwandte dich immer wieder über den Löffel barbieren«, erklärte Theo und verschränkte die Arme vor der Brust. »Du hast recht, unser Auftritt bedeutet uns etwas. Wir haben Freude daran, unsere Zuschauer zu unterhalten. Aber unsere Arbeit unterscheidet sich durch nichts von jeder anderen. Man muss für sie bezahlen, Mallo. Vielleicht haben dir deine Biester in Alkohol das noch nicht mitgeteilt, deshalb will ich das tun. Niemand wird sich allein um des Vergnügens willen abrackern oder sein Leben aufs Spiel setzen. Inzwischen dürfte dir aber wohl klar sein, dass wir unser Geld wert sind, oder? Entweder bezahlst du uns also, oder du stiehlst dich zum Gebannten! Wir werden jedoch auf gar keinen Fall noch einmal für dich auftreten, wenn wir nicht vorher unser Geld erhalten haben.«
»Ganz genau!«, schrie eine Frau aus der Menge. »Zahlst du nicht, verlasse ich deinen Zirkus. Dann kannst du deine verfluchten Löwen selbst füttern!«
»Für uns gilt das auch!«, ließen sich weitere Stimmen vernehmen, und einige setzten bereits an, in höchst beredter Weise abzuziehen.
»Behalten wir doch bitte alle einen kühlen Kopf!«, lenkte Mallo sofort ein und hob zum Zeichen seiner Kapitulation sogar beide Hände. »Ich werde das Geld auftreiben und euch allen meine Schulden zurückzahlen.«
»Und wann?«, erkundigte sich Theo.
»Morgen.«
»Nein. Das wirst du noch heute erledigen. Und zwar binnen einer Stunde.«
»Bitte?!«, stieß Mallo fassungslos aus. »Noch heute?!«
»Die Nächte in Varen sind bekanntlich dunkel und gefährlich. Wie können wir da sicher sein, dass du morgen früh nicht längst ausgeraubt bist? Dann würden wir ja nach wie vor mit leeren Händen dastehen ... Deshalb bezahlst du uns in einer Stunde. Inzwischen werden Kyn und seine Jungs darauf achten, dass dir kein Räuber in die Taschen greift.«
Mallo knirschte mit den Zähnen und blickte Theo voller Hass an.
»Gut«, presste er schließlich heraus. »Ihr sollt euer Geld noch heute erhalten.«
»Glaubst du, auf ihn ist Verlass?« Henryn hatte sich in einen dünnen, ausgeblichenen Umhang gehüllt und stand vor ihrem Wagen. Nun, da der Sommer zu Ende ging, hielten im Herzogtum Varen kühle Nächte Einzug. »Denn wenn Mallo etwas noch mehr liebt als seine Monster, dann ist das sein Geld.«
Theo saß auf den Stufen, die zum Wagen hochführten, und beobachtete, wie sich am Firmament ein fahler Stern nach dem nächsten entzündete.
»Du hast recht«, erwiderte er. »Mit Männern wie ihm hatte ich es schon öfter zu tun. Sie wissen ihre Bosheit gut zu verbergen und schlagen nur dann zu, wenn du es nicht erwartest.«
»Wir sollten uns allmählich nach einer anderen Truppe umsehen«, meinte Henryn. »Bevor wir richtige Schwierigkeiten bekommen und am Ende ebenfalls im Schneesturm zurückgelassen werden. Wenn du mich fragst, sollten wir uns sogar auf der Stelle davonmachen.«
»Du neigst doch sonst nicht zu überstürzten Taten.«
»Glaub mir, ich habe mir alles in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Bei Mallo ist Hopfen und Malz verloren. Er ändert sich nicht mehr, eher wird er noch schlimmer. Aber es gibt mehr als nur diesen einen Zirkus. Wir werden mühelos Arbeit finden.«
»Es gibt aber noch etwas«, erwiderte Theo, »das wir in Taver erledigen müssen.«
»Darum habe ich mich gekümmert, als du mit deiner Nummer aufgetreten bist.«
»Du hast einen Käufer gefunden?«, fragte Theo überrascht. »So schnell? Wie viel bietet er uns denn?«
»Zehn Goldstücke.«
»Nicht übel.«
»Nicht übel?! Bei den Erhabenen Sechs! Einen besseren Preis kriegen wir nirgends!«
Theo lächelte nachsichtig, denn natürlich irrte Henryn sich. In Riona hätten Sammler ihnen für dieses alte Artefakt mindestens das Dreifache geboten. Aber sie weilten nun einmal gerade im Herzogtum Varen, nicht in Trettin. Hier oben lebte ein ganz anderer Menschenschlag. Außerdem war längst alles entschieden, was sollte er seinem Freund da die Stimmung verhageln? Und auch er selbst würde deswegen nicht den Kopf hängen lassen. Beim nächsten Verkauf würden sie bestimmt mehr Glück haben ...
Henryn schnippte ihm mit dem Daumen eine Münze zu, die Theo geschickt auffing.
»Das ist ein Vorschuss. Den Rest erhalten wir, wenn wir die Ware abliefern. Wir sollen in einer Stunde in der Lästigen Bremse sein.«
»Das schmeckt mir nicht«, erklärte Theo sofort. »Warum bestellt dieser Kunde uns mitten in der Nacht in dieses Drecksloch ein?«
»Seit wann hast du Angst im Dunkeln?«, fragte Henryn grinsend. »Du bist doch kein kleiner Junge mehr, der glaubt, in der Nacht würden Schahuter auf ihn lauern! Im Übrigen lass dir gesagt sein, dass die Bremse die beste Schenke der Stadt ist. Artisten wie uns lässt man da sonst gar nicht rein!«
»Ich kann nicht gerade behaupten, dass ich mich darüber beschweren würde«, murmelte Theo, der sich gedankenverloren mit der Faust über die linke Schläfe rieb. Eine Geste, die bei ihm stets höchste Alarmbereitschaft verriet. »Wer ist denn der Käufer? Ein Adliger?«
»Nein, ein Kaufmann und Antiquitätenhändler.«
»Sollte er sich doch als Hehler herausstellen, können wir ja immer noch einen Rückzieher machen ...«
Theo hasste riskante Unternehmungen. Jedenfalls wenn damit ein Verstoß gegen geltendes Recht einherging. Sein Leben setzte er ja tagein, tagaus aufs Spiel. Beispielsweise bei einem Salto auf einem schlecht gespannten Hochseil. Diese Gefahren konnte er jedoch abschätzen, sie gehörten zu seiner Arbeit. Auf einem anderen Blatt standen zwielichtige Gestalten, allen voran Angehörige des Nachtclans. Dieser war einst in Pubyr entstanden, hatte seine Netze aber inzwischen auch in etlichen anderen Herzogtümern gespannt. Der alte Quio, sein erster Lehrer, hatte ihm immer wieder eingeschärft: »Schlepp von mir aus die Astoré in diese Welt oder schließ einen Handel mit dem Gebannten, aber lass dich niemals mit dem Nachtclan ein, mein Junge! Wir sind Zirkusmenschen. Wir sind eine Familie. Aber das ... das sind Ratten, die sogar ihre toten Verwandten verkaufen. Oder bei einer Hungersnot die lebenden verschmausen. Hüte dich vor ihnen! Die töten jeden, der ihnen im Weg steht, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken ...«
Henryn riss ihn aus seinen Erinnerungen.
»Wir haben aber schon einen Vorschuss bekommen«, sagte er.
»Den können wir jederzeit zurückgeben.«
»Den Gebannten werden wir! Das ist leicht verdientes Geld! Der Käufer ist ein Antiquitätenhändler mit gutem Ruf und ehrbaren Kunden, der eine Menge von der Zeit des Geeinten Königreichs versteht. Für ihn lege ich meine Hand ins Feuer.«
»Gut, wenn du es sagst«, erwiderte Theo und verschwand im Wagen.
In diesem konnten gut und gern sechs, notfalls aber auch acht Menschen leben. Ein Haus auf Rädern mit – je nach Tageszeit – Schlafstube, Esszimmer, Lager für die Requisiten und Garderobe.
Im Sommer war es darin kochend heiß, im Winter eisig kalt. Ständig roch es nach Schweiß und Schminke sowie nach all den Menschen, die irgendwann in ihm gelebt hatten. Zurzeit waren das Theo, Henryn und vier Schlangenmenschen aus Savjatien, übermütige Hitzköpfe, die oft genug in eine Schlägerei verwickelt waren.
Theo schlief ganz oben, direkt unter der Decke. Diese bestand aus derbem Leinen, das mit dem Saft der Bäume aus dem Nebelwald getränkt war. In alten Überlieferungen hieß es, in diesem Wald hätten einst die legendären Eywen gelebt. Tagsüber war Theos Bett nach oben geklappt, genau wie die der anderen auch.
Theo entriegelte den Verschluss, sodass die dünne Strohmatratze vorkippte. In der Wand gab es eine schmale Nische, in die mit etwas Mühe sein zusammengefalteter Reisesack hineinpasste. Die Jahre der Wanderschaft und das Zusammenleben mit den unterschiedlichsten Menschen hatten ihn gelehrt, sein Herz nicht an Gegenstände zu hängen. Deshalb häufte er keinen Besitz an – der ja ohnehin rasch in andere Hände wandern konnte – und reiste stets mit leichtem Gepäck.
Auch Henryn nahm seine Tasche an sich. Diese war jedoch deutlich praller als Theos, denn sie enthielt die Requisiten, auf die der Zauberer nicht verzichten konnte: einen Kasten mit doppeltem Boden, einen Umhang aus feuerfestem Stoff, formbare Kugeln, die sich auf seinem Handteller in Luft auflösten, ein Seidentuch, bunte Schnüre, eine Kette aus metallenen Ringen, ein Messer mit einer Klinge, die im Griff verschwand, und vieles andere mehr.
In einmütigem Schweigen verließen sie den Wagen wieder.
Nun ist Kyn mit seinen Ungeheuern doch nicht zu meinem Zuhause geworden, dachte Theo. Im Unterschied zu so vielen anderen Zirkussen, mit denen ich bereits durch die Lande gezogen bin.
Im Grunde hatte er aber von Anfang an gewusst, dass er bei diesem Zirkus nicht lange bleiben würde, denn er wollte nach Süden, um dort einige alte Freunde wiederzutreffen und sich mit ihnen auf die neue Saison vorzubereiten. Vielleicht bestand sogar die Hoffnung, dass der Herzog von Trettin ihm inzwischen nicht mehr grollte und sie zu Beginn des nächsten Sommers doch in Riona auftreten konnten. Vor dem besten und anspruchsvollsten Publikum im ganzen Land ...
Inzwischen war Kyns Frau Suvy zu ihrem Wagen gekommen. Die massige, gedrungene Frau mit den hängenden Schultern und den riesigen Pranken war gewiss keine Schönheit, ganz im Gegenteil, sie hatte sogar etwas abstoßende Züge. Dafür war sie von Herzen gut. Gerade streichelte sie voller Hingabe einen kleinen rotfelligen Hund in ihrem Arm.
In ihrer Begleitung befand sich ihre ältere Schwester Zay, eine mollige Frau mit ersten grauen Strähnen, die ein wenig an einen Frosch erinnerte. Sie las aus Hand und Karten, ohne indes die seltene Gabe zu besitzen, in die Zukunft der Menschen blicken zu können. Dummköpfe nahm sie gnadenlos aus, gesprächig wurde sie nur, wenn sie am Tisch vor ihrer Kristallkugel saß, ansonsten musste man ihr jedes Wort aus der Nase ziehen. Mitunter schwieg sie sich mehrere Tage lang aus und gab erst wieder einen Ton von sich, wenn sie eine Stadt erreichten, wo sie einfältigen Opfern mit ihrem Geplapper erneut die Kupferlinge aus den Taschen zog.
»Wolltet ihr uns etwa verlassen, ohne euch zu verabschieden?«, fragte Suvy und hielt den Blick ihrer dunkelgrauen Augen fest auf die beiden Männer gerichtet.
»Ein tränenreicher Abschied ist nun mal nichts für mich«, erwiderte Henryn lächelnd, während er seinen Reisesack schulterte.
»Als ob euch irgendjemand auch nur eine Träne hinterherheulen würde«, murmelte Suvy und setzte den Hund ab. Voller Freude über die zurückerlangte Freiheit rannte er unter fröhlichem Gekläff um sie herum. »Ich bin bloß gekommen, weil ich euch danken wollte, dass ihr meinen närrischen Ehemann zur Vernunft gebracht habt. Manchmal handelt er, bevor er seinen Kopf einschaltet ... Wohin wollt ihr jetzt?«
»Das haben wir noch nicht entschieden«, sagte Theo und drückte ihr das Goldstück in die Hand. »Kauf deinen Kindern etwas zu essen, falls dieser Gauner das Geld am Ende doch nicht rausrückt!«
»Das kann ich nicht annehmen ...«, widersprach Suvy, der es allerdings nicht gelang, Theo die Münze zurückzugeben. »Das ist doch viel zu viel.«
»Dann reicht es vielleicht noch für ein warmes Tuch. Unsere Zay könnte eines brauchen ...«
»Nun sag auch mal was!«, verlangte Suvy von ihrer wortkargen Schwester. »Warum bist du sonst hier?«
»Fahrt nur!«, sagte Zay schließlich mit piepsiger Stimme. Sie mied jeden Blick auf die zwei. »Beeilt euch und lasst diesen Zirkus möglichst weit hinter euch! Diese Nacht bringt nämlich nichts Gutes!«
Henryn setzte schon zu der Erwiderung an, dass Zays Vorhersagen doch lächerlich seien, murmelte dann aber: »Genau das hatten wir vor.«
»Grüßt die anderen von uns«, bat Theo. »Wir wünschen euch allen viel Glück!«
»Wir sehen uns bestimmt wieder«, versicherte Henryn.
Dann stapften die beiden davon.
Zay schüttelte bloß traurig den Kopf, den Blick fest auf Henryns Rücken geheftet.
»Du musst heute die Spendierhosen anhaben, Theo.«
»Wie kommst du darauf?«
»Ein ganzes Goldstück!«, murmelte Henryn, nur um sogleich in forschem Ton hinzuzufügen: »Natürlich kannst du mit deinem Geld machen, was du für richtig hältst, aber ein ganzes Goldstück ...«
»Geld ist zum Ausgeben da, nicht um es in einem Tonkrug zu horten.«
»Das habe ich schon oft gehört. Und ich kenne genug Menschen, die nichts für ihre alten Tage zurücklegen, sondern ihr Geld fröhlich zum Fenster rauswerfen. Denkst du denn nie an die Zukunft? Oder beabsichtigst du insgeheim, zur unbändigen Freude aller Gaffer rechtzeitig vom Hochseil zu stürzen und dich auf dem Pflaster in einen Fladen zu verwandeln?«
»Diese Absicht habe ich bestimmt nicht«, hielt Theo dagegen. »Ist es hier?«
»Ja.«
Die Lästige Bremse gefiel Theo wider Erwarten auf Anhieb. Ein dreistöckiges Haus, das in warmes Licht gehüllt war. Eine prächtige Auffahrt, ein gepflegtes Gelände, dazu ein großer Pferdestall und zahllose Bedienstete. In der Nachbarschaft ausschließlich respektable Häuser gut situierter Bürger. Nirgends dunkle Gassen, dreckige Spelunken oder verrottete Schuppen.
Wanzen und Flöhe fange ich mir schon mal nicht ein, frohlockte Theo innerlich. Und niemand setzt mir sauren Wein vor oder das Fleisch eines verreckten Pferdes, geschweige denn das eines Hundes. Keine Schlägerei, kein Stilett in der Leber, denn in diesem Haus geht es tatsächlich anständig und gesittet zu. Hier verkehren Menschen, die Wert auf eine gewisse Bequemlichkeit legen und keinen Geldmangel leiden. Henryn hat recht, das ist eine gute Adresse.
Selbstverständlich hielten zwei Türsteher sie auf, erstaunlich höfliche Männer, vor allem angesichts ihrer eigenen Körpermaße sowie angesichts der Kleidung ihrer beiden Gäste.
»Es ist kein Tisch mehr frei«, teilte einer der beiden ihnen mit. »Wenn ihr etwas Gutes essen und ein kühles Bier wollt, geht die Straße runter zum Tanzenden Feuer. Dort empfängt man euch mit offenen Armen. Und die Preise da können sich auch sehen lassen.«
»Diesen Rat würde ich nur zu gern beherzigen, aber wir werden hier erwartet«, antwortete Henryn ebenso höflich. »Herr Taled Gorh hat uns einbestellt.«
»Warum sagt Ihr das nicht gleich, mein Herr?«, erwiderte der Mann. »Begebt Euch bitte die Treppe hinauf. Herr Taled Gorh erwartet Euch im obersten Stock. Er hat bei uns eigens einen Raum für geschäftliche Treffen gemietet. Es ist die Tür mit dem geschnitzten Wildschwein.«
Während sie die breiten Stufen aus Eichenholz hochstiegen, sah Henryn sich aufmerksam um. Auf seinen Lippen lag ein zufriedenes Grinsen. Vor allem die Laternen aus Schmiedeeisen am Geländer begeisterten ihn.
»Irgendwann lebe ich auch in einem solchen Haus«, sagte er. »Mit wunderbarer Kleidung, einer schönen Frau, beflissenen Dienern und einem prallen Beutel voller Goldstücke.«
Im Unterschied zu ihm zeigte sich Theo von all der Pracht, den Teppichen, dem Samt und Kristall um ihn herum nicht beeindruckt. Da er nicht nur auf Marktplätzen auftrat, sondern auch in den Häusern der Reichen – einmal sogar im Palast des Herzogs von Trettin –, hatte er in seinem Leben schon genug Gold und Silber gesehen. Mittlerweile hielt er sogar Pferdeäpfel für wertvoller. Vergoldete Wandleisten und Pokale aus Bergkristall – darin sah er nur noch eine Marotte jener Reichen, die einfach zu viel Reichtum angehäuft hatten, aber niemals auf die Idee kamen, Bedürftigen zu helfen.
Im obersten Stockwerk riss Henryn die Tür mit dem meisterlich ausgeführten, wütenden und Dampf ausstoßenden Keiler auf, ohne vorher anzuklopfen.
»Du bist erstaunlich pünktlich«, bemerkte ein beleibter Mann mit rotem Gesicht und schweißglänzender Stirn.
Er musterte beide aufmerksam, und als er schwer atmend auf sie zukam, setzte er die Füße so, als hegte er Zweifel daran, dass die Eichendielen sein nicht unbeträchtliches Gewicht tragen würden.
»Ich weiß es zu schätzen, wenn man mich nicht warten lässt. Ist das dein Freund?«
»So ist es, Herr Gorh.«
»Sehr schön. Nehmt Platz und bedient euch. Wein, Früchte ... es ist alles da.«
Er deutete mit einer Geste auf den Tisch, wo eine Schale mit Obst und einige Flaschen mit Perlwein aus Savjatien standen. Die Etiketten zeigten allesamt einen Löwen, das Wappentier dieses Herzogtums.
»Solltet ihr hungrig sein, kann ich noch etwas Handfesteres bestellen«, versicherte der Antiquitätenhändler, wobei sein gewaltiger Wanst in Bewegung geriet, als könnte er es kaum erwarten, all die Gerichte und Delikatessen aufzunehmen, die der Koch dieses wunderbaren Hauses zuzubereiten verstand.
»Danke vielmals, aber wir wollen keine Umstände machen«, versicherte Theo, der ans Fenster trat und nach draußen spähte.
Henryn schenkte sich dagegen nur zu gern ein Glas Wein ein und bot auch Theo etwas an. Dieser wusste jedoch, wie schnell der berauschende Beerensaft die Aufmerksamkeit minderte und die Kontrolle über die eigenen Bewegungen schmälerte. Deshalb schüttelte er den Kopf.
»Könnte ich mir euren Fund jetzt einmal ansehen?«, erkundigte sich Gorh und rieb sich in Vorfreude bereits die Hände.
Henryn schob grinsend die schwere Obstschale beiseite und legte mit der ihm eigenen Theatralik, ganz als vollführte er einen seiner Zaubertricks, einen Gegenstand auf den Tisch, der in Tuch eingeschlagen war.
Herr Gorh wischte sich die Hände an seiner Kleidung ab, schlug das Tuch zurück und nahm die Statuette einer Frau an sich, die aus dunklem Metall gefertigt worden war. Ihre Kleidung ließ an Nebelschwaden denken, so schwerelos und luftig wirkte sie. Die Hände waren aneinandergepresst, die Finger formten ein aufwendiges Zeichen. Die rechte Brust war entblößt. Der einzige Makel dieser Figur bestand darin, dass der Kopf abgebrochen war.
Der Antiquitätenhändler schnalzte vernehmlich mit der Zunge. Theo hätte nicht zu sagen vermocht, ob er damit sein Erstaunen oder seine Vorbehalte zum Ausdruck bringen wollte. Behutsam fuhr der Mann mit seinen Wurstfingern über die Figur, von den Beinen bis hoch zum Hals, über die Falten des Gewandes hinweg und den flachen Bauch. Nur auf der Brust hielt er kurz inne. Ohne Frage kostete es Gorh Mühe, seine Finger wieder von diesem Artefakt zu lösen.
Schließlich zog er aus der Innentasche seines Wamses ein Etui, entnahm diesem ein großes, gut geschliffenes und solide eingefasstes Glas, steckte es sich vors Auge und untersuchte die Statuette abermals.
»Du hattest recht, Henryn«, stellte er zufrieden fest, als Theo schon dachte, er sei hinter seinem Glas eingeschlafen. »Das ist eine alte Arbeit. Das genaue Jahr ihrer Anfertigung lässt sich nicht bestimmen, doch möglicherweise stammt dieses Stück noch aus dem ersten Jahrzehnt nach dem Kataklysmus. Es handelt sich um eine gängige Darstellung der Arila, die den Gebannten getäuscht hat und dafür von ihm bestraft worden ist. Ihr kennt diese Legende, oder?«
»Ich konnte die Geschichten über Astoré schon in meiner Kindheit nicht ausstehen«, gab Henryn grinsend zu. »Wahrscheinlich weil ich mir schon immer mehr aus klimpernden Münzen gemacht habe.«
»Natürlich«, sagte der Antiquitätenhändler und wollte Henryn schon den prallen Geldbeutel in die Hand drücken. Offenbar fiel ihm jedoch in letzter Sekunde ein, dass Zauberkünstler in der Regel über allzu flinke Finger verfügen, weshalb er die Münzen vorsichtshalber auf dem Tisch zu einem kleinen Turm aufbaute. »Zwei Goldstücke habt ihr schon erhalten. Fehlen also noch acht. Oder sehe ich das falsch?«
Sobald Theo ihm mit einer Geste bedeutete, dass alles seine Richtigkeit habe, widmete Herr Gorh seine ungeteilte Aufmerksamkeit wieder der Statuette. Er tastete sie ab, als suchte er einen geheimen Mechanismus. Das Ganze wirkte allerdings ungeduldig und sogar leicht fahrig. Henryn nahm unterdessen vier der Münzen an sich, die andere Hälfte schob er Theo mit der Handkante zu. Dieser steckte den Verdienst in eine kleine, unauffällige Tasche an seinem Gürtel.
»Zu bedauerlich, dass die Statuette beschädigt ist«, murmelte Gorh. »Wenn ihr mir noch den Kopf liefern würdet, ginge ich mit dem Preis noch einmal nach oben.«
Theo mochte nun nicht länger zusehen, wie der Mann mit seinen Wurstfingern die Figur betatschte, und drängte Henryn mit einem Nicken zum Aufbruch.
»Wo habt ihr sie ausgegraben?«
»An einem Ort«, antwortete Theo, um dann kurz zu schweigen, »der sehr weit von hier entfernt ist.«
»Ich hatte nicht angenommen, dass das ein Geheimnis ist«, erwiderte Gorh.
Als sich nun auch Henryn erhob, wurde die Tür so heftig aufgerissen, dass sie gegen die Wand knallte. Mehrere Männer stürmten in den Raum. Der erste stürzte sich auf Theo – der ihn jedoch mit einem kräftigen Kinnhaken zu Boden schickte.
Danach war es jedoch mit seinem Glück vorbei. Die Spitze eines vierkantigen Kurzdolchs zielte auf seine Kehle. Theo erstarrte. Würde er jetzt Widerstand leisten, wäre sein Schicksal besiegelt.
»Ich spieße dich auf wie einen Frosch!«, krächzte sein Gegenüber, dessen Stirn und rechte Wange von Pockennarben entstellt wurden.
»Nun mal sachte«, verlangte Theo, der beide Arme hob, um dem Kerl zu bedeuten, dass er bestimmt keine Dummheiten begehen werde. »Wir wollen doch nichts überstürzen ...«
Der Bursche, den er niedergestreckt hatte – den leicht schrägen Augen nach zu urteilen, ein Mann aus Iriasta –, stand schon wieder auf und rammte ihm die Faust in den Magen.
»Da hast du’s, du Schwein!«
»Jetzt reicht’s aber!«, ließ sich da eine strenge Stimme vernehmen.
Tatsächlich unterblieb danach jeder weitere Angriff der Eindringlinge. Theo spürte wie üblich kaum Schmerzen. Ob er nun übermäßig viel übte, unglücklich stürzte, sich schlug oder verbrannte, er litt selten darunter. Sehr zum Erstaunen sämtlicher seiner Kollegen. Als er jetzt den Rücken durchdrückte, bemerkte er lediglich ein ganz leichtes Ziehen im Bauch und stellte zufrieden fest, dass die Übelkeit sich bereits legte.
Ein kräftiger Kerl presste Henryn mit seiner gewaltigen Pranke erbarmungslos auf die Tischplatte, sodass dessen Gesicht schon krebsrot leuchtete. Zwei weitere Kerle im Wams und mit breitkrempigem Hut standen an der Tür Wache. Derjenige, der den Rohlingen Einhalt geboten hatte, war ein nicht sehr großer Mann mit rotblondem Haar und schwerem Unterkiefer. Die Halbglatze, die tiefen Falten in den Mundwinkeln und der gewaltige Bauch ließen ihn deutlich älter wirken, als er war. Er hielt ein spitzenbesetztes Batisttuch in der Hand und verströmte den starken Geruch von Duftölen.
»Herr Gorh«, wandte er sich nun an ihren Gastgeber. »Ich hoffe, ich komme nicht zu spät.«
»Ihr seid pünktlich auf die Minute, Mylord.«
Dieser bedeutete einem seiner Männer an der Tür, einen prallen Geldbeutel auf den Tisch zu werfen.
»Das ist eine kleine Anerkennung für die Loyalität, die Ihr meiner Familie entgegenbringt, und eine Entschädigung für die Zeit, die Ihr mir geopfert habt.«
Gorh erhob sich ein wenig umständlich, nahm das Geld an sich und warf voller Bedauern einen letzten Blick auf die Statuette, ehe er wortlos den Raum verließ. Einer der Männer Mylords schloss die Tür hinter ihm, ein anderer schob seinem Herrn beflissen einen Stuhl an den Tisch.
Mylord nahm Platz und musterte Theo und Henryn eingehend.
»Nun zu uns!«, sagte er dann und hieß Theo Platz nehmen. »Wir müssen miteinander reden.«
Erst jetzt gab der Kraftbolzen Henryn frei. Diesen packte ein Hustenanfall.
Ach ja, schoss es Theo durch den Kopf, als er auf dem Hocker Platz nahm. Das respektable Haus und seine besonders anständigen Gäste ...
»Ihr wisst, wer ich bin?«, fragte Mylord.
»Tut mir leid, mein Herr, aber nein«, antwortete Henryn – und schrie noch im selben Moment auf, weil ihm sein Aufpasser einen Schlag verpasst hatte.
»Das heißt Mylord«, zischte der Kraftbolzen Henryn zu.
»Ich bin Ian Erbett, der Sohn von Yasev Erbett ...« Sobald ihm klar wurde, dass diese Namen den beiden Männern vom Zirkus nicht das Geringste sagten, seufzte er leidgeprüft. »Es ist doch stets eine Plage, mit Menschen von außerhalb zu verkehren. Stimmt es nicht, Claus?«
»Ja, Mylord«, bestätigte der schwarzhaarige, ein wenig an einen Wolf erinnernde Mann neben ihm, dessen Gesicht von einem hohen, breitkrempigen Hut verschattet wurde.
»Ihr kommt in meine Stadt, wisst aber nicht, was der Anstand gebietet«, fuhr Erbett niedergeschlagen fort. »Ahnt ihr überhaupt, wie sehr mich das ermüdet?«
»Wenn wir den hiesigen Gepflogenheiten zuwidergehandelt haben, dann bestimmt unwillentlich, Mylord«, versicherte Theo. »Es lag keinesfalls in unserer Absicht, Euch oder Euren ehrwürdigen Vater vor den Kopf zu stoßen.«
»Für einen fahrenden Akrobaten war das gar keine schlechte Rede«, murmelte Erbett. »Aber zu meinem unsagbaren Bedauern entbindet die Unkenntnis der in unserer Stadt geltenden Gesetze einen nicht von der Verantwortung für sein Tun. Von einer Aussetzung der Strafe kann daher keine Rede sein. Schon als kleiner Junge konnte ich es nicht leiden, wenn man mich bestohlen hat.«
»Da müsst Ihr einem Irrtum erliegen, Mylord«, erwiderte Theo gelassen. »Wir sind keine Diebe.«
Daraufhin brach Erbett in schallendes Gelächter aus, in das seine Männer sofort einstimmten.
»Oh, natürlich, ihr seid keine Diebe, sondern lediglich fahrende Narren.« Das Lachen verzog sich von seinen adligen Lippen fast ebenso schnell, wie es dort erschienen war. »Aber dann verrate mir bitte einmal, wie dieses kostbare Stück hierherkommt?«
»Das haben wir gefunden.«
»Wo, wenn ich fragen darf?«
»In einem alten Steinbruch am Stadtrand von Taver.«
»Eben«, stieß Erbett genüsslich aus und ließ sich gegen seine Stuhllehne zurücksacken. »Weshalb habt ihr dort herumgesucht?«
»Regen hatte einen Teil der Sandwand fortgespült und damit eine alte Mauer freigelegt«, erläuterte Theo. »Aus feinen gebrannten Ziegeln. In der Regel entdeckt man an solchen Orten noch mehr ...«
»Durchaus pfiffig und auch scharf beobachtet«, meinte Erbett, während er die Statue zu sich heranzog. »Ich vergöttere seltene Stücke aus vergangenen Zeiten. Ebendeshalb bringt mich dieser Diebstahl so auf.«
»Gehört Euch dieses Stück Land denn, Mylord?«, fragte Henryn sofort.
»Der Steinbruch liegt innerhalb der Stadtgrenzen. Mein Vater ist der Herr von Taver, folglich auch ich. Wer in dieser Stadt etwas ohne Erlaubnis an sich nimmt, der stiehlt es uns.«
»In dem Fall«, sagte Henryn, »möchten mein Freund und ich uns aufrichtig für dieses Missverständnis entschuldigen. Wir hatten nie die Absicht, Euch zu bestehlen. Wenn Ihr diese Statuette daher als Geschenk von uns entgegennehmen würdet ...«
»Wie liebenswürdig von dir«, brachte Erbett süffisant hervor. »Mir etwas zu schenken, das mir ohnehin gehört.«
»Was wollt Ihr dann von uns, Mylord?«, fragte Theo. »Eine Entschädigung?«
»Da kommen wir der Sache schon näher!«, stieß Erbett aus. »Du bist wirklich ein kluger Kopf! Eine Entschädigung! Das würde meine Stimmung heben, denn die ist mir verhagelt worden, weil ich euretwegen um ein herrliches Gelage gekommen bin. Deshalb erwarte ich diese Entschädigung ... auf der Stelle.«
Er zeigte auf Henryn.
Was folgte, ging viel zu schnell, als dass Theo es mitbekommen hätte. Doch als heiße Blutstropfen gegen seine Wange spritzten, erfasste ihn eine solche Wut, dass er am liebsten aufgesprungen wäre. Das verhinderten jedoch zwei bärenstarke Burschen, die ihn bei den Schultern packten, auf den Hocker drückten und seine Arme mit eisernem Griff umschlossen.
Theo spannte all seine Muskeln an, vermochte gegen die beiden Kraftbolzen, von denen jeder Einzelne schon schwerer war als er, aber nichts auszurichten. Er knurrte. Wütend und verzweifelt, wie ein Tier, das in die Ecke gedrängt worden ist. Angewidert starrte er in das grinsende Gesicht Mylords.
Der Anblick stachelte ihn so an, dass er sich erneut aufbäumte. Als er nur noch einen roten Schleier vor sich sah, sackte er zusammen. Da endlich gaben die beiden Schwergewichte ihn frei, blieben jedoch dicht hinter ihm stehen, um ihn jederzeit wieder packen zu können, sollte er sich auch nur zu einer einzigen ruckartigen Bewegung hinreißen lassen.
»Möchtest du vielleicht etwas Wein?«, erkundigte sich Erbett. »Du bist etwas blass um die Nase.«
»In dem Fall sage ich nicht Nein«, antwortete Theo krächzend.
Er musste unbedingt Zeit gewinnen.
Eine Flasche wurde entkorkt, einer der Burschen schenkte erst Erbett, dann Theo ein. Dieser beobachtete, wie die dunkelrote Flüssigkeit nach und nach den Pokal füllte. Er wollte sie um keinen Preis trinken ...
Sein Blick huschte zu Henryn, der mit zertrümmertem Schädel auf den Tisch gekippt war, um ihn herum bereits eine gewaltige Blutlache, die aber immer noch weiterwuchs und unaufhaltsam auf die Statue zukroch.
Erbett nippte am Wein und tupfte die Mundwinkel mit seinem Tuch ab.
»Wie konnte er nur annehmen, ich würde euch ungeschoren ziehen lassen?«, fragte er Theo mit einem Nicken hinüber zu der Leiche. »War ihm tatsächlich nicht bewusst, dass mir das als Schwäche ausgelegt wird? Dergleichen kann ich mir bei meiner Stellung nicht erlauben. Täte ich das, würde mich bald niemand mehr achten.«
»Warum tötet Ihr dann nicht auch mich?«
»Hast du es so eilig, auf die andere Seite zu gelangen?«, fragte Mylord erstaunt zurück. »Das kann ich mir freilich kaum vorstellen, denn Burschen wie dich kenne ich. Ihr hängt doch alle am Leben.«
Ohne auf das Blut zu achten, langte er nach der Statue. Sobald er die Hand ausstreckte, legte einer seiner Männer ihm ein kleines Päckchen hinein. Mylord entnahm ihm einen kleinen Kopf, der aus dem gleichen Metall gefertigt worden war wie der Fund, den Theo und Henryn gemacht hatten.
»Den habe ich in dem Steinbruch entdeckt, in dem auch ihr fündig geworden seid. Vor mehr als zehn Jahren.« Erbett setzte den Kopf mit der gebührenden Sorgfalt auf den Hals der Figur. Ein dumpfes Klacken ertönte.
»Wirklich erstaunlich«, murmelte Mylord und betrachtete verzückt die Statue. »Nicht einmal ein Riss ist zu erkennen. Der Kopf sitzt so fest, als wäre er zusammen mit dem Rest gegossen worden.«
Als er versuchte, die beiden Teile wieder voneinander zu lösen, wollte ihm das selbst mit einem gewissen Krafteinsatz nicht gelingen.
Das war die erste Arila, der Theo ins Gesicht sehen konnte, war dieses sonst doch unter einer Maske verborgen. Nun aber lächelte die Frau ihn an, als wäre er ein alter Freund.
Ein schöneres Lächeln habe ich noch nie gesehen, dachte Theo unwillkürlich. Für dieses Lächeln stürzt man sich glatt in einen Abgrund, zieht nach Ödien gegen die Schahuter oder fängt einen zweiten Krieg des Zorns an ...
»Wunderschön, nicht wahr? Aber eine Kleinigkeit fehlt. Das ist auch der Grund, warum du noch am Leben bist. Und jetzt enttäusche meine Hoffnungen nicht und verrate mir, worauf ich erpicht bin!«
»Die Maske.«
»Ich irre mich wirklich selten in einem Menschen. Der Kanon schreibt vor, dass die Arila mit einer Maske dargestellt wird. Der Gebannte hat einen Umhang zu tragen, unter dem eine abgerissene Kette hervorlugt. Niemand wird sich Thion ohne seinen Fächer vorstellen, Neysi ohne ihr Schwert, Quint ohne Ratte oder Lavenda ohne Spiegel. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Alle großen Magier haben ein eigenes Symbol. Und Arilas Wahrzeichen ist nun einmal die Maske. Nie wurde sie ohne diese auf Leinen gemalt, in Metall gegossen oder aus Ton geformt, denn kein Mensch darf ihr Gesicht sehen, weil sie den alten Legenden zufolge allein mit ihrem Lächeln jeden verführen kann. Bei Thion hat sie das einst bewiesen. Wenn du mich fragst, mangelte es dem ersten Bildhauer aber schlicht und ergreifend an Vorstellungskraft. Er wusste nicht, wie er Arilas Gesicht wiedergeben sollte und hat es deshalb hinter einer Maske verborgen. Alle Künstler nach ihm haben ihn in ihrer Einfalt bloß nachgeahmt.«
Obwohl Theo die Ansichten dieses Erbett nicht im Geringsten scherten, nickte er.
»Anhand der Maske lassen sich der Meister und das Jahr der Anfertigung zweifelsfrei bestimmen.«
Das wusste auch Theo.
»Ohne dieses wichtige Detail ist die Arila für mich wertlos. Dein Leben hängt deshalb von deiner Antwort auf eine einfache Frage ab. Wo habt ihr sie versteckt?«
Theo fuhr sich mit der Zunge über seine ausgetrockneten Lippen.
»Wir haben ...«, brachte er vorsichtig heraus, denn er wusste, er begab sich nun auf sehr dünnes Eis, »… nur den Körper gefunden, Mylord.«
»Nur den Körper? So, so«, murmelte Erbett mit finsterer Miene. »Wie es scheint, habe ich mich in dir wohl doch getäuscht. Dein Wunsch, am Leben zu bleiben, ist offenbar nicht besonders ausgeprägt. Deshalb wird morgen früh im Abwassergraben nicht eine Leiche liegen, sondern man wird ihrer zwei dort finden.«
»Nein, wartet!«, stieß Theo aus, als er eine Bewegung in seinem Rücken spürte. »Darf ich sie kurz an mich nehmen, Mylord?«
»Weshalb das?«, wollte Erbett wissen, gab seinen Handlangern aber zu verstehen, sie möchten nichts überstürzen.
»Wenn diese Statue eine Maske getragen hat, muss der Meister sie als Einzelstück angefertigt haben, denn an dem Gesicht sind keine Bruchstellen zu erkennen. In dem Fall muss es irgendwelche Befestigungsmöglichkeiten geben. Sollten sie jedoch fehlen, hieltet Ihr vermutlich einen ganz und gar einzigartigen Fund in Händen.«
»Worauf willst du hinaus?«
»Dann wäret Ihr vielleicht im Besitz einer Statuette der Arila, die noch von einem ihrer Zeitgenossen stammt. Von jemandem, der sie mit eigenen Augen gesehen hat.«
»Das ist ein bedenkenswerter Einwand, das will ich gar nicht abstreiten«, gab Erbett zu. »Vor allem wenn man vorübergehend vergisst, dass Arila nur ein Mythos ist. Die Schahuter seien mit dir, du bist wirklich ein kluges Köpfchen! Nimm dir die Figur und sieh sie dir an! Ich bin sogar ein wenig neugierig, mit welchem Kniff du mich für deine Vermutung gewinnen willst.«
Er reichte Theo die Figur. An dem schmalen Sockel schimmerte Blut. Als Theo sie an sich nahm, stellte er verwundert fest, dass das Metall eine sanfte Wärme verströmte. Das war etwas Neues. Für den Bruchteil einer Sekunde wurde ihm zudem schwarz vor Augen, während sich unter seinem Schulterblatt ein dumpfer Schmerz bemerkbar machte. Er riss sich zusammen und richtete seine ungeteilte Aufmerksamkeit auf die Frauenfigur in seinen Händen. Behutsam tastete er mit den Fingerkuppen den Kopf und vor allem das prachtvolle Haar nach einer Ritze ab, in die der Meister die Maske hätte einpassen können. Doch da war nichts.
»Ich verstehe einiges von alten Artefakten, Mylord. Als ich noch ein kleiner Junge war, hat mir ein Mann aus einem Wanderzirkus alles über sie beigebracht. Unzählige Geschichten hat er mir erzählt. Deshalb kann ich versichern, dass ... Beim Gebannten!«
Theo zog seine Hand ruckartig von der Figur fort.
»Was ist?!«
»Ich habe mich verbrannt! Die Figur ist sengend heiß, Mylord!«
»Red keinen Unsinn!«, polterte Erbett wütend, stand auf und wollte die Statue an sich nehmen – als im Innern der Arila etwas klackte. Die metallenen Finger gerieten in Bewegung und legten sich zu einem neuen, noch aufwendigeren Symbol zusammen. Sämtliche Kerzen im Raum erloschen so abrupt, als hätte sie jemand mit einem einzigen kräftigen Atemzug ausgeblasen. Nur in den beiden bronzenen Wandlampen glomm im Glasgehäuse noch Licht. Plötzlich flackerte jedoch auch dieses und fiel in sich zusammen, bloß um anschließend als blaue Flamme hochzuzüngeln.
Der süßliche Rauch, der von den gelöschten Kerzen ausging, kitzelte Theo in der Nase. Benommen sah er sich im Raum um.
»Das ist unmöglich!«, stieß Erbett aus. »Wir sind hier nicht in Lethos! Steckst du dahinter, Akrobat?! Ist das irgendein Zauberkunststück?«
Am liebsten wäre Theo bei dieser törichten Frage in schallendes Gelächter ausgebrochen, am Ende schüttelte er aber nur schweigend den Kopf. Sein Blick hing wie gebannt an der blauen Flamme. Er hatte schon viel von ihr gehört, bis eben jedoch gehofft, er müsse sie nie im Leben mit eigenen Augen sehen.
Mylord fasste Theos Schweigen jedoch auf seine eigene Weise auf.
»Das könnte dir so passen, mir einen derart dummen Streich zu spielen! Lok! Schlitz ihm die Kehle auf!«
Die beiden Schläger packten Theo erneut bei den Schultern und pressten seine Arme auf die Tischplatte. Lok zog seinen Dolch blank und trat dicht an Theo heran.
»Ich frage dich nur noch dieses eine Mal!«, keifte Erbett. »Wie hast du das angestellt?!«