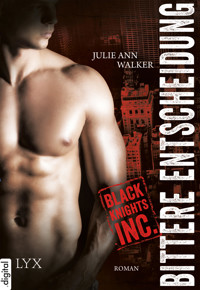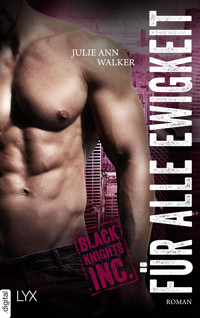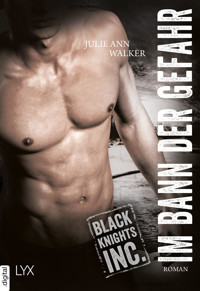9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deep Six
- Sprache: Deutsch
Was ist besser als ein heißer Navy SEAL? Sechs heiße Navy SEALS!
Eigentlich hatte sich Ex-Navy SEAL Leo Anderson geschworen, den gefährlichen militärischen Einsätzen für immer den Rücken zu kehren. Doch als CIA Agentin Olivia Mortier ihn und sein altes Team um Hilfe bei einer streng geheimen Mission bittet, bringt er es einfach nicht fertig, sie zu enttäuschen. Denn Olivia ist die einzige Person aus seinem früheren Leben, die er nicht vergessen kann. Und die einzige Frau, die sein Herz seit langem wieder schneller schlagen lässt als jede noch so gefährliche Kampfhandlung.
"Heiße Kerle, heiße Action und heiße Temperaturen sorgen für ein heißes Leseerlebnis!" BOOK PAGE
Auftakt der DEEP-SIX-Reihe von New-York-Times- und USA-Today-Bestseller-Autorin Julie Ann Walker
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungProlog123456789101112131415161718192021EpilogDanksagungDie AutorinDie Romane von Julie Ann Walker bei LYXImpressumJULIE ANN WALKER
Deep Six
Rausch der Gefahr
Roman
Ins Deutsche übertragen von Michael Krug
Zu diesem Buch
Was ist besser als ein heißer Navy SEAL? Sechs heiße Navy SEALS!
Eigentlich hatte sich Ex-Navy SEAL Leo Anderson geschworen, den gefährlichen militärischen Einsätzen für immer den Rücken zu kehren. Doch als CIA Agentin Olivia Mortier ihn und sein altes Team um Hilfe bei einer streng geheimen Mission bittet, bringt er es einfach nicht fertig, sie zu enttäuschen. Denn Olivia ist die einzige Person aus seinem früheren Leben, die er nicht vergessen kann. Und die einzige Frau, die sein Herz seit Langem wieder schneller schlagen lässt als jede noch so gefährliche Kampfhandlung.
An alle Fans, die mich durch jedes Abenteuer in jeder Geschichte begleitet haben, die mich ermutigt haben, weiterzuschreiben, und die mich seit dem ersten Satz des ersten je von mir veröffentlichten Buchs angespornt haben:
Das hier ist für euch!
As the son of a son of a sailor, I went out on the sea for adventure …
– Jimmy Buffett
Prolog
26. Mai 1624 …
Das Ende ist nah …
Die Worte hallten mit der bedrohlichen Klarheit einer Totenglocke durch Käpt’n Bartolome Vargas’ Geist. Die See … die so launische See hatte sich, wie schon so oft, wieder einmal gegen ihn gewandt. Aber im Gegensatz zu all den früheren Schlachten, die er nach hartem Kampf gewinnen konnte, ereilte ihn die Gewissheit – vielleicht eine Vorahnung? Oder schlichte Intuition? –, dass es an diesem Tag kein Entrinnen geben würde. Die wässrigen Klauen des Ozeans warteten nur darauf, sein geliebtes Schiff und die 224 Seelen an Bord zu verschlingen wie ein riesiger Blauwal, der sich einen Schwall Krill einverleibt. An diesem Tag konnten weder der Herrgott höchstpersönlich noch irdische Kanonen Bartolomes kostbare Galeone vor den riesigen, schäumenden Wellen schützen, die auf den Rumpf zurasten.
»Großsegel einholen! Schnell!«, brüllte er den Mitgliedern der Besatzung zu, die in der Takelage kletterten und über das überschwemmte Deck der Santa Cristina schlitterten und rutschten. Sein Erster Offizier blies den Befehl durch eine Fischbeinpfeife. Die drei schrillen Noten gingen beinah völlig unter, als der böige Wind sie erfasste und aufs Meer hinausfegte. Bartolome wischte sich den Regen und die salzige Gischt aus den Augen, kämpfte mit dem großen Steuerrad aus Holz und blickte nach Osten zu der brodelnden Wolkenwand, die seinem Verhängnis vorausging. Als er an jenem Morgen erwacht war und den gespenstischen Schimmer am Horizont erblickt hatte, da hatten ihn seine Seemannsinstinkte gewarnt, dass ihnen ein höllischer Sturm bevorstand. Dennoch war er so früh um die Jahreszeit nicht dafür gewappnet gewesen …
Un huracán – einHurrikan. Für ihn bestand kein Zweifel.
MiteinemwüstenFluch schwenkte er den Blick nach Norden und hoffte, sein Schwesternschiff, die Nuestra Señora de Cádiz, würde es rechtzeitig zu Bone Key geschafft haben, um das Unwetter im Windschatten der Insel abzuwarten. Beim Anblick des aufgewühlten rötlichen Himmels bei Sonnenaufgang hatten Kapitän Quintana, Bartolomes Pendant an Bord der Cádiz, und er die Entscheidung getroffen, die nach Spanien segelnde Armada aufzuteilen. Quintana sollte weiterfahren und unterwegs bei Bone Key Zuflucht suchen, falls es nötig wäre. Bartolome würde zu ihrem Heimathafen Havanna umkehren – falls ihm das nicht gelänge, sollte er Schutz in der Nähe der Ringinsel auf halbem Weg dazwischen suchen. Ihre Überlegung dahinter war gewesen, dass so im schlimmsten Fall zumindest ein Schiff den Sturm überleben würde. Aber un huracán … Un huracán konnte sie ohne Weiteres beide auf den Meeresgrund befördern.
GenauwieEustacio …
Bartolome verzog das Gesicht zu einer Grimasse, als er an den Mann dachte, der am Vormittag zusammen mit sechs seiner Bronzekanonen über Bord gegangen war, als eine unverhoffte Monsterwelle die volle Breitseite der Santa Cristina erfasst hatte. Es hätte sein erster Hinweis darauf sein sollen, dass es sich nicht bloß um eine sommerliche Sturmbö handelte. Schon da hätte er Zuflucht suchen sollen.
Erhatte esnicht getan.
»Gott steh ihnen bei.« Leise murmelte Bartolome ein Gebet sowohl für Eustacio als auch für sein Schwesternschiff. Abschließend bezog er seine verbleibende Besatzung und sich selbst darin ein: »Möge Gott uns allen beistehen.« Dann richtete er die Aufmerksamkeit nach Süden.
Der gnadenlose Wind peitschte ihm das Haar aus der Spange in seinem Nacken und klatschte es gegen die Stoppeln auf seinen Wangen und an seinem Kinn. Er achtete nicht darauf, als er die Augen zusammenkniff und mit ganzem Herzen wünschte, er könnte die funkelnden, einladenden Lichter von Havanna sehen. Leider lag die Stadt noch so weit entfernt, dass der Anblick bloßes Wunschdenken blieb. Mittlerweile war es unmöglich geworden, gegen den Wind und die Gezeiten anzukämpfen und dorthin zurückzusegeln.
Wie zur Betonung musste er betroffen mit ansehen, wie die San Andrés und die San José, die beiden mit dem Schutz der Santa Cristina beauftragten Kanonenschiffe, den Monsterwellen zum Opfer fielen, die über ihre Decks schwappten. Erst das eine, dann das andere Schiff glitt lautlos unter die Oberfläche des aufgewühlten Wassers. Ihr Untergang wirkte durch die Banalität, die Mühelosigkeit, mit der sie die Reise zum Meeresgrund antraten, umso grauenvoller.
Das Ende ist nah …
Wieder tauchten die Worte in Bartolomes Gedanken auf, als wollten sie ihn verhöhnen. Ihm blieb gerade noch genug Zeit, um ein Stoßgebet für die verlorenen Seelen an Bord der Kanonenschiffe gen Himmel zu schicken, bevor – Platsch! – die Rahen der Santa Cristina ins zornige Meer tauchten, als das Schiff brutal zur Seite krängte. Das Deck bäumte sich unter seinen Füßen auf. Er umklammerte mit einer Hand das Steuerrad, mit der anderen die glitschige Reling, so krampfhaft, dass seine Finger schmerzten. Die mächtigen Masten ächzten und knarrten eine düstere Warnung, und der bittere Geruch von Schlick und Seetang, aufgewühlt von den wirbelnden Strömungen, ergänzte das durchdringende Knistern von Elektrizität in der Luft.
Bumm! Ein Blitz, wie er nur bei den turbulentesten und unberechenbarsten Hurrikans vorkam, zuckte über den Himmel und erhellte gespenstisch die Gesichter von Bartolomes Besatzung, die um das Leben des Schiffes und somit letztlich um die eigene Rettung kämpfte.
Ihnen blieb nur eine Chance: die Ringinsel, die Bartolome vor Kurzem hinter sich gelassen hatte, als er noch arrogant gedacht hatte, es wäre möglich, den Heimathafen zu erreichen …
»Wir drehen bei!«, brüllte er seinem Ersten Offizier zu.
Der junge Mann nickte ruckartig und hob sich die Pfeife an die Lippen. Bartolome beobachtete, wie sich die Wangen des Mannes blähten, doch es drang kein Laut aus dem kleinen Instrument. Mit einem gebrüllten Fluch schüttelte sein Erster Offizier so viel von der salzigen Gischt aus der Pfeife, wie er konnte, bevor er es erneut versuchte. Diesmal drangen zwei kurze, klare Noten durch die stürmische Luft, gefolgt von einem langen, melodischen Ton.
Bartolome beobachtete durch den blendenden Schleier des heftigen Regens, wie sich seine wackere Mannschaft bemühte, seinen Befehl auszuführen. Als die Takelage bereit war, drehte er das Ruder. Seine Muskeln brannten von den langen Stunden, die er schon verzweifelt um die Kontrolle über das große Schiff kämpfte. Die Santa Cristina stöhnte gewaltig. Das Holz des Rumpfs knarzte unter der Belastung, als der Kahn in der aufgewühlten See beizudrehen versuchte. Doch kaum hatte die volle Wucht des Sturmwinds die Hilfssegel erfasst und das Schiff jäh angehoben, bevor es zur Seite krängte, wurde offensichtlich, dass es zu spät war. Wahrscheinlich könnte die Santa Cristina lang genug durchhalten, um sie zu der Ringinsel zu befördern, nur war sie viel zu schwerfällig für die nötigen Manöver, um wohlbehalten auf die Leeseite zu segeln.
»Sie ist zu schwer, Sir!«, rief der Sohn des Smuts, der sich verzweifelt an der Reling des Achterdecks festklammerte. Die Angst in den weit aufgerissenen Augen des jungen Burschen war so gewaltig wie die Entscheidungen, die vor Bartolome lagen. »Wir müssen die Fracht loswerden, wenn wir überleben wollen!«
Ihre Fracht … die Tonnen von Gold- und Silbermünzen, die Fässer voll Schmuck und ungeschliffenen Edelsteinen, die sie im großen Bauch der Santa Cristina beförderten. Ein Schatz, den König Philip dringend brauchte, um den laufenden Kampf gegen die Engländer, die Franzosen und die Holländer zu finanzieren – die gemeinen Mistkerle, die fest entschlossen zu sein schienen, das spanische Imperium in Schutt und Asche zu legen. Ein Schatz, den der König Bartolome, Quintana und den beiden von ihnen befehligten Schiffen anvertraut hatte, dem Stolz der spanischen Flotte.
Bartolomewusste, was er zu tun hatte. König und Vaterland zuerst.
Er rissdasSteuerradhartnach links und versuchte, der Strömung zu folgen, um das Schiff aus der trügerischen Sicherheit des tiefen Wassers in die gewissen Gefahren der Untiefen zu lenken.
»Was machen Sie da?«, kreischte der Junge, als der Kahn eine Mammutwelle erklomm. Das Deck neigte sich beinah senkrecht, bevor sie die Kuppe erreichten und auf der anderen Seite abtauchten. »Sie lassen uns noch auf Grund laufen!«
Undgenau daswarBartolomes Plan. Bliebe er draußen in den unergründlichen Tiefen der Meerenge und entledigte er die Santa Cristina ihrer kostbaren Fracht, um anschließend zum Norden der Insel zu segeln, hätten sie vielleicht eine Chance gegen den Zorn des Sturms. Nur würde dann das Vermögen seiner Nation, das Vermögen, auf das sein König zählte, für immer in ein schwarzes, wässriges Grab verdammt.
»Wir steuern sie zum Riff!«, brüllte er dem Jungen zu, als eine weitere Welle über die Decks schwappte. Seine Männer suchten schlitternd, rutschend nach Halt, und Bartolome wurde kurzzeitig die Sicht geraubt, weil er salziges Wasser mitten ins Gesicht bekam. »Dort besteht die Chance auf Bergung!«
»Aber so bringen Sie uns alle um!«, schrie der Sohn des Smutjes schrill. Wieder wischte sich Bartolome salzige Gischt aus den Augen und erübrigte einen flüchtigen, mitleidigen Blick auf das dreizehnjährige Bürschchen.
So jung mit der Unausweichlichkeit des Todes konfrontiert. Hat wahrscheinlich noch nicht mal sein erstes Vergnügen mit einer Frau gehabt …
Die Vorstellung ließ Bartolome kurz innehalten. Dann jedoch schüttelte er den Kopf, verdrängte den Gedanken und konzentrierte sich wieder darauf, das Schiff durch die tückische See zu steuern. Das Leben eines Seemanns war bestenfalls ungewiss, und der Junge war eindringlich vor den Gefahren gewarnt worden, bevor er unterschrieben und sich verpflichtet hatte, sich seinem Vater auf dieser Reise mit der königlichen Flotte anzuschließen.
»Bitte tun Sie das nicht, Käpt’n!«, flehte der Junge, erstickte dabei halb an den eigenen Tränen und am Wasser, das sich weiter über das Schiff ergoss. Indes tauchten die schattigen Umrisse einer kleinen Insel vor ihrem Bug auf.
Bartolomeachtete nicht auf die Rufe des Burschen. Diesmal verzichtete er auf die Pfeife seines Ersten Offiziers und brüllte der Mannschaft an Deck zu: »Fallen Anker, Männer!«
Wenn es ihm gelänge, einen Teil des nahenden Riffs zu erwischen, würde die Galeone mit Sicherheit in den seichteren Gewässern sinken, wo ihre Fracht geborgen werden könnte, und er hätte seine Pflicht erfüllt. Er würde alles für sein Vaterland und dessen Sache gegeben haben, höchstwahrscheinlich sogar sein Leben.
Für wenige Sekunden kam nach seinem Befehl alles Treiben an Bord der Galeone zum Stillstand, als die Besatzung begriff, was er vorhatte. Bartolome fragte sich, ob seine Männer womöglich meutern würden. Dann erfüllte Stolz sein Herz, als einer seiner Fähnriche zur See – vielleicht Rosario – begann, Befehle zu rufen. Die tapferen Matrosen an Bord der Santa Cristina setzten sich hastig wieder in Bewegung, um seine Anordnung auszuführen.
Bumm! Ein weiterer Blitz riss den schwarzen Himmelauf wie eine Wunde und erhellte die Ketten der Anker, als sie über die Seite des Schandecks rasten und im schäumenden Wasser verschwanden.
Nun blieb nur noch, sich bestmöglich festzuhalten.
»Verzurr dich an einem leeren Wasserfass, Junge!«, brüllte Bartolome zu dem schluchzenden Burschen. Er behielt das Steuerrad fest im Griff, als die Anker über den sandigen Untergrund schleiften und nach dem Korallenriff suchten. Das Schiff krängte gefährlich, während die Wellen weiter wie riesige, zornige Fäuste gegen den ächzenden Rumpf schlugen.
Unddann geschah es. Die Anker fanden Halt – einen Herzschlag, bevor eine Sturzwelle die Santa Cristina anhob undgegen das Riff schleuderte. Krach! Die Galeonebrach entzwei, und Wasser strömte in den aufgerissenen Frachtraum. Bartolome musste hilflos mit ansehen, wie der an ein Wasserfass gezurrte Sohn des Smutjes über Bord gespült wurde.
Viel Glück, mein Junge, dachte er, als erdieAugenschloss unddas Gesicht zum tobendenHimmel hob, während ihm die Schreie seiner verängstigten und sterbenden Männer in die Ohren drangen. Sekunden später schwappte eine mächtige Woge über ihm und dem großen Schiff zusammen und zog sie beide unter die aufgewühlte Meeresoberfläche …
1
Heute 22:52 Uhr …
»Und die Santa Cristina, ihre tapfere Crew und ihr Kapitän wurden von der See verschlungen und waren für die Welt verloren. Das heißt … bis heute …«
Leo »Löwe« Anderson, den seine Freunde als LT kannten – eine Anspielung auf seinen früheren Rang bei der Navy –, ließ die letzten Worte in der Luft hängen, bevor er den Blick über die vier vom flackernden Feuer am Strand erhellten Gesichter schwenkte. Andächtige Mienen starrten ihn an. Er kämpfte gegen das Grinsen an, das seine Lippen verziehen wollte.
Bingo. Seine Zuhörer standen unter einem Bann so tief und weit wie die großen Meere selbst. Passierte jedes Mal, wenn er die Legende der SantaCristina erzählte. Woraus er seinem Publikum keinen Vorwurf machen konnte. Die Geschichte von dem Geisterschiff, dem heiligen Gral der versunkenen spanischen Wracks, faszinierte ihn selbst schon, seit er alt genug gewesen war, um sie zu verstehen, während sie ihm auf den Knien seines Vaters erzählt wurde. Und vielleicht erklärte diese lebenslange Faszination, warum er so fest entschlossen war, etwas zu tun, was so vielen vor ihm nicht gelungen war – auch nicht seinem verstorbenen Vater, den er schmerzlich vermisste. Leo wollte nämlich den Schatz des prunkvollen alten Schiffs aufspüren und bergen.
Mit der Entdeckung eines versunkenen Wracks gingen Romantik und der Reiz des Geheimnisvollen einher. Natürlich wusste er, dass darin nur ein Teil des Grundes lag, warum er die vergangenen zwei Monate und einen gewaltigen Batzen seiner Ersparnisse – sowie der Ersparnisse anderer – in die Generalüberholung des altersschwachen, lecken Bergungsschiffes seines Vaters investiert hatte. Und der Rest der Geschichte, warum er nun hier war? Warum sie alle nun hier waren? Tja, darüber wollte er lieber nicht nachdenken.
Zumindest nicht in einer Nacht wie dieser. Nicht in einer Nacht, in der sich Millionen funkelnder Sterne und ein großer Halbmond im dunklen, sich kräuselnden Wasser der Lagune spiegelten, südöstlich des abgeschiedenen Fleckchens aus Dschungel, Mangrovenwald und Sand der Florida Keys. In einer Nacht, in der die Luft mild und warm seine Haut und sein Haar mit zarten, nach Salz duftenden Fingern liebkoste. In einer Nacht, in der so viel … Leben herrschte, an dem man sich erfreuen konnte.
Das hatte er – hatten sie – sich fest vorgenommen, oder? Das Leben mit beiden Händen zu packen und es voll auszukosten. Das Mark des Lebens in sich aufzusaugen.
Unwillkürlich schwenkte sein Blick zur Haut an der Innenseite seines linken Unterarms, wo in eintätowierter Schreibschrift FürRL stand. Er fuhr mit dem Daumen über die pechschwarze Tinte.
Dasist für dich, du sturer Mistkerl, dachte er, als er den Deckel der neben seinem Gartenstuhl tief in den Sand versenkten Kühlbox öffnete. Er griff sich eine Flasche Budweiser, schraubte den Verschluss auf und ließ den Blick das Dock entlangwandern, an dem der Katamaran seines Onkels vertäut lag. Die Schellen am Tauwerk klirrten rhythmisch gegen den Metallmast und ergänzten die Harmonie der leise rauschenden Wellen, des knisternden Feuers und des hohen Pi-sii-pi-sii-pi-sii eines nahen Kletterwaldsängers.
Dann richtete Leo den Blick auf das offene Meer, vorbei am Unterwasserriff, das die Seite von Wayfarer Island umgab, wo das alte Bergungsboot seines Vaters träge auf der Dünung wogte. Auf und ab. Hin und her. Der frisch lackierte Rumpf und die runderneuerte Ankerkette schimmerten matt im Mondlicht. Der Name, Wayfarer-I, war dank der neuen, strahlend weißen Schrift deutlich sichtbar.
Tief atmete er ein, sog den Geruch von brennendem Treibholz und Sonnenmilch in die Nase. Dabei bemühte er sich, die Ruhe des Abends ebenso zu genießen wie den tröstlichen Gedanken, dass der Kahn zwar nicht unbedingt sexy, aber zumindest seetüchtig aussah. Was eine gewaltige Verbesserungist.
Verdammt, was war er stolz auf all die Arbeit, die seine Männer und er an dem Boot geleistet hatten …
Seine Männer …
Zum tausendsten Mal ermahnte er sich, dass er nicht so von ihnen denken sollte. Nicht mehr. Nicht, seit sich die fünf durchgeknallten SEALs von der Navy verabschiedet hatten, um sich ihm bei seiner Suche nach Hochseeabenteuern und der Entdeckung unermesslicher Reichtümer anzuschließen. Nicht mehr, seit sie offiziell Zivilisten waren.
»Aber warum ihr?« Die Blondine unter Spiro »Romeo« Delgados Arm riss Leo aus seinen Gedanken. »Was unterscheidet euch von all den anderen, die schon vergeblich versucht haben, das Wrack zu finden?«
»Abgesehen vom Offensichtlichen, meinst du, mamacita?« Romeo zwinkerte, lehnte sich auf dem Gartenstuhl zurück und breitete die Arme weit aus. Durch sein Grinsen hoben sich seine weißen Zähne schimmernd vom gepflegten Kinnbart ab, und Leo beobachtete, wie sich die Blondine auf dem Liegestuhl aus Plastik vorbeugte, um das Prachtexemplar von Mann zu beäugen, das Romeo Delgado verkörperte. Nach einem ausgiebigen, begehrlichen Blick kicherte sie und schmiegte sich wieder an Romeos Seite.
Leo verdrehte die Augen. Romeos dunkler Latino-Teint und seine sechs Prozent Körperfett ließen selbst die prüdesten Damen schneller aus dem Höschen springen, als man blinzeln konnte. Und diese Braut? Tja, diese Braut mochte im alltäglichen Leben vielleicht etepetete sein. Verdammt, soweit Leo wusste, konnte sie durchaus die führende Expertin für Etikette an einem Mädcheninternat sein. Aber heute, seit Romeo sie und ihre süße Freundin in der Schooner Wharf Bar auf Key West mit dem zum Augenverdrehen lahmen Spruch »Wollt ihr mitkommen und euch meine private Insel ansehen?« aufgerissen hatte, spielte sie die Rolle einer unbekümmerten jungen Frau, die sich Spaß in der Sonne und eine zwanglose Affäre gönnen wollte. Für das träge, selbstgefällige Grinsen in Romeos Gesicht zeichnete vermutlich – ach was, mit Sicherheit – der Teil mit der zwanglosen Affäre verantwortlich.
»Aber im Ernst.« Tracy oder Stacy oder Lacy, wie auch immer sie heißen mochte – Leo hatte bei der Vorstellung nur mit einem Ohr zugehört –, rümpfte die von der Sonne gerötete Nase. »Woher wisst ihr überhaupt, wo ihr suchen müsst?«
»Deswegen.« Leo hob das Acht-Reales-Stück aus Silber an, eine spanische Münze aus dem siebzehnten Jahrhundert, die an einer langen Platinkette um seinen Hals hing. »Mein Vater hat es vor zehn Jahren vor der Küste der Marquesas Keys entdeckt.«
Das Stirnrunzeln von Tracy/Stacy/Lacy vermittelte ihre Skepsis. »Eine Münze? Ich dachte, der Golf und die Karibik wären geradezu übersät von alten Dublonen.«
»Mein Vater hat nicht nur ein Acht-Reales-Stück gefunden.« Leo zwinkerte. »Es war ein großes, schwarzes Konglomerat von zehn Acht-Reales-Stücken sowie …«
»Konglomerat?«, fragte die Brünette mit den sinnlichen Lippen dazwischen. Die Freundin von Tracy/Stacy/Lacy sandte Leo schon eindeutige Signale, seit Romeo den Katamaran an das wackelige alte Dock auf Wayfarer Island gesteuert und ihre Gäste hatte aussteigen lassen. Die Signale hatten aus sofortigen Blicken der hübschen, dunklen Augen und einem schüchternen, ermutigenden Lächeln bestanden.
Gut, es schien an der Zeit für ein Eingeständnis zu sein. Denn für einen flüchtigen Moment, als sie – Sophie oder Sophia? Herrgott, an diesem Abend hatte es Leo wirklich nicht mit Namen – sich an ihn herangemacht hatte, war er in Versuchung geraten, auf all die Dinge einzugehen, die ihre nonverbale Kommunikation versprach. Doch dann war ein Bild von schwarzen Haaren, saphirbauen Augen und einem leicht schiefen Schneidezahn in seinem Kopf aufgeblitzt. Und einfach so hatte die Brünette jegliche Anziehungskraft verloren.
Was gut soist, hielt sich Leo vor Augen. Du wirst allmählich zu alt, um die Schnallen zu knallen, die Romeo aus Kneipen abschleppt.
Auftritt Dalton »Doc« Simmons mit seinen fast zwei Metern Körpergröße und dem schlichten Charme aus dem Mittelwesten, den er in Hülle und Fülle besaß. Flugs hatte er sich zwischen Leo und Sophie/Sophia gedrängt. Nun klebte ihr Blick an Docs Gesicht, als er mit seiner tiefen, rauen Kiefer-Sutherland-Stimme sagte: »Im Gegensatz zu Gold, das sich seinen Glanz auch nach Jahren auf dem Meeresgrund bewahrt, greift Salzwasser Silbermünzen an. Sie klumpen sich durch Korrosion oder andere maritime Ablagerungen zusammen. Wenn das passiert, bezeichnet man es als Konglomerat. Man muss es elektronisch säubern, um die Ablagerungen an der Oberfläche zu beseitigen, damit so etwas dabei herauskommt.« Doc ergriff die Silberkette um seinen Hals und zog ein Acht-Reales-Stück unter seinem T-Shirt hervor. Es glich jenem, das Leo trug.
»Und so etwas«, fügte Romeo hinzu und drehte die Münze an der Kette um seinen Hals wie eine billige Stripperin eine Boa.
Am ersten Tag auf der Insel hatte Leo jedem seiner Männer – Verflucht noch eins!Seiner Freunde – eine der Münzen geschenkt. Dabei hatte er zu ihnen gesagt, ihre zueinanderpassenden Tätowierungen wären Symbole ihrer gemeinsamen Vergangenheit, die zueinanderpassenden Acht-Reales-Stücke Symbole ihrer gemeinsamen Zukunft.
Leo prostete mit seinem Bier in Docs Richtung. »Maritime Ablagerungen, was? Du klingst schon wie ein waschechter Schatzsucher, mein Freund.«
Doc schmunzelte. Näher kam der Mann einem Lächeln nie. Hätte Leo nicht gelegentlich gesehen, wie Doc ein Steak verzehrte, wäre er nicht mal überzeugt davon gewesen, dass der Kerl überhaupt Zähne besaß.
»Aber selbst ein Konglomerat von Münzen wäre noch nicht genug, um die Lage des Schiffs zu garantieren«, fügte Leo hinzu, wieder an die Blondine gewandt. »Mein Vater hat außerdem eine Handvoll Deckkanonen aus Bronze gefunden. Alle standen im Ladeverzeichnis der SantaCristina. Also ist sie da unten … irgendwo.« Er musste sie nur finden. Alle seine Freunde verließen sich aus verschiedenen Gründen auf diesen Glücksfall, und wenn er nicht …
»Aber wie du gesagt hast: Dein Vater hat wie lange nach diesem Santa-Dingsbums-Boot gesucht?« Leo zuckte zusammen. Gut, die Frau schien süß zu sein. Aber schlimmer als die Verunglimpfung des Namens dieses legendären Schiffes war nur, es als Boot zu bezeichnen. »Um die zwanzig Jahre, oder?«
»Und Mel Fisher hat sechzehn Jahre lang nach der Atocha gesucht, bis er sie endlich gefunden hat.« Damit bezog er sich auf den berühmtesten Schatzsucher und die berühmteste Schatz-Galeone aller Zeiten. Nun ja, den berühmtesten Schatzsucher, bis die Jungs und er es in die Geschichtsbücher schaffen würden, richtig? Richtig. »In seichten Gewässern wie um die Florida Keys ist der sandige Untergrund durch Winde und die Gezeiten in Bewegung. Der Meeresboden verändert sich täglich, ganz zu schweigen von fast vier Jahrhunderten. Aber mit etwas harter Arbeit und Beharrlichkeit wird das scheinbar Unmögliche dann doch möglich. Wir sind ihr dicht auf der Spur.« Auf der verwirrenden, unsichtbaren, praktisch nicht vorhandenen Spur. Scheiße.
Langsam zwinkerte Doc der Frau bestätigend zu und drehte den Zahnstocher, den er ständig im Mundwinkel hatte, mit der Zunge im Kreis. Das musste die arme Sophie/Sophia verzaubert haben, denn sie sog scharf die Luft ein, bevor sie mit den hübschen Wimpern klimperte und ihren Gartenstuhl näher zu ihm rückte. Doc schlang ihr einen Arm um die Schultern und wackelte in Leos Richtung mit den Augenbrauen. Wie die anderen ließ Doc keine Gelegenheit aus, Leo nach Strich und Faden zu verarschen. Was nicht anders zu erwarten war, da Leo als ihr ehemaliger befehlshabender Offizier von jeher als Zielscheibe für ihren gesamten Spott hergehalten hatte.
Ja, ja, dachte Leo und schmunzelte bei sich. Ich bin hier der RogerMurtaugh – zu alt für diesen Scheiß. Und du findest, ich hab’s voll vergeigt, indem ich abgelehnt habe, was sie anbieten wollte, richtig? Also, nur zu. Reib’s mir unter die Nase, du großer, plumper Stinkstiefel.
»Wieso müsst ihr den alten Schatz überhaupt finden?«, wollte die Blondine wissen. »Ihr habt doch eine private Insel.« Sie deutete mit dem Bier zum sich kräuselnden Wasser der Lagune und verschüttete beschwipst ein paar Spritzer ins Feuer, wo sie zischend verdampften. »Seid ihr nicht r…« Sie hickste, hielt sich die Finger vor den Mund und kicherte. »Reich?«, beendete sie die Frage.
»Ha! Wohl kaum.« Leo stellte seine schwitzende Bierflasche auf den Stoff seiner Badehose. Hier auf den Keys waren Shorts und Badehosen untereinander austauschbar – was anscheinend nicht für seine möglichen Bettgespielinnen galt.
Jetzt komm schon! Warum kriegst du Olivia Mortier nicht aus dem Kopf?
Und das schien die Frage der Stunde zu sein, nicht wahr? Oder eher die Frage der letzten verfluchten achtzehnMonate. Seit jener Mission in Syrien …
»Aber wenn ihr nicht reich seid«, hakte die Blondine nach, »wie könnt ihr euch dann« –hicks – »den Ort hier leisten?«
Im Ernst, Romeo sollte sie besser schleunigst ins Haus und in sein Bett verfrachten. Noch ein, zwei Flaschen, und sie wäre zu sehr durch den Wind für das, was dem selbst ernannten Don Juan mit ihr vorschwebte. Romeo mochte ein außergewöhnlich geiler Bock sein und mehr Kerben im Bettpfosten haben als Leo Einsätze in seinem SEAL-Lebenslauf, doch wie die anderen Jungs war Romeo durch und durch ehrenwert. Wenn Tracy/Stacy/Lacy zu weggetreten wäre, würde Romeo nicht mehr tun, als sie mit einem keuschen Kuss auf die Stirn ins Bett zu bringen und zuzudecken. Und wie ihr SEAL-Team-Motto lautete: Wo bleibt denn da der Spaß?
Wie auf ein Stichwort drehte sich Romeo in Leos Richtung und schnippte mit den Fingern. Ein besorgtes Stirnrunzeln verzog seine schwarzen Augenbrauen zu einem V. Leo verkniff sich ein Lächeln, als er die Kühlbox erneut öffnete und darin herumkramte, bis er eine Flasche Wasser fand. Er warf sie über das Feuer, und Romeo fing sie mit einer Hand auf. Dann tauschte Mr Oberstecher kurzerhand das Bier der Blondine gegen das Wasser aus. »Probier mal das, m’ija«, gurrte er und trug mit seinem Akzent echt dick auf, bevor er sich zu ihr beugte und ihr etwas zweifellos Anzügliches ins Ohr flüsterte.
Blondie kicherte, schraubte gehorsam den Verschluss der Wasserflasche auf und trank einen ausgiebigen Schluck.
»Die Insel gehört uns nicht, Schätzchen«, rief eine tiefe Stimme vom Strand herauf. Leo drehte sich um und sah, dass sein Onkel auf sie zukam. Der Mann trug seine übliche Uniform, die aus weiten Cargoshorts und einem Hawaiihemd bestand, das Augenbluten verursachte. Sein dichter Hemingway-Schopf und der dazu passende Bart schimmerten im Licht des Mondes und bildeten einen harten Kontrast zu seiner Haut, die von der endlosen subtropischen Sonne praktisch zu Leder gegerbt worden war.
Bran Pallidino, Leos bester Freund und Schwimmpartner bei BUD/S – der als Basic Underwater Demolition/SEAL bezeichneten Ausbildung – hatte Leos Onkel mal als »ein Teil kerniger Seebär und zwei Teile arbeitsscheuer Hippie« beschrieben. Leo fand, das fasste den alten Kauz in einem prägnanten Satz ziemlich gut zusammen. »Mein Ur-ur-hab-vergessen-wie-viele-Urs-Großvater hat die Insel für einhundertfünfzig Jahre von Ulysses S. Grant gepachtet.«
»Von Präsident Grant?«, entfuhr es der Brünetten mit einer hohen Piepsstimme. Sie verschluckte sich an ihrem Bier.
»Genau der«, bestätigte Onkel John, pflanzte sich auf einen freien Plastikgartenstuhl, streckte die nackten Füße dem Feuer entgegen und hob sich ein Trinkglas mit gesalzten Rändern an die Lippen – gefüllt mit Salty Dog, Johns Standard-Cocktail aus Grapefruit und Wodka. Eis klirrte gegen die Seite des Glases, als er einen kräftigen Schluck trank. »Du weißt das vielleicht nicht, Tracy«, sagte er – Tracy. Leo schnippte mit imaginären Fingern und bemühte sich, den Namen im Gedächtnis zu behalten – »aber der gute, alte Ulysses hat um die zehn Zigarren pro Tag geschmaucht. Und mein Ur-ur…« Onkel John machte mit der Hand eine Drehbewegung. »Na, egal wie viele Urs, jedenfalls war mein Vorfahre der angesagteste Zigarrenhersteller zu der Zeit. Als Gegenleistung für lebenslangen Nachschub an qualitativ hochwertigen kubanischen Zigarren hat sich mein Ur-ur-Opa die Rechte gesichert, dieses kleine Paradies hier anderthalb Jahrhunderte lang als Urlaubsdomizil für sich und seine Nachkommen zu nutzen.« Onkel Johns vertrauter, gedehnter Louisiana-Akzent – den Leo mit ihm teilte, wenngleich weniger ausgeprägt – trieb träge durch die warme Brise.
Die Anderson-Brüder, Onkel John und Leos Vater James, stammten ursprünglich aus New Orleans. Wie ihr Vater vor ihnen waren sie zu Krabbenkutterkapitänen im Golf ausgebildet worden. Aber eine zufällige Entdeckung an einem gewöhnlichen Nachmittag bei einem Tauchgang vor der Küste von Geiger Key hatte alles verändert. Sie hatten ein kleines spanisches Kanonenboot mit allen möglichen archäologischen Reichtümern gefunden, von Musketen über Dolche bis hin zu Schwertern, und der Schatzsuchervirus hatte sie schwer infiziert. Im folgenden Jahr, als Leo gerade mal fünf war, zogen die Brüder auf die Keys, um ihr umfassendes Wissen über das Meer der Suche nach versunkenen Kostbarkeiten statt nach fetten rosa Krabben zu widmen.
Leider fanden sie nie wieder Beute, die es mit der von jenem Kanonenboot aufnehmen konnte. Onkel John gab das Unterfangen nach einem Jahrzehnt auf, wurde sesshaft und betrieb bis zu seinem Ruhestand vor sechs Monaten eine der zahlreichen Bars von Key West. Leos Vater hingegen war im Bergungsgeschäft geblieben und hatte seine Zeit zwischen bezahlten Aufträgen und der Jagd nach der SantaCristina aufgeteilt, bis er während eines Tauchgangs einen Herzinfarkt erlitt. Leo fand Trost in dem Wissen, dass sein alter Herr so gestorben war, wie er gelebt hatte: umschlungen von den Armen der See.
»Ulysses S. Grant? Das muss dann ja … irgendwann in den 1870ern gewesen sein, oder?«, fragte die Brünette.
»Du kennst dich anscheinend mit den Präsidenten aus, Sophie.« Onkel John zwinkerte und nippte erneut an seinem Cocktail.
Sophie, Sophie, Sophie. Leo hätte bei der Vorstellung wirklich genauer aufpassen sollen. Denn mal ehrlich – was hatte er eigentlich für ein Problem? Wenn der Name einer Frau nicht Olivia Mortier lautete, ging er einfach zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus? Schluss damit!
»Ich unterrichte an der Girls’ Academy of the Holy Saints High School in Tuscaloosa Geschichte.« Sie deutete mit dem Daumen auf ihre Freundin. »Tracy unterrichtet Hauswirtschaft.«
Leo spuckte beinah sein Bier aus. Sie war zwar keine führende Expertin für Etikette, aber verdammt nah dran.
»Ah.« Onkel John nickte wissend. »Tja, das erklärt es. Und du hast recht. Es war in den 1870ern.«
»Also …« Sophies Lippen verzogen sich zu einer skeptischen Miene. »Wann werdet ihr rausgeworfen? In fünf Jahren? Zehn?«
»Tja.« Onkel John zuckte mit den Schultern. »So richtig rauswerfen kann man uns nicht, weil uns die Insel ja nie wirklich gehört hat. Außerdem wird diese Crew hier die SantaCristina bis dahin gefunden haben.« John war unter dem Vorwand auf Wayfarer Island gezogen, dass er Leo bei der Suche nach dem Schiff »helfen« wollte. Leo vermutete jedoch, dass sich der alte Knabe in Wirklichkeit bloß im Ruhestand langweilte und an einem letzten Abenteuer teilhaben wollte. »Dann«, fügte er hinzu, »werden sie genug Kohle haben, um sich jedes Haus oder jede Insel zu kaufen, die sie wollen. Hab ich recht oder hab ich recht?«
»Hu-hia!«, johlten Doc und Romeo unisono und erhoben prostend die Biere.
Leo stimmte nicht mit ein. An sich war er zwar kein abergläubischer Mensch, doch die verschollene Galeone brachte selbst bei ihm die Scheu vor schwarzen Katzen von links, zerbrochenen Spiegeln und Freitag dem Dreizehnten hervor. Er wollte ihre Chancen, das Wrack zu finden, nicht verschreien, indem er es als Selbstverständlichkeit betrachtete. Ebenso wenig gefiel ihm der Gedanke, dass sein Onkel und er die herrliche Insel in wenigen Jahren verlieren würden – die Insel, auf der Generationen von Andersons Frühjahrsferien, Sommerurlaube, Wochenenden um den Vierten Juli und gelegentlich sogar Weihnachten verbracht hatten. Erst, als Leo mit seiner fröhlichen Bande ehemaliger Navy SEALs aufgekreuzt war, hatte zum ersten Mal jemand versucht, dauerhaft auf der Insel zu leben; sie lag dafür eigentlich zu abgeschieden.
»Und apropos Crew …«, sagte Onkel John. Crew. Leo ließ sich den Begriff durch den Kopf gehen und dachte schließlich: Okay. Schätze, das ist eine Bezeichnung, mit der ich leben kann. »Die andere Hälfte hat gerade übers Satellitentelefon angerufen.«
Denn mit zu abgelegen meinte Leo richtig abgelegen. Der nächstgelegene Mobilfunkturm befand sich fünfzig Seemeilen entfernt. Was die Frage aufwarf: Was zum vermaledeiten Kuckuck hatten sich Tracy und Sophie dabei gedacht, sich von Romeo hier raussegeln zu lassen? Sie konnten sich verflucht glücklich schätzen, dass Romeo ein anständiger Kerl und kein Axtmörder war. Wäre Leo danach zumute gewesen, er hätte den Frauen einen verdienten Vortrag darüber gehalten, wie unratsam es war, für einen vierstündigen Segeltörn an Bord eines Katamarans zu einem dunkelhäutigen Kerl mit einem viel zu präzise getrimmten Kinnbart zu springen. Doch im Augenblick gab es wichtigere Dinge zu besprechen.
»Was haben sie gesagt?«, fragte er seinen Onkel. Mit sie meinte er seine drei Freunde, die eine Woche jenseits des großen Teichs in Sevilla in Spanien verbracht hatten.
»Sie haben gesagt, dass sie mit dem Fotokopieren und Digitalisieren der Bilder von den Dokumenten aus den spanischen Archiven gestern Nachmittag fertig geworden sind. Sie haben die gesamten Daten an diesen Historiker geschickt, wie er auch heißen mag. An den, mit dem du online gesprochen hast.«
Online über die Internetverbindung, die Leo über die auf dem Haus montierte Satellitenschüssel eingerichtet hatte. Die meisten Jungs und Leo selbst hätten zwar gut auf Mobilfunksignale verzichten können. Aber wenn Mason »Monet« McCarthy sich nicht auf ihrem einzigen Laptop die Spiele seiner geliebten Red Sox ankucken konnte oder Ray »Wolf« Roanhorse nicht mit seinen unzähligen Verwandten in Oklahoma skypen konnte, drohten schwerwiegende mentale und emotionale Konsequenzen. Diese Satellitenanlage stellte einen weiteren Grund dar, warum auf Leos Sparbuch – und den Sparbüchern der anderen – kaum noch etwas übrig war.
Gott, wir brauchen einen Bergungsauftrag. Einen großen. Denn ihre Mittel reichten gerade noch, um die Suche nach der SantaCristina für weitere zwei, vielleicht drei Wochen zu finanzieren. Und das würde nicht reichen.
Natürlich mussten sie ihr frischgebackenes Unternehmen erst mal offiziell gründen, bevor sie beginnen konnten, für ihre Dienste zu werben. Das bedeutete Papierkram. Konten mussten eröffnet werden, und sie mussten sich einen Namen für ihre Firma einfallen lassen. Leo war nicht glücklich mit Romeos Vorschlag, sie sollten sich Bergung & mehr im Meer nennen. Klar, Wortspiele bereiteten ihm so viel Vergnügen wie jedem anderen auch – aber das war nun wirklich mies.
Leo verdrängte seine Geldsorgen und die lange Liste der Dinge, die er noch abhaken musste, und konzentrierte sich wieder auf das aktuelle Thema: den Historiker, mit dem er in Verbindung stand.
»Wie ich dir schon zwanzigmal gesagt habe, heißt der Mann Alex Merriweather«, rügte er seinen Onkel. Er verkniff sich darauf hinzuweisen, dass John kein Problem hatte, sich die Namen von Sophie und Tracy zu merken, zweier Frauen, die er eben erst kennengelernt hatte, deralteLustmolch. »Und er hat mir versichert, wenn sich aus diesen Dokumenten neue Erkenntnisse gewinnen lassen, dann ist er der Mann, der sie finden kann.«
Schatzsucher sterben alt undpleite. Leo wollte unter keinen Umständen, dass sich das alte Sprichwort für die Jungs und ihn bewahrheitete. Daher hatte er vor, jede Möglichkeit auszuschöpfen, auf die er zugreifen konnte. Auch die, einen Historiker zu engagieren, der einen Wucherpreis dafür verlangte, all die alten Dokumente zu durchforsten, die sich auf den Hurrikan im Jahr 1624 und das Schicksal der spanischen Flotte bezogen.
»Hrmpf.« Sein Onkel verzog das Gesicht. »Ich bezweifle ja, dass dir irgendein Bibliothekar mehr erzählen kann als …«
»Was haben sie sonst noch gesagt?«, fiel ihm Leo ins Wort, weil er keine Lust hatte, sich auf diese Diskussion einzulassen. Schon wieder. »Hat ihnen Alex nach dem Empfang der digitalisierten Kopien irgendeinen Hinweis darauf gegeben, ob …«
»Immer mit der Ruhe, Leo, mein Junge.« Onkel John hob die Hand, mit der er nicht das Cocktailglas hielt. »Lass die Gedanken nicht rumwirbeln wie ’ne Mücke in ’nem Tornado. Erstens haben sie mir überhaupt keine Einzelheiten genannt. Und zweitens glaub ich nicht, dass sie irgendwelche Einzelheiten haben. Die armen Teufel haben den ganzen Tag auf einem Flug über den Atlantik festgesessen. Sind erst vor Kurzem in Key West gelandet. Sie werden dort übernachten und gleich morgen früh herkommen. Bis dahin wirst du dir deine Fragen wohl oder übel verkneifen müssen.«
Leo lehnte sich auf dem Stuhl zurück. Die Verzögerung frustrierte ihn, doch er tröstete sich mit einem weiteren herzhaften Schluck Bier.
»Ich muss mal für kleine Mädchen«, kündigte Tracy plötzlich an. »Kommst du« – hicks – »mit, Sophie?«
Nach einem schnellen Blick zu Doc stemmte sich Sophie von ihrem Liegestuhl hoch. »Sicher«, sagte sie und zupfte flüchtig hinten an ihren mega-knappen Jeansshorts. Es half nicht das Geringste, um die Wölbung ihrer Pobacken zu bedecken, die unter dem ausgefransten Stoff hervorlugten.
»Ich zeig euch den Weg.« Romeo sprang von seinem Stuhl auf. Der Mann erkannte eine Gelegenheit, wenn er eine sah. »Kommst du auch mit, vato?«, fragte er Doc und zog dabei eine schwarze Braue bedeutungsvoll hoch.
»Komme gleich nach«, antwortete Doc. Zu dritt blieben sie um das Feuer sitzen und beobachteten mit zur Seite geneigten Köpfen, wie Romeo die Frauen über den Sand zum Haus begleitete. Na und? Immerhin waren sie alle gesunde, heißblütige, heterosexuelle Männer, also ließ man sich den Anblick langer, sonnengebräunter Beine und süßer, herzförmiger Hinterteile doch nicht entgehen.
»He, LT«, sagte Doc und nahm den Zahnstocher aus dem Mund. »Falls du’s dir wegen Sophie anders überlegt hast, begeh ich gern Harakiri.«
»Du tust was?« Leo löste den Blick von den Frauen.
»Du weißt schon.« Doc schmunzelte. »Ich lass mich auf mein Schwert fallen, damit sie auf, äh, deines fallen kann.«
Vielleicht wurde Leo ja wirklich alt. Oder vielleicht hatte er auch bloß andere Dinge im Kopf – nichtOlivia, nicht Olivia … na schön, wahrscheinlich doch Olivia. Jedenfalls konnte er sich nicht dazu durchringen, Begeisterung bei der Aussicht auf einen weiteren bedeutungslosen One-Night-Stand zu empfinden. »Danke für das Angebot, auch wenn es gerade ziemlich abstoßend geklungen hat.« Er verzog das Gesicht. »Aber glaub mir, du kannst sie ganz für dich haben, falls du sie in die Kiste bekommst.«
»Da mach dir mal keine Sorgen.« Doc zwinkerte, stemmte sich von seinem Sitz hoch, warf den Zahnstocher ins Feuer und trat den Weg zu dem weitläufigen alten Haus an. »Ich hol sie mir schon.«
Ja, das wird er wohl, dachte Leo. Immerhin hatte mal eine Frau zu ihm gesagt, dass Doc irgendeinem großen französischen Schauspieler wie aus dem Gesicht geschnitten wäre. Und wenngleich Leo keinen Schimmer hatte, wen sie meinte, hatte er aufgrund ihres verträumten Gesichtsausdrucks vermutet, dass es als Kompliment gedacht war. »Onkel John und ich hängen hier noch eine Weile ab. Dann könnt ihr euch genug Zeit nehmen.«
»Wenn das so ist, müsst ihr vielleicht die ganze Nacht hier verbringen«, prahlte Doc. »Denn wenn ich mir Zeit nehme, dann richtig …«
»Schon gut, schon gut.« Leo winkte ihm zum Abschied. »Verzieh dich, ja? Hab genug davon, mir deine selbstgefällige Visage anzusehen.« Und wie zu erwarten, wurde Docs Gesichtsausdruck noch … nun ja … noch selbstgefälliger. Leo grinste, denn er wusste haargenau, was er sagen musste, um dagegen etwas zu unternehmen. »Außerdem: Wenn du noch lange rumtrödelst, gibst du Romeo womöglich genug Zeit, die liebe, süße Sophie zu überzeugen, dass ein flotter Dreier eine Menge Spaß bereiten könnte.«
Docs Grinsen schmolz dahin wie ein Eiswürfel in der Sahara, und er verwünschte Romeo mit einem wüsten, gemurmelten Fluch. Doch zu Leos Überraschung rannte Doc nicht hastig zum Haus hinüber. Stattdessen legte er den Kopf schief und sah Leo über den Schein des Feuers hinweg suchend ins Gesicht.
»Und?«, fragte Leo. »Worauf wartest du noch?«
»Also, äh …« Doc hob die Hand und kratzte sich am Kopf.
»Was ist denn los, Bro?« Und ja. Die fünf Kerle, die mit an Bord seines Unterfangens gekommen waren, stellten für ihn mehr als seine Männer, seine Freunde oder seine Crew dar – sie waren seine Brüder. In jeder Hinsicht, die zählte.
»Weißt du, äh, so, wie ich das, äh, sehe«, begann Doc stockend, »gehört zu unserem Gelübde, dass wir nicht mehr um den heißen Brei herumreden, wenn’s um die Dinge geht, die wir wirklich wollen.« Leo beobachtete, wie Doc abwesend über die Tätowierung an der Innenseite seines linken Unterarms rieb. »Und es ist seit dem ersten Tag offensichtlich gewesen, dass du Olivia Mortier willst.«
Verdammt. Allein, ihren Namen laut ausgesprochen zu hören, sträubte Leo die Nackenhaare.
»Also warum schickst du ihr keine E-Mail, hm? Find raus, ob sie von der Firma nicht ein wenig Urlaub kriegt, um für einen kleinen Besuch herzukommen.« Und schon hatte Doc das selbstgefällige Grinsen wieder im Gesicht. »Wenn sie dir ein-, zweimal das Rohr durchgepustet, den Ständer poliert hat, hörst du vielleicht auf, dich nach ihr zu sehnen wie ein liebeskranker Teenager.«
Verfluchte Sch… Manchmal nervte es, so eng mit einer Gruppe von Männern zusammenzuleben, die in der hehren Kunst der Beobachtung ausgebildet und erprobt waren. »Das Rohr durchgepustet? Den Ständer poliert? Wie alt bist du? Dreizehn?«
»Weichst du gerade der Frage aus?«
Erwischt. »Fürs Protokoll«, sagte Leo mit knurrendem Unterton. »Ich will nicht, dass sie meinen Ständer poliert, wie du es so eloquent ausgedrückt hast.« Eine Stimme in seinem Kopf warnte ihn, dass seine Nase jeden Moment auf Pinocchio-Länge ausfahren könnte.
Na schön. Wenn er ganz ehrlich sein wollte, hätte er sehr wohl gern herausgefunden, wohin die Sache mit Olivia führen könnte. Er hätte gern erkundet, ob all die nicht sehr subtilen, flirtenden Blick und jener eine, so aufregende Kuss zu mehr hätten werden können – Ständerpolitur inklusive. Leider hatte das Schicksal in Form der Mutter aller Malheure dazwischengefunkt. Dadurch hatte sich sein Ausscheiden aus der Navy beschleunigt, und jede Chance, dass er je wieder mit der unheimlich verführerischen Olivia Mortier zusammenarbeiten würde, waren dahin.
Mittlerweile war er nur noch Zivilist. Und Zivilisten und CIA-Agenten im Außendienst gerieten selten in eine Lage, die sie zusammenführte. Selbst wenn er sie überreden könnte, eine Auszeit von Raketen und Chaos zu nehmen, bestand keine echte Chance auf eine gemeinsame Zukunft für sie beide. Schließlich drehte sich bei der Frau alles um einen Adrenalinrausch nach dem anderen, während er … nun ja … im Ruhestand war.
2
03:21 Uhr …
»Wir müssen Leo Anderson aus dem Ruhestand zurückholen«, sagte Olivia Mortier am Telefon zu ihrem Vorgesetzten, während sie hastig T-Shirts und Shorts in eine Reisetasche warf und sich innerlich verfluchte, weil sie nicht schon längst zum Aufbruch bereit war. Andererseits sollte ihre Rolle bei dieser Mission inzwischen abgeschlossen sein. Sie sollte eine Nacht frei haben, weil Morales fortan die Dinge in die Hand nehmen sollte.
Aber außer dem Tod und Steuern ist uns auf dieser Welt nichts sicher. Na schön, ja. Das stimmte.
Das Blut raste durch ihre Adern, bis es pochend in ihren Ohren pulsierte, und ihr Adrenalinpegel schwappte über die rote Linie. Beides schrieb sie dem offiziellen und endgültigen, spektakulären Versagen des Plans zum Aufspüren des Maulwurfs – oder der Maulwürfe – bei der CIA zu. Nicht dem Umstand, dass sie vielleicht eine weitere Chance erhalten würde, mit Leo zusammenzuarbeiten.
Dem großen, der Welt überdrüssigen Leo »Löwe« Anderson.
Eine Erinnerung an das letzte Mal, als sie ihn gesehen hatte, fegte wie ein Wirbelwind durch ihr Hirn und ließ sie vergessen, wo sie beim Packen gerade war. Damals war er hinten in einen CH-47D Chinook Helikopter für Schwerlasten gestiegen. Als seine staubigen Kampfstiefel die Rampe berührten, hatte er sich noch einmal umgedreht, zu ihr zurückgeschaut, ihre Hand ergriffen und sie gedrückt.
Verdammt, was war ihr der Moment kristallklar im Gedächtnis geblieben …
Die Abluft von den Rotoren peitschte ihm das sandblonde Haar um den Kopf, der zottige Bart, der sein comicheldenartiges Kinn bedeckte, war von Blut und Staub verkrustet. Sie wollte ihm so viel sagen, zu viel, denn … na ja, in den drei Monaten ihrer gemeinsamen Stationierung hatte sie nicht nur gelernt, ihn zu mögen und zu respektieren, sie hatte Gefühle für ihn entwickelt, die sie noch nie zuvor für jemanden empfunden hatte.
Natürlich hatte sie ihre Pflicht getan und den Mund gehalten, obwohl sie wusste, dass sein falkenartiger Blick sie hinter den verspiegelten Gläsern seiner Sonnenbrille erwartungsvoll beobachtete. Und sein Gesichtsausdruck in jenem Moment? Selbst jetzt, so viele Monate später, wurde ihr von der Erinnerung noch speiübel. Es war der Blick eines Soldaten gewesen, der mit verkürzten Rationen kilometerlange Märsche hinter sich gebracht hatte. Der Blick eines Anführers, der mit ansehen musste, wie einer seiner loyalsten Männer in einen Leichensack verfrachtet wurde.
Leo wusste es nicht – und ein Teil von Olivia, ein feiger Teil, hoffte, er würde es nie herausfinden –, aber der Leichensack war ihre Schuld gewesen …
Jedes Mal, wenn sie an jene katastrophale Mission zurückdachte, schwappte eine Welle erbarmungsloser Schuldgefühle über ihr zusammen, so heftig, dass sie davon fast auf die Knie gezwungen wurde.
Direktor Morales meldete sich zu Wort. »Warum Anderson?«, wollte er wissen, und es gelang Olivia – mit Müh und Not –, sich auf die Frage und das anstehende Problem zu konzentrieren, indem sie das lähmende Bedauern in den hintersten Winkel ihres Gehirns verdrängte.
Abschottung. Eine praktische Fähigkeit. Eine, die jeder CIA-Agent im Außendienst zu meistern lernte, um nicht eines Tages eine Kugel aus der eigenen Dienstwaffe zu schlucken. Und in Anbetracht ihres Hintergrunds war Olivia besser als die meisten darin, Dinge in sicheren, getrennten emotionalen Nischen wegzusperren.
Was hatte sie noch mal gerade gemacht? Achja. Sie schnippte mit den Fingern. Unterwäsche.
Mit dem Handy zwischen Schulter und Ohr wandte sie sich der Kommode zu und sagte zu ihrem Boss: »Weil er der beste Tiefseetaucher auf dem Planeten ist. Und da die Druckanzeigen am Peilsender besagen, dass sich das Paket fast sechzig Meter unter der Meeresoberfläche befindet, können wir kein Risiko eingehen und brauchen den Besten. Außerdem«, versüßte sie ihm den Plan, »ist Leo bereits mit seinem eigenen Bergungsboot in Florida.« Na schön, sie hatte ihn im Auge behalten – und wenn schon.
»Meinen Berechnungen nach kann er das Paket in vier Stunden erreichen, sobald er Anker hievt. Also vermutlich schneller, als wir andere Taucher und die nötige Ausrüstung auftreiben könnten, die sie bräuchten, um runterzugehen und die Bergung durchzuführen. Und falls Sie das alles nicht überzeugt, wie wär’s hiermit? Wenn wir Leo einsetzen, können wir weiterhin Funkstille in den Rängen der Regierung halten. Und dadurch könnten wir aus dem Schlamassel rauskommen, ohne den oder die Verräter merken zu lassen, dass wir ihnen auf der Spur sind. Es könnte uns die Chance verschaffen, eine weitere Falle zu stellen.«
Olivia vermutete, der letzte Teil könnte genau der richtige Anstoß für ihren Vorgesetzten sein, um ihr grünes Licht zu geben. Und wie auf ein Stichwort …
»Wie kommen Sie darauf, dass Anderson überhaupt zustimmen würde?«, fragte Morales.
»Sie meinen, abgesehen davon, dass er Patriot ist und es seiner Natur widersprechen würde, eine Bitte um Hilfe von seinem Land abzulehnen?«
»Ja.« Morales klang skeptisch. »Abgesehen davon.«
»Er braucht Geld.« Na gut, dann hatte sie ihn eben wirklich, wirklich genau im Auge behalten. Das entsprach ihrer Natur. Immerhin war sie Spionin.
Red’s dir nur weiterein, wenn’s dir dann besser geht …
Herrgott noch mal … Fein. Die Wahrheit sah so aus, dass sie ihn und das, was sich auf jener verdorrten Hochebene ereignet hatte, anscheinend nicht vergessen konnte. Und auch, wenn es ihr bis jetzt noch nicht bewusst gewesen war: Sie hatte nach einer Möglichkeit gesucht, ihm zu helfen. Nicht nach einer Möglichkeit, es wiedergutzumachen – was geschehen war, ließ sich nicht wiedergutmachen. Aber vielleicht gab es eine Möglichkeit, die Waage dem Gleichgewicht zumindest ein bisschen anzunähern. Um ein wenig symbolisches Kleingeld auf ihr Karma-Konto zu bekommen. Und ein wenig echtes Geld auf Leos reales Konto.
Dagegen gibt’s nichts einzuwenden, oder? Eine Win-win-Situation!
»Geld wofür?«, fragte Morales.
»Um für Ausrüstung, Treibstoff und all den anderen teuren Kram zu bezahlen, den man wohl braucht, um nach einem vor vierhundert Jahren gesunkenen Schiff zu suchen.«
Schweigen am anderen Ende der Leitung, und Olivia hielt den Atem an. Dann endlich: »Was glauben Sie, wie viel nötig ist, um ihn zu überzeugen?«
Hip-hip-hurra! Und da die CIA regelmäßig Koffer voll Bargeld an Warlords, Rebellen und Söldner verteilte, zögerte Olivia nicht im Geringsten, ihrem Vorgesetzten mitzuteilen: »Eine halbe Million Dollar würde wahrscheinlich genügen. Damit würden er und seine Leute rund ein Jahr in den schwarzen Zahlen bleiben.«
Ohne zu zaudern, antwortete Morales ungerührt: »In Ordnung. Ich sorge dafür, dass Sie das Bargeld erhalten … Wo?«
Olivia streckte eine imaginäre Siegesfaust in die Luft. »Reagan National Airport. Sobald wir beide das Gespräch beenden, lasse ich einen meiner lokalen Kontakte einen Privatjet auftreiben, der mich auf dem Rollfeld dort erwartet.«
»Sie und Ihre Kontakte.« Olivia konnte beinah hören, wie Morales den Kopf schüttelte. Er zog sie gern mit der Behauptung auf, dass sie Informanten, Spitzel und Quellen sammelte wie ein Eichhörnchen Nüsse.
»Sie kennen mich doch, Sir. Ich habe am liebsten den Spatz in der Hand und die Taube auf dem Dach.«
Morales schnaubte. »Ich treffe Sie dort und bringe ein zusätzliches Signalortungsgerät sowie ein sicheres Satellitentelefon mit.«
»Klingt nach einem Plan«, meinte Olivia und las die Uhrzeit von ihrem leuchtenden Digitalwecker ab. »Ich schätze, mit der Fahrzeit zum Flughafen und der Flugzeit nach Key West sollte ich gegen Tagesanbruch im sonnigen Florida ankommen. Wenn Sie für ein Wasserflugzeug sorgen könnten, das mich zur Familieninsel von Lieutenant Anderson bringt, dann …«
»Wird gemacht«, fiel ihr Morales ins Wort. Der Mann verlor selten ein Wort mehr als nötig. Olivia war gerade dabei, saubere BHs und Slips in die Reisetasche zu stopfen, als er hinzufügte: »Aber ich gebe Ihnen nur vierundzwanzig Stunden. Danach ist mir egal, ob wir diese Operation aufdecken müssen.« Wodurch er wahrscheinlich ihren Ruf und ihre Karrieren im Klo runterspülen würde. »Dann hole ich die großen Nummern bei der Firma dazu und tue, was immer nötig ist, um diese Chemikalien zurückzubekommen.«
»Verstanden«, erwiderte Olivia und warf ihren Kulturbeutel in die schwarze Reisetasche.
»Und, Agent Mortier?«
»Ja?«
»Seien Sie vorsichtig. Wir wissen nicht, was da draußen passiert ist. Es ist durchaus möglich, dass Sie sich vom Feind umzingelt wiederfinden könnten. Da ich die Satelliten nicht einsetzen kann, um Sie im Auge zu behalten, werden Sie im Blindflug unterwegs sein.«
»Verstanden, Sir.« Ein Schauder lief Olivia beim Gedanken über den Rücken, mitten auf dem endlosen blauen Meer zu treiben, umzingelt von Mitgliedern dieser Splittergruppe der Al-Kaida. »Aber keine Sorge. Sie können sich auf mich verlassen.« Und auf LeoAnderson. Denn wenn es darum ging, sich auf See eine Horde feindlicher Kämpfer vom Leib zu halten, könnte sie es wesentlich schlechter als mit dem großen SEAL treffen, der den Spitznamen der »Löwe« trug. Aber wahrscheinlich nicht viel besser.
»Ich weiß«, gab Morales zurück. »Die Frage ist: Wollen Sie, dass ich das Z-Team in Key West zu Ihnen stoßen lasse?«
Olivia malte sich aus, wie sie mit einer Gruppe von Söldnern vor Leos Schwelle auftauchte, und verzog skeptisch das Gesicht. »Ich denke, in Anbetracht der involvierten Personen wäre es besser, wenn ich allein bin. Allerdings hätte ich nichts dagegen, wenn das Zugriffsteam draußen beim Paket zu uns stößt.«
»In Ordnung«, willigte Morales ein. »Wir sehen uns am Flughafen.« Wie üblich beendete ihr Vorgesetzter das Gespräch ohne Verabschiedung.
Olivia gab die Nummer ihres Kontakts am Reagan National Airport ein und traf rasch die nötigen Vorkehrungen für den Privatjet. Dann öffnete sie die oberste Schublade des Nachttischs und holte ihre treue Sig P228 heraus. Als sie zur CIA gegangen war, hatte sie sich mit der unerfreulichen Tatsache abgefunden, dass sie irgendwann in ihrer Laufbahn vermutlich gezwungen sein würde, die Handfeuerwaffe für mehr als simplen Nachdruck einzusetzen. Aber als sich jahrelang kein Anlass für Gewalt präsentiert hatte, war sie dem Glauben verfallen, das Schicksal meine es vielleicht gut mit ihr und wolle sie davor bewahren, dass der Verlust eines Lebens auf ihrem Gewissen lastete.
Allerdings war das Schicksal für seine Launenhaftigkeit berüchtigt. Dementsprechend hatte Olivias gesamtes Glück auf unvorstellbare Weise eines Tages im Wüstenhochland geendet. Damals war irgendwie – mittlerweile vermutete sie, dass der geheimnisvolle CIA-Maulwurf die Hand dabei im Spiel gehabt hatte – ihre Tarnung aufgeflogen, und sie war gezwungen gewesen, einem Mann das Leben zu nehmen. Es war grauenhaft gewesen. Schlimmer, als es sich Olivia vorgestellt hatte. Insbesondere, weil die Konsequenzen jenes Todes einem beherzten amerikanischen Soldaten das Leben gekostet hatten.
Nicht zum ersten Mal seit jener katastrophalen Mission stellte sie infrage, ob sie überhaupt weiterhin für die CIA arbeiten wollte. Mit dem Stress konnte sie umgehen. Die Gefahr und die Intrigen? Kinderspiel. Aber das Morden und der Tod … Das war ein völlig anderes Paar Schuhe.
»Verdammt noch mal«, fluchte sie und schüttelte sich. »Reiß dich zusammen, Mortier.« Sie stählte sich, straffte die Schultern und warf einen raschen Blick durch ihre winzige Wohnung in Washington, D. C.
Den meisten Platz nahm ein Doppelbett mit einer tristen grauen Tagesdecke ein. Daneben standen zwei charakterlose Nachttische, die sie vor fünf Jahren bei IKEA gekauft hatte. Kein einziges Kunstwerk zierte die Ziegelsteinwände. Kein einziges Foto stand in einem Regal. Abgerundet wurde diese Antithese zu SchönerWohnen von einem faden Schreibtisch samt dazu passendem Stuhl. Beides benutzte sie bei den seltenen Gelegenheiten, wenn sie zu Hause war und am Laptop arbeiten musste.
Als sie sich der Küche zudrehte, fiel das gelbliche Licht der Deckenbeleuchtung auf die Efeupflanze, die sie aus einem Impuls heraus vor einem Monat gekauft hatte – oder waren es inzwischen schon zwei Monate? Jedenfalls war sie in ihrem Topf auf dem Fenstersims verschrumpelt und abgestorben. Die einst glänzenden Blätter waren braun und spröde. Sie schienen Olivia im Tod zu verhöhnen. Anscheinend konnte sie nicht mal ein an sich widerstandsfähiges kleines Rankengewächs am Leben erhalten. Und das fand sie einfach nur … ja, was eigentlich? Traurig vielleicht? Erbärmlich? Ehertypisch.
»Viel lässt du ja nicht zurück, was, altes Mädchen?« Die Worte schienen durch die beengte Wohnung zu rasen, von den Wänden zurückzuprallen und ihr ins Gesicht zu klatschen.
Noch vor nicht allzu langer Zeit hätte sie über die melancholische Richtung gelacht, die ihre Gedanken einschlugen. Schließlich wollte sie seit ihrem vierzehnten Lebensjahr, als sie unter der großen Eiche im Garten des Waisenhauses Romane von Tom Clancy gelesen hatte, immer nur Spionin werden. Unnahbar. Unabhängig. Emotionslos.
Doch in den vergangenen Monaten hatte sich irgendetwas verändert. Irgendetwas … fehlte.
Ein Ort, den sie wirklich als Zuhause betrachtete? Menschen, an denen ihr etwas lag? Menschen, denen etwas an ihr lag?
Pah, von wegen. Das hatte sie nie gehabt. Nie gebraucht. Nie gewollt.
Aber vielleicht hatte es etwas damit zu tun, dass sie unlängst den Meilenstein ihres dreißigsten Geburtstags erreicht hatte. Oder vielleicht lag es am sadistischen Ticken ihrer biologischen Uhr. Jedenfalls klangen die Worte mittlerweile hohl, auch wenn Olivia nach wie vor versuchte, sie sich einzureden.
Na gut, wenn sie ganz ehrlich sein wollte, dann hatte sich seit Syrien etwas verändert, seit der Begegnung mit Leo, seit jenem Kuss …
Oh mein Gott! Dieser Kuss!
Selbst jetzt noch bekam sie jedes Mal, wenn sie daran zurückdachte, ganz weiche Knie. Östrogenig und feminin. Was überhaupt nicht zu einer toughen CIA-Agentin passte. Olivia war alles andere als stolz darauf, doch so war es nun mal.
»Sch…eibenkleister, Mortier. Was bist du für ein jämmerliches Weichei? Du kannst doch nicht zulassen, dass eine harmlose Knutscherei …« Moment, was? Harmlos? Jener Kuss war nicht mal annähernd harmlos gewesen. Im Guinness Buch der Rekorde würde man ihn wahrscheinlich unter dem Eintrag »Innigste und heißeste Lippenverschmelzung des Jahrhunderts« finden. Und er hatte sich über einen langen Zeitraum angebahnt. Über drei Monate, um genau zu sein. Seit sie sich zum ersten Mal in die Augen geblickt hatten. Und als Olivia schon gedacht hatte, der Mann würde nie den ersten Schritt wagen – hatte er es doch getan.
Sie hatten ausgerechnet vor einem Waffenschrank gestanden und ihre Ausrüstung überprüft, als er sich ihr unverhofft zudrehte. Eine warme, schwielige Hand legte sich unter ihr Kinn, sein Kopf senkte sich. In der Sekunde, bevor sein Mund auf ihren traf, flüsterte sein heißer Atem über ihre Lippen. Und als sich seine Zunge langsam, sinnlich in ihren Mund schob? Tja, da war die Leidenschaft in ihr explodiert wie eine Handgranate, und die Knie waren unter ihr eingeknickt. Tatsächlich eingeknickt. Olivia hatte immer gedacht, das passierte nur in rührseligen Romantikkomödien und kitschigen Liebesromanen. Doch an jenem Nachmittag hatte sie am eigenen Leib erfahren, dass die Fiktion der Realität einen Spiegel vorhielt.
Tja, juhu! Wie schön für dich! Nicht wirklich.
Sie straffte die Schultern und versuchte es erneut. »Du kannst doch nicht zulassen, dass ein einziger Kuss deinen gesamten Lebensplan über den Haufen wirft.«
So. Erledigt. Sie hatte es ausgesprochen. Und es klang nach einem vernünftigen Rat. Leider wusste Olivia, dass es ihr verflucht schwerfallen würde, ihn zu beherzigen. Denn es trennten sie nur wenige Stunden davon, Lieutenant Leo »Löwe« Anderson wiederzusehen …
* * *
07:34 Uhr …
Alles in Leos Schädel – die grauen Zellen, Blut, Zerebrospinalflüssigkeit – war zu einem gewaltigen, pochenden, schmerzenden Kater verschmolzen. Regungslos lag er in der zwischen zwei Palmen gespannten Hängematte. Das schrille Kiii-keee-riii-kiii des Hahns, der sich bei einer der zahlreichen Besorgungsfahrten als blinder Passagier an Bord des Katamarans von Key West nach Wayfarer Island geschlichen hatte, und Klops’ schlabbernde Zunge, die Leos über den Rand der Hängematte baumelnde Hand in ekligem Hundesabber badete, ließen ihn ernsthaft überlegen, ob er nicht sich selbst und der Welt einen Gefallen täte, wenn er sich eine Ladung Steine um die Hüfte bände und einen Ausflug ins Meer unternähme.
Warum? Warum nur hatte er gedacht, es wäre eine gute Idee, sich mit seinem Onkel das letzte Bier hinter die Binde zu gießen, nachdem sich Doc, Romeo und die Ladys für die Nacht verabschiedet hatten? Er war doch ein vernünftiger, rational denkender, erwachsener Mann. Also noch mal: Warum hatte er sich das angetan?
Ach ja. Richtig. Ohne die derben Unterhaltungen seiner Freunde – und wahrscheinlich dank Docs Äußerung über Ständerpolitur – hatte sich sein Verstand wie ein Pfeil aus einer Harpune geradewegs auf Olivia und jene ätzende Mission gestürzt. Um die Erinnerungen abzustumpfen – eine immer noch so schmerzlich, dass er kaum atmen konnte, die andere so verflucht heiß, dass sie ihn erregter als eine vierzigjährige Jungfrau werden ließ –, hatte er sich für Türchen Nummer zwei entschieden, als ihn sein Onkel gefragt hatte: »Also: Willst du drüber reden oder willst du darauf trinken?«
SchlechteIdee. Ganz, ganz schlechteIdee.
Ein dumpfes Klacken verriet ihm, dass sein Onkel die Wiedergabetaste des knallgelben Ghettoblasters aus den frühen 1980ern gedrückt hatte. Das Gerät stand auf einem kleinen schmiedeeisernen Tisch auf der vorderen Veranda. Das Ding verschlang halbdutzendweise D-Batterien, und sie hatten genau drei Kassetten dafür: Bob Marley, Harry Belafonte und Jimmy Buffett. Nur die drei, weil sein Onkel einen geradezu peinlich begrenzten Musikgeschmack besaß und der Rest der Jungs keinen Schimmer hatte, wie man die Songauswahl ergänzen könnte, weil nun mal nur … Kassetten abgespielt werden konnten. Und damit war dazu alles gesagt.
Leo blieb ein kurzer Atemzug, um sich zu fragen, mit welchem Song sein Onkel den Tag beginnen wollte. Dann forderte ihn – ach Gott, hätte ich mir ja denken können – Bob Marley mit seinem jamaikanischen Akzent dazu auf, doch mit der aufgehenden Sonne zu lächeln!
»Scheiße …« Leo stöhnte, als er vorsichtig die Hand hob, die Klops noch nicht mit seiner großen nassen Zunge vollgeschlabbert hatte. Er presste sie an seine Stirn, als er sich langsam und behutsam in sitzende Haltung stemmte. Dabei achtete er darauf, die Augen vor den gnadenlosen Strahlen der aufgehenden Sonne, die bereits heiß und herrisch am östlichen Horizont hing, verschlossen zu halten.
Linkisch kletterte er aus der Hängematte, richtete sich auf und konzentrierte sich auf tiefe, beruhigende Atemzüge. Das durchdringende Aroma von Onkel Johns bevorzugtem Kaffee kroch ihm in die Nase. »Scheiße«, murmelte er abermals, als er langsam ein Augenlid aufzwängte.
Wuff! Klops bellte fröhlich und leckte sich über den lächerlich ausgeprägten Unterbiss, während sich sein schrumpeliges Hinterteil an der Schwanzwedelversion einer englischen Bulldogge versuchte.
»Ich hätte dich mit Mason nach Spanien schicken sollen, du flohverseuchter Kläffer«, brummte Leo, als er zaghaft den warmen Becher Kaffee entgegennahm, den ihm sein Onkel hinhielt. »Danke, Onkel John«, brachte Leo hervor. Denn obwohl ihm der Geruch den Magen umdrehte, wusste er: Wenn es ihm gelänge, die säuerliche Brühe hinunterzubekommen, würde sie die Auswirkungen des Katzenjammers lindern, den er sich dummerweise vergangene Nacht eingehandelt hatte.
»Jau«, gab sein Onkel einsilbig zurück und lehnte sich an den Stamm einer Palme. Er summte leise vor sich hin und tappte mit dem Fuß den Rhythmus von Bobs Song.
Als Leo zu ihm schaute, stellte er mürrisch fest, dass der alte Seebär keinerlei Verschleißerscheinungen durch den übermäßigen Alkoholgenuss der letzten Nacht erkennen ließ. »Allein vom Anblick dieses Hemds krieg ich Kopfschmerzen«, brummelte er.
»Jungchen, schieb mir nicht die Schuld an deinem Brummschädel in die Schuhe.« Onkel John rückte den Kragen seines Hemds zurecht und strich es über der Brust glatt. »Davon abgesehen, kannst du dir nur wünschen, du würdest so gut aussehen.«
Unwillkürlich grinste Leo. Jedenfalls bis – Wuff! – Klops erneut bellte. Da kam ihm der Gedanke, dass es vielleicht besser wäre, Klops abzuservieren, statt sich selbst ins Meer zu werfen.
Wuff!
Kikerikiiii!