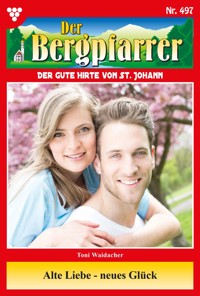Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Bergpfarrer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Mit dem Bergpfarrer hat der bekannte Heimatromanautor Toni Waidacher einen wahrhaft unverwechselbaren Charakter geschaffen. Die Romanserie läuft seit über 13 Jahren, hat sich in ihren Themen stets weiterentwickelt und ist interessant für Jung und Alt! Toni Waidacher versteht es meisterhaft, die Welt um seinen Bergpfarrer herum lebendig, eben lebenswirklich zu gestalten. Er vermittelt heimatliche Gefühle, Sinn, Orientierung, Bodenständigkeit. Zugleich ist er ein Genie der Vielseitigkeit, wovon seine bereits weit über 400 Romane zeugen. Diese Serie enthält alles, was die Leserinnen und Leser von Heimatromanen interessiert. Mit einer wütenden Bewegung führte Robert Demant den Pinsel über das Bild. Es gab ein knirschendes Gräusch, als der Druck seiner Hand die Leinwand zerriß. Noch wütender schlug er mit der Faust darauf und verschmierte die Farben, so daß das Motiv, das zuvor ein Stilleben dargestellt hatte, nun aussah, als wäre es das Experiment eines modernen Künstlers. Dabei stieß er einen gequälten Schrei aus. Der Maler ließ Pinsel und Palette fallen, und stützte seinen Arm an ein Regal, das an der Wand des Ateliers stand. Dort wurden Töpfe und Tuben mit Farben, Pinsel und Lösungsmittel aufbewahrt. Außerdem stand eine halbvolle Ginflasche darin. Robert nahm die Flasche und schaute sie nachdenklich an. Nein, ging es ihm durch den Kopf, sich zu betrinken war keine Lösung. Sein Blick schweifte durch das Atelier. Es war der größte Raum in der Wohnung, die Robert vor mehr als zehn Jahren im Münchener Stadtteil Schwabing gemietet hatte. Sie befand sich im obersten Stock des Hauses. Für den Arbeitsraum hatte der Kunstmaler ein riesiges Fenster in das Dach einbauen lassen, um genügend Licht hereinzulassen. Überall standen Bilder, Leinwände, Rahmen und Staffeleien herum. Es roch nach Farbe und Terpentin, und es war seiner Zugehfrau strengstens verboten, das Atelier, außer zum Fensterputzen, zu betreten. Robert war der einzige, der sich in diesem Chaos auskannte. Nun sah er sich um und dachte darüber nach, was mit ihm geschehen war. Robert Demant galt seit Jahren als der führende malende Künstler. Nur zu gut erinnerte er sich an die Zeit davor. Mit Aufträgen von Banken und Versicherungen, die irgendwelche Bilder für ihre »Paläste«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Bergpfarrer – 435 –
Dein Bild in meinem Herzen
Toni Waidacher
Mit einer wütenden Bewegung führte Robert Demant den Pinsel über das Bild. Es gab ein knirschendes Gräusch, als der Druck seiner Hand die Leinwand zerriß. Noch wütender schlug er mit der Faust darauf und verschmierte die Farben, so daß das Motiv, das zuvor ein Stilleben dargestellt hatte, nun aussah, als wäre es das Experiment eines modernen Künstlers. Dabei stieß er einen gequälten Schrei aus.
Der Maler ließ Pinsel und Palette fallen, und stützte seinen Arm an ein Regal, das an der Wand des Ateliers stand. Dort wurden Töpfe und Tuben mit Farben, Pinsel und Lösungsmittel aufbewahrt. Außerdem stand eine halbvolle Ginflasche darin. Robert nahm die Flasche und schaute sie nachdenklich an. Nein, ging es ihm durch den Kopf, sich zu betrinken war keine Lösung.
Sein Blick schweifte durch das Atelier. Es war der größte Raum in der Wohnung, die Robert vor mehr als zehn Jahren im Münchener Stadtteil Schwabing gemietet hatte. Sie befand sich im obersten Stock des Hauses. Für den Arbeitsraum hatte der Kunstmaler ein riesiges Fenster in das Dach einbauen lassen, um genügend Licht hereinzulassen. Überall standen Bilder, Leinwände, Rahmen und Staffeleien herum. Es roch nach Farbe und Terpentin, und es war seiner Zugehfrau strengstens verboten, das Atelier, außer zum Fensterputzen, zu betreten. Robert war der einzige, der sich in diesem Chaos auskannte.
Nun sah er sich um und dachte darüber nach, was mit ihm geschehen war.
Robert Demant galt seit Jahren als der führende malende Künstler. Nur zu gut erinnerte er sich an die Zeit davor. Mit Aufträgen von Banken und Versicherungen, die irgendwelche Bilder für ihre »Paläste« kauften, hielt er sich über Wasser. Aber, das war nicht das, was er eigentlich malen wollte. Seine Bilder sollten etwas mitteilen, eine Botschaft haben, den Menschen etwas Schönes bieten. Er entwickelte sich vom Expressionisten zum Naturalisten, bildete seine Umwelt naturgetreu in ihrer ganzen Schönheit ab. Offenbar traf er damit den Nerv der Zeit, seine Bilder verkauften sich schneller, als er malen konnte, und Robert war ein begehrter Gast auf allen möglichen Festen und Empfängen.
So ging es eine lange Zeit, doch seit Monaten schon spürte der Maler, daß »die Luft raus war«. Er mußte sich regelrecht dazu zwingen, Pinsel und Palette in die Hände zu nehmen, und mit Sorge beobachtete sein Galerist, wie der Künstler offensichtlich in eine Schaffenskrise geriet. Hinzu kam, daß eine große Ausstellung mit Werken von Robert Demant keinen besonderen Anklang fand. Das Publikum hatte sich anderen Stilrichtungen zugewandt, und die Kritiker fanden nur Worte der Häme für den Maler.
Er habe sich nicht weiter entwickelt, hieß es, seine Bilder wirkten auf den Betrachter wie das Spätwerk eines Hobbymalers, und überhaupt sei der Stil, den Robert Demant male, nicht mehr länger gefragt.
All dies führte dazu, daß der Maler sich mehr zurückzog, Einladungen ablehnte und, außer zu seinem Galeristen und der Putzfrau, jeden Kontakt vermied.
Robert wischte sich die Hände an einem alten Lappen ab, dessen ursprüngliche Farbe unter all den Farbtupfen nicht mehr zu erkennen war. Dann verließ er das Atelier und ging hinüber ins Wohnzimmer. Auch hier hingen und standen überall Bilder, Zeichnungen und Skizzen. Robert setzte sich in einen großen, alten Ohrensessel, den er vor Jahren, als er noch nicht so bekannt gewesen war, vom Sperrmüll gerettet hatte. Seither war es sein Lieblingssessel, in den sich außer ihm niemand setzen durfte. Obwohl der Maler inzwischen in der finanziellen Lage gewesen wäre, sich zehn solcher Sessel zu kaufen, mochte er sich doch nicht von dem guten, alten Stück trennen. Es erinnerte ihn immer wieder an die Zeit, als er vor der Frage stand, ob er das wenige Geld, das er hatte, für Farben oder Brot ausgeben sollte. Meistens hatte er sich für die Farben entschieden, denn Robert Demant war ein von seiner Kunst Besessener gewesen, der eher auf Essen verzichten konnte, als auf seine künstlerische Arbeit.
Mein Gott, wie lange war das schon her! Es kam ihm vor, als wäre es in einem anderen Leben gewesen.
Robert erinnerte sich an das letzte Gespräch mit Walter Murrer, dem Mann, dem er so viel zu verdanken hatte. Walters Galerie befand sich nahe dem Stachus in bester Lage. Seine Kunden kamen aus dem Adel und der Hochfinanz. Darunter waren etliche, die es als ihre Pflicht ansahen, junge Künstler als deren Mäzen zu unterstützen. Hatte Walter Murrer einmal einen Maler unter seine Fittiche genommen, so hatte dieser gute Chancen, eines Tages von seiner Kunst leben zu können. Das war auch bei Robert der Fall gewesen. Walter, der immer an ihn geglaubt hatte, vermittelte die Bekanntschaft eines reichen Geschäftsmannes, der den jungen Maler förderte. Damit begann sein Aufstieg.
»Du mußt fort aus München«, hatte Walter bei ihrem letzten Treffen gesagt. »Wann war dein letzter Urlaub? Vor beinahe drei Jahren. Also, setz’ dich in deinen Wagen und fahre irgendwohin. Spanne endlich einmal aus, tanke neue Kraft und komm mit neuen Ideen zurück!«
Warum nicht, dachte Robert. Es wäre wirklich einmal an der Zeit, alles hinter sich zu lassen. Etwas anderes zu sehen, andere Menschen kennenzulernen.
Am besten setzte er die Idee sofort in die Tat um, wenn er noch damit wartete – vielleicht überlegte er es sich dann doch wieder…
*
Sophie Tappert summte leise vor sich hin, während sie mit dem Staubsauger durch das Pfarrbüro fuhrwerkte. Wie alles, was sie tat, verrichtete Sophie auch diese Tätigkeit mit äußerster Sorgfalt. Dabei achtete sie darauf, ja nicht den Stapel Papiere durcheinander zu bringen, den Hochwürden auf seinem Schreibtisch liegen hatte. In der Küche simmerte unterdessen eine kräftige Fleischbrühe auf dem Herd. Frau Tappert warf einen Blick auf die Uhr. Gleich zwölf. Es würde nicht mehr lange dauern, und dann kam Max Trenker zum Essen. Eigentlich müßte er schon in der Tür stehen.
Der Bruder des Geistlichen, und Gendarm in St. Johann, war ein gern gesehener Gast im Pfarrhaus, der die Kochkünste der Haushälterin über alles zu schätzen wußte. Er ließ kaum eine Gelegenheit aus, an den Mahlzeiten teilzunehmen.
Nachdem auch das letzte Staubkörnchen im Sauger verschwunden war, schaltete Sophie Tappert das Gerät ab. Im gleichen Augenblick steckte Sebastian Trenker den Kopf durch die Tür.
»Ist mein Bruder noch net da?« fragte er.
Die Haushälterin hob die Schulter.
»Ich weiß auch net, wo er bleibt. Er müßt’ doch schon da sein.«
»Wie weit sind S’ denn mit dem Essen?« erkundigte Sebastian sich.
»Es ist alles soweit fertig. Bloß anrichten müßt’ ich noch.«
»Gut, dann warten wir halt noch fünf Minuten.«
Maximillian Trenker verspätete sich schließlich um eine geschlagene Viertelstunde. Als er endlich in der Pfarrküche am Tisch saß, machte er einen erschöpften Eindruck. Sophie Tappert hatte vorsorglich die Suppe auf kleiner Flamme gelassen, und füllte die Terrine neu.
»Was hat’s denn gegeben?« wollte Sebastian Trenker wissen.
Sein Bruder sah ihn an und rollte dabei mit den Augen.
»Ich komm’ g’rad vom Moosingerhof. Dem Anton haben’s in der Nacht sein nagelneues Auto gestohlen.«
»Was?« entfuhr es dem Pfarrer. »Schon wieder ein Autodiebstahl in unserer Gegend!«
»Der dritte in vierzehn Tagen, und alles Neuwagen. Der vom Moosinger war erst seit zwei Tagen zugelassen. Da steckt eine ganze Bande dahinter, die die Autos ins Ausland verschiebt. Die Kollegen von der Kripo sind sich da ziemlich sicher.«
»Vielleicht sollten S’ Ihren Wagen net immer hinterm Kirchplatz stehen lassen«, mischte sich Sophie Tappert in das Gespräch. »Eines Tages ist der auch noch verschwunden.«
Pfarrer Trenker besaß tatsächlich ein noch recht neues Auto. Nachdem er jahrelang einem uralten Käfer die Treue gehalten hatte, entschloß er sich doch, schweren Herzens, das alte gegen ein neues, schadstoffarmes Fahrzeug einzutauschen. Hier hatte der Umweltgedanke über die Liebe zu seinem Käfer gesiegt. Ohnehin benutzte Sebastian den Wagen sowieso nur, wenn es unumgänglich war. Meistens bewegte er sich auf Schusters Rappen und wanderte in seinen geliebten Bergen.
»Das glaub’ ich net«, erwiderte Max auf Sophie Tapperts ängstliche Einlassung. »Die Diebe stehlen nur Autos der Luxusklasse. Der vom Moosinger hat mehr als sechzigtausend Mark gekostet.«
»Was, soviel?«
Die Haushälterin war erschüttert. Wie konnte jemand so viel Geld für ein Auto ausgeben?
»Na ja, der hat’s ja auch«, sinnierte sie und deckte den Tisch ab.
Freilich stimmte es. Anton Moosinger war einer der reichsten Bauern in der Gegend um St. Johann. Der Hof war seit Generationen im Familienbesitz, und neben etlichen Hektar Land, gehörten zwei Almwiesen und ein riesiges Waldgebiet dazu. Drei Söhne arbeiteten mit dem Vater zusammen auf dem Hof. Außerdem eine ganze Anzahl Knechte und Mägde, die teilweise schon seit Jahrzehnten zum Moosingerhof gehörten.
»Deswegen darf man ihm aber noch lange net das Auto stehlen«, schüttelte Sebastian Trenker den Kopf. »Wem gehören denn die anderen Fahrzeuge?«
»Der eine war der Wagen vom Dr. Hendrich, dem Kunsthändler aus Garmisch, der andere gehört einem Gast vom Reisinger.«
Dr. Hendrich war ein in Garmisch Partenkirchen ansässiger Kunsthändler, der in der Nähe von St. Johann ein Ferienhaus besaß, in dem er oft und gerne ein paar Tage verbrachte, wenn die Geschäfte es zuließen. Pfarrer Trenker erinnerte sich an einige nette Abende, die er in dem Haus verbracht hatte. Genau wie er auch, so schätzte Dr. Hendrich ebenfalls ein gutes Glas Wein und ein geistvolles Gespräch.
Der Gast vom Hotel »Zum Löwen«, stammte aus dem Rheinland. Er hatte ein paar erholsame Ferienwochen in den Bergen verbringen wollen, die doch so unschön endeten. Wohl oder übel war er gezwungen, mit einem Leihwagen wieder nach Hause zu fahren.
»Natürlich sprangen sofort die Versicherungen ein«, fuhr Max fort. »Aber das entschädigt natürlich net für den ganzen Ärger, den man durch den dreisten Diebstahl hat.«
*
Robert Demant war froh, seinen Urlaub sofort angetreten zu haben. Schon als er in München in den Zug stieg, spürte er ein Gefühl der Entspannung und Erleichterung in seiner Brust.
Viele Sachen hatte er nicht mitgenommen. Lediglich eine Reisetasche befand sich in der Gepäckablage über dem Sitz und ein kleines Köfferchen, in dem Robert ein paar Malutensilien mitnahm. Vielleicht gab es das eine oder andere Motiv, das lohnte, festgehalten zu werden.
Die Fahrt verlief ohne besondere Ereignisse. Von München aus ging es in Richtung Alpen. Der Maler hatte sich auf einen bestimmten Ort festlegen können, und erst die charmante Mitarbeiterin in einem Reisebüro hatte ihm den Hinweis auf ein kleines Dorf in den Bergen gegeben. St. Johann hieß es und war touristisch noch nicht so »heimgesucht« wie andere Orte.
Robert war von der Beschreibung und von dem, was er in einem Prospekt las, angetan und zögerte nicht länger. Jetzt saß er in einem Regionalzug, der scheinbar unendlich langsam durch die kleinen Ortschaften fuhr und an jeder Milchkanne hielt.
Der Maler störte sich nicht daran. Im Gegenteil, er kostete jede Minute der Bahnfahrt aus, schaute dabei aus dem Fenster oder blätterte in den Zeitschriften, die er vor der Abfahrt gekauft hatte.
Schließlich schaute er auf die Uhr. Es war früher Nachmittag. Die übernächste Station war die letzte. Weiter fuhr der Zug nicht. Von dort aus ging ein Bus zu seinem Urlaubsziel. Robert war schon gespannt. Außerdem hatte er noch kein Quartier gebucht. Das hätte die junge Frau im Reisebüro zwar gerne für ihn übernommen, doch der Maler wollte sich erst einmal selbst in St. Johann umsehen. Ob er dann ein Zimmer in einem Hotel nahm, oder in einer kleinen Pension, hing von seiner jeweiligen Laune ab.
Der Zug hielt zum vorletzten Male, und nach kurzer Zeit wurde die Tür des Abteils geöffnet, in dem Robert Demant saß. Bisher hatte er ganz alleine gesessen, nun trat ein junges Madel ein. Es hatte nur eine kleine Tasche als Gepäck. Der Zug ruckelte wieder an.
»Grüß’ Gott«, erwiderte der Mann auf den Gruß der Eintretenden.
Dabei schweifte sein Blick über ihre Gestalt und was er sah, gefiel dem Maler. Ein schlankes, hochgewachsenes Madel mit braunen Augen, das schulterlange Haar hatte die Farbe von Kastanien und in dem aparten Gesicht dominierte ein schwungvolles Lippenpaar.
Die junge Frau setzte sich ihm gegenüber. Sie schien ein wenig außer Atem zu sein.
»Glück gehabt«, sagte sie und holte tief Luft. »Beinah’ hätt’ ich ihn verpaßt.«
Sie lachte herzerfrischend, und Robert konnte nicht anders, als mit einzustimmen.
»Wissen S’, ich war zu Besuch bei einer alten Schulfreundin, und wir hatten uns soviel zu erzählen, daß wir glatt die Zeit vergessen haben.«
»Und einen späteren Zug hätten S’ net nehmen können?« fragte der Maler, dem die offene und freundliche Art der jungen Frau gefiel.
Das Madel schüttelte seinen Kopf.
»Von der Kreisstadt muß ich mit dem Bus weiter, und der fährt um Viertel vor fünf. Das ist der letzte. Wenn ich den verschwitze, kann ich zu Fuß nach St. Johann laufen.«
Robert horchte auf.
»Nach St. Johann wollen S’?«
»Ja«, nickte sie. »Sie etwa auch?«
»Ich mache Urlaub dort«, antwortete er und stellte sich dann vor. »Ich heiße übrigens Robert Demant.«
»Katharina Lehmbacher.«
»Wohnen Sie dort?«
»Inzwischen ja. Ursprünglich stamm’ ich aus Engelsbach. Aber seit einem halben Jahr wohne ich in St. Johann. Ich arbeite als Saaltochter im Hotel ›Zum Löwen‹. Werden S’ denn bei uns wohnen?«
Robert zuckte die Schulter.
»Ich weiß noch net. Mal schau’n, wie’s mir überhaupt dort gefällt.«
Katharina hob den Kopf.
»Toll wird’s Ihnen gefallen. Das kann ich jetzt schon sagen«, erwiderte sie im Brustton der Überzeugung.
Der Maler schmunzelte.
»Sie scheinen ja wirklich überzeugt zu sein.«
»Also, ich hab’ bis jetzt nur nette Menschen dort kennengelernt«, antwortete die junge Frau. »Außerdem ist es ein ruhiges und beschauliches Dorf.«
»Sie machen mich wirklich neugierig.«
Der Zug lief in den Bahnhof der Kreisstadt ein. Die beiden Reisenden machten sich für den Ausstieg bereit.
»Kommen S’, der Bus fährt von dort drüben«, sagte Katharina, als sie auf dem Bahnsteig standen.
Die Rückbank war noch frei und bot genügend Platz für Menschen und Gepäck. Sie setzten sich, während der Fahrt wurde Katharina Lehmbacher nicht müde, die Vorzüge von St. Johann und seiner Bewohner aufzuführen. Außerdem schwärmte sie von dem Hotel, in dem sie arbeitete, daß Robert gar nicht anders konnte, als zu erklären, daß er dort absteigen werde.