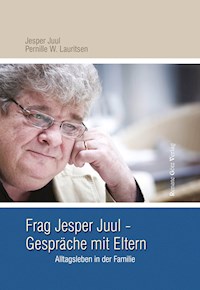9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach neuen Werten für die Kindererziehung und eine moderne Familie ist eines deutlich geworden: Kinder haben von Anfang an eine eigene Persönlichkeit und sind damit menschlich und sozial kompetente Partner ihrer Eltern. Diese Kompetenz, die sich entsprechend der kindlichen Reife äußert, muss Kindern nicht erst durch Erziehung beigebracht werden. Sie müssen beobachten und experimentieren dürfen, dann fügen sie sich durch Nachahmung in die Kultur ein. So kooperieren Kinder, und Erwachsene müssen lernen, auch störendes Verhalten in Botschaften zu übersetzen. Denn Erziehung ist ein Entwicklungsprozess – für die Eltern ebenso wie für die Kinder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Einleitung
Wie so viele meiner Generation wusste ich vor fünfundzwanzig bis dreißig Jahren, dass an der Art und Weise, wie unsere Eltern (und die Generationen vor ihnen) über Familie und Kindererziehung dachten, etwas grundlegend falsch war. Dass sich unser konkretes Wissen durchaus in Grenzen hielt, tat unseren Überzeugungen keinen Abbruch.
In den folgenden zehn Jahren, in denen ich mich zum Familientherapeuten ausbilden ließ – während ich mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen sowie mit Gruppen alleinerziehender Mütter arbeitete–, wurde mir allmählich klar, dass meine Ansichten weder besser noch schlechter als diejenigen waren, die sie ersetzen sollten. Denn über einen Mangel an ethischer Substanz konnten auch sie nicht hinwegtäuschen. Vielmehr polarisierten sie durch die unbeirrbare Überzeugung, dass manche Menschen sich richtig verhielten, weil sie die richtigen Ansichten vertraten, während andere sich falsch verhielten, weil ihre Ansichten falsch waren.
Das Feedback, das ich von Kollegen und Klienten bekam, spiegelte diese Polarisierung. Einige waren voll des Lobes, andere kritisierten mich, und in meiner Naivität dachte ich lange, ich sei auf der sicheren Seite, solange die Erstgenannten in der Überzahl waren. Erst sehr spät begriff ich, dass ich auf die anderen hätte hören sollen. Erst als ich meine eigene Unzulänglichkeit als Vater erlebte, wurde mein theoretisches Wissen durch praktische Erfahrung ergänzt.
Bis dahin hatte ich geglaubt, dass die Beziehung zwischen Eltern und Kindern vor allem von Verständnis, Toleranz und demokratischen Spielregeln geprägt sein sollte – im Gegensatz zur moralisierenden, intoleranten und bevormundenden Art der Erziehung, die Kindern das Selbstbewusstsein raubt und ihre Vitalität beeinträchtigt. Doch je besser ich meinen Sohn und die Familien kennenlernte, mit denen ich zusammenarbeitete, desto mehr begriff ich die Oberflächlichkeit meiner Überzeugung. Obwohl sich die Situation der Kinder in Familie und Gesellschaft in vieler Hinsicht verbessert hatte, waren es zwei Probleme, die mich umtrieben.
Als Lehrer und Familientherapeut habe ich erlebt, wie schwierig es für Eltern ist, «auf Augenhöhe» mit einem Psychologen zu kommunizieren. Allzu oft scheinen sie durch die Gespräche an Selbstvertrauen zu verlieren und am Ende orientierungsloser zu sein als vorher. Beim Psychologen löst dies verständlicherweise Gefühle der Hilflosigkeit und Inkompetenz aus, und so klammert er sich gern an eine traditionelle Form der Psychologie, die mehr darauf aus ist, Fehler zu finden, als nach Möglichkeiten zu suchen.
Als Familientherapeut habe ich erlebt, dass Kinder und Jugendliche stets den Preis dafür bezahlen. Auch wenn das pädagogische Verständnis der Erwachsenen differenzierter, ihre Erziehung weniger besserwisserisch und die öffentliche Moral weniger restriktiv ist als früher, so wird den Kindern auch weiterhin eine Verantwortung aufgebürdet, die nur wenige Eltern, Politiker, Pädagogen, Lehrer und Therapeuten zu tragen bereit sind. Dies geschieht nicht aus bösem Willen – oft genug stecken nur die besten Absichten dahinter–, ist aber eine logische Konsequenz unser grundlegenden Fehleinschätzung, was das Wesen der Kinder betrifft.
Die schwedische Psychologin Margareta Brodén hat dies in einem schlichten Satz zum Ausdruck gebracht, der mich zum Titel dieses Buches angeregt hat: «Vielleicht haben wir uns geirrt – vielleicht sind Kinder kompetent». (Margareta Brodén, Mor og barn i Ingenmandsland, København 1992, dt. «Mutter und Kind im Niemandsland»).
Brodéns Formulierung ist teils dem wissenschaftlichen Kontext geschuldet, in dem sie sich bewegt, zeigt aber vor allem ihr besonderes Interesse, das sie dem frühen Zusammenspiel zwischen Säuglingen und Eltern entgegenbringt. Da ich kein Wissenschaftler bin, sondern aus der Praxis komme und mein Erfahrungsgebiet die Interaktion zwischen Kindern und Eltern im weiteren Sinn ist, möchte ich die Summe meiner Beobachtungen etwas anders formulieren.
Soweit ich sehe, machen wir einen entscheidenden Fehler, wenn wir davon ausgehen, dass Kinder bei ihrer Geburt noch keine «richtigen» Menschen sind. Lange Zeit wurden Kinder gewissermaßen als asoziale Halbmenschen angesehen, die der massiven Einflussnahme und Manipulation der Erwachsenen bedürfen und zudem ein gewisses Alter erreichen müssen, ehe man sie als vollwertige Menschen betrachtet. Diese Ansicht ist im Laufe der Zeit sowohl wissenschaftlich als auch privat vertreten worden, stets mit denselben Folgen: Die Erwachsenen haben verschiedenste Wege erprobt, den Kindern beizubringen, sich wie richtige, erwachsene Menschen zu benehmen. Wir haben das als «Erziehungsmethoden» bezeichnet, und auch wenn wir die ganze Bandbreite von der althergebrachten autoritären bis zur antiautoritären Erziehung diskutiert haben, wurde der ideelle Ausgangspunkt doch nie grundlegend in Frage gestellt.
Ich möchte mit diesem Buch klarmachen, dass ein Großteil dessen, was wir im traditionellen Sinn unter Erziehung verstehen, nicht nur überflüssig, sondern schädlich ist. Dass nicht nur die Kinder darunter zu leiden haben, sondern auch die Eltern in ihren Entwicklungsmöglichkeiten gehemmt werden, was die Interaktion zwischen Kindern und Erwachsenen gleichermaßen belastet. So wird ein Teufelskreis in Gang gesetzt, der unsere Einstellungen in sozialen und pädagogischen Fragen beeinflusst und bis in die Gesellschafts- und Familienpolitik hineinwirkt.
Meine Generation hat dazu beigetragen, eine illusorische Distanz zwischen Subjekt und Gesellschaft zu schaffen, eine Illusion, die vor fünfundzwanzig Jahren logischer Bestandteil unserer Auflehnung gegen Autoritäten war, die aber heutzutage, da Politik sich zunehmend auf Wirtschaftspolitik reduziert, immer gefährlicher wird. Vielleicht stimmt es mehr denn je, dass die Art und Weise, wie wir unsere Kinder behandeln, für die Zukunft der Welt von entscheidender Bedeutung ist. Die Menge an Informationen hat in solchem Maß zugenommen, dass wir nicht davon ausgehen dürfen, unser Doppelspiel im Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen noch lange aufrecht erhalten zu können. Ein Doppelspiel, das darin besteht, in politischen Zusammenhängen Ökologie, Mitmenschlichkeit und Gewaltverzicht zu predigen, unseren Kindern aber nach wie vor Gewalt anzutun.
Ich hatte das Privileg, viele Jahre in verschiedenen Kulturen leben und arbeiten zu dürfen. Das hat mich davon überzeugt, dass die Veränderung im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, die in Skandinavien zu beobachten ist, auch anderen Ländern als Modell dienen könnte. Dem Außenstehenden mag dieses Verhältnis zunächst sehr beliebig, unentschieden und ziellos erscheinen, doch trägt es den Keim für eine Entwicklung in sich, die man nur als Quantensprung in der Entwicklung der Menschheit bezeichnen kann. Zum ersten Mal in neuerer Zeit sind wir bereit, das unantastbare Recht des Einzelnen auf die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit weder unter dogmatischen noch autoritären Gesichtspunkten zu betrachten. Allmählich scheint sich die Überzeugung durchzusetzen, dass die existenzielle Freiheit des Individuums keine Gefährdung der Gemeinschaft darstellt, sondern im Gegenteil von vitaler Bedeutung für deren Fortbestand ist.
Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern spielt sich in verschiedenen Tonlagen ab. Denken wir nur an die großen Unterschiede zwischen den USA und Europa und innerhalb Europas zwischen dem Norden, dem Süden und den osteuropäischen Ländern. Ganz zu schweigen von den markanten Unterschieden, die in den Landesteilen ein und desselben Staates bestehen. Natürlich spielen die kulturelle Identität eines Landes, seine politische Geschichte und religiöse Zugehörigkeit eine große Rolle für das Selbstverständnis eines Volkes. Menschen, die ursprünglich aus anderen Ländern kommen, sind sich dieser Tatsache in besonderem Maße bewusst. So ist von Einwanderern mitunter der Satz zu hören, sie wünschten nicht, dass ihre Kinder so werden wie dänische Kinder, während Dänen zuweilen irritiert über den physischen Umgang der Südeuropäer mit ihren Kindern sind. Da sich vor allem die USA und die europäischen Staaten zu multiethnischen und multinationalen Gesellschaften entwickeln – falls sie es nicht schon sind–, wird es umso wichtiger, sich die jeweiligen kulturellen Eigenarten bewusst zu machen. Mag der soziale Stellenwert der Familie von Kultur zu Kultur auch verschieden sein, so ist er meiner Erfahrung nach doch stets von existenzieller Bedeutung. Die Freude über ein konstruktives Zusammenspiel ist stets dieselbe, auch wenn es unterschiedlich zum Ausdruck kommt. Das gilt auch für den Schmerz angesichts destruktiver Beziehungen.
Wenn ich in diesem Buch das «Alte» mit dem «Neuen» konfrontiere, tue ich das weniger, um das Alte zu kritisieren, sondern vielmehr um konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. In meiner täglichen Arbeit mit Familien und ihren Therapeuten begegne ich oft einer großen Aufgeschlossenheit für neue Verhaltensmuster. Die meisten Eltern wissen sehr genau, wenn sie sich unangemessen verhalten, brauchen jedoch konkrete Anleitungen, um ihr Verhalten zu ändern, was auch verdeutlicht, dass es vielen heute an Vorbildern und Rollenmodellen fehlt.
Die traditionelle Psychologie stellt oft unsere Gefühle in Frage. Wird das Kind von seinen Eltern auch wirklich geliebt? Wie groß ist der Hass des Sohnes auf seinen Vater? Wie zornig ist die Tochter auf ihre Mutter? Doch möchte ich betonen, dass ich noch nie Eltern begegnet bin, die ihre Kinder nicht liebten, oder Kindern, denen ihre Eltern nicht am Herzen lagen. Hingegen habe ich eine Reihe von Eltern und Kindern kennengelernt, denen es nicht gelang, ihre liebevollen Gefühle in liebevolles Verhalten umzusetzen.
In der heutigen Zeit sind wir erstmals in der Lage, gleichwürdige Beziehungen zwischen Männern und Frauen sowie zwischen Erwachsenen und Kindern aufzubauen. Nie zuvor ist dies in vergleichbarem Maße geschehen. Die Forderung nach Gleichwürdigkeit impliziert aber auch Offenheit und Toleranz, erfordert eine generelle Akzeptanz von Verschiedenartigkeit, was bedeutet, dass wir einen Großteil unserer Vorstellungen, was richtig und falsch ist, überdenken und gegebenenfalls über Bord werfen müssen. Wir können nicht einfach eine Methode durch eine andere ersetzen, genauer gesagt: Es reicht nicht aus, unsere Irrtümer zu modernisieren. Gemeinsam mit unseren Kindern und Kindeskindern brechen wir buchstäblich zu neuen Ufern auf.
Die Handlungsmöglichkeiten, die in diesem Buch aufgezeigt werden, sollen zum Experimentieren anregen. Sie sind nicht dazu da, stur befolgt zu werden, da es eben nicht ausreicht, einfach ein System durch ein anderes zu ersetzen. Eltern sind nicht nur von unterschiedlichem Geschlecht, sondern bringen auch unterschiedliche Erfahrungen aus ihren Herkunftsfamilien mit. Doch haben wir auch vieles gemeinsam. Wir alle haben als Kinder gelernt, dass es unterschiedliche Wege gibt, mit anderen Menschen in Beziehung zu treten. Wege, die sich als mehr oder minder fruchtbar erwiesen haben. Die nächste Familie, an der wir teilhaben, gibt uns die Möglichkeit, Dinge zu lernen, die wir in unserer ersten Familie nicht lernen konnten.
Wenn ich Kinder als kompetent bezeichne, dann meine ich damit, dass wir wichtige Dinge von ihnen lernen können. Dass sie uns durch ihre Reaktionen ermöglichen, unsere verlorene Kompetenz wiederzugewinnen und unsere unfruchtbaren, lieblosen und destruktiven Handlungsmuster loszuwerden. In dieser Weise von den Kindern zu lernen erfordert jedoch mehr, als den Dialog zwischen Erwachsenen und Kindern zu demokratisieren. Wir müssen vielmehr zu einer Form des Dialogs finden, den viele Erwachsene auch untereinander nicht beherrschen, zu einem Dialog, der persönlich ist und auf der gleichen Würde des Einzelnen beruht.
Dass jeder von uns seinen eigenen Weg finden muss – den Weg, der für uns wie für unsere Kinder am fruchtbarsten ist–, bedeutet indes nicht, dass alle Wege gleich gut sind. Ich werde in diesem Buch wiederholt auf einige zentrale Prinzipien zu sprechen kommen, die gewissermaßen den Rahmen abstecken, an dem sich jeder orientieren kann.
In Anbetracht der allgemeinen Tendenz, allzu schnell mit dem Finger auf andere zu zeigen, besteht die Gefahr, dass sich mancher Leser von diesem Buch kritisiert fühlen könnte. Ich habe jedoch keinesfalls die Absicht, irgendjemanden zu kritisieren oder ihm die Schuld für gewisse Missstände in die Schuhe zu schieben. Dass ich des Öfteren auf die historische oder heute gängige Praxis verweise, liegt an meiner Erfahrung, dass die meisten Menschen ihr eigenes Verhalten am besten im Spiegel der Geschichte verstehen.
Die in diesem Buch formulierten Prinzipien und beschriebenen Beispiele gehen in erster Linie auf meine Arbeit am Kempler Institute of Scandinavia zurück. Ich schulde dem amerikanischen Psychiater und Familientherapeuten Dr.Walter Kempler sowie den übrigen Mitgliedern des Instituts großen Dank dafür, dass sie mich stets inspiriert und mir auch in den Jahren vertraut haben, in denen ich mein Selbstvertrauen weitgehend verloren hatte. Dasselbe gilt für die vielen Familien aus der ganzen Welt, die mir Einblicke in ihr Privatleben gewährt haben. Mit peinlicher Deutlichkeit erinnere ich mich an meine Einstellungen und Vorurteile, mit denen ich zum ersten Mal einer japanischen Familie gegenübertrat, und nicht anders erging es mir bei der ersten Begegnung mit einer muslimischen Familie, einer ethnisch gemischten Familie in einem kroatischen Flüchtlingslager oder einer amerikanischen Alkoholikerfamilie.
Mein längst erwachsener Sohn trägt dazu bei, diese Erfahrungen im Lichte seiner Entwicklung zu betrachten, und meine Frau konfrontiert mich hin und wieder mit etwas, von dem ich stets hoffe, es mögen die letzten Reste meiner kindlichen Egozentrik sein.
Die Familie als Machtstruktur
Seit Jahrhunderten hat die Familie als Machtstruktur existiert. Die Männer hatten Macht über die Frauen, und die Erwachsenen hatten Macht über die Kinder. In sozialer wie in politischer und soziologischer Hinsicht war die Macht absolut und ließ keinen Zweifel an der familiären Hierarchie aufkommen: Zuerst der Mann, dann die Frau – sofern es keine männlichen Jugendlichen gab–, danach die Jungen und zuletzt die Mädchen. Eine gelungene Ehe basierte auf der Fähigkeit und dem Willen der Frau, sich dem Mann unterzuordnen, und die Erziehung sollte den Kindern vor allem klarmachen, dass sie sich den Machthabern anzupassen und zu gehorchen hatten.
Wie in allen totalitären Systemen wurde mangelnder Fähigkeit oder fehlendem Willen zur Kooperation mit physischer Gewalt und/oder Einschränkungen der ohnehin beschränkten Freiheit des Einzelnen entgegengetreten. Offene Konflikte sollten unter allen Umständen vermieden werden.
Gegen Ende des 19.Jahrhunderts begannen wir, Kinder als geistig unabhängige, eigenständige Wesen zu betrachten, deren individuelle Existenz von Bedeutung für ihr Wohlergehen und ihre persönliche Entwicklung war. In den 20er-Jahren machten die Frauen dann nachdrücklich auf sich aufmerksam und verlangten – sowohl in menschlicher als auch in sozialer und politischer Hinsicht – ernst genommen zu werden. In der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts schwächte sich der totalitäre Charakter der Familien schrittweise ab, doch an der Machtstruktur als solcher wurde nicht gerüttelt.
Für diejenigen, die sich den Machtverhältnissen anpassten, war die Familie ein sicherer Ort. Wer jedoch seiner Individualität mehr Geltung verschaffen wollte, bekam die destruktiven Folgen dieses Zusammenspiels in der Familie zu spüren. Wer dadurch Schaden nahm und sich «auffällig» verhielt, wurde pädagogischen oder psychiatrischen Zwangsmaßnahmen unterworfen, die nur ein Ziel kannten, nämlich das Subjekt wieder in die bestehenden Machtverhältnisse einzupassen.
Den Machthabern (Ehemännern und Eltern) wurde geraten, den Abweichlern (Frauen und Kindern) bei ihrer «Resozialisierung» liebevolles Verständnis und Konsequenz entgegenzubringen, doch riet ihnen niemand, etwas von ihrer Macht abzugeben. Infolgedessen wurden viele Frauen und Kinder in Institutionen eingewiesen oder gezwungen, Medikamente einzunehmen.
Über die Familie traditioneller Prägung lässt sich einiges sagen, doch dem Wohlergehen des Einzelnen und seiner persönlichen Entwicklung war sie nur selten dienlich. In sozialer Hinsicht mag sie recht erfolgreich gewesen sein, doch unmittelbar unter der sozialen Oberfläche waren die Krankheitssymptome unübersehbar.
Manchen mag diese Beschreibung einseitig und ungerecht erscheinen. Natürlich hatte auch die traditionelle Familie ihre positiven Aspekte. Auch in ihr gab es liebevolle Beziehungen, und die willige Akzeptanz bestehender Machtverhältnisse bringt zweifellos eine besondere Form der Sicherheit mit sich, wie angepasste Bürger totalitärer Systeme sie kennen.
Eines der zentralen Probleme vieler moderner Familien besteht darin, dass wir eine veraltete Sprache benutzen, wenn wir über Kindererziehung reden. Sie stammt aus einer Zeit, in der eine konfliktfreie Familie als gelungene Familie betrachtet wurde und in der das Verständnis von mentaler Gesundheit ein völlig anderes war als heute. Wenn wir die Wörter und Begriffe, auf die ich im Folgenden zu sprechen komme, auch weiterhin benutzen wollen, dann müssen wir ihnen eine neue Bedeutung verleihen.
Die Pubertät
Pubertät ist an sich ein neutraler klinischer Begriff, der im Laufe des 20.Jahrhunderts negativ aufgeladen wurde und heute eine ganze Reihe negativer Assoziationen weckt. Die meisten Erwachsenen denken bei dem Wort Pubertät nur an Konflikte, Streitereien und Probleme. Diesem negativen Bild hat man nach dem Zweiten Weltkrieg den Begriff der Präpubertät hinzugefügt, was bedeuten soll, dass der Ärger gleich hinter der Ecke lauert.
Objektiv betrachtet ist die Pubertät eine intrapsychische (individuelle) psychosexuelle Entwicklungsphase, die vielen 12- bis 15-Jährigen heftige Turbulenzen und einen hohen Grad an innerer Unsicherheit beschert. Dass sie jedoch im Kern für die interpersonalen Konflikte (mit Erwachsenen) verantwortlich sein soll, ist blanker Unsinn. Die Anzahl und Heftigkeit der Konflikte hängt unter anderem von der Fähigkeit der Erwachsenen ab, ihrer veränderten Elternrolle gerecht zu werden, sowie von der Art und Weise, mit der sie der Entwicklung der kindlichen Integrität in den ersten drei, vier Lebensjahren Rechnung getragen haben.