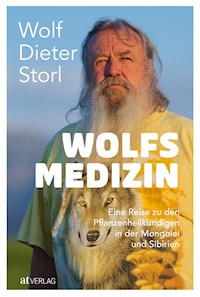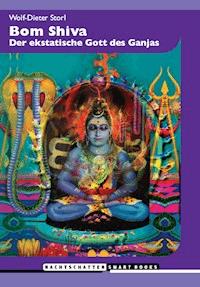Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AT Verlag AZ Fachverlage
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Überall, wo der Bär lebt, galt er als Krafttier. Er war kein gewöhnliches Tier, sondern eine Art "Waldmensch", unter dessen zotteligem Fell sich eine Menschen- oder gar Götterseele verbarg. Er konnte die Gedanken der Menschen verstehen und hatte Heilkräfte. Wolf-Dieter Storl, Kulturanthropologe und Ethnobotaniker, der selbst viele Jahre in Bärenbiotopen in den Rocky Mountains lebte, zeichnet in diesem Buch die Beziehung zwischen Mensch und Bär auf. Die Reise führt von den Bärenhöhlen der Neandertaler zu den Bärenkulturen sibirischer Stämme der Gegenwart, vom Höhlenbär bis zum Teddybär und nicht zuletzt auch in die Bärenstadt Bern. Wir erfahren von der Bärengöttin Artemis und dem Medizinbären der indianischen Schamanen und finden zahlreiche Bärenmärchen und - geschichten aus aller Welt. Eine faszinierende Beziehung zwischen Mensch und Bär - in Kulturgeschichte, Mythologie, Heilkunde und Biologie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Bär
Wolf-Dieter Storl
Der Bär
Krafttier der Schamanen und Heiler
Gewidmet meiner Berner Alma Mater und insbesondere den Berner Mutzen innerhalb und außerhalb des Bärengrabens und dem Braunbär, der von der Schutzgemeinschaft Deutsches Wild zum Wildtier des Jahres 2005 ausgerufen wurde.
Dieses Buch ist eine überarbeitete und ergänzte Ausgabe des 2001
im J. Kamphausen Verlag erschienenen Werks.
4. Auflage, 2013
© 2005
AT Verlag, Baden und München
Lektorat: Diane Zilliges, München
Umschlagbild: Adrian Pabst, Gebenstorf
Lithos: AZ Print, Aarau
ISBN 978-3-03800-146-1
www.at-verlag.ch
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Inhalt
Einführung
Bärenschamanen und Pflanzenheiler
Das Wesen der Tiere verstehen
Tierische Verbündete
Der Lehrer der Heilpflanzenkundigen
Die Heilerhaltung oder Bärenhaltung
Bärenhöhlen und Neandertaler
Eine mysteriöse Frau
Steinzeitjäger und Bärenschamanen
Bärenahnen
Der Götterbär
Kinder des Bären
Die goldenen Bären
Waldjungfrauen und wilde Bergmenschen
Vielfraß und Feinschmecker
Bärenliebe und Mutterrecht
Begegnung mit Maheonhovan
Bären sind keine feigen Hunde
Licht in der Bärenseele
Großmuttergeschichten
Die Höhle, der Bär und die Frau
Die Kraft der Bärenmilchgesäugten
Eine bärige Frau Holle
Der Vegetationsdämon
Blutige Opfer
Kornbär und Erbsenbär
Der Bärenkönig der Kelten
Das Rad mit acht Speichen
Das Lichtfest
Maiwonne und Augustfeuer
Die Nacht der Mütter
Der Hüter der Schätze
Der Krösus des Tierreiches
Krishna demütigt den Bärenkönig
Salmoxis und die Unsterblichkeit
Meister des Feuers
Bärenhäuter und Schwellenhüter
Deutungen
Die Spur des Großen Himmelsbären
Die Kraft, die den Himmel bewegt
Der Besucher aus dem zwölften Himmel
Der verbotene Name
Die Kinder der Artemis
Der entrückte Herrscher
Der kämpfende Bär
Berserker und Wolfshemden
Folgeseelen
Der Krieg der Tiere
Häuptling der Tiere
Bärenheilige und Teufel
Ein Bote des Fischezeitalters
Der Petz als Gepäckträger und Pflugknecht
Die Bärengöttin im Nonnengewand
Waldteufel und »schedlich Gewild«
Die Lichtbären des Bruder Klaus
Bärenpflanzen, Bärenmedizin
Schlafkraut
Ein Meister der Botanik
Bärlauch, Ramser
Bärlapp
Bärentrauben
Klette
Bärenmilch und Bärendreck
Des Bären Fett, des Bären Galle
Die Ausstrahlung des Bären
Das Allheilmittel
Bärenfett
Bernstein
Wegschickungs-Zeremonien: Versöhnung mit dem Bärengeist
Der Bär ist eine liebeshungrige Frau
Orte der Bärenkraft
Smokey Bear und der Yellowstone Nationalpark
Lachsschlemmer am McNeil-Fluss
Der himmlische Gast
Besuch beim Herrn des Waldes
Mutzopolis – Die Bärenstadt Bern
Menschgewordene Bären
Herzog Berchtold und Edelfrau Mechthildis
Der Schutzheilige
Teddybär und Winnie der Puh
Der dumme Bär
Der Präsident und der erste Teddy
Der weise Bär von geringem Verstand
Lexikon berühmter Bären
Nachwort: Hoffnung auf Wiederkehr
Wer frei durch die Wälder streift, wird erschossen
Danksagung
Literatur
Einführung
»Je mehr wir uns auf die Zeit einlassen und mit ihr dahineilen, desto weiter entfernt sie uns vom Währenden. Das gilt auch für die Tiere; nie hat man von ihnen mehr und (gleichzeitig) weniger gewusst. Nie mehr, was ihre Anatomie und ihr Verhalten betrifft. Nie weniger über ihr heiles Wesen, ihren unberührten Schöpfungsglanz, wie ihn Märchen und Mythen als Wunder und wie ihn Kulte als göttlich erfasst haben.«
Ernst Jünger, Hund und Katz, 1974
Etwa fünf Jahre lang lebte ich in bear country in den Rocky Mountains und an der pazifischen Küste Nordamerikas, wo Bären, vor allem Schwarzbären, noch recht präsent sind. Sechs Monate verbrachte ich in der Wildnis von Yellowstone, wo einem Meister Petz nahezu täglich begegnete: Die Düfte der Küche lockten ihn, neugierig schnüffelte er an Türritzen und Abfallbehältern. Man begegnete ihm auf abgelegenen Holzwegen und Wanderpfaden und blieb – eine respektvolle Distanz haltend – bewundernd stehen. Während man nachts am Lagerfeuer döste, hörte man ihn gelegentlich da draußen im Dunkeln schnaufen oder brummen. Man sah ihn mit tollenden Jungen am See planschen, baden oder fischen; man sah ihn genüsslich mampfend in den Beerenschlägen, sah seinen von Heidelbeeren blau gefärbten Kot, seine Sohlenabdrücke im Schlamm. Wenn man viel Zeit in der Natur verbringt, fängt man unwillkürlich an, den Bären so zu sehen, wie die Indianer oder andere naturnahe Völker ihn sehen – als magisches Wesen, als »Mensch« in Tiergestalt, möglicherweise als Lehrmeister, der uns im Traum erscheinen kann und uns an unsere ureigene, unschuldige, wilde Natur zu erinnern vermag. So lernt man Bären anders kennen als im Biologieunterricht, anders als beim Zoobesuch oder Safariurlaub.
Inzwischen lebe ich im Allgäu. Herrliche Berge, Seen und Wälder gibt es hier. Schön ist es hier zu wandern. Aber es fehlt etwas, etwas, was zu dem Land eigentlich gehören sollte: Wolfsgeheul, das in Vollmondnächten Schauer durch die Seele jagt, kreisende Geier über einem verendeten Wildtier und der Bär, der einem gemütlich über den Weg tappt. In unserer überzivilisierten Welt gibt es zu wenig, was einem den Atem verschlägt, was unsere archaische Neandertaler-Seele in Wallung bringt, was in uns die Ehrfurcht vor der Schöpfung zu erwecken vermag. Die virtuellen Bilder der allgegenwärtigen Unterhaltungsindustrie können nie die wahre Natur, die Wildnis, ersetzen. Und so verarmt unsere Seele. Alles ist sicher – zu sicher! –, alles kontrolliert, wissenschaftlich dokumentiert, schulmeisterlich erklärt. Selbst die Berge und Wälder werden zunehmend gebändigt. Hatte doch der alte Squamish-Häuptling See-Yahtlh (Seattle) Recht, als er die weißen Eindringlinge warnte (Seattle 1987: 88): »Was ist der Mensch ohne Wildtiere? Wenn die wilden Tiere alle verschwunden sind, dann wird die Seele an Einsamkeit zugrunde gehen; alles, was den Tieren widerfährt, widerfährt auch den Menschen.«
Nun wollen wir von Bruder Bär und Schwester Bärin erzählen, die uns auf unserem Weg seit der Steinzeit begleiten, die den Schamanen und Medizinleuten Träume und Inspirationen schickten, die den Berserkern Kraft und Mut schenkten und den Heilern Wissen vermittelten. Ich schreibe als Völkerkundler und Kulturanthropologe und streife nicht nur die biologischen und ökologischen Aspekte des Bärenwesens, sondern vor allem die ethnologischen und mythologischen. Aber mein Anliegen ist nicht nur Information. Ich möchte den Bären ins Bewusstsein fokussieren, damit wir ihn wieder ins Dasein träumen können.
Bärenskizze aus einer steinzeitlichen Höhle. (Combarelles, Dordogne; Kultur des Aurignacien)
Bärenschamanen und Pflanzenheiler
»Die Seelen! Sie sind ja gar nicht in den Körpern.
Die Körper sind in den Seelen!«
Christian Siry, Die Muschel und die Feder
Wir haben es fast vergessen: Tiere sind unsere Helfer und Gefährten. Die Katzen sind nicht nur nützlich, weil sie Mäuse fangen, die Hunde, weil sie den Hof bewachen, die Kühe, weil sie Milch, Butter und Käse geben, oder die Pferde, weil sie Wagen ziehen oder uns tragen können. Das sind lediglich die auf den materiellen Nutzen bezogenen, utilitaristischen Erwägungen. Wenn man die Tiere mit dem Auge des Herzens sieht, dann erkennt man, dass ihr Wert weit über dem bloßen Ökonomischen liegt. Es stimmt zwar, dass Kinder, die mit Haustieren aufwachsen, seelisch ausgeglichener sind, oder dass der Spitz, die Schmusekatze oder der Goldfisch das Leben für Alte und Einsame erträglicher macht. Aber auch diese psychotherapeutischen Aspekte sind hier nicht unser Hauptanliegen. Wir wollen uns mit dem archetypischen Wesen der Tiere, in diesem Fall des Bären, befassen.
Tiere haben feine Sinne, sie spüren, was auf die Haus- und Hofbewohner zukommt, lange ehe es der Mensch wahrnimmt. Sie spüren bis in die unsichtbare energetische und astrale Dimension hinein. Oft nehmen sie einen Fluch oder ein karmisch bedingtes Unglück auf sich, so dass sie krank werden oder gar sterben, damit es die Menschen, mit denen sie verbunden sind, nicht trifft. Tierverbündete können dem Menschen telepathische Botschaften zukommen lassen, ihn lehren und ihm helfen bei der Erfüllung seines Schicksals. Was für die Hof- und Haustiere zutrifft, das trifft noch mehr auf Wildtiere zu. Da diese nicht gezähmt und den unnatürlichen Zwängen der Domestikation nicht unterworfen sind, ist ihnen eine besondere Kraft eigen. Immer wieder gibt es Menschen, die in Resonanz mit einem Wildtier – dem Eber, dem Hirsch, dem Hasen, den Vögeln und sogar den Winzlingen, den Ameisen und Käfern – treten können.
In unseren Schulen lernen wir diesen Zugang zu den Tierseelen nicht. Unsere Aufmerksamkeit wird auf andere, »wichtigere« Dinge gelenkt, auf leblose Mechanismen und rechnerisch abstrakte Daten. So kann man im »System« funktionieren. Aber die Seele braucht etwas anderes, um gesund zu sein. Etwa tierische Seelenverbündete. Diese lassen sich auch finden. Man kann in die Natur hineinlauschen, sich ihr gegenüber bewusst öffnen. Man braucht nur aufmerksam Acht zu geben, welche Tiere einem im eigenen Leben immer wieder erscheinen, zu welchen man sich unwillkürlich hingezogen fühlt und welche besonderes Interesse wecken. Vielleicht ziert eine bestimmte Tierart unser Familienwappen? Vielleicht erzählt die Familiengeschichte von einem Tier, das mit einem Urahn verbunden war?
Das Wesen der Tiere verstehen
Tiere sind unseren Seelen näher als die schweigsamen Pflanzen oder Steine. Tiere sind, wie wir, verkörperte Seelen. Wie wir leben sie im Spannungsfeld der Gefühle und Emotionen, der Freude und des Leides, der Abneigungen und Zuneigungen. Pflanzen und Mineralien besitzen zwar auch so etwas wie eine empfindsame Seele und einen weisheitsvollen Geist, diese sind aber nicht – wie bei atmenden Tier- und Menschenwesen – an ihre Körperlichkeit gebunden: Ihre »Geist-Seelen« sind weiter entfernt, sie befinden sich außerhalb ihrer physischen Leiber, ausgebreitet in der makrokosmischen Natur. Diese mineralischen und pflanzlichen »Geist-Seelen« sind nicht dem alltäglichen Verstand zugänglich, deswegen kann eine Wissenschaft, die sich nur auf das Messbare, Wägbare und Logische beschränkt, sie nicht wahrnehmen. Schamanen aber haben die Fähigkeit, aus dem alltäglichen Bewusstsein herauszutreten. Wenn sie stark sind – und eventuell einen Bären als Schutzgeist haben –, können sie mit diesen »Geist-Seelen« kommunizieren.
Tiere sind beseelte Wesen. Sie atmen. Ihre Seele fließt mit jedem Atemzug. Gefühle, Stimmungen und Emotionen sind innig mit dem Rhythmus des Ein- und Ausatmens verbunden. Das Wort Tier (altenglisch deor, niederländisch dier, schwedisch djor) entspringt dem Indogermanischen *dheusóm und bedeutet »atmendes, beseeltes Wesen«. Auch das Lateinische animal, animalis (Tier) ist mit dem Begriff anima, animus (Seele, Atem, Wind, Geist, beseeltes Wesen) verwandt. Wenn ein Mensch oder ein Tier aufhört zu atmen, verlässt die Anima den Körper und kehrt in die jenseitige Dimension zurück. Die Lebenswärme verflüchtigt sich, erstarrt liegt der Körper und löst sich in seine stofflichen Komponenten auf.
Die Seelen der Tiere – das weiß jeder Schamane und jeder, der Tiere liebt – sind jedoch reiner, unverfälschter als die unseren. Keine Gedankenabstraktionen, kein »schöpferischer Intellekt«, keine »kulturellen Konstruktionen der Wirklichkeit«, keine Lebenslüge spaltet das Tier von seiner unmittelbaren natürlichen Umwelt ab. Das Tier ist unmittelbar in seine Um- und Mitwelt eingebunden. Nicht Worte und abstrakte Symbolsysteme, nicht die Gedanken, die an ein übergroßes stoffliches Hirn gebunden sind, bestimmen das Verhalten der Tiere, sondern die Gerüche, die Laute und Stimmungen der Umwelt, die Tages- und Mondrhythmen und der Wandel der Jahreszeiten steuern ihre Aktivitäten. Die Natur »denkt« in ihnen. Sie haben teil an der ordnenden Vernunft des makrokosmischen Geistes.
Es ist nicht so, wie die heutige Schulwissenschaft behauptet, dass die zerebral-kognitiven Fähigkeiten des Tieres im Vergleich zum Menschen unterentwickelt oder weniger evolviert sind. Nein, es ist so, dass sich der »Geist« des Tierindividuums größtenteils auf einer anderen Ebene befindet, in einer nichtmateriellen Dimension. Dieser Geist ist nicht ein individualisierter, verkörperter Geist, sondern er hat teil an einem »Gruppengeist«, der – wie es bei den meisten Naturvölkern heißt – beim »Herrn der Tiere« in der »Anderswelt«, bei der »Tiermutter« in der Höhle, im Inneren eines Berges oder auf »unterirdischen grünen Wiesen« zu finden ist. Dieser »Gruppengeist« ist ein spirituelles Wesen; es ist eine Gottheit, ein Deva. Er ist es, der den Schwalben im Spätherbst den Weg in den sonnigen Süden weist, der den Tieren zeigt, wie sie ihre Nester zu bauen haben, sie vor einer Sturmflutwelle oder Erdbeben warnt oder ihnen sagt, welche Pflanzen fressbar sind, welche heilend, welche giftig.
Heute nennt man das »Instinkt«. Das Wort, das im 17. Jahrhundert in die Wissenschaft eingeführt wurde, bedeutet lediglich »Antrieb« (vom lateinischen instinguere, »anstacheln«, »antreiben, so wie der Hirt die Herde mit seinem Stock antreibt«). Wer ist es aber, der die Tiere zu ihrem Verhalten antreibt? Heute glauben wir es zu wissen. Es sei die »genetische Programmierung«, die die angeborenen, stereotypen Verhaltensweisen, die nicht erlernt und kaum durch Lernprozesse abgeändert werden, steuert. Exogene Reize (Wärme, Licht, Düfte usw.) lösen endogene, genetisch verankerte Reaktionen aus – so die gegenwärtige, materialistisch-positivistische, auf genauen Laboruntersuchungen und Messungen basierende Lehrmeinung.
Die Naturvölker haben weder Labore noch haben sie eine experimentelle Methode zur Wissensfindung entwickelt. Ihr Wissen über Tiere beruht auf einem engen, unmittelbaren Zusammenleben mit den wilden gefiederten oder felltragenden Bewohnern ihrer Umwelt. Ihre Gemeinschaft ist eine, die viele Generationen überspannt; Mensch und Tier wissen voneinander, verhalten sich mit-, für- und gegeneinander und bilden eine Lebenseinheit, eine Symbiose. Naturmenschen kennen jeden Laut der Wildnis, sie können auch die feinsten Spuren – Fressspuren im Laub, Abdrücke auf feuchten Böden, Haare, Federn – exakt deuten. Alles haben sie intensiv und genau beobachtet. Aber sie bleiben nicht bei der bloßen äußeren Beobachtung stehen. Sie gehen jenseits der alltäglichen Sinne. Traum, Vision und auch schamanische Techniken – Versenkung, langes Fasten und Wachen, Trance-Tanz und Trommeln und bei einigen Stämmen die Anwendung von Pflanzen, die das Bewusstsein erweitern – verbinden sie mit dem Deva der jeweiligen Tierart, mit dem Tierherrn oder der Tiermutter. Sie hüllen sich in die Haut des Büffels, des Hirschs oder des Bären, ahmen mit Tanzschritten seine Bewegungen nach und singen die Tierlieder, bis sie im Einklang mit ihm sind, bis sich die Grenze zwischen ihrer und der Tierseele auflöst. Sie fliegen dann als Rabe, Nachteule oder Milan, sie schwimmen als Delphin, laufen als Wolf mit der Meute durch Tundra oder Prärie, oder als Hirsch mit den Hinden (Hirschkühen) durch den Wald. Im Gegensatz zum positivistischen Wissenschaftler, der die Tiere nur von außen beobachtet und ihre Reaktionen misst, erleben sie das Tier von innen heraus.1
Dabei sind nicht unbedingt die Menschen die aktiven Initiatoren dieser intensiven Interaktionen. Wie mir der Cheyenne-Medizinmann Bill Hoher Büffelstier (Tallbull) zu erklären versuchte, sind es meistens die Tiere selber, die den Menschen aufsuchen, ihm Inspirationen, Träume, Hinweise oder Warnungen zukommen lassen. Nicht der Schamane sucht sich sein Schutztier aus, es ist das Tier, das ihn aussucht. Der Anthroposoph Karl König schreibt im ähnlichen Sinne (König 1988: 90): »Das Tier greift tief in das Leben der Menschen, der Mensch entscheidend ins Dasein der Tiere ein. Sie durchdringen einander, und es ist nicht nur Furcht und Aberglaube, welche die Tabus, die Feste, die Zauberhandlungen bedingen. Die Seelenwelt der Tiere selbst, ihre Handlungen, ihr Verhalten, ihre Phantasien und übersinnlichen Erfahrungen durchwirken das Vorstellen, Fühlen und Handeln der mit ihnen lebenden Wilden (Menschen).« Dass Tiere die Menschen telepathisch beeinflussen und steuern können, erlebt man sogar mit den Haustieren: Eine Kuh, die in der Nacht in eine Grube fiel, schickte mir einen Traum – sie erschien in der Gestalt der Kuhgöttin Hathor – und ließ mich wissen, in welcher Not sie war und wo ich sie finden konnte. Lassen wir es zu, ist die Verbindung gegeben: Ich denke an die Ameisen, die mir das Schreiben beibrachten, als ich noch ein dummer Schüler war; denke an die Geier, die meine Seele in den Himmel trugen, oder auch an den Kormoran, der mich spät in der Nacht hinaus ins Moor rief; seine Flügel waren bei einem plötzlichen heftigen Temperatursturz fest ans Eis angefroren, und ich konnte ihn befreien.
Für die Völker, die als Jäger und Sammler oder als simple Ackerbauern leben, ist der »Herr der Tiere« – der archetypische Tiergeist, die Tiergottheit – keine abstrakte Idee, keine Glaubensangelegenheit, sondern Erfahrungstatsache. Der Schamane bildet sich auch nicht ein, dass er mit den Tieren sprechen kann, sondern er tut es. Er bekommt Antworten. Was er erfährt, hat Wirkung in der »wirklichen« Welt. Es ist kein Produkt der subjektiven Fantasie. Der Indianer spricht mit dem »Tierlehrer«, der ihm während der Visionssuche erscheint, und erfährt von ihm seine Lebensaufgabe; der sibirische Schamane spricht mit dem »Herrn der Tiere« und erfährt, wo sich das Wild befindet, das zur Jagd freigegeben wurde; der Eskimo Angakkok besucht Sedna, die Mutter der Seesäuger, um zu erfahren, wo sich die Robben aufhalten. Die Tiergeister zeigen dem Pflanzenschamanen, welche Heilkräuter er zu verwenden hat. Verbündete Tiergeister warnen den Menschen vor Gefahr. (So wurde Phoolan Devi, das Bauernmädchen, das eine Räuberbande führte, durch einen Panther vor dem Herannahen der indischen Polizeitruppe gewarnt.) Tiergeister legen dem Menschen auch Verhaltensregeln und Tabus auf, die es unbedingt einzuhalten gilt. Und immer wieder nimmt eine Gottheit Tiergestalt an.
Selbstverständlich waren auch unsere Vorfahren naturverbunden. Auch sie hatten diesen Zugang zu dem magischen Wesen der Tiere. Märchen, Sagen und der so genannte Aberglauben, der tiefe heidnische Wurzeln hat, geben eindeutiges Zeugnis davon. Immer wieder erscheinen dem Märchenhelden oder der -heldin, neben Feen, Heinzelmännchen und anderen Andersweltlichen, helfende, sprechende Tiere (Meyer 1985: 114). Aschenputtel helfen Tauben und Vöglein bei der unsäglich schwierigen Aufgabe, gute und schlechte Linsen aus der Asche zu lesen; zwei Täubchen im Haselstrauch verraten dem jungen Königssohn, wer die falsche und wer die wahre Braut ist: »Ruck di guck, Blut ist im Schuck ...« Fallada, das edle Pferd, weissagt der Königstochter, die als Gänsemädchen Dienst tun muss. Ameisen helfen den Dummling, dem jüngsten von drei Brüdern, verborgene Perlen zu finden, die Enten helfen ihm, einen im See versenkten Schlüssel zu bergen, und die Bienen zeigen ihm, wer unter mehreren Jungfrauen die wahre Königstochter ist, indem sie an den Lippen saugen, die am süßesten sind. Sie helfen ihm, den die klugen älteren Brüder als einen Dummkopf betrachten, da er immer gut und voller Mitleid mit den Tieren ist. Die Märchen sind voller Beispiele dieser Art. Aber auch die christlichen Sagen und Legenden sind voller Geschichten von Tierverbündeten: Ein Hund und ein Rabe bringen dem von der Pest befallenen heiligen Rochus jeden Tag Brot zu essen, damit er nicht verhungert; dem Gallus tragen die Bären das Holz herbei für den Bau von Kapellen.
Nun, der moderne Zeitgenosse wird wohl eher herablassend lächeln und sagen: »Das sind eben Märchen.« Ja, richtig, das sind Märchen, Märchen im ursprünglichen Sinne des Wortes. Eine Mär (althochdeutsch mari) ist eine Kunde, ein Bericht aus einer andersweltlichen Dimension – etwa im Sinne von Martin Luthers Lied zum Mysterium von Weihnachten: »Vom Himmel hoch da komm ich her, ich bring euch gute, neue Mär.« Märchen beziehen sich nicht auf empirische, wissenschaftliche Fakten, sind aber trotzdem wahr. Sie beziehen sich auf Wesentlicheres, auf die transzendente Natur der Wirklichkeit. Der weisheitsvolle, reine Geist der jeweiligen Tierarten kann nur mittels schamanischer Fähigkeiten begriffen werden. Und echte Märchen und Sagen sind wahrhafte Kunde davon.
Tierische Verbündete
Bei den Naturvölkern heißt es, dass jeder Mensch sein Tier oder seine Tierhelfer hat, mit denen er auf Gedeih oder Verderb verbunden ist. Nagual nannten die Azteken den tierischen Doppelgänger des Menschen, der seine wilde Natur verkörpert. Das Nagual gibt sich oft während der Schwangerschaft oder bei der Geburt eines Menschen zu erkennen. Die mittelamerikanischen Indios halten in der Geburtsnacht Ausschau und lauschen, welches Tier sich da zeigt. Ist es ein Jaguar, ein Wildschwein oder ein anderes Krafttier, dann weiß man, es wird eine starke Persönlichkeit geboren, ein Schamane vielleicht. Manchmal wird das Kind dann auch nach seinem tierischen Doppelgänger benannt.
Auch den germanischen Völkern war der Gedanke nicht fremd. Folgeseelen oder Fylgia nannte man die tierischen Doppelgänger. Als Bären, Wildschweine, Hirsche und Wölfe streifen die Seelen starker Männer und Frauen durch den Wald, als Adler, Raben und Schwäne fliegen sie durch die Lüfte, als Lachs oder Otter schwimmen sie im Wasser (Meyer 1903: 262). Als Bär kämpft der Krieger Bjarki draußen auf dem Schlachtfeld, während sein Körper in der Halle erstarrt in tiefer Trance liegt.
Die Verbindung mit den Krafttieren kommt in Namen wie Rudolf (althochdeutsch hrod und wolf, »ruhmreicher Wolf«), Bernhard (ahd. bero und harti, »kräftiger, ausdauernder Bär«), Björn (schwedisch, »Bär«), Bertram (ahd. behrat und hraban, »glänzender Rabe«), Arnold (ahd. arn und walt, »der wie ein Adler herrscht«), Falko (ahd. falkho, »Falke«), Schwanhild (svan und hilt, »kämpfender Schwan«) oder Eberhart (ebur und harti, »zäher Eber«) zum Ausdruck. Auch Arthur und Art (altkeltisch arto, »Bär«) und Urs oder Ursula (lateinisch ursus, »Bär«) sind Nachklänge totemischer Namensgebung in unserem Kulturkreis.
Ein Schamane ohne Tierverbündete wäre schwach und hilflos. Jedes Tier kann ein solcher Verbündeter sein. Wie bei Odin (Wotan), dem nordeuropäischen Schamanengott, kann ein verbündeter Rabe für den Schamanen ausfliegen und Unbekanntes auskundschaften. In Gestalt eines Jaguars kann der südamerikanische Schamane, dessen Körper sich erstarrt im tiefen Trancezustand befindet, durch den Urwald streifen. Mit Hilfe des Wildschweingeists schnüffelt der nepalesische Jhankrie den im Körper des Patienten verborgenen Krankheitsgeist oder den magischen Pfeil heraus. Als Adler hoch am Himmel fliegt der indianische Trancetänzer beim Sonnentanz und bringt bei seiner Rückkehr seinem Stamm wegweisende Botschaften von den hohen Geistern. In Werwölfe verwandelt, liefen einst litauische Bauern in der Vollmondnacht im Mai durch Wald und Wildnis, um gegen die Wintergeister zu kämpfen, die die letzten saatschädigenden Fröste bringen.
Bärenreitender Schamane auf magischer Reise. (Zeichnung auf dem Schamanenkostüm eines Samojeden, Sibirien)
Auch unsere Sagen sind voller weissagender Schwäne, sprechender Pferde, magischer Hirsche und anderer Tiere, die mit schamanischen Persönlichkeiten verkehren. Schamanentum ist auch unser – wenn auch verschüttetes – Erbe. Die Schamanen, die einstigen Rivalen der christlichen Missionare, wurden im Zuge der Bekehrung verteufelt und diskreditiert. Aber noch lange gab es Alte, die in der Gestalt von Wolf oder Bär durch die Wälder streiften, als schwarze Katze auf Samtpfoten durch das nächtliche Dorf schlichen oder als großäugige Eule flogen. Oder ihren Tierfamiliar, ihren spiritus familiaris, ausschickten.
Das von der Inquisition im Spätmittelalter brutal bekämpfte Hexentum ist einer der letzten Ausläufer des alteuropäischen heidnischen Schamanentums (Müller-Ebeling/Rätsch/Storl 1998: 48). Aber auch bei den Christen tauchen gelegentlich Tiere als Verbündete oder Begleitwesen auf: Der Esel bei der Krippe und als Reittier des Jesus, Lukas als Stier, Johannes als Adler, der Heilige Geist als Taube. Und Konrad von Würzburg (1220–1287) sieht den Heiland als ein Wiesel: »Christ der hohe Hermelin, schlüpft in der tiefen Hölle Schlund und biss den mord-giftigen Wurm zu Tode in all seiner Macht.«
Bei den Naturvölkern sind das Schamanentum und der Umgang mit tierischen Schutzgeistern und Verbündeten noch lebendig. Bei den Indianern haben jede Medizinfrau und jeder Medizinmann ein helfendes Tier, das ihnen Kraft gibt, ihnen Träume schickt und sie auf Reisen in die Geisterwelt begleitet. Der Tiergeist kann den Medizinmann oder die Medizinfrau als Kind adoptieren oder sogar heiraten – auch wenn der Betroffene im Alltag schon mit einem menschlichen Gefährten vermählt ist. Es gibt Adlerträumer, Büffelträumer und andere Medizinleute, die mit dem Steppenwolf, den Ameisen oder dem Dachs verbunden sind, und die, in ihrem Charakter und Verhalten auch die Eigenschaften ihres jeweiligen Schutztieres aufweisen. Der Schamane, der den Hirsch als Verbündeten hat, der »Hirschträumer«, wird robust und gesund sein und genießt – wie ein Hirsch mit seinem Harem – die Liebe vieler Frauen. Er kann kranke Frauen heilen und ist in Besitz von Liebesmagie, die Jungen und Mädchen zusammenführen kann (Lame Deer 1976: 155). Der Büffelschamane ist ein großer Seher, einer, der wie ein Büffelstier seinen Stamm sicher führen kann. Der Schlangenmedizinmann, der meistens durch den Biss einer Giftschlange berufen wurde, hat Verbindung zu diesen Reptilien, er kennt die Kräuter und Gesänge, mit denen Schlangenbisse kuriert werden. Die Seele des Wolfsschamanen ist rein wie frisch gefallener Schnee, sie vermag weit in die Wildnis der Geisterwelt zu wandern. Der Hasenmedizinmann ist sehr klug, aber er kann auch, wie ein Hase, vor Schreck sterben (Garrett 2003: 29).
Unter allen Medizinleuten hat der Bärenschamane oder Bärenträumer eine ganz besondere Stellung. Der Bär ist nämlich ein ganz besonderes Tier oder besser, er ist schon fast wie ein Mensch. Ein »Halb-Mensch«, Ukuku, nennen ihn etwa die Quechua sprechenden Indianer in den Anden. Wie Bärenkenner immer wieder berichten, ist jeder Bär eine individuelle Persönlichkeit. Er ist jedoch nicht, wie die menschliche Persönlichkeit, ein abgekapseltes Egowesen, gefangen in einem Netz kulturell vorgegebener, verbaler und symbolischer Konstruktionen. Trotz seiner ausgeprägten Individualität bleibt der Bär innig verbunden mit seiner makrokosmischen Gruppenseele, mit dem großen Bärengeist, mit der Natur. So ist er wie ein Vermittler zwischen den Welten. So haben ihn auch viele Naturvölker erlebt. Für sie ist der Bär kein bloßes Tier; unter seinem Fell verbirgt sich ein göttliches Wesen. Für viele indianische und sibirische Völker, für die Ostjaken, Tungusen, Samojeden und Finnen, ist der Bär ein Mittler zwischen dem Himmelsgott und der Erdgöttin. Der Bär, das Tier der Erde und der Höhlen, ist der Erdgöttin und der fruchtbaren weiblichen Sphäre zugeordnet. Zugleich aber ist er auch der himmlischen Sphäre, der oberen Götter, den befruchtenden Wettergottheiten zugeordnet. Er ist, wie der echte Schamane, Teil von beiden Welten. Er ist Waldtier und Waldmensch. Er ist der kraftvolle Hüter der Pforten zur Anderswelt. Er ist Bote der Götter und als solcher ein wohlwollender Besucher der mittleren Welt, in der die Menschen leben.
Der Bärenschamane hat teil am Wesen des Bären. Als Zeichen dieser Verbundenheit trägt er Bärenmasken, Bärenfell oder ein Halsband oder Amulett aus den Zähnen oder Krallen seines Tiergeisthelfers, und er besitzt auch dessen grimmige Macht, mit der er auch die übelsten Krankheitsdämonen in Angst und Schrecken versetzen kann. So ist ein vom Bärengeist berufener Schamane einer der mächtigsten Heiler. Bei den Kirati, einem im Osten Nepals angesiedelten Stamm, der noch eine alte schamanische Naturreligion befolgt, gilt der Bär (Balu) als der Großvater der Schamanen. Die Bärenkralle, die ihre Schamanen bei sich tragen, gilt als Talisman, als Guru und als Schutz (Müller-Ebeling/Rätsch/Shahi 2000: 177). Als Trommelhäute bevorzugen sie die Haut des Bären. Der Ethnologe Christian Rätsch berichtet, dass Bärenteile nicht von lebenden Bären oder erjagten Exemplaren genommen werden. Um wirklich gut zu wirken, muss der Schamane sie während der Trance finden (Müller-Ebeling et al. 2000: 251). Selbst die Rinde, von einem vom Bären angekratzten Baumstamm, vermittelt noch Kraft. Die Schamanen der mongolischsprachigen Burjaten, die östlich des Baikalsees leben, trocknen und zerkrümeln diese Rinde, um ihren Räucherkräutern besondere Bärenkraft zu verleihen.2
Bärenschamanen: links altsteinzeitliches Ritzbild aus La Marche, Vienne, Frankreich; rechts die bekannte Darstellung eines tungusischen Schamanen mit Bärenpfoten (Nicolas Witsen, 1705).
Der Lehrer der Heilpflanzenkundigen
In den Augen der Indianer und vieler paläosibirischen Völker kennen die Bären nicht nur die Heilkräuter, sondern sie können dieses Wissen auch an die Menschen weitergeben. Nicht nur etwa, dass die Menschen diese Tiere beim Ausbuddeln der Wurzeln und Ausprobieren der Kräuter und Rinden beobachten und daraus ihre Schlüsse ziehen, sondern der Bärengeist kann auch dem Heiler oder Schamanen Träume schicken und Heilinspirationen vermitteln. Demjenigen, dem unvermittelt ein Bär im visionären Traum erschient, der ist zum Kräuterheiler oder Pflanzenschamanen berufen. Der Ojibwa-Medizinmann Siyaka erklärte dem Ethnologen Frances Densmore (Densmore 1928: 324): »Der Bär ist oft recht wild und aufbrausend und doch achtet er auf Pflanzen, die bei anderen Tieren kein Interesse erwecken (...) Für uns ist der Bär der Häuptling der Pflanzenheilkunde, und wir wissen, dass ein Mensch, der von einem Bären träumt, ebenfalls zum begabten Pflanzenheilkundigen wird. Der Bär ist das Tier, das am besten die heilenden Wurzeln kennt, da er solche guten Krallen hat, um diese Wurzeln auszugraben.«
Der berühmte Sioux-Medizinmann Lame Deer erzählt, dass der Wicasa Wakan, der Schamane, seine Kraft (»Medizin«) durch eine Vision oder einen Traum erhält, den ihm ein Tierlehrer zuschickt. »Der Medizinmann kann ein Büffel-, ein Adler-, ein Hirsch- oder ein Bärenträumer sein. Unter den vierbeinigen oder geflügelten Geschöpfen, die dem Menschen Kraftträume schenken, ist der Bär der vortrefflichste. Was Medizin betrifft, ist er der weiseste. Wer von diesem Tier träumt, der kann ein hervorragender Heiler werden. Der Bär ist das einzige Tier, das sich im Traum wie ein Medizinmann verhält, der einem Heilpflanzen zeigt und ganz bestimmte Wurzeln mit seinen Krallen ausgräbt. Oft schickt er den Menschen eine Vision von den Heilmitteln, die sie brauchen.«
Die alten Medizinmänner hatten Bärenkrallen in ihrem Beutel. Sie drückten dem Kranken mit der Kralle ins Fleisch, damit die heilende Bärenkraft in seinen Körper eindringen konnte. Die Lieder der Bärenträumer enden mit den Worten Mato hemakiye – »Ein Bär hat mir das gesagt«. Dann wusste jeder, dieser Medizinmann hatte seine Heilkraft von einem Bären erhalten. Das Richten und Heilen von gebrochenen Knochen war eine der besonderen Begabungen der Bärenträumer. »Ja, diese Bärenmedizinmänner konnten heilen! Wir hatten Leute, die waren neunzig oder hundert Jahre alt und hatten noch alle ihre Zähne!« (Lame Deer 1976: 153).
Bärenschamane. (Nach George Catlin, 1841)
Ähnliches erzählte der Medizinmann der Dakota (Sioux), Two Shields, »Der Bär, der weder vor Menschen noch vor anderen Tieren Angst hat, ist zwar übellaunig, aber er ist das einzige Tier, welches im Traum erscheint und uns die Kräuter zeigt, die den Menschen heilen können« (Densmore 1928: 324). Der Tiefenpsychologe würde dazu sagen, wer sich mit dem »Bären« in der Seele, mit seinen tief verschütteten Instinkten verbinden kann und zugleich klare, scharfe Sinne hat wie der Bär, der wird leicht Zugang zum Verständnis der heilenden Kräuter erlangen.
Wie sehr der Bär als Heiler und Kenner der Heilpflanzen verehrt wurde, erzählt eine Geschichte der östlichen Waldlandindianer.
Eines Tages erschien ein alter Mann im Dorf. Er kam mit leeren Händen, war hungrig und krank. Er stank und seine Haut war mit Geschwüren bedeckt. Beim ersten Wigwam rief er: »Helft mir, ich brauche Unterkunft und etwas zu essen.«
Man schickte ihn weg, denn man hatte Angst, er würde womöglich die Kinder anstecken. Beim zweiten Haus erging es ihm nicht anders, auch hier jagte man ihn fort. So ging es im ganzen Dorf, niemand wollte ihn aufnehmen. Einzig beim letzten Haus hatte er Erfolg. Eine arme Frau, die nur wenige Verwandte hatte und in einem winzig kleinen Wigwam am Dorfrand lebte, hatte Erbarmen, lud ihn ein, gab ihm zu essen und einen Schlafplatz. Da er am nächsten Tag noch kränker war als zuvor, versuchte sie ihn mit den ihr bekannten Mitteln zu heilen. Es half nicht, er wurde noch kränker. Nach mehreren Tagen erzählte er eines Morgens, dass der Große Geist ihn in einem Traum eine Heilpflanze sehen ließ, die ihm helfen würde. Der Alte beschrieb die Pflanze ganz genau, und die Frau suchte und fand sie im Wald. Mit einem Gebet und kleinem Ritual erntete sie die Pflanze und bereitete die Medizin. Nachdem er diese zu sich genommen hatte, ging es ihm besser. Nach einigen Tagen war er gesund und wollte sich verabschieden. Doch plötzlich hatte er einen Fieberanfall und wurde abermals krank. Wieder halfen die Mittel, die die Frau kannte, nicht. Er lag schon am Rande des Todes, als er wieder im Traum eine Heilpflanze sah. Wieder holte die Frau das angegebene Kraut, wieder wurde er gesund. Als er sich abermals verabschieden wollte, fing er an zu zittern und musste sich plötzlich übergeben. Wieder war er krank, wieder erträumte er die richtige Heilpflanze. So ging es ein ganzes Jahr lang. Dann – endlich – war er wirklich ausgeheilt. Er stand von seinem Lager auf und drehte sich noch einmal um, ehe er zur Tür hinausging und sagte: »Der Große Geist hatte mir gesagt, es sei jemand in diesem Dorf, dem ich beibringen soll, wie man Kranke mit Kräutern heilt. Ich wurde zu dir gesandt, um dich zu lehren. Das habe ich getan.«
Er schritt hinaus ins Sonnenlicht, und die Frau schaute ihm verblüfft nach. Gerade als der Alte im Wald verschwand, verwandelte er sich in einen großen Bären. Es war der Bärengeist gewesen, der die Frau zur Kräuterheilerin berufen hatte.
Der Bärenschamane oder Bärenträumer ist aber nicht nur ein Meister der Heilkräuter, sondern er kann, wie bei den Germanen, Römern und Kelten, auch die Krieger inspirieren, ihnen Mut, Kraft und Besonnenheit im Kampf gewähren. Hier nun die Geschichte von einem Pawnee-Indianer, der Bärenschamane und Kriegshäuptling war (Spence 1994: 308):
Bärenschamane der Schwarzfuß-Indianer bei der Heilséance. (Zeichnung nach George Catlin)
Im Stamme der Pawnee lebte ein Junge, der Bären gut nachahmen konnte und der tatsächlich einem Bären glich. Seinen Spielkameraden erzählte er, dass er sich in einen Bären verwandeln könne, wann immer er es wolle.
Vor vielen Jahren, noch ehe der Junge geboren wurde, befand sich sein Vater auf dem Kriegspfad. Da, weit weg von zu Hause, traf er auf einen Bärenwelpen. Das Bärchen war so klein und hilflos und schaute ihn so traurig an, dass er es aufhob, ihm einige Tabakblätter um den Hals band und ihm sagte: »Ich weiß, der Große Geist Tirawa wird dich beschützen, aber ich konnte nicht einfach an dir vorbeigehen, ohne dir diese heiligen Tabakblätter zu schenken, um zu zeigen, dass ich dir gut gesinnt bin. Ich hoffe, dass auch mein noch ungeborener Sohn von den Tieren gut behandelt wird, und dass ihr ihm helft, ein großer weiser Mann zu werden.«
Als der Krieger wieder zu Hause war, erzählte er seiner Frau von der Begegnung mit dem kleinen Bären. Da dachte die Frau viel über Bären nach. Die Indianer aber glauben, dass eine schwangere Frau nicht zu lange oder zu oft an ein bestimmtes Tier denken soll, denn sonst würde das Kind diesem Tier gleichen. Und so war es auch. Als der Junge älter wurde, ging er oft allein in den Wald; er war von Bären fasziniert und verehrte sie mit kleinen Ritualen.
Als er erwachsen war, zog er einmal mit einer Truppe Krieger auf dem Kriegspfad gegen die Sioux. Sie waren weit weg von ihrem Pawnee-Dorf, als sie in einer steinigen, von Wacholdersträuchern bewachsenen Schlucht in einen Hinterhalt gerieten. Es gelang den Sioux, alle Pawnee-Krieger zu töten und anschließend zu skalpieren. Viele Bären lebten in dieser Schlucht. Eine Bärin erkannte sofort, dass sich unter den Getöteten auch derjenige befand, der ihnen Rauchopfer gebracht, Bärenlieder gesungen und ihnen anderes Gutes getan hatte. Die Bärin sagte zu ihrem Gefährten: »Lasst uns diesen Menschen wiederbeleben!«
Der Medizinbär antwortete: »Das ist fast unmöglich. Wenn es dunkel oder bewölkt ist, wird es nicht gehen, nur wenn die Sonne scheint. Aber ich werde mein Bestes tun.«
An dem Tag schien die Sonne nur ab und zu. Dennoch legten sie den geschundenen Leichnam auf ein Bett aus Beifuss, bliesen ihm Tabakrauch ins Gesicht, besangen ihn und rieben ihn mit Kräutern ein. Allmählich kam das Leben in den Körper zurück. Endlich war er wieder bei vollem Bewusstsein und sah die beiden Bären. An das, was geschehen war, konnte er sich jedoch nicht erinnern. Die Bären erzählten es ihm und nahmen ihn mit in ihre Höhle, wo sie ihn bis zur vollen Gesundheit pflegten. Sie brachten ihm all ihr Wissen bei – und das war sehr viel, denn Bären sind die weisesten Tiere. Ehe er schließlich in sein Dorf zurückkehren wollte, sagten sie ihm, er solle nicht aufhören die Bären zu imitieren und die Bärenlieder zu singen, denn das würde ihm Erfolg im Leben bringen.
Der Medizinbär, der das Wiederbelebungsritual ausgeführt hatte, sagte noch: »Ich werde dir immer beistehen, Bären-Mann. Wenn ich sterbe, wirst auch du sterben; werde ich alt, so wirst auch du alt werden.« Anschließend deutete er auf einen Wacholderbaum: »Dieser Baum soll dein Beschützer sein. Der Wacholder wird nie alt, immer ist er frisch und schön. Er ist ein Geschenk des Großen Geistes. Wenn ein Gewittersturm kommt, wirst du ihn stillen können; wirf einige Zweige ins Feuer, dann wird kein Unheil geschehen.«
Zuletzt gab er dem Mann eine Bärenfellmütze. Die brauchte er, denn da die Sioux ihn skalpiert hatten, hatte er keine Haare mehr auf dem Kopf.
Als er im Dorf ankam, konnten die anderen es kaum glauben, dass er es war. Man glaubte er sei gefallen. Schließlich erkannten ihn seine Eltern. Nachdem er seine Freunde umarmt und ihnen von den Bären, denen er sein Leben verdankt, erzählt hatte, ging er zu den Bären, die unweit vom Dorf warteten und brachte ihnen Tabak, wohlriechendes Lehmpulver, Büffelfleisch und Flussperlen. Der Medizinbär umarmte ihn und sprach: »Da mein Pelz dich berührt hat, wirst du ein großer Mann sein; da meine Tatzen deine Hände berührt haben, wirst du furchtlos sein; da mein Mund deinen Mund berührt hat, wirst du weise sein.«
Nachdem diese Worte gesprochen wurden, gingen die Bären fort. Es waren wahre Worte. Bären-Mann wurde einer der größten Krieger seines Stammes. Er wurde Medizinmann und brachte den Pawnee den Bärentanz bei, den sie noch immer tanzen. Er wurde alt und genoss hohes Ansehen bei seinem Volk.
Die Geschichte erzählt von der Initiation eines Bärenmedizinmannes. Der Jüngling starb und wurde von den Tieren wiederbelebt, dabei wurde ihm seine wahre Aufgabe im Leben offenbart. Wenn die Indianer einen Bären erlegen, dann führen sie eine ähnliche Wiederbelebungszeremonie aus, damit sich der Bärengeist erneut verkörpern kann.
Die Heilerhaltung oder Bärenhaltung
Der Bär zieht seine größte Kraft aus seiner Mitte, aus seinem Sonnengeflecht (plexus solaris), jenem Kraftzentrum, das sich zwischen dem Bauchnabel und dem Herzzentrum befindet. Das ist offensichtlich, wenn man die Bären beobachtet. Der Bärenschamane bezieht ebenfalls seine Kraft aus diesem Zentrum, welches die Hindus das Manipurna Chakra nennen. Der indische Weise Sivananda sagt dazu: »Der Yogi, der sich auf dieses Chakra konzentriert, erlangt fortwährende Siddhi3 und vermag verborgene Schätze zu finden. Er ist von allen Krankheiten befreit und kennt keine Furcht vor Feuer« (in Friedrichs 1996: 53). Auch Carlos Castaneda beschreibt den Solarplexus als die Quelle der magischen Kräfte der Schamanen.
Bärengeist. (Zeichnung von Nana Nauwald)
Das unter dem Zwerchfell liegende Gangliengeflecht des sympathischen Nervensystems reagiert als erstes bei plötzlichem Schock oder Panik. Das Gefühl kann als »Schlag in die Magengrube« beschrieben werden. Andererseits kann es auch als plötzliche Energieentladung erfahren werden, wobei der Erschrockene reflexartig reagiert und blitzschnell den übermächtigen Feind überrumpelt oder durch mutigen Zugriff dem Freund das Leben rettet. Oft spüren Schamanen oder spiritistische Medien während ihrer so genannten AKE-Zustände (außerkörperliche Erfahrungen), dass sich dabei das Sonnengeflecht »öffnet«. Der »geistige Leib« – so die Aussagen spiritistischer Medien – schwebt an einer hauchdünnen »Silberschnur« aus diesem Energiezentrum heraus und erfährt nicht-sinnliche Dimensionen (Storl 1974: 206).
Die Verbindung dieses Chakras mit dem Bärengeist und seiner Heilkraft zeigt sich auch in den sorgfältig durchgeführten Studien von Felicitas Goodman. Die Kulturanthropologin untersuchte Trancezustände und die verschiedenen Körperstellungen, die die Schamanen dabei annehmen, wenn sie mit einer Gottheit oder einem Tiergeist in Verbindung treten. Jedes Geistwesen fordert vom Menschen eine bestimmte Körperhaltung, wenn dieser mit ihm in Verbindung treten will. Die »Bärenhaltung« – auch Heilerhaltung genannt –, die es ermöglicht, sich gegenüber dem Bärengeist zu öffnen und seine Heilkraft einfließen zu lassen, wird gewöhnlich stehend eingenommen. Dabei liegen die eingerollten Hände so über dem Nabel, dass die ersten Knöchel der Zeigefinger sich berühren. Die Knie sind leicht gebeugt, und die Füße stehen parallel zueinander fest auf dem Boden (Goodman 1995: 165). Diese Bärenhaltung lässt sich auch in Statuen und Schnitzereien in vielen historischen und auch gegenwärtigen Kulturen nachweisen.
»Schamane in Kontakt mit dem Bärengeist«: Holz schnitzerei der Giljaken, Sibirien; rechts Menhir, Saint-Germain-sur-Rance, Frankreich, 2000 v.u.Z.
Bärenhöhlen und Neandertaler
»Europa. ›Der Westen‹,
da sind die Bären verschwunden,
außer vielleicht Brünhilde?
Oder die Wiedergeburt älterer wilderer Göttinnen
– rasend
durch die Straßen Frankreichs und Spaniens
mit Maschinenpistolen –
In Spanien
Bären und Bison,
Rote Hände, an denen Finger fehlen,
Rote Pilzlabyrinthe;
Blitzstrahlnetze,
in Höhlen gemalt,
Underground.«
Gary Snyder, Der Weg nach Westen, Underground
Der dicke Carlo wohnt abseits am Waldrand in einer säuberlich herausgeputzten Köhlerhütte. Dort hat er sich auch eine Schmiede und Werkstatt eingerichtet. In dieser arbeitet er auf seine brummelige, gemütliche Weise vor sich hin, probiert ungewöhnliche Metalllegierungen, schnitzt an Knochen, Hörnern und Geweihstückchen und schleift die hier und da gesammelten, glitzernden Steinchen zu wertvollen Schmuckgegenständen. »Müllbär« nennen ihn so manche, denn nicht selten durchstöbert er die Abfallhalden nach brauchbaren Gegenständen, und jeder Sperrmülltag bedeutet einen Beutezug für ihn. Er selbst gibt sich als »freischaffender Künstler« aus, ein Etikett, das es ihm erlaubt, in aller Würde ein ungewöhnliches Leben zu führen.
Eines Tages tuckerte dieser Carlo mit einer Fuhre Winterholz an unserem Hof vorbei. Er hielt an, um uns einen guten Tag zu wünschen. Ja, ’s Tässli Kaffee würde er schon nicht abschlagen. Aber nicht extra einen kochen. Kalter Kaffee sei ihm recht, nur müsse etwas Zucker drin sein.
»So, du Bücherschreiber, kannst die Blätter nicht an den Bäumen lassen, was?«, zwinkerte er mir zu. »Woran schreibst du denn im Augenblick?«
Ich erzählte ihm von der Stadt Bern, den vielen Bärengaststätten und Bärenbrunnen, dem Bärengraben mit lebenden Petzen drin und dass diese Stadt vor genau achthundert Jahren von dem Herzog von Zähringen gegründet worden war, nachdem dieser in einem Buchenwald an der Aareschleife einen Bären erlegt hatte.
»Nun ist mir etwas Eigenartiges passiert«, redete ich weiter, »als ich aus Bern zurückkam und hier durch diesen Wald den Berg hinaufwanderte. Wahrscheinlich war ich von der langen Reise übermüdet, hatte ja kaum geschlafen. Jedenfalls war mir zumute ... ja, wie soll ich sagen ... als ginge ich durch einen Märchenwald. Und plötzlich spricht dieser Wald zu mir – diese Tannen und Buchen, diese Farne und Felsen – und sagt, es sei so traurig, dass es hier keine Bären mehr gäbe!«
Ein schwer zu deutender Blick schoss aus Carlos Augen, aber er schwieg, nahm nur einen Schluck aus der Tasse.
»Ja, und dann, in der Nacht, träumte ich sogar von einem riesigen Bären. Ich träumte, er stehe über unserem Bett und lecke unserem Sohn das Gesicht. Und im selben Augenblick wacht der Bub weinend auf!«
»Hm«, brummte Carlo und stich sich dabei über den Bart.
»Es ist sonderbar«, fuhr ich fort, »denn auch meine Frau Marie träumte von einem solchen Tier, einem mächtigen Koloss, der mit den Tatzen fuchtelte, wobei helles Licht aus seinen Krallen aufblitzte, als schlage er Funken aus der Luft!«
»Da willst du also den Leuten etwas über Bären erzählen«, sagte Carlo mit ruhiger Stimme, in der dennoch eine gewisse Erregung mitzuschwingen schien.
»Ja, das stimmt. Weißt du etwa etwas über Bären?«, fragte ich ihn, ohne irgendeine bedeutsame Antwort zu erwarten. Schließlich hatte er die Schulmauern hauptsächlich von außen gesehen und mit dem Lesen hatte er auch nicht viel am Hut. Doch er blickte mich an, als wäre er bereit, mir ein wichtiges Geheimnis zu verraten.
»Weißt, Bären sind wie Menschen. Sie haben Seelen wie Menschen. Nur, eben wie die Menschen von ganz früher, als diese noch frei und wild in der Natur lebten, ehe sie eng und ängstlich wurden und sich von anderen Lebewesen absonderten. Verstehst? Schau, da drüben, der Säntis ...«
Ich schaute über die Bodenseesenke, hinüber ins St. Galler Land und ins Appenzell, das von unserem Allgäuer Berghof aus gut zu sehen ist. Opalblau leuchtend ragte der Schneeberg in den Himmel empor.
»Da sind Höhlen. Drachenloch, Wildenmannlisloch, Wildkirchli und so ähnlich heißen sie. Da haben die Neandertaler, die frühen Steinzeitmenschen, friedlich mit den Bären zusammengelebt. Damals verstanden die Menschen noch die Sprache der Tiere. Primitiv nennt man die Neandertaler, blöd und kulturlos, dabei sind wir die Primitiven oder eigentlich die Degenerierten! Primitiv heißt nämlich mit dem Ursprünglichen, mit der Natur verbunden sein.
Eigentlich machten diese Neandertaler keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Menschen und Tieren, zwischen Menschen und Bären schon gar nicht. Selbstverständlich galt der Bär, der mit ihnen die Höhlen teilte, als besonders mächtig, als heilig. Er konnte ihnen Schutz gegen Wölfe oder heißhungrige Säbelzahntiger gewähren. Die Höhlenmenschen behielten auch die Schädel und Knochen der Bären und bestatteten sie sorgfältig, damit der Bärengeist bei ihnen bleibe. Und wenn sie Bären jagten, um warme Pelze zu bekommen oder Bärenschmalz für ihre Wunden und Krankheiten, dann taten sie es nur mit der Erlaubnis des Bärengeistes, und auch nur zu ganz bestimmten Zeiten. Dann tranken sie auch das Blut des erlegten Tieres, um sich dessen Macht anzueignen. Die Krallen hängten sie um den Hals ihrer Kinder, damit der mächtige Bärengeist auch sie vor allen Gefahren schütze.
Ja, diese Menschen lebten mit den Bären! Das gibt es übrigens auch noch bei einigen primitiven Jägervölkern irgendwo in Ostasien, dass sie sich einen Bären als geehrten Gast im Dorf halten!«
Carlo sprach, wie einer, der das alles selbst erlebt hatte, entweder als Neandertaler oder als Höhlenbär. Er sprach mit der Autorität eines Sehers. Bären als Freunde und Wohngenossen der Steinzeitmenschen! Ähnliches behaupten die Theosophen und andere Esoteriker. Im »atlantischen Zeitalter« seien die Menschen hellsichtig gewesen. Mit Göttern und Heroen seien sie einhergeschritten und mit den »Gruppenseelen« der Tiere hätten sie ohne Furcht oder Aberglaube verkehren können. Mittels Kulthandlungen, Riten und Zeremonien hätten sie mit ihnen, und auch mit dem Bärengeist, kommuniziert. Aber welcher seriöse Wissenschaftler kann solche Aussagen schon ernst nehmen?
Die Professoren, bei denen ich Urgeschichte studiert habe, hatten das grundsätzlich anders gesehen. Da war stets vom unerbittlichen Kampf ums Überleben die Rede, von Konkurrenzkämpfen mit den zotteligen Ungeheuern um den Besitz der schutzgewährenden Höhlen, von tierähnlichen Hominiden, die mit Rauch und Lärm, Fallgruben und niederrollenden Felsbrocken den Tieren diese Orte streitig machen wollten. Survival of the fittest (»Überleben des Stärkeren«), hieß demnach die Parole der Steinzeit. Nicht nur den Wohnraum wollten sie dem Bären streitig machen, sie gierten auch nach seinem Fleisch und Fett, um sich den ständigen Hunger vom Leibe zu halten. Sie begehrten seine Knochen, um Schaber und Dolche daraus anzufertigen, seine Sehnen als Bindfäden, seinen Pelz als Decken, seine Unterkiefer als Schlagwaffe, seine Zähne als magische Anhängsel. Schon immer sei der Mensch der skrupellose Ausbeuter, der ewige Homo oeconomicus gewesen!
So stellt man sich die Neandertaler bei der Jagd auf den Höhlenbär vor.
Irrationaler Aberglaube oder Furcht hätte diese Frühmenschen dazu getrieben, Bärenschädel zu bestatten und Bärenbilder an die Höhlenwände zu kritzeln. Von »Abwehrzauber« sprechen die Kulturanthropologen, und die Psychologen entdecken darin den gesicherten Beweis für die damals schon grassierende Urangst.
War es nun so, wie es Carlo – der mir immer mehr wie ein Mensch gewordener Bär vorkam – erzählt hatte? Oder hatten die hochgelehrten Professoren Recht? Übertrugen diese etwa ihre eigene Raffgier und ihre Angst vor der Natur, auch der eigenen inneren »wilden« Natur, auf Bär und Wildmensch? Dienten die spärlichen Funde, die Ausgrabungen und Höhlenforschungen zutage förderten, als Projektionsflächen eines doch nicht so eindeutig objektiven Weltbildes?
Eine mysteriöse Frau
Carlo hatte seinen kalten Kaffee ausgetrunken und sich wieder auf den Weg gemacht. Noch lange schaute ich sinnend auf die Appenzeller Berge hinüber und dachte über Berghöhlen und Neandertaler nach.
Der Neandertaler – eine alte Menschenrasse, vierschrötig, mit starken Knochen, Unterkiefern mit fliehendem Kinn, dicken Wülsten über den Augen und einem Gehirnvolumen, das das der modernen Menschen sogar leicht übertrifft. Während der mittleren Altsteinzeit, also während der Zwischeneiszeit und der letzten Eiszeit, besiedelten die Neandertaler den Nahen Osten, Nordafrika und den Zipfel des asiatischen Erdteils, den man heute Europa nennt.
Vom ersten Neandertalerskelett, das zufällig 1856 entdeckt wurde, glaubten die Experten, es handle sich lediglich um die Reste eines »pathologischen Idioten« oder eventuell um einen Kosaken, der beim Rückzug der Grande Armée Napoleons übriggeblieben und gestorben war. Als dann noch andere ähnliche Schädel und Knochenreste entdeckt wurden, glaubten die Anhänger Darwins, einen Beweis für ihre Evolutionstheorie gefunden zu haben, nämlich ein Zwischenglied zwischen dem modernen Homo sapiens und seinem Affenurahn. Es wurde theoretisiert, dass es sich bei dem Neandertaler um eine minderwertige menschliche Urrasse gehandelt habe, die später im Kampf ums Überleben von dem höher entwickelten Homo sapiens restlos ausgerottet wurde. Als immer mehr Tatsachen zum Vorschein kamen, brach diese theoretische Konstruktion wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Die Neandertaler kannten nämlich nicht nur das Feuer, sie fertigten auch mit ausgeprägtem Stilgefühl brauchbare Klingen, Hämmer, Schaber und Speerspitzen aus Feuerstein und nähten mit Sehnen und Riemen Pelze zu Kleidung und Zelten zusammen. Sie hatten also eine Kultur, die es ihnen erlaubte, die Schneestürme und krassen Temperatureinbrüche der Eiszeit gut zu überstehen.
Offensichtlich waren sie auch im Besitz einer geistigen Kultur – Erfahrung und ein Wissen um die für uns »unsichtbaren Dinge«. Sie bestatteten ihre Toten mit Grabbeigaben. Mal umlegten sie die Grabstätten mit Wildziegenhörnern (in Usbekistan), mal färbten sie die Knochen der Verstorbenen mit rotem Ocker, mal betteten sie mehrere Tote in ein mit blühenden Kräutern und Wildblumen ausgelegtes Grab (im irakischen Kurdistan). Natürlich haben sich die Wildkräuter nicht bis heute erhalten, aber Pollenanalysen geben sogar Aufschluss über die einzelnen Arten. Es waren vor allem Heilkräuter, die in der Pflanzenheilkunde noch immer eine Rolle spielen. Lange war man der Überzeugung, dass die Neandertaler, ähnlich den Schimpansen oder Gorillas, keine sprachlichen Fähigkeiten besäßen. 1989 fand man jedoch in Kebara (Israel) das sechzigtausend Jahre alte Zungenbein (os hyoideum) eines Neandertalers. Inzwischen besteht kein Zweifel mehr, dass diese Menschen im Besitz von Sprache waren. Auch Musik war ihnen nicht fremd. 1995 entdeckte man in einer Höhle in Slowenien eine 50 000 Jahre alte »Blockflöte« mit vier Fingerlöchern, hergestellt aus dem Oberschenkelknochen eines jungen Bären. Professor Jelle Atema von der Boston University entlockte dieser Bärenflöte sanfte harmonische Töne.
Ganz besonders war das geistig-spirituelle Leben dieser Frühmenschen mit dem Bären verbunden, so dass Urgeschichtler von einem regelrechten Bärenkult der Neandertaler sprechen. Auch die Bären wurden bestattet. An mehreren Fundorten in Europa – in den Karawanken, in Jugoslawien, im fränkischen Jura – findet man Nachweise dieses recht eigenartig anmutenden Brauchs. In Regourdou (Dordogne, Südfrankreich) entdeckten Forscher eine mit Steinen ausgelegte rechteckige Grube, in der sich zwanzig Bärenschädel befanden. Die Grube war mit einer schweren Steinplatte bedeckt. In einem Neandertalergrab fand man auch den Oberarmknochen eines Bären. Spuren deuten an, dass einige Neandertaler in Bärenfelle gehüllt bestattet wurden (Sanders 2002: 153).
Neandertaler beim Errichten eines Bärenaltars. (Zeichnung von Martin Tiefenthaler)
Landkarte der paläolithischen Bärenhöhlen in der Ostschweiz.