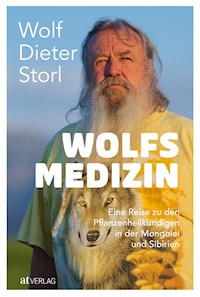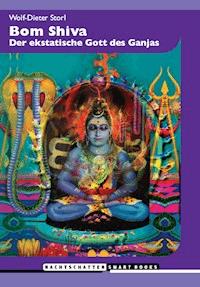19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Für Wolf-Dieter Storl sind Pflanzen Persönlichkeiten mit eigenem Wesen – sie sind seine pflanzlichen Verbündeten. Im Mittelpunkt dieses sehr persönlichen Buchs stehen die Pflanzen, die sein Leben geprägt haben. Ob Kanadische Goldrute, Weberkarde oder Schwarze Tollkirsche, jede hat eine ganz besondere Bedeutung und mit jeder verbinden ihn eigene Erlebnisse, von denen er fesselnd und lebendig erzählt. Ein Lesegenuss für alle, die es ihm gleichtun wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Stattdessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
Zitat
Reinige deinen Körper mit Gebet, Fasten und langen Wanderungen im Wald. Atme tief ein, öffne dich den Geistern der Pflanzen, die die großen Heiler der Seele sind. Nimm von dir selbst Abstand und gib dich vertrauensvoll dem heilsamen Atem der Natur hin. Indianische Weisheit; Jean-Paul Bourre
Hinweis
Hinweis: Der Autor ist kein Heilpraktiker und gibt auch keine Konsultationen. Er möchte lediglich seine Erfahrungen mit Pflanzen, insbesondere Heilpflanzen, aus persönlicher wie auch kulturanthropologischer Sicht schildern – in der Absicht, das Vertrauen des Lesers in die Heilkräfte der Natur zu stärken und daran zu erinnern, dass letztlich jeder mündige Mensch selbst die Verantwortung für seine Gesundheit trägt. Auch wenn der Ansatz gelegentlich scheinbar kritisch ausfällt, ist es nicht die Absicht des Autors, die Errungenschaften der modernen Medizin zu schmälern.
Pflanzen sind mehr als sie scheinen
Suchst du das Höchste, das Größte?
Die Pflanze kann es dich lehren.
Was sie willenlos ist,
sei du es wollend – das ist's!
Friedrich Schiller, „Das Höchste“
In Indien sucht der Suchende seinen Guru. Von ihm, der in unzähligen Lebensläufen Erleuchtung und Weisheit gefunden hat, erhofft sich der Suchende das Heil und die wahre Selbsterkenntnis. Richtiger wäre es jedoch, zu sagen, dass der Guru seinen „Schüler“ sucht. Es ist nicht nur seine Aufgabe, es ist auch des Gurus Freude und Wonne, den Schüler an der Wonne, die er wie eine leuchtende Sonne in sich trägt, teilhaben zu lassen. Der Guru selbst ist die Sonne, die die ungezählten Seelenpflänzchen freudig wachsen lässt.
Der Guru ist kein gewöhnlicher Mensch, er gleicht einem Gefäß, das vollkommen leer ist und mit göttlichem Licht oder mit göttlich berauschender Ambrosia gefüllt ist. Er ist leer, weil sein Karma ausgebrannt ist und so nur noch aus weißer, reiner, etwas bitterer Asche besteht.
Der Guru, der Lehrer beziehungsweise Führer der Seele, erscheint uns Menschen meistens in menschlicher Gestalt: in Südasien als ein Heiliger, der am Gangesufer oder in einer Höhle im Himalaja sitzt, im christlichen Westen als der Heiland, der an der Herzenstür klopft, bei den Muslimen in der Erscheinung Mohammeds, der von Allah kündet. Bei den Indianern und anderen naturnahen Völkern kann der Führer der Seele auch als Tier, zum Beispiel als Bär, Wolf, Kojote, Adler oder Käfer, erscheinen – oder gar als Pflanze, als Stein, als Berg, als ein See, als Wogen des Meeres.
Pflanzen sind besonders machtvolle Gurus. Von solchen Pflanzen, die mein Leben veränderten und von denen ich viel lernte, will ich hier erzählen. Es sind Pflanzen, auf die ich gestoßen bin oder die – wie die Indianer sagen würden – mich gesucht haben, um meine „Verbündeten“ zu werden.
Pflanzen sind machtvolle Gurus, weil ihr Dasein die reinste Meditation ist. Was tun sie denn anderes, als in absoluter Stille zu verweilen und mit ihrem grünen Laub das Licht der Sonne aufzunehmen – der Sonne, die das ewige, alles erhaltende OM, den Urton der Schöpfung, unablässig aus sich herausströmen lässt. Mit ihrem Netzwerk von Wurzeln sind die Pflanzen mit dem Gegenpol zum Himmelslicht, mit der feuchten, dunklen Erde, mit der Pilzwelt, dem Wasser und den Mineralien, verbunden.
Diese Wesen, deren Blut grün ist, schöpfen aus beiden Quellen: aus dem Dunkel der Erde und aus dem Licht der Sonne und des Sternenkosmos. Ihre Meditation ist reinste Wonne. Wer es vermag, sich in Gedankenleere neben eine Pflanze, sei es ein Kraut oder ein Baum, zu setzen und an ihrer Stille teilzuhaben – sich sozusagen in ihre Meditation „einzuklinken“ –, der wird diese Wonne selbst erfahren können. Diese hohen Meister der Meditation sind aufgrund ebendieser Meditation selbst zu Quellen geworden, an denen sich alle Wesen laben. Wie nebenbei säubern Pflanzen die Atmosphäre, atmen den Sauerstoff aus, den alle Lebewesen als Lebenselixier brauchen, bringen aus sich Nahrung für Pilze, Kleinstlebewesen und Tiere in unerschöpflicher Fülle hervor, geben dem Menschen sein täglich Brot, seine Kleidung, seine Behausung und erfreuen seine Sinne mit bunten, duftenden Blumen und grünen Landschaften.
In ihren stillen Meditationen verbinden sie das, was uns als Gegensatz erscheint: Himmel und Erde – den Vater und die Mutter des Daseins –, die Höhen und die Tiefen, Licht und Dunkel, Wasser und Feuer. Pflanzen sind diesseitig, aber auch jenseitig. Ihre lebendige Leiblichkeit ist hier vor unseren Augen ausgebreitet und unseren fünf Sinnen zugänglich; ihre Geistseele weilt dagegen in der „Anderswelt“, in der geistigen Dimension, bei den Göttern und Engelwesen und bei den Seelen der Verstorbenen, die der Wiederverkörperung harren. Wenn wir unser Bewusstsein nach innen wenden, wenn wir die inneren Sinne – das Seelenauge – öffnen, dann können sie uns mit hineinnehmen in diese „Anderswelt“. Und da sie wie eine Brücke beide Dimensionen verbinden, können sie uns auch wieder sicher zurückführen auf die diesseitige Seite.
Die Pflanzen verbinden alles; sie sind nicht gespalten, sie sind heil, das heißt heilig. Deswegen können sie heilen und Zerbrochenes wieder herstellen: kaputte, geschundene Körper ebenso wie leidvolles Schicksal, das die karmische Folge von Neid, Gier, Geiz, Hass und anderen Dummheiten ist.
Jede Pflanzenart heilt auf ihre Art und Weise. Jede hat ihr ganz besonderes Verhältnis zu den kosmischen Rhythmen, zu den Jahreszeiten, zu Sonne, Mond und den Planeten. Manche, wie der Bärlauch, stecken voller Frühlingskräfte, im Mai verblühen sie und ziehen sich wieder unter die Erde zurück; andere, wie das Johanniskraut, haben ihre hohe Zeit im Mittsommer, wieder andere dagegen, wie die Astern, Berufskräuter und Goldruten, im Herbst; und einige wenige, wie die Herbstzeitlose oder die Nieswurz, sogar im Winter.
Jede Art hat ihr besonderes Verhältnis zur Erde und zum Wasser: Einige wurzeln tief, andere nicht, einige brauchen Schatten, andere volles Licht, einige leben in Sümpfen, andere auf trockenen, steinigen Böden. Jede Art ist ein Archetypus und in dem Sinn ein Individuum, ein eigenes Wesen, eine „Persönlichkeit“. Jede Art – das wusste man noch im Mittelalter – ist mit einer Region des Tierkreises verbunden und hat eine besondere Beziehung zu einem oder mehreren Planeten. Und wenn so ein als Pflanze inkarnierter Archetypus dich auserwählt, indem er an dein Bewusstsein anklopft wie der Heiland an der Seelentür, und du nimmst ihn aus freiem Willen als deinen Freund an und öffnest ihm die Tür, dann kann er auch deine Zerbrochenheit heilen.
Die Pflanzen suchen dich. Sie suchen sich Menschen, so wie der Mensch sich ein Haustier suchen würde, mit dem er Kurzweil treiben und seine Freude haben kann.
Eine andere Art, Pflanzen zu verstehen
Für einen studierten Biologen grenzen solche Gedankengänge natürlich an Wahnsinn. Mein Freund Harald, ein Arzt für Allgemeinmedizin, hält auch nicht viel davon. Er fragte: „Pflanzliche Verbündete, wie soll man das verstehen? Wie können Pflanzen Verbündete sein? Das würde ja voraussetzen, dass sie ansprechbare Persönlichkeiten sind, dass sie fühlen und denken können. Dabei handelt es sich bei ihnen doch nur um stumme, vor sich hin wuchernde Zellgebilde – zugegeben, mit genetischer Programmierung, aber ohne Nerven, ohne Hirn, ohne innere Organe und völlig ohne Bewusstsein. Das weiß doch jedes Schulkind! Kein Zweifel, sie haben ästhetische Reize, können als Symbole herhalten – etwa die Rose als Symbol für weibliche Schönheit, das Veilchen als Zeichen der Demut –, können Poeten zu lyrischen Höhenflügen anregen. Aber das sind unsere subjektiven Empfindungen. Ob sie an sich schön sind, das sei dahingestellt. Und selbstverständlich ist ihr wirtschaftlicher Nutzen enorm … Wie kommst du überhaupt auf solch merkwürdige Ideen?“
Ich erzählte ihm von meinen Wanderungen mit dem alten Cheyenne-Medizinmann Tallbull, der mit den Pflanzen, dem „grünen Volk“, redete und nicht nur über sie, der ihnen im Herbst „Decken“ – kleine Stoffstreifen – brachte, damit sie es im Winter nicht zu kalt haben, der mit dem „Pflanzenhäuptling“ Tabak rauchte, wenn er ihn darum bat, Heilpflanzen sammeln zu dürfen. Der alte Indianer, der das tat, war kein Spinner, sondern ein Stammesältester, der höchste Verantwortung trug. Auch erzählte ich meinem skeptischen Freund von Schamanen aus aller Welt, die es ganz ähnlich tun, und von unseren eigenen heidnischen Vorfahren, die – wie etwa der angelsächsische Neunkräutersegen (Lacnunga) zeigt – die Pflanzen mit wohlerwogenen Worten anredeten, so wie man Fürsten oder Gottheiten anredete.
„Ach so? Die Indianer haben es dir gesagt?“, meinte er mit einer wegwerfenden Geste. Er glaubte nun mal an den Fortschritt. „Nun, das ist sehr interessant, aber es entspricht nicht der Realität. Es handelt sich um kollektive Fantasien, die sich mittels moderner Psychologie, insbesondere durch Hirnforschungen und Psychoanalyse, erklären lassen. Glaubst du das etwa nicht? Du sagst, diese Vorstellungen beruhen auf Visionserlebnissen der Indianer und anderer Naturvölker? Nun, Visionssuche ist lediglich eine psychosomatische Technik, die wahrscheinlich schon in der Steinzeit entwickelt wurde und die durch Fasten, Schlafentzug und eventuell durch Einnahme toxischer Substanzen, also Psychopharmaka, eine Art Nahtoderfahrung induziert, sodass Halluzinationen erzeugt werden. Diese sind aber rein subjektiv und entsprechen keiner Realität. Redende Bäume gibt es nicht. Und auch nicht Verbündete aus dem Reich des „grünen Volkes“.“
„Du schaust ja nur auf die Oberfläche und begnügst dich lediglich mit dem, was man wiegen und messen kann“, versuchte ich, mich zu verteidigen. „Das ist aber gar nicht so modern, wie du glaubst, Harald. Das ist der Materialismus des 19. Jahrhunderts, das ist der sogenannte Reduktionismus. Egal, für mich sind Pflanzen Persönlichkeiten. Und mit dieser Auffassung bin ich im Einklang mit den Erfahrungen der meisten alten Kulturen, bei denen sie als mächtige Wesenheiten, als Devas, Gottheiten oder, im Sinne der christlichen Mythologie, als Ausdruck der Engel der höheren Hierarchien gelten. Wenn sie mit uns reden, dann ist es weniger in der Sprache unseres alltäglichen Verstandes, sondern sie durchfluten mit ihren Inspirationen die tiefen Regionen unserer Seele; Regionen sind das, die für die meisten von uns unbewusst sind. Yogis, Schamanen, Indianer auf Visionssuche und Meditierende können sie hören. Sie sprechen aus Dimensionen, die dem nahekommen, was wir als Ewigkeit bezeichnen. Ja, sie selbst sind Brücken zu dieser Ewigkeit. Ihre physischen Körper – das sind die vielen sinnlich greifbaren, grünen Pflanzen, denen wir tagtäglich begegnen – befinden sich in der Dimension der Zeit und Vergänglichkeit, aber ihre Seelen streifen diesen Körper nur, und wenn sie das tun, dann erblühen die sichtbaren Pflanzengebilde in frischen, bunten Farben, duften und schwitzen süßen Nektar aus. Ihr Geist jedoch, ihr ‚Ich‘, bleibt ewig ungeboren, bleibt makrokosmisch und eins mit der Ewigkeit.“
„Klingt reichlich mystisch, um nicht zu sagen psychiatrieverdächtig“, erwiderte er zweifelnd. „Du glaubst also, dass jede Pflanze eine Gottheit ist? Und du redest mit ihr? Wenn du sonst nicht so vernünftig wärst, könnte man Angst um dich kriegen.“
Ich wollte ihm noch sagen, dass nicht die einzelne Pflanze ein Deva ist, aber jede Art. So ist der Deva der Kartoffel mit jeder Kartoffelstaude auf der ganzen Welt verbunden und jedes Gänseblümchen ist Teil des Gänseblümchenarchetypus. Aber darauf wollte er sich nicht weiter einlassen.
Geheime Herrscher
Pflanzen haben die Geschicke ganzer Nationen beeinflusst. Wegen Gewürzen zogen die ersten Entdecker, wie Christoph Kolumbus, Vasco da Gama und andere, aus und erschütterten mit ihren Entdeckungen das herkömmliche Weltbild des christlichen Universums. Kartoffeln, Mais, Bohnen und andere Nahrungspflanzen aus der Neuen Welt ermöglichten eine weltweite Bevölkerungszunahme von vorher unbekanntem Ausmaß. Der Anbau von Zuckerrohr, später Tabak und Baumwolle entvölkerte weite Teile Afrikas, da man Arbeitssklaven in der Neuen Welt brauchte. Ohne diese Pflanzen hätte es keinen Reggae, Kalypso, Blues, Jazz oder Samba gegeben; ohne Hopfen und Malz keine bayrische Blasmusik; ohne den Kaffeestrauch keine Bachkantaten; ohne indischen Hanf keine hingebungsvollen Ragas und Bhajans. Und die Kartoffel! Wegen ihr sind Abermillionen verarmte Nordeuropäer, vor allem Iren, in die Neue Welt ausgewandert und haben die fast ausgerotteten Indianer ersetzt. Pflanzen bestimmten die Wanderrouten der frühmenschlichen Jäger und Sammler in größerem Maße als die Tiere, die gejagt wurden. Diese selbst wanderten ja von Weidegrund zu Weidegrund. Kulturanthropologen sind sich einig, dass, ganz allgemein gesprochen, bei den Naturvölkern rund 80Prozent der Nahrung aus Pflanzen besteht, die vor allem von Frauen gesammelt werden. Fleisch, von den Männern gejagt, macht dagegen nur rund 20 Prozent aus (Storl 1997: 13).
Aus einer globalen Perspektive betrachtet, verhält es sich wirklich so, als würde unser Leben von den Pflanzen beherrscht. Sehr viel länger als der Mensch haben die Pflanzen die Erde bewohnt, ja, diese für uns und die Tiere erst bewohnbar gemacht. Warum sollte man diesen alten Wesen die Weisheit absprechen? Sie herrschen weise, so weise – im Sinn des Tao Te King –, dass man ihre Herrschaft gar nicht bemerkt:
Die Meister stehen über dem Volk
und niemand fühlt sich unterdrückt.
Sie gehen dem Volk voran,
und niemand fühlt sich manipuliert.
Die ganze Welt ist ihnen dankbar.
Da sie mit niemandem in Wettstreit treten,
kann niemand mit ihnen wettstreiten.
Laotse, Tao Te King 66, (S. Mitchell, Hrsg.)
Resonanzen
Warum sollte man nicht alle Pflanzen lieben? Jede ist ein Gedanke Gottes, jede ein Geschenk. Der Begriff „Unkräuter“, weeds, mauvaises herbes, entstammt einem naturentfremdeten Denken. Wie gegen einen bösen Feind gehen viele Gartenbesitzer und Rasenfetischisten, hochgerüstet mit einem Arsenal von Giftspritzen und motorisierten elektrischen Trimmern, gegen ihre grünen Widersacher vor. Einer unserer Nachbarn in Ohio starb an Leberversagen, da er sich beim verzweifelten Abwehrkampf gegen eine Invasionsarmee von Unkräutern und Insekten beim ständigen Einatmen des Giftes selbst vergiftet hatte. Er ist kein Einzelfall. Dabei sind die zähen, unverwüstlichen Unkräuter oft unsere besten Helfer und Verbündeten, wenn wir krank werden. Die Pflanzen, vor allem die Wildkräuter, die rund ums Haus, im eigenen Garten, im Hinterhof oder unter der Hecke wachsen, eignen sich als Heilmittel noch besser als von weit her importierte Waren. Pflanzen enden ja nicht an ihrer Oberfläche, an ihrer Epidermis, sie strahlen Energien aus, von denen die leuchtenden Auren, die mittels Kirlian-Fotografie sichtbar gemacht werden, nur ein kleiner Teil sind.
Nur auf der stofflich-körperlichen Ebene erscheinen die einzelnen Pflanzen als getrennte, abgesonderte Einzelwesen. Jenseits der Stofflichkeit teilen sie sich jedoch mit uns und den Tieren, innerhalb eines Lebensraumes, ein energetisch ätherisches Feld. Energetische Ausstrahlungen fließen und durchdringen einander. Insbesondere Bäume sind energetische Kraftreservoires. Für einen erschöpften Menschen ist es möglich, heilende Energien zu erfahren, wenn er sich an die Hauslinde, die Hofeiche oder den Apfelbaum lehnt. Er kann sich da richtig aufladen. Aber auch das Sitzen in der Wiese oder neben einer Lieblingspflanze kann belebend und heilend wirken.
Wenn wir geistig und seelisch aus dem Gleichgewicht „herausfallen“ und als Resultat körperlich krank werden, dann berührt die das ganze Feld oder Energienetz. Man kann es sich wie ein Spinnennetz vorstellen, das mit jeder einzelnen Faser vibriert, weil sich an einer Stelle eine Fliege verfangen hat. Und so „weiß“ die unmittelbare Natur, dass etwas nicht stimmt, dass eine Seele nicht mehr freudig mitsingt im Chor des Lebens, und trifft Maßnahmen, damit die Harmonie wieder hergestellt wird: Da keimen dann plötzlich „Unkräuter“, die vorher nicht da waren, oder ein bestimmtes Unkraut wird zur regelrechten Plage.
Eine Frau erzählte mir von ihrer Mutter, die sich seit Jahren mit einem chronischen Harnleiterleiden herumschlug. Die Mutter, eine begeisterte Gärtnerin, hatte einen besonders schönen Garten, voller Blumen und kräftiger Gemüse. Nur das Zinnkraut (Acker-Schachtelhalm) ärgerte sie ständig. Mit allen Mitteln versuchte sie, es auszurotten. Zufällig blätterte sie eines Tages in einem Buch von Maria Treben und sah ihren Feind, das Zinnkraut, abgebildet. Sie las, dass gerade dieses Unkraut das Richtige für ihr Leiden sei. Es war einen Versuch wert. Sie trank den Tee und schon nach kurzer Zeit war sie wieder gesund. Das Unkraut, das sie jahrelang bekämpft hatte, war das Heilkraut für ihre langjährige Krankheit.
Ähnliche Geschichten habe ich schon früher gehört und lange für alten Aberglauben, für Altweibergeschichten gehalten. Aber immer wieder, auf Kräuterwanderungen oder in Workshops, die ich veranstalte, höre ich von solchen – vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen unmöglichen – Erlebnissen. Inzwischen habe ich selbst festgestellt: Wenn ich oder jemand in meiner Familie krank ist, zieht irgendeine Pflanze, der ich sonst kaum Beachtung schenke, mein „Bewusstsein“ auf sich. Wenn ich mich dann näher mit ihr befasse, ist es meistens die Heilpflanze, die vonnöten ist.
Diese Resonanz zwischen Krankheiten und den entsprechenden lokal wachsenden Heilpflanzen beschränkt sich nicht auf einzelne Personen oder Haushalte. Manchmal wird eine ganze Region von einem invasiven Unkraut heimgesucht. Seit einigen Jahrzehnten wächst in den mitteleuropäischen Städten immer mehr Echte Nelkenwurz(Geum urbanum). Es ist ein gelb blühendes Kraut, das in den Städten unter Hecken und Gebüsch eine Nische gefunden hat. Einmal bemerkte ich gegenüber Sepp Ott, dem Münchener Kräuterexperten, dass es doch merkwürdig sei, dass sich dieses Rosengewächs in der heutigen Zeit immer mehr ausbreitet.
„Warum wohl?“, fragte der Kräutermeister. „Mutter Natur hat der Pflanze den Marschbefehl gegeben, weil die heutigen Menschen sie brauchen. Noch nie gab es so viele Chemikalien und Schadstoffe in den Nahrungsmitteln, der Luft und im Wasser. Die Nelkenwurz regt die Leber an und wirkt entgiftend!“
Das war mir neu. Bisher hatte ich die Nelkenwurz als hervorragende Gerbstoffdroge gekannt, wobei die zerkleinerte Wurzel, kurz aufgekocht, sich sehr gut bei Darmkatarrh und Kolik, Entzündungen des Rachenraums und bei Zahnfleischblutungen bewährt hat. Auch wenn man die nach Gewürznelke duftende Wurzel einfach kaut, hilft sie. Sofort spürt man ihre starke, Gewebe zusammenziehende (adstringierende) Wirkung. Dass sie aber der Leber beim Entgiften helfen soll, war mir nicht bekannt gewesen. Es stimmt jedoch: Schon im Mittelalter verwendete man sie als Antidoton (Gegengift) bei Vergiftungsfällen.
Damals erklärte man sich die Wirkung nicht durch die molekularen Inhaltsstoffe, sondern durch den Einfluss der Engel oder der Heiligen. Die Nelkenwurz war Benedikt, dem Gründer des ersten Klosters in Europa (Monte Casino, 345 n. Chr.), geweiht. Er war ein äußerst strenger Abt. Er duldete keine Laxheit und menschliche Schwäche. Seine Mönche, die in ständiger Erinnerung an ihre Sündhaftigkeit schwarze Kutten trugen, mussten ein hartes, asketisches Leben führen. Die Mönche rebellierten. Sie beschlossen, ihren Peiniger, den Abt, zu töten. Heimlich gossen sie Gift in den Messwein. Als Benedikt dann anhob, die Messe zu zelebrieren und den Schluck aus dem heiligen Kelch zu nehmen, ballte sich das Gift zusammen und kroch in Schlangengestalt über den Rand des Messkelchs hinaus. So wurde Benedikt auf wundersame Weise vor dem Gifttod gerettet. Der Messkelch, aus dem eine Giftschlange kriecht, ist das Attribut dieses Heiligen geworden.
Indem man die Nelkenwurz mit dem heiligen Benedikt in Verbindung brachte, sagte man über ihre Wirkung aus: Diese Wurzel hat dieselbe Macht wie der Heilige, sie konzentriert das Gift und leitet es aus. Um die giftwidrige Wirkung zu steigern, grub man die Wurzel an seinem Namenstag aus. Das war der 21.März, gleichzeitig der Tag der Frühlingstagundnachtgleiche – ein Datum, das den hohen Stellenwert dieses Heiligen unterstreicht.
© Bereitgestellt von Wolf-Dieter Storl
Echte Nelkenwurz Geum urbanum
Pflanzenverbündete
In diesem Buch will ich aber nicht in der großen Perspektive verweilen – das habe ich anderswo schon getan 1 –, sondern ganz persönlich von meinen „Pflanzenverbündeten“ erzählen. „Verbündete“, so nennen die Indianer jene Pflanzengeister, die ihnen persönlich erschienen sind, ihnen Kraft gegeben haben und mit ihrem Leben verbunden sind. Es sind Freunde aus dem „grünen Volk“, auf die man sich verlassen kann. Auch wenn man oberflächlich viele Pflanzen mit Namen kennt oder auch um ihre heilkundliche Bedeutung weiß, so sind es nur wenige, die man als „Verbündete“ bezeichnen kann. Es ist wie mit anderen Menschen: Man hat viele Bekannte, doch echte Freunde lassen sich an den Fingern einer Hand abzählen – wenn man Glück hat, eventuell an beiden Händen.
Die Auswahl und Reihenfolge, die hier getroffen wurden, sind willkürlich. Gern hätte ich noch die EchteKamille(Matricaria chamomilla) – wohl das erste Kräutlein, mit dem ich, schon als Wickelkind, in Berührung kam – in dieses Buch aufgenommen. Mit dieser Blume, die einst dem Sonnengott Baldur geweiht war und in Skandinavien noch immer „Baldurs Braue“ heißt, hat meine Großmutter richtig gezaubert. „Kamillen statt Pillen“ hätte auch ihr Leitspruch sein können. Bei Magenbeschwerden, „Bauchkneipen“, Krämpfen, Halsentzündungen, zum Waschen von Schürfungen und manch anderem Wehweh, das Kinder und gelegentlich Erwachsene befällt, setzte sie Kamille ein. Schon der freundliche Duft des heißen Tees versprach Linderung und Heilung. Und wenn sie dann das Mantra „Nun, das wird schon wieder!“ sagte, war das Schlimmste meist schon vorüber. Der Oma konnte man ja glauben, sie sagte immer die Wahrheit! Noch heute, wenn es mir wirklich schlecht geht, stehe ich auf und koche mir einen Kamillentee. In dem Duft erscheint mir die Großmutter, und noch ehe ich die Tasse ausgetrunken habe, geht es mir besser. Kamille ist überhaupt eine himmlische Pflanze, ganz dem Licht hingegeben. Ihr entzündungshemmendes, ätherisches Öl, das Chamazulen, ist blau wie ein unbewölkter Sommerhimmel.
Auch die Strahlenlose Kamille(Matricaria discoidea, Chamomilla suaveolens), die auf festgetrampelten Wegen neben Breitwegerich und Vogelknöterich wächst, ist ebenfalls ein Freund. Den kegelförmig gewölbten, grün-gelblichen Blütenköpfen fehlt der Strahlenkranz weißer Zungenblüten, dafür aber duften sie wunderbar nach Ananas. Das Aroma macht sie, neben Gänseblümchen und Pusteblumen, zu einer der beliebtesten Kinderpflanzen. Pineapple weed, „Ananaskraut“, nannten wir sie in Ohio. Erwachsene übersehen das Pflänzchen meistens oder betrachten es abschätzig oder gar fälschlich als „Hundskamille“. In den meisten Kräuterbüchern blättert man vergebens nach ihr. Wenn sie dennoch Erwähnung findet, dann heißt es meistens „ohne Heilwirkung“ oder „bedeutungslos“. Aber wie kann das sein? Allein der süße Duft lässt unerkannte Heilkräfte erahnen.
© M. Golte-Bechtle/Kosmos
Strahlenlose Kamille (Matricaria discoidea)
Dass man ihre Heilkräfte bei uns nicht kennt, liegt an ihrer Herkunft: Erst um 1850 erschien sie in Europa und breitete sich, vom botanischen Garten in Berlin ausgehend, rasch aus. Kamtschatka, der Nordostzipfel Eurasiens, ist ihre Urheimat. Nach Alaska kam die Pflanze, deren Samen klebrig sind und an Sohlen und Hufen haften bleiben, vermutlich mit den indianischen Mammutjägern vor 30 000 Jahren – sozusagen in den „Fußstapfen des roten Mannes“. Allmählich breitete sie sich entlang der Rocky Mountains aus. Von den Cheyenne konnte ich erfahren, dass sie eine ihrer Lieblingspflanzen ist. Sie zerreiben die Blütenköpfchen, mischen sie mit gepulvertem Mariengras (Hierochloe odorata), Wilder Goldmelisse (Monarda fistulosa) oder Ponderosakiefernharz und reiben sich damit ein. Die Indianerkinder machen sich aus den runden Blütenköpfen Halsketten. „Nicht leicht zu sehende, winzige Büffelkälbchen“ ist einer der vielen Namen, die sie dieser Kamille geben; „Präriehund-Parfüm“ ist ein weiterer Name. Die Blüten sind auch ein Heilmittel. Sie kommen in den Erkältungstee oder werden bei Magenverstimmung, Durchfall oder Fieber gekocht. Als wichtiges Frauenkraut wird es bei Menstruationsbeschwerden, zur schnelleren Austreibung der Nachgeburt oder als Stärkungsmittel nach der Geburt getrunken (Welschbillig 1997: 43). Mädchen bekommen den Tee zum Anlass ihrer ersten Monatsblutung zu trinken, wenn sie zum ersten Mal in die „Mondhütte“ abseits des Dorfes gehen. Die Nachbarn der Cheyenne, die Krähenindianer (Absaroka), streuen die getrockneten Blütenköpfe in die Kinderwiegen und Traggestelle für Säuglinge. Der Duft beruhigt die Kleinen und nimmt ihnen die Angst. Es gibt keinen Grund, die strahlenlose Kamille bei uns nicht ähnlich zu verwenden: Man kann sie in Duftkissen stopfen, einen Tee brauen, gegen Magenprobleme, Erkältung, zur Regulierung der Periode, als Wurmmittel zur Austreibung von Maden- und Spulwürmern oder – wie es die Weißen in Alaska machen, wenn sie zu tief in die Whiskeyflasche geschaut haben – um Kater und Schädelbrummen abzumildern. Nur Wunden lassen sich mit dieser Pflanze nicht heilen, da ihr das Chamazulen fehlt.
Der EfeublättrigeGundermann (Gundelrebe, Glechoma hederacea) ist die erste Wildpflanze, die ich mit Namen kannte. Auch ihn würde ich gern mit in dieses Buch aufnehmen. Das tue ich aber nicht, da ich ihn schon an anderer Stelle ausführlich behandelt habe. Die Gundelrebe ist selbstverständlich eine hervorragende Heilpflanze, die aufgrund ihrer Saponine und ätherischen Öle schleimlösend wirkt. Der Teeaufguss oder, besser, der Auszug in heißer, fettiger Milch ist angezeigt bei verschleimten Lungen, Bronchitis, Schnupfen, Schleimhautentzündung sowie bei Ohrenklingen, das durch Schleimansammlungen im Mittelohr entsteht. Aufgrund der in ihm enthaltenen Bitterstoffe regt der Gundermanntee die Verdauungssäfte an und fördert den Leberstoffwechsel. Maler und Büchsenmacher tranken ihn, um giftige Schwermetalle (Blei) auszuschwemmen. Dank seiner Gerbstoffe vermag er auch wundes, verletztes, eiterndes, wässriges, gequetschtes und schlecht heilendes Gewebe zu festigen und zu trocknen. Gundermann war einst auch, noch lange bevor die Benediktinermönche den Hopfen ins Bier taten, das gängige Bierkraut, mit dem man Bier würzte und haltbar machte.
Die Gundelrebe mag nicht in die Höhe wachsen, wie es sich für einen normalen Lippenblütler gehört. Ihre kriechenden Ausläufer, die den Rasen durchwuchern und durch Hecken und Zäune kriechen, bleiben dem Erdboden verhaftet. Mit den Adventivwurzeln, die aus jeder Sprossachse des Stängels hervortreiben, klammert sie sich förmlich an der Erde fest. Wenn man sich einen Gundelrebenkranz um den Kopf windet, ist es, als verbände sich die eigene Wahrnehmung mit der Erde oder, genauer, mit den Heinzelmännchen, jenen ätherischen Wesen, die die Wurzelwelt bevölkern. Solch ein Kranz, so hieß es einst, kann einen sensiblen Menschen hellsichtig machen, sodass er die Naturgeister sehen kann. Trägt man ihn zur Walpurgisnacht, so glaubte man, kann man die Hexen erkennen. Beim Springen über das Johannisfeuer zur Sommersonnenwende trug man gern einen solchen Kranz im Haar – wahrscheinlich auch, damit der Tänzer nicht „wegfliegt“, sondern mit der Erde verbunden bleibt.
© F. Quidemus
Der Sprung über das Johannisfeuer
Heutzutage schmunzelt man über solchen Aberglauben. Aber in Zeiten, als unsere Sinne noch nicht von endlosen Unterhaltungsprogrammen, Maschinenlärm und technischen Ablenkungen gefangen genommen wurden, als das tägliche Naturerlebnis noch unmittelbarer war, da bedurfte es kaum starker, psychedelischer Drogen, um die zarten Spuren des „Andersweltlichen“, die ätherischen Hauchgestalten, wahrzunehmen. Da genügte wohl die herb-würzige Ausdünstung dieser Pflanze, um die seelische Wahrnehmung anzuregen. Physiologisch wirkt das Aroma ja bis ins limbische System unseres Hirns hinein. Auf jeden Fall trage ich, wenn ich Vorträge halte, gern etwas Gundermann hinter dem Ohr oder ins Haar geflochten. Das gibt mir das Gefühl, auch in der Stadt, in einem sterilen Raum, umgeben von Elektronik, mit der Erde und den klugen, erdbewohnenden Heinzelmännchen verbunden und ihren Eingebungen gegenüber offen zu sein.
Die GewöhnlicheWegwarte(Cichorium intybus) mit ihren himmelblauen Blüten ist mir ebenfalls seit langem eine Weggefährtin. Schon in den alten Papyrustexten wird ihre Heilkraft gepriesen. Vor allem bei Leber- und Galleleiden ist sie eine Heilerin. Bei den Kelten galt sie als Braut der Sonne, die Verkörperung der Pflanzengöttin, die mit dem Sonnengott vermählt ist. Am Wegrand steht sie und hält ständig Ausschau nach ihm, wenn er am Morgen seinen Wagen auf den Zenit hinlenkt. Kurz vor Mittag schließt sie ihre Blüten, wobei jede Blüte nur einen Morgen lang blüht und dann verwelkt. Im Mittelalter sah man in ihr ein blauäugiges Mädchen, das weinend am Wegrand steht und nach Osten schaut, da ihr Ritter, im Kreuzzug nach Jerusalem, in diese Richtung geritten war und nie wieder zurückkehrte. Mit dieser Blume heilte man die Schwermut, Traurigkeit und Melancholie – die ja oft auch auf organischer Ebene mit der Leber zu tun hat (Scheffer/Storl 1995: 87). Als Leberheilmittel lernte ich die schöne Pflanze in Indien kennen, als ich in einer kleinen Hütte am Ganges mit einer schweren Leberentzündung darnieder lag. Sie wuchs, feldmäßig angebaut, neben dem Haus. Die Inder brauen aus den Samen ein kühlendes Sommergetränk. Die Wegwarte – ich trank einen aus den Stängeln und Blättern hergestellten Tee – begleitete mich auf dem Weg der Genesung. Auf einem Bauernhof im Emmental lernte ich sie von einer anderen Seite kennen: Wegwartenwurzeln wurden im Herbst ausgegraben und dann im Winter in guter Erde zum Austreiben gebracht. Das Resultat war der heutzutage so populäre Brüssler Endiviensalat.
Den Sanikel(Sanicula europaea), der in schattigen, feuchten Wäldern wächst und dessen Blätter leicht mit denen des giftigen Hahnenfußes zu verwechseln sind, lernte ich erst im Allgäu von den Bauern kennen. Beim armen Landvolk im Westallgäu, in Vorarlberg und Appenzell, das sich keine Ärzte leisten konnte, war dieser unscheinbare Doldenblütler ein Allheilmittel. Die würzige Pflanze wurde vor der Blüte gesammelt, gedörrt und dann zu einem Heilpulver verrieben, das bei Magen-Darm-Problemen, Lungenbeschwerden und zur Wundheilung verwendet wurde. Inzwischen ist „Saunigel“ auch bei uns Teil der Hausapotheke.
Der Kalmus(Acorus calamus), auch Deutsche2Magenwurz genannt, soll hier nicht vergessen werden. Es handelt sich um ein schilfähnliches Aronstabgewächs mit stark aromatischen Wurzeln, das an Teichrändern und feuchten Gräben wächst. Die Sumpfpflanze kommt ursprünglich aus Indien. Ihr Sanskritname ist Vacha, „Sprechen“. Sie ist der Saraswati, der Göttin des schöpferischen Wortes, der Shakti des Schöpfergottes Brahma, geweiht. Diese jungfräuliche, weiße Göttin mit dem Schwan ist die Muse aller Heiler, Dichter und Sänger. In diesem Sinne wird das Wurzelpulver „hirntonisch“ als intelligenz- und gedächtnisförderndes Mittel verwendet, aber auch bei Störungen des Nervensystems, bei Hysterie, Epilepsie, Neuralgien und Ohrensausen, außerdem bei Bluthochdruck, Husten und Asthma sowie gegen Magersucht (Anorexia nervosa). Für Männer ist ein Bad mit der beigefügten Abkochung einer fingerlangen Wurzel ein Aphrodisiakum.
© Ingrid und Peter Schönfelder
Kalmus (Acorus calamus)
Nicht nur in Indien, sondern überall auf meinen Wanderungen bin ich dieser Pflanze begegnet. Die Cheyenne benutzen die „Bitterwurzel“ (Wi uhk is e eyo) gekocht bei Magenbeschwerden, reiben sie bei fiebrigen Erkrankungen zur Stärkung auf den Körper, hängen die getrocknete Wurzel den Kindern als Amulett um den Hals, um Nachtgeister zu vertreiben, rauchen das Wurzelpulver, mit anderen Kräutern gemischt, in ihren Pfeifen oder legen es während der Schwitzhüttenzeremonie mit auf die heißen Steine. Es ist eine heilige Pflanze. Krieger flochten die duftenden Blätter einst in ihre Haare und in die Mähnen ihrer Pferde. Die Teton-Dakota rieben sich die gekauten Wurzeln ins Gesicht, um angesichts des Feindes Ruhe zu wahren und die Furcht zu bannen.
Auch die Europäer kannten die magische Schutzwirkung der Pflanze. Sie wurde dem Vieh als Schutz gegen Verhexung gegeben, und als quasi heilige Pflanze streute man sie auf den Weg, auf dem die Fronleichnamsprozession entlangzog.
Vor allem aber ist die Deutsche Magenwurz ein Mittel bei hartnäckigen Krankheiten des Magen-Darm-Trakts, einschließlich der Leber, Galle, Milz und Bauchspeicheldrüse. Die große Kräuterfrau Maria Treben berichtet, dass ihre Mutter schwer krank war. Als der Arzt Darmkrebs diagnostizierte, war Maria Treben mehr als bestürzt, sie war kaum fähig, ihrer Arbeit nachzugehen. Sie ging früh ins Bett und grübelte über die hoffnungslose Situation nach. Um sie abzulenken, stellte ihr Mann ein Kofferradio neben ihr Bett und schaltete es ein. Die Stimme im Rundfunk sagte: „Hier spricht der Hausarzt. Mit Kalmuswurzel wird jede Magen- und Darmstörung geheilt. Sie kann noch so hartnäckig, veraltet oder bösartig sein. Man nimmt eine Tasse kaltes Wasser, gibt einen gestrichenen Löffel Kalmuswurzel hinein, lässt es über Nacht stehen, wärmt es morgens leicht an, seiht ab und trinkt vor und nach jeder Mahlzeit einen Schluck.“ (Treben 2002:28). Ein Pflanzendeva hatte zu der Kräuterfrau gesprochen, hatte ihr Gebet gehört und das Radio als Medium benutzt, um ihr die rettende Botschaft zukommen zu lassen! Die Mutter wurde geheilt. Für meine indianischen Freunde wäre diese Geschichte nichts Außergewöhnliches. Pflanzengeister sind eben Geistwesen und sie können auf vielerlei Art und Weise ihre Botschaften übermitteln, auch über Rundfunk. Aber es braucht eine Medizinperson, eine Schamanin mit reiner Seele, um die Botschaft zu hören.
© Wolf-Dieter Storl
Die Göttin Saraswati, der der Kalmus geweiht ist
Vor einigen Jahren kam der Bruder eines befreundeten Luzerner Künstlers zu mir. Er war höchst besorgt. Sein Bruder, sagte er, habe eine Bauchspeicheldrüsenfehlfunktion, er sei ganz apathisch und werde nicht mehr lange zu leben haben. Da erinnerte ich mich an Maria Trebens Geschichte und grub eine Menge Kalmuswurzeln an unserem Teich aus. Diese sollte er einnehmen, dazu schlug ich vor, noch Brennnesseltee zu trinken, der ja ebenfalls eine tonisierende 3 Wirkung auf den Pankreas hat. Auch sollte er auf seine Diät achten: viel Obst – insbesondere Papaya – essen, auch Zitrusfrüchte und Rettiche. Dann steckte ich einen Weidenzweig in den Boden und sagte: „Das ist für ihn. Wenn der Baum lebt, wird er leben. An dem Baum kann man erkennen, wie es ihm geht!“ Nun sind etliche Jahre vergangen und der Baum ist prächtig gewachsen. Der Künstler ist wieder in seinem Beruf tätig und, entgegen jeder Erwartung, wohlauf.
Da ich einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend in den Wäldern Ohios verbrachte, ist es verständlich, dass viele nordamerikanische Kräuter und Bäume zu meinen Vertrauten zählen. Wenn ich ihnen zufällig in irgendeinem botanischen Garten begegne, dann freue ich mich. Oft kümmern sie vor sich hin, als fehlte ihnen, so fern ihres natürlichen Lebensraumes, die rechte Lebensfreude. Immer aber wecken sie Erinnerungen: Die Papau(Pawpaw, Asimina triloba), eine Verwandte des Rahmapfels und der Cherimoya, mit ihren süßen, weichen, nach Pudding schmeckenden Früchten erinnert an stickig heiße, subtropische Sommer und an die Palisadenburgen, die wir jungen Waldläufer aus ihren Stämmen an versteckten Stellen im Wald bauten. Der Fieberstrauch(spicebush, Lindera benzoin), ein Lorbeergewächs mit aromatischem Holz, der im Winter wie im Sommer am Lagerfeuer einen erfrischenden Tee ergab und dessen rote, feurig scharf schmeckende Beeren als Pfeffer unser Gulasch würzten. Der Hirschkolben-Sumach(Rhus hirta, R. thyphina), dessen rote Beeren sauer wie Zitronen schmecken und, in Wasser ausgezogen, eine vorzügliche, rosafarbene Limonade ergeben. Erst später bei den Cheyenne erfuhr ich, dass dieser Essigbaum eine heilige Pflanze ist, dessen Blätter mit in die Rauchmischung der Friedenspfeife kommen und der als Heilpflanze bei Wunden, schlecht heilenden Geschwüren, Verpilzung, Durchfall, Geschlechtskrankheiten und anderen Leiden verwendet wird (Storl 2004b: 163).
Noch viele weitere Pflanzen, zu denen ich eine persönliche Beziehung habe, könnte ich auflisten. Etwa den Kaffeestrauch (Coffea arabica), ein Rötegewächs (Rubiaceae) mit dunklen, lederigen Blättern, weißen Blüten und dunkelroten Beeren, das ich in Afrika und Ceylon bewundern konnte. Der Kaffee (aus dem arabischen qahwa, „Wein“) beziehungsweise das Koffein, „die beliebteste Droge der Welt“, befreit hirneigene Stimulanzien des zentralen Nervensystems (Rudgley 1999: 175). Folglich wäre ohne „Freund Kaffee“ dieses Buch wohl nicht entstanden. Der Ethnopharmakologe Christian Rätsch nannte mich zu Recht einen „Kaffee-Schamanen“. Für einen Sachsen ist das keine Beleidigung, sondern vielmehr so etwas wie ein Erkannt-worden-Sein. Auch beim Lesen dieses Buches wird ein Tässchen Gift – „schwarz wie die Seele, heiß wie die Hölle und süß wie die Sünde“ (Arthur Hermes) – dem Geist auf die Sprünge helfen.
Da viele meiner Pflanzenfreunde in meinen anderen Büchern vorgestellt wurden, will ich mich hier nicht unnötigerweise wiederholen. Nur einigen meiner wichtigsten Verbündeten möchte ich die folgenden Seiten widmen.
Beinwell
Als Heilpflanze regt sie stark den Ätherleib zu
regenerativer Tätigkeit an, entsprechend ihrer
eigenen vital-plastischen Natur, hilft aber dabei,
diese Tätigkeit mit gesunden Formkräften zu
durchdringen, dank ihrer Kieselnatur.
Wilhelm Pelikan
Kein Zweifel, es kam so, wie es kommen musste: Der Hund rannte vors Rennrad, ich stürzte im hohen Bogen mit voller Wucht auf den Asphalt. Beim Aufprall der Schulter zersplitterte das Schlüsselbein wie eine Glasröhre. Da stand ich nun, unter Schock, neben der Straße und hielt meine linke Schulter. Beim Abtasten spürte ich die Knochensplitter unmittelbar unter der Hautoberfläche. Der Hund war nicht schuld. Nein, es war die ganze verflixte Situation. Nach sechs langen Jahren in Europa und Asien waren Ganga und ich zurückgekehrt, um endlich mal wieder meine Eltern in ihrer gutbürgerlichen deutschen Miniaturoase mitten im amerikanischen Mittelwesten zu besuchen.
Noch immer trugen wir indische Kleidung, Sari und Kurta-Pyjamas. Wir hatten uns einfach noch nicht wieder an die ungemütliche Enge westlicher Kleidermode gewöhnen können. Wie jede indische Landfrau hatte Ganga einen goldenen Ring im Nasenflügel, rote Glasreifen hingen an den Handgelenken und Silberringe schmückten die Zehen – dabei war sie gar keine Inderin, sondern ein waschechtes, amerikanisches Cowgirl. Mit meiner Haartracht und dem langen Rauschebart sprengte ich jede Regel amerikanischen Anstands, und ein OM, das Sanskritzeichen des Urtons der Schöpfung, hatte ich mir auf den Handrücken zwischen Daumen und Zeigefinger eintätowieren lassen. So standen wir vor der Haustür. Eine Mischung aus Wiedersehensfreude und Entsetzen stand meinen Eltern ins Gesicht geschrieben, als sie die Tür öffneten. Unseren Pontiac – ein junger Schweizer hatte ihn uns in San Francisco mangels gültigen Fahrzeugbriefes spottbillig verkauft – mussten wir sofort in der Garage verstecken. Die Nachbarn hätten sonst was zu reden gehabt, wenn sie den alten Straßenkreuzer vorm Haus hätten stehen sehen.
Nun war ich schon über vierzig und im Gegensatz zu meiner braven Schwester hatte ich weder eine Anstellung noch regelmäßiges Einkommen. Wie ein Narr hatte ich damals meine unkündbare Stelle als Anthropologiedozent gekündigt und war wie Hans im Glück auf Reisen gegangen.