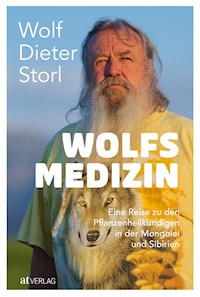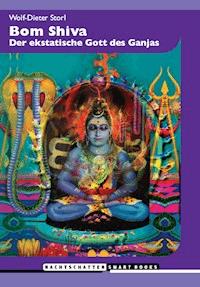19,99 €
Mehr erfahren.
Pflanzen als Heiler, als Ernährer, als Wohltäter, als Götter und Dämonen – das Wissen um die Wirkung von Pflanzen und Kräutern ist so alt wie die Menschheit selbst. Dieses Buch macht uns mit all diesen Aspekten bekannt und lehrt uns, sie zu respektieren und anzuerkennen, dass Pflanzen eine Seele haben, einen eigenen Charakter und eine Persönlichkeit, die uns sehr viel mehr beeinflussen kann, als wir es vielleicht wahrhaben möchten. Der Kulturanthropologe und Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl erklärt unter anderem auch, wie wir mit Pflanzenseelen in Kontakt kommen und wieder lernen können, die Heilkraft oder Zaubermacht einer Pflanze intuitiv zu erfassen. Der Inhalt des Buches basiert zu einem großen Teil auf den persönlichen Erfahrungen des Autors mit Kräuterkundigen unterschiedlicher Kulturen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Pflanzen als Heiler, als Ernährer, als Wohltäter, als Götter und Dämonen – das Wissen um die Wirkung von Pflanzen und Kräutern ist so alt wie die Menschheit selbst. Dieses Buch macht uns mit all diesen Aspekten bekannt und lehrt uns, sie zu respektieren und anzuerkennen, dass Pflanzen eine Seele haben, einen eigenen Charakter und eine Persönlichkeit, die uns sehr viel mehr beeinflussen kann, als wir es vielleicht wahrhaben möchten. Der Kulturanthropologe und Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl erklärt unter anderem auch, wie wir mit Pflanzenseelen in Kontakt kommen und wieder lernen können, die Heilkraft oder Zaubermacht einer Pflanze intuitiv zu erfassen. Der Inhalt des Buches basiert zu einem großen Teil auf den persönlichen Erfahrungen des Autors mit Kräuterkundigen unterschiedlicher Kulturen.
Autor
Dr. Wolf-Dieter Storl, geboren 1942, ist Kulturanthropologe und Ethnobotaniker. Er wanderte 1954 mit seinen Eltern in die USA (Ohio) aus, wo er die meiste Zeit in der Waldwildnis verbrachte. Nach dem Studium der Botanik und Völkerkunde an der Ohio State University lehrte er als Dozent für Soziologie und Anthropologie an der Kent State University. 1974 promovierte er als Doktor der Ethnologie in Bern. Seine zahlreichen Reisen und Feldforschungen prägen sein Denken und finden ihren Niederschlag in vielen erfolgreichen Büchern. Wolf-Dieter Storl lebt seit 1988 mit seiner Familie auf einem Einsiedlerhof im Allgäu.
Außerdem von Wolf-Dieter Storl im Programm
Kräuterkunde, Kailash Unsere Wurzeln entdecken, Kailash Die alte Göttin und ihre Pflanzen, Kailash Schamanentum, Kailash Mein amerikanischer Kulturschock, Kailash
Wolf-Dieter Storl
Von Heilkräutern und Pflanzengottheiten
Mit Zeichnungen von Martin Tiefenthaler
Alle Informationen in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Ausgabe Februar 2024
Copyright © 1993 der Originalausgabe: Aurum in Kamphausen Media GmbH, Bielefeld, 2014 vollständig überarbeitete Neuauflage
Copyright © 2024 dieser Ausgabe: Kailash, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Sabine Schiche, ad department
Covermotiv (Illustration): © Manfred Scharpf
Autorenfoto: © Björn Gaus/Dorling Kindersley/gettyimages
Satz: Sabine Schiche, ad department
ISBN 978-3-641-37065-7V001
www.kailsh-verlag.de
Erster Teil
Von weisen Frauenund Wurzelkundigen
Wir gehen durch den Wiesentau,
Wir gehen zu der Kräuterfrau,
Die wohnt im dichten Wald.
Richard Schaukal: Die Hexe
Inhalt
Erster Teil
Von weisen Frauen und Wurzelkundigen
Einführung
I. Wurzelkunde
Wort und Wurz, Kunst und Kunde
Die Anfänge der Kräuterkunde
Der südasiatische Einfluss
Im Zweistromland
Ägyptische Heilkunst
Griechische und römische Medizinkunde
Kräutergärten in den Klöstern
Die Araber
Die heidnische oder altdeutsche Überlieferung
Die klassische Wiedergeburt
Paracelsus
Die Aufklärung
Kräuterheilkunde in Amerika
Triumph der Materialisten
Synthetische Pharmazeutika
Angst vor den Kräutern
II. Medizinische Modelle: Der Westen, China, Indien
Heilmittel aus alten Quellen
Bildersprache und Visionen des Heilens
Chinesische Heilkunde
Ayurvedische Medizin Indiens
III. Medizinische Modelle: Primitive Medizinund Schamanismus
Das dritte Auge
Kräuterkunde der Indianer
Die Ojibwa
Die Irokesen
Die Cheyenne
Afrikanische Heilkunde
IV. Medizinische Modelle: Alternativmethoden
Weitere alternative Heilmethoden
V. Imaginationen der europäischen Kräuterkunde
Die Tore zu den Göttersphären
Planeten und Pflanzen
Planetenpaare
Das Verhältnis der Planeten zu den Elementen
Das Verhältnis der Planeten zum Tierkreis
Zur Anwendung der planetarischen Regeln
Günstige Sammelzeiten
VI. Die Pflanze als kosmischer Mensch
Korrespondenz der Menschenkrankheit und der Pflanzensignatur
Anthroposophische Medizin
Bilder kontra exakte Wissenschaft
Zweiter Teil
Alles Heilen rührt von Pflanzen her
I. Wie man kräuterkundig wird
Wie man sammeln soll
Wo man sammelt
Aufbewahrung
Die Verabreichung der Heilkräuter
Alchemistische Präparate
Die natürliche Kur
II. Von den Lebensmitteln zu den Giften
Die Wirkstoffe
Glykoside
Ätherische Öle
Alkaloide
Gerbstoffe (Tannin)
Bitterstoffe (Amara)
Schleimstoffe
III. Medizin aus dem Garten
Liliengewächse
Gänsefußgewächse
Kohlgewächse (Brassicaceen)
Doldengewächse (Umbelliferen)
Kürbisgewächse (Cucurbitaceen)
Korbblütler (Kompositen)
Schmetterlingsblütler (Familie: Faboideae)
Nachtschattengewächse (Solanazeen)
Gartenunkräuter
Planetarische Koch- und Salbenbereitungskunst
Wildgemüse
IV. Kräuter zum Würzen und zur Gesundheitspflege
Gewürze und Duftstoffe
Aromatherapie
Kräuterbäder
Küchenkräuter
Gewürzkräuterfamilien
Kräuteressig, -butter und -salze
V. Der Kräutergarten
Bodenqualität und Düngung
Vermehrung
VI. Der Garten der Hekate
Shiva
Gift als Begriff
Giftpflanzen
Was tut man, wenn man sich vergiftet?
Pflanzen, die lieber Tiere wären
Die giftigsten Pflanzen
VII. Die Weisheit der Frauen
Liebeszauber
Übergangsriten und die Kunde der weisen Frauen
Pflanzen zum Färben
Faserpflanzen
Im Dunkeln des Mondes
Das Kräuterbündel der Freya
VIII. Bewusstseinswandelnde Kräuter und gesellschaftlicheSanktionen
Der Blick durch verbotene Fenster
Kulturgeschichte der bewusstseinsverändernden Drogen
IX. Das dritte Auge und der magische Flug
Hexenfeiertage
Hexenschmiere
Gehirn und Droge
Nachtschatten-Power
Der Fliegenpilz (Amanita Muscaria)
Die Hanfpflanze
Ololiuqui
Johanniskraut und Baldrian
X. Wie man mit den Pflanzen spricht
Unterwegs zu den Pflanzendevas
Pflanzengottheiten im Spiegel unserer Seele
Ammen der Menschheit
Neue Kontakte
Nachwort: Die mystische Chemie der Pflanzengeister
Bibliographie
Anmerkungen
Einführung
Fast nirgendwo auf unserem Planeten hat die Homöopathie Samuel Hahnemanns so viele begeisterte Anhänger gefunden wie in Indien. Das mag wohl teilweise daher kommen, dass für den einfachen Inder Hahnemann gleich Hanuman ist. Eine beliebte Ikone zeigt den Affengott Hanuman, wie er durch die Lüfte fliegt, eine Keule in der Hand, einen ganzen Berg mit Heilkräutern in der anderen.
Im großen indischen Epos, dem Ramayana, erfahren wir seine Geschichte und die der schrecklichen Schlacht zwischen den Rakshasas des Südens und dem Affenheer, geführt von den göttlichen Helden Rama und Lakshmana. Die dämonischen Rakshasas hatten nicht nur ihre Macht fast über die ganze Erde ausgedehnt, sondern auch die Königin Sita, die Gemahlin Ramas, geraubt und nach Sri Lanka verschleppt. Die ganze Schöpfung stöhnte unter der Last dieser ungerechten Herrschaft. Als Rama und Lakshmana sich aufmachen, um Sita zu befreien und die Gewaltherrschaft zu beenden, zieht das ganze Affenheer mit und baut eine Brücke nach Sri Lanka.
Bald tobt die Entscheidungsschlacht – zum Nachteil der Dämonen. Plötzlich aber fällt Lakshmana, tödlich getroffen von einem unsichtbaren, mit Zauberworten besprochenen Pfeil. Blutend, seiner Sinne beraubt, sinkt der holde Bruder Ramas zu Boden, und mit ihm die Hoffnung auf Sieg und Befreiung der geraubten Königin. Keine gewöhnliche Arznei würde helfen können. Niemand wusste Rat, außer dem weisesten und ältesten Affen, Sushena: »Das Leben hat den Helden noch nicht verlassen«, sagte der Weise. »Sofort würde der Gefallene genesen, wenn er den Duft der Heilpflanze Vishalya Karani noch vor Sonnenaufgang einatmen könnte. Aber diese Schlingpflanze mit goldenen Blättern und blauen Blüten wächst nur auf einem bestimmten Berg im Himalaya, dem Gandhamadana-Berg!«
Und somit war auch die letzte Hoffnung verflogen, denn in jenen Zeiten dauerte eine Reise vom Südrand der Erde bis zu den Bergen in der Mitte der Welt nicht Tage, sondern mehrere Jahre – achtzehn Jahre, um genau zu sein! Da meldete sich Hanuman, der Sita und Rama über alles liebte. Seine Stunde war gekommen, denn als Affengott und Sohn des Windes konnte er mit der Schnelligkeit des Gedankens jede Entfernung überbrücken. Der Weise beschrieb ihm genau die Eigenschaften der Pflanze, er verschwand im Nu hinter den Wolken. Sogleich fand er den Berg mit der Kräuterwiese. Aber da er, trotz seiner wunderbaren Fähigkeiten, doch letzten Endes bloß ein Affe war, konnte er sich nicht mehr genau erinnern, welches dieser vielen Heilkräuter nun das richtige war. Grübeln war nicht seine Sache! Mit seiner Riesenkraft riss er einfach den ganzen Berg heraus und trug ihn flugs nach Sri Lanka. Schon als er herannahte, sprangen die Pfeile aus den Wunden der vielen Verwundeten. Lakshmana sog den Blütenduft in die Lungen und stand geheilt auf. Nun konnte er erneut dem Dämonenfürsten, dessen Zauberwaffe verbraucht war, nachsetzen. Schließlich wurde die Königin – die ja niemand anderes als die Menschen- und Seelengöttin ist – befreit und die Willkürherrschaft der Dämonen beendet.
Diese Episode aus alter indischer Erzählung soll uns in das Abenteuer dieses Buches geleiten. Unter anderem will damit gesagt werden, dass nicht nur die Vernunft – sei sie auch so weise wie der alte Sushena – die Heilkräuterkunde fruchten lässt. Es bedarf auch des »göttlichen Affen« in uns – das heißt des magischen, instinktiven, tiefer gelagerten Bewusstseins, dessen Höhenflug uns erst die Heilkräfte zugänglich machen kann. Ist das Handhaben der Heilkräuter nicht immer mit einem kühnen Flug der Imagination verbunden? Schwebende Schamanen, Kräuterhexen auf Besenstielen, Engelwesen, die den Heilsgral aus höheren Regionen herunterbringen, der beschwingte Heilgott Hermes/Merkur, der ebenfalls in Blitzesschnelle die heilende Idee im stoffgewordenen Mittel entdeckt, die geflügelten Schlangen des Äskulap: Immer wieder stoßen wir auf das Flugmotiv; und ebenso wie Hanuman bringen sie nicht Dürftiges, mühselig Erarbeitetes, sondern ganze Heilberge – Gutes in Hülle und Fülle – mit.
Für den Leser sei dies ein Reiseführer, eine Einladung, diesen Flug selber zu unternehmen: zum Heil der Welt, zur Ehre des göttlichen Menschen in uns.
Isny im Allgäu, Dezember 2013
I. Wurzelkunde
Wort und Wurz, Kunst und Kunde
Als Wurzelkundige wurden in grauer Vorzeit die weisen Frauen und Heiler verehrt. Wortcunners wurden sie bei den Angelsachsen genannt. Unter »Wurzel« oder »Wurz« verstand man damals nicht das, was unser heutiger, naturwissenschaftlich geschulter Botaniker damit meint: das Faserngewebe, das die Pflanze zugfest im Erdboden verankert, das Wasser und die darin gelösten mineralischen Nahrungsstoffe aufnimmt und sie in die oberirdischen Organe leitet. Nein, eine Wurzel war weder Rhizom oder Knolle noch Stolon, sondern sie war vor allem das heilkräftige Pflanzenwesen. Die Bezeichnung »Wurz« klingt in vielen alten Heilkräuternamen nach: Magenwurz, Meisterwurz, Engelwurz, Schwalbenwurz, Goldwurz (Schöllkraut), Haselwurz, Wallwurz (Beinwell) usw. Die Kräuterkundige war oft die runzelige Alte, die halb träumend am Herdfeuer saß. Viele Sonnenwenden hatte sie hinter sich gebracht. Kinder hatte sie geboren, die Erde umgegraben, gesät, gepflanzt, das duftende Heu gerecht, sich über Wiesenblumen und Waldesbeeren gefreut. Nun sitzt sie still, der Nachtseite des Lebens zugewandt. Ihre Seele tastet die dunklen Gründe ab, wie das Wurzelwerk die stille Erde. Dort, wo niemand etwas sieht, höchstens ahnt, dort weilt ihr Sinn. Wo Keime sich entfalten, wo der Wurm sich windet, wo Alben und Wurzelmännlein wesen, wo der böse Zauber wirkt und wo der Segen seinen Anfang nimmt – da hinein sieht ihr Geist. Das sind die Früchte eines langen Lebens. Sie kennt die Wurzelkräfte und besitzt die Wortkraft, mit der sie diese ansprechen kann. Sie weiß den Zauber zu beheben und die Krankheit, die im Dunkeln wurmt. In den Tiefen der Welt liegen die Ursprünge der vielen Dinge. In keltisch-germanischer Sage sitzen die drei Mütter an den drei Wurzeln des Weltenbaumes. Dort spinnen die Urgöttinnen das Schicksal der Welt – der Menschen und Tiere und gleichermaßen der Götter. Also verkündet die Wölva, die Seherin der Edda:
Eine Esche weiß ich, sie heißt Yggdrasil,
die hohe, umhüllt von hellem Nebel;
von dort kommt der Tau, der in Täler fällt,
immergrün steht sie am Urdbrunnen.
Von dort kommen Frauen, vielkundige,
drei, aus dem Born, der beim Baume liegt:
Urd hieß man eine, die andre Werdandi –
sie schnitten ins Scheit –, Skuld die dritte:
Lose lenkten sie, Leben koren sie
Menschenkindern, Männergeschick.
Die Philologen, die Sprachliebhaber, versichern uns, dass der Name der Norne Urd mit der Vorsilbe Ur, wie in Ursprung, Urstand oder Urwald, zu tun hat. Er deutet auf die Anfänge, die wirkende Vergangenheit. Es ist die Sphäre der ältesten Götter, des Uranos, der jenseits von Zeit und Raum (jenseits der Sphäre seines Sohns Chronos-Saturn) waltet. Im vedischen Indien erscheint Uranos als der über alle Erden- oder Himmelsgeschehnisse erhabene Varuna, der Hüter des allgültigen Rtam: des Rechts, des kosmischen Schicksalsgesetzes – des Sitten- sowie Naturgesetzes. Dieses Rtamdes Urgottes ist verwandt mit Wortgruppen wie Recht, richtig, aufrecht, Richter, Reich, Raja und lat. ritus, ritualis, rex (König, als Hüter der Gesetze). Solche Zusammenhänge besagen, dass das karmische Gesetz in den Ursprüngen selber mit veranlagt ist. Dieses Rtam hat seinen Keim in der Weltenwurzel und entspringt ihr wie eine Rute. Sprachlich ist Rtam ebenfalls verwandt mit Wurz (engl. root; altengl. wyrt; altnord. urt – ein (Heil-)Kraut; lat. radix; griech. rhadix – der Zweig oder rhiza – die Wurzel).
Die zweite Norne, die die Seherin erwähnt, ist Werdandi (Wyrdim Angelsächsischen). Sie deutet auf das im Werden Begriffene, auf das Gegenwärtige.
Die dritte Schicksalsschwester ist Skuld (verwandt mit dem deutschen »Schuld« und dem englischen »should«). Sie bereitet die Zukunft und zeigt an, was wir dem Leben, dem Rtam, schuldig geblieben sind. Daraus ergibt sich das zukünftige, gerechte Schicksal für die nächste Runde des ewigen Seinskreislaufs.
Am Urdbrunnen, aus dem die Nornen aufsteigen, um den Göttern ihr Schicksal zu verkünden, schläft der Lindwurm, die Weltenschlange. Wurm gehört mit zu dem indogermanischen Wortkomplex (uert), zu dem auch Wurzel, Wort, Würde, Werk, Wirbel, Wirtel, werfen usw. gehören. Der Wurm (lat. vermis) würgt und windet sich in der tiefen Erde, ebenso wie das Wort sich aus dem Dunkeln der Seele entwindet, der Wurf der Würfel das Los offenbart, die Wirtel durch Windungen die einzelnen Fasern zu neuen Fäden verspinnt, das Werken den Gegenstand entstehen lässt oder der Wirbelwind der Steppe wie aus dem Nichts vernichtend und unberechenbar seine Bahn zieht. Der Grundbegriff des indogermanischen Stammwortes uert bedeutet also winden, drehen, herausdrehen, werken, entpuppen oder herausspinnen aus einem dunklen, unsichtbaren Urgrund und daraufhin in Erscheinung treten.1* Dieses Entwinden wird oft in religiöser Kunst, wie in den komplizierten Schnörkeln und Windungen keltisch-germanischer Schnitzkunst, dargestellt (siehe Abb.). Man sieht das Motiv ebenfalls in den Weinranken, die die Manuskripte der Mönche zieren, oder in den schraubenden Säulen des Baldachins von Bernini am Hochaltar im Petersdom.
Die »Kunde« von der Wurzel ist ebenfalls nicht ein Wissen im Sinne der Wissenschaft. »Kunde« ist verwandt mit tatkräftigem »Können«, mit dem »König« als demjenigen, der »kann« – eben weil er Erkennen besitzt. In früheren Zeiten glaubte man, dass die mächtige Hand des Gekrönten heilkräftig ist.2
»Kunde« ist verwandt mit dem »Kunden«, dessen eigentliche Bedeutung, ehe der Kommerz sich das Wort aneignete, Bekannter, Einheimischer oder Freund war. Im Englischen erscheint das Wort als kin (Blutsverwandtschaft) und kind (freundlich, gut gesinnt). Daneben hat das gemeingermanische Wort kuntha auch den Sinn des Kündens, des Bekanntmachens, des Aufzeigens, Zeugens oder des Ablegens eines Zeugnisses. Es ist ferner verwandt mit »Kunst«. Die noch weiter zurückliegende indogermanische Wurzel gen (gebären, hervorbringen, kennen) gibt unserer Sprache das Wort »Kind«, dem Englischen kindle (entzünden, anfachen), dem Lateinischen generare (hervorbringen, zeugen) und dazu Neologismen wie Genius, Generator, Gene, Genetik usw. Die Kunde erweist sich als heroische Tat, als Erkennen, als das ins Licht des Bewusstseins Heben dessen, was sonst unerkannt im Dunklen west.
Dieses Durchstöbern alter Wortverwandtschaften verrät uns den wahren Sinn der Wurzelkunde: Der Wurzelkundige weiß nicht nur um die unsichtbaren, im Geheimen wirkenden Mächte, sondern er begegnet diesen mit Können und Kunst, mit Wort und Wurz. Er weiß sie anzusprechen, und mit den Wurzeln hat er ein verwandtschaftliches Verhältnis (kinship). Das vermögen nur die wenigsten zu tun, wie die alte Muhme, die wir am Herdfeuer sitzen sahen, oder der einsame Hirte oder der asketische Sadhu-Baba, der die Schluchten des hohen Himalaya durchwandert. Es vermögen nur diejenigen, die dem Schrecken der chthonischen Wesen, den Tiefen der Erde, der Schwärze der Nacht und dem Abgrund der Seele standhalten können. Das sind die wenigen, die am Lindwurm vorbei ihre Schritte lenken und uns aus den Tiefen die Edelsteine des Zaubers und der Heilkunst mitbringen können.
Die Anfänge der Kräuterkunde
Unsere Forscher glauben, dass dickschädelige, stumpfsinnige Frühmenschen, von Hunger und Schmerz getrieben, nach und nach in blinden Versuchen lernten, welche Pflanzen sie essen konnten, welche ihnen Bauchkneifen und welche ihnen Wohlbehagen bereiteten. In zahllosen mühseligen Versuchen haben sich dabei etliche tödlich vergiftet – so fabuliert die fortschrittsgläubige Wissenschaft –, aber schließlich sammelten sich die Kenntnisse an, die zum Teil bis in die Neuzeit überliefert sind.
Solch ein experimentierender Vorgang charakterisiert aber eher unsere heutige wissenschaftliche Methode, mit der wir unseren Wissenskreis erweitern wollen. Eine solche Methode gab es damals nicht! Die ältesten Schriftzeugnisse und die Feldforschungsberichte der Ethnologen über die »Wilden« deuten auf eine andere Art der Erlangung von Kenntnissen. Die ältesten Texte der Hindus besagen, dass das Wissen von den Rishis, den Weisen der Urzeit, unmittelbar wahrgenommen (shruti) und erst in viel späteren Zeiten als das Hören und Sagen der Tradition (smriti) weitergegeben wurde. Diese Rishis waren nicht dem oberflächlichen Schein verhaftet. Hinter den Phänomenen nahmen sie die übersinnlichen, geistigen Wesensqualitäten wahr. Diese Art der Wahrnehmung bezog sich natürlich auch auf die Pflanzen, mit denen sie im stillen Innern ihrer Seele Zwiesprache pflegen durften. Ihr Seelenauge konnte die Pflanzenseelen wahrnehmen, weil sie durch heiligen und züchtigen Lebenswandel den Schleier der Illusion (Maya) mit ihrem Geist durchbrechen konnten. Wie scheue Rehe im Waldtümpel konnten die Pflanzendevas, Geister und Götter sich getreu in ihren Seelentiefen spiegeln.
In der Sprache der modernen Psychologie könnten wir sagen, dass sie die Fähigkeit hatten, zu »dissoziieren«, in Trance zu fallen, und dabei die erlernten, rigiden Strukturen unseres alltäglichen, funktionsorientierten, nach außen gerichteten Bewusstseins zurückzustellen, damit die Inhalte der Psyche ins Bewusstsein aufsteigen konnten. Sie hatten demnach das Vermögen, die tieferen Schichten des Unterbewusstseins, die Ebene der Instinkte, anzuzapfen. Das ist aber unsere Interpretation, mit der wir zu erklären versuchen, was wir kaum mehr verstehen. Es handelt sich nicht, wie unsere Psychologen glauben, um ein bloßes Versenken in die Subjektivität der eigenen Psyche mittels besonderer Techniken, sondern um ein Wahrnehmen des »Inneren« des Universums, um einen Zustand des höheren – oder auch tiefer gehenden – Bewusstseins, wo die Unterscheidung »subjektiv/objektiv« sinnlos wird. Wahrscheinlich handelte es sich auch gar nicht um einen Sonderzustand, sondern es war das Bewusstsein der damaligen Menschen schlechthin. Es waren die Zeiten, deren man sich als des »goldenen Zeitalters« erinnert, in dem der Mensch, wie einst im Garten Eden, mit den Tieren (Seelen) und mit »Gott« reden konnte.
Diese Fähigkeit hat sich immer mehr verdunkelt – die Studien Mircea Eliades zeigen dies – mit zunehmendem zivilisatorischem Fortschritt, mit dem Erscheinen der Spezialisierung, der Ausbeutung von Mensch und Tier, der Entfremdung von der Natur und der Entwicklung des sich abgrenzenden »Ich-Bewusstseins«. Mit diesem Sich-Ablösen vom Makrokosmos geht der Zugang zur übersinnlichen Welt verloren; das Tor zu den Göttern wird verriegelt, der Cherub steht davor mit flammendem Schwert; Atlantis versinkt aus der Welt des menschlichen Bewusstseins. In den nachfolgenden Zeiten sind es nur wenige, oft unscheinbare Gestalten, die den Weg noch finden: Schamanen, einsame Hirten oder alte Kräuterweiber. Aber oft können sie es nicht mehr aus eigener Kraft, sondern benötigen die Hilfe von Zauberkräutern oder Liedern, Trommeln und Tänzen. Damit schieben sie die überwältigenden Gebilde und Eindrücke der Zivilisation vorübergehend beiseite, um wieder einmal dem Raunen der Geister lauschen zu können oder die Lichtelfen, Zwerge oder Nachtalben zu schauen.
Aus jenen Zeiten, als es noch einfach war, als man die Pflanzenseelen noch befragen konnte, stammen auch viele Namen der Heilkräuter. Es sind Namen, mit denen die Pflanzen sich den Menschen offenbarten. In diesen oft seltsamen Benennungen klingen die geheimen Eigenschaften der Pflanzen nach.
Dem aufgeklärten Großstadtmenschen kommt dieses sicherlich recht eigenartig, wenn nicht fragwürdig vor. Aber so eigenartig ist das nun auch wieder nicht! Kinder scheinen manchmal ganz von allein über Pflanzen Bescheid zu wissen. Schrammt sich einer aus der kleinen Rasselbande das Knie oder kriegt eins an die Birne beim Steinwerfen, dann wissen sie oft »instinktiv«, dass sie das Blatt eines Wegerichs zerknüllen müssen, um damit die Blutung zu stillen. Woher bekommen sie diese Idee? Vielleicht gehört es mit zur Kinderkultur, wie Hüpfspiele, Pfeil und Bogen, Kreisel, Steckenpferd, Reime, Rätsel und Reigen, die unter Kindern seit Jahrtausenden von einer Generation zur anderen überliefert wird.
Auch ich erinnere mich an solche Kindergeheimnisse. Irgendwie kannten wir auch die genießbaren und die giftigen Pflanzen. Oft kletterten wir auf eine Eibe, die am Gehsteig in der Auguststraße in Oldenburg wuchs, und ergötzten uns an den süßen, schleimigen Beeren. Die Erwachsenen, die uns bemerkten, erschraken und versuchten uns wegzuscheuchen: Die Beeren seien tödlich giftig! Wir lachten sie nur aus. Von irgendwoher »wussten« wir, dass die roten Eibenbeeren uns nicht schaden würden. Den inneren Kern zu zerbeißen, der das tödliche Alkaloid Taxin enthält, kam uns gar nicht in den Sinn. Ebenso »instinktiv« rieb ich als Neunjähriger ein Stückchen grünen Apfel auf eine eiterige Beule, ohne objektiv wissen zu können, dass es die adstringierende Wirkung des Apfels war, die dieses Ärgernis daraufhin heilte. Auch später kam es ab und zu vor, dass ich irgendwie zur richtigen Heilpflanze griff. In der Folge eines sehr kalten Winters zum Beispiel, in dem wir in einem Berner Bauernhaus wohnten, bekam ich eine Lungenentzündung. Die durch den Holzofen trockene Luft hatte die Lungen angegriffen. Da träumte ich während einer beschwerdevollen Nacht von einer strahlenden, gelben Blume und erwachte mit der Ahnung, dass diese ein Heilmittel für mein Ungemach sein könnte. Am nächsten Tag sah ich eben diese Blümchen – die ersten des Frühlings – an kahlen Böschungen wachsen, wo schon der Schnee geschmolzen war. Es waren Huflattichblüten, deren lateinischer Name Tussilago tatsächlich »Hustenvertreiber« bedeutet. Als Tee zubereitet, strahlten die Blüten wie lauter kleine Sonnen in die kalten, verwinterten Luftbälge hinein und heilten die Lungenentzündung.
Geschichtliche wie völkerkundliche Überlieferungen bestätigen, dass man oft auf ähnliche Weise – durch eine Art Eingebung – auf die Heilmittel und Nahrungspflanzen gestoßen ist, nicht durch blindes Herumexperimentieren. Aspasia von Milet, die berühmteste, anmutigste und klügste der griechischen Hetären, die später die Frau des Perikles von Athen (500–429 v. Chr.) wurde, hatte als Mädchen eine arge Geschwulst im Gesicht. Der Arzt, der von ihrem Vater gerufen wurde, verweigerte die Behandlung, da man das verlangte Honorar nicht zahlen konnte. Weinend ging das Kind zu Bett, schlief ein und träumte, eine Taube komme zu ihr. Der hübsche Vogel verwandelte sich in eine schöne Frau, die zu ihr sagte: »Fasse Mut, verachte die Ärzte und ihre Medizin! Nimm die vertrockneten Rosenkränze, mit denen die Venusstatue geschmückt ist. Zerreibe sie zu Pulver und lege es auf die Geschwulst!« Das tat sie und wurde geheilt.
Cicero erzählt die Geschichte von Alexander dem Großen, der traurig und ratlos am Bett seines durch einen Giftpfeil verwundeten Freundes Ptolemäus sitzt und dessen Ende erwartet. Dabei fällt Alexander in einen Schlummer und sieht einen Drachen vor sich, der eine Wurzel im Rachen hält. Das Untier teilt dem Helden mit, wo er diese Wurzel finden könne, die seinem Freund das Leben wiedergeben werde. Ptolemäus – Gründer der letzten ägyptischen Dynastie, die mit der göttlichen Kleopatra ausklingen wird – und andere, durch Giftpfeile verwundete Krieger Alexanders werden mit der Pflanze, die der Drache offenbarte, gerettet.
Der Humanist und Reformator Philipp Melanchthon (1497 bis 1560) litt einst an Triefaugen, gegen die keine Medizin half. Da erschien ihm im Traum ein »Dr. Philo«, der ihm Augentrost (Euphrasia officinalis) anriet. Er folgte dem übernatürlichen Rat, indem er sich die Augen mit einem Augentrosttee auswusch. Nach zwei Tagen war die Entzündung verschwunden.
Man könnte solche Geschichten beliebig fortsetzen. Eine Bäuerin im Emmental erzählte mir von einem alten grauen Männlein, das ihr plötzlich im Halbschlaf erschien und sie auf ein Heilmittel aufmerksam machte.3 Sie wurde von der Tuberkulose geheilt. Der »schlafende Prophet« Edgar Cayce aus Tennessee, der im Schlafzustand seine Patienten untersuchte und ihnen Heilmittel verschrieb, ist auch kein Einzelfall.
In Schreckenszeiten der Seuchen und Kriege erscheinen die übersinnlichen Wesen, die Elfen, Waldmännlein und -weiblein nicht nur im Traum, sondern springen gar direkt in unsere lichte Tageswelt hinein. Unzählige Geschichten werden von solchen Übertritten erzählt. Es wird zum Beispiel gesagt, dass in Langbernsdorf in Westsachsen ein »graues Männl« während der Pest von Haus zu Haus sprang und an die Türen klopfte. Bei jedem Klopflaut starb ein Mensch. Einem Mann und einer Frau, die das Glück hatten, es zu sehen, sagte es: »Trinkt Baldrian, so kommt ihr davon!« An anderen Orten ist es ein Totenkopf, aus dessen Gebiss es zischt:
»Trinkt Baldrian und Bibernell,
sonst sterbt ihr schnell!«
Oder ein Rabe kommt geflogen und krächzt dem verstörten Volk zu:
»Nehmt Pimpernell und Armedill,
wenn sich die Pest nicht geben will!«
Eine weitere Überlieferung berichtet Folgendes: Während die Pest im Breisgau wütete, sank im Wald eine alte Kräutersammlerin vor Erschöpfung zu Boden. Sie hatte Tag und Nacht nach den Kräutern gesucht, mit denen die Freiburger Ärzte vergeblich versuchten, den Schwarzen Tod zu vertreiben. Da erschien ihr ein sonderbarer Vogel und sang:
»Esst Wacholderbeeren und Bibernell,
so sterbet ihr nicht so schnell!«
Es wird behauptet, dass diejenigen, die diesen Rat in vollem Vertrauen befolgten, mit dem Leben davonkamen.
Aber es waren nicht nur Visionen und Träume, die den Menschen Heilmittel offenbarten. In einigen Bauerngemeinschaften gab und gibt es besonders feinfühlige Menschen. Befinden diese sich in der Nähe bestimmter Pflanzen, dann regt sich in diesem oder jenem Organ oder Körperteil eine leise Empfindung. Es ist, als spürten sie – ähnlich wie Wünschelrutengänger die Wasseradern – die subtilen Ausstrahlungen der Pflanze und empfänden die Sympathie, die diese mit den jeweiligen Körperstellen verbindet. Solche Pflanzen eignen sich als Heilmittel für diese Organe. Sie werden entweder eingenommen oder nur auf die Körperstelle aufgetragen.
Über Jahrtausende wurden die unmittelbaren Einsichten der Seher, Träumer und Sensitiven von den Priestern und Gelehrten zu großartigen Systemen zusammengefügt. Priesterliche Schulen der Medizin und Bibliotheken entstanden in Babylonien, Ägypten und Griechenland. In China wurde die Kräuterkunde schon um 3000 v. Chr. vom legendären Kaiser Shen Nung – dem später vergöttlichten Vater der Heilkunde und des Ackerbaus – im Pen-tsao fixiert. Die Arzneilehre der Inder wurde ebenfalls von emsigen Pandits (Gelehrten) im Atharvaveda (um 1000 v. Chr.) zusammengestellt. Der Übergang von der offenbarten zur tradierten, systematisierten Heilmittellehre war allmählich, ist bis heute noch nicht vollständig vollzogen und wird es auch nie sein. Diese Entwicklung spiegelt den Übergang von naturverbundenen, einfachen Wildbeuter- und Pflanzergesellschaften zu den großen Zivilisationen. Mit zunehmender Spezialisierung, mit Schrifttum und Stadtleben verstummen allmählich die Stimmen der Geister.
Der südasiatische Einfluss
Verbindungen mit den Kulturen des Ostens hat es immer gegeben. Schon zur Zeit der Römer bestand die »Seidenstraße«, die sich über den Kyberpass durch die endlose staubige Karstlandschaft Persiens bis nach Damaskus und von dort nach Alexandrien wand. Auf ihr kamen nicht nur Seide, Zucker und Gewürze, sondern auch kostbare Heilkräuter und barfüßige Pilger mit sonderbaren Ideen und Lehren. Auch zu Schiff bestanden Verbindungen zwischen diesen Welten. Ein Handbuch für griechische Schiffer aus der Zeit Kaiser Neros – der Periplus des erythräischen Meeres – gibt die Waren an, die die Römer nach Indien verschifften: Wein, Kupfer, Zink, Blei, Koralle, Topas, Amberbaumharz zur Herstellung von Räucherwerk und Düften, süßer Steinklee, Glasware, Weihrauch und dünngewebte Stoffe. Diese wurden gegen Narde und Nardenöl, Pfeffer, Perlen, Elfenbein, Seide, Musselin, Edelsteine, würziges Kostus-Öl (Sassurea lappa), Myrrhe, Färbemittel und Heilkräuter getauscht.4
Auch schon vor den römischen Handelsbeziehungen, sogar ehe Alexander der Große nach Osten stürmte, waren Verbindungen vorhanden. Zu Platons Zeiten erschienen »nackte Weise« – Gymnosophisten wurden sie von den Griechen genannt – auf der Agora, dem Marktplatz, um Einsichten und Gedanken mit den Philosophen auszutauschen. Noch heute wandern solche »Luftgekleidete« durch Indien. Ob nicht doch etwas von ihren Gedanken in den Ausführungen Platons (die Welt als Illusion; die vier Zeitalter und vier Kasten), Pythagoras’ und der Orphiker (die Notwendigkeit, dem Kreislauf der Geburten durch Askese und Abstinenz von Fleisch und Alkohol zu entrinnen) hängen geblieben ist? Ob nicht auch die Ansichten der griechischen Ärzte, besonders des späteren Galenus, Gedankengut aus dem Ayurveda enthalten, beispielsweise dass Krankheit aus einer Unausgeglichenheit der Körpersäfte (Humoren) entsteht?
Auch heutzutage noch verlassen Bhikkhus (buddhistische Wandermönche), Sadhus (Heilige) und Sannyasins (hinduistische Mönche) ihre Familien und weltliche Angelegenheiten, um Gottes Erde zu bewandern. Kommt ein solcher »Heiliger« in ein indisches Bauerndorf, versammelt sich Jung und Alt, um Segen und Rat zu empfangen, um Hilfe gegen die Übel, die Leib und Seele plagen, zu erbitten. Aus der uralten Tradition des Ayurveda schöpfen die Weltentsager ihre Ratschläge. Mit Sprüchen, Märchen und Geschichten, die von Göttern und Dämonen erzählen, werden die Lehren von gesunder Diät, heilsamem Lebenswandel und heilenden Kräutern vermittelt. Diese Art der Wissensvermittlung liegt dem Hinduismus wie dem Buddhismus zugrunde.
Über die Jahrhunderte hinweg, ehe Nationalstaaten und Ideologien ihre Grenzen abriegelten, wanderten solche Gestalten durch die Alte Welt. Auch buddhistische Mönche, die Seelen erfüllt mit Mitleid für die leidenden Wesen, durchquerten Wüsten und Berge. Etliche gelangten ins Abendland. Sie waren in der Heilkunde und der Kräuterkunde besonders bewandert, denn das hatte ihnen ihr erleuchteter Meister befohlen. Einst fand Buddha einen ruhrkranken Mönch, der sich in seiner Qual auf rauher Lagerstätte im eigenen Kot wälzte. Da wusch der Meister den Kranken mit eigenen Händen und bettete ihn in ein sauberes Bett; zu den anderen sagte er:
»Brüder, ihr habt weder Mutter noch Vater, die für euch sorgen. Wenn ihr nicht einander helft, wer wird euch helfen? Brüder, wer mich liebt, der sorgt für die Kranken.«
Seitdem widmen sich die Bhikkhus der Heilkunde. Ähnlich den christlichen Mönchen im Mittelalter wahrten sie das Wissen um Heilpflanzen und Arzneiherstellung. Ihre Meditationstechniken ermöglichten ihnen, ihre Seelen von unnützen, überflüssigen Gedanken und falschen Vorstellungen zu reinigen, um so besser in die verborgenen Seelenschichten des Patienten hineinsehen zu können oder die versteckten Eigenschaften eines Heilkrautes ausfindig zu machen. Was diese Wanderer aus Südasien mitbrachten, vermengte sich mit griechischen, babylonischen und ägyptischen Lehren und drang im Laufe der Jahrhunderte auch in den Schatz der einfachen Volksheilkunde ein.
Im Zweistromland
Auch in den fruchtbaren Tälern und Sümpfen von Tigris und Euphrat verlieren sich die Spuren der Heilkunde in schweigender Vergangenheit. Doch einige Geheimnisse haben die Ausgräber und Altertumsforscher dem Sand und Schlamm entreißen können.
Für die Sumerer, Babylonier, Akkadier, Chaldäer waren die Krankheiten böse Dämonen, die am Menschen fressen. Priesterärzte heilten durch Beschwörungen, Zauberrituale und Kräuter, nachdem sie am Sternenhimmel die Vorzeichen gelesen hatten. Mittels der Leberschau eines geschlachteten Tieres, in dessen Nüstern der Kranke seinen Atem geblasen hatte, identifizierten sie den Dämonen. Die abscheuliche Dreckapotheke – Gebräue aus Kot, Kadavern, Skorpionen und Kerbtieren – diente wohl dazu, die Krankheitsteufel aus dem Leib zu treiben. Assyriologen haben mit viel Mühe und Aufwand die Keilschrift aus dem dritten Jahrtausend v. Chr. entziffert, die ein sumerischer Arzt in Tontafeln ritzte.5 In diesem »ersten Handbuch der Medizin« werden 250 Heilmittel erwähnt. Salz, Salpeter, Milch, Schlangenhaut und Schildkrötenpanzer werden angegeben. 90% der Heilmittel sind jedoch pflanzlichen Ursprungs. Die Namen der Seuchen und Krankheiten sind die der Dämonen und können daher nicht leicht entziffert werden. Bei Pflanzennamen wie »Rabenfußpflanze« tappen die Forscher ebenfalls im Dunkeln. Bei anderen ist die Bestimmung gesichert.
Man benutzte Cassia, also Senna, und Koloquinten als Abführmittel; die stinkende Asafoetida (Ferula asafoetida), deren widerlich riechender Milchsaft bei Koliken und Krämpfen Verwendung fand; die narkotische Tollkirsche (Atropa belladonna), die beruhigend bei Krämpfen, Asthma und Hustenanfällen wirkt, indischen Hanf (Cannabis indica), ein hervorragendes Beruhigungsmittel, Weißen Germer (Veratrum album), ein giftiges Brechmittel, das eventuell gegen hartnäckige Hautkrankheiten oder als »Schocktherapie« bei Geisteskrankheiten benutzt wurde. Thymian, Weide, der Birnenbaum, Fichte und Dattel werden auch erwähnt. Kümmel, ein windtreibendes, verdauungsförderndes Mittel, und Myrrhe, ein zusammenziehendes Mittel, das man dem Mundwasser oder der Zahnpasta häufig beigibt, haben sogar bis heute ihre akkadischen Namen beibehalten: kamun und murra. Myrrhe und auch essigsaure Tonerde wurden wahrscheinlich zur Spülung und Desinfektion verwendet.
Die Kräuter wurden zu Salben, Einläufen, Kataplasmen und Getränken verarbeitet. Viele wurden in Salz oder Alkali (hergestellt aus der Asche von Gänsefußgewächsen) gekocht, abgefiltert und unter Aufsagen langatmiger Beschwörungsformeln eingegeben. Süßholz (Glycyrrhiza glabra) wurde mit Baumöl und einem Rauschmittel gegen Husten eingenommen. Andere Rezepte verlangen, dass die Kräuter in Bier oder Milch verabreicht werden.
Was uns jedoch an der mesopotamischen Heilkunde am meisten fasziniert, ist, dass ihre Kräuter und Kuren von astrologischen Gesichtspunkten betrachtet, unter Berücksichtigung der Planetenstellungen und -häuser, angewendet wurden. Am Himmelsgewölbe wurde abgelesen, ob es günstige oder schlechte Einflüsse waren, die an dem Tag den Kranken und das Kraut beherrschten. Diese Vorwegnahme der Idee der Biorhythmen geht ebenso auf die alten Heilpriester des Zweistromlandes zurück wie das Bild des Kosmos als das eines gigantischen, makrokosmischen Menschen (Makroanthropos), dessen Sternenleib in die zwölf Regionen des Tierkreises eingeteilt wird. Durch diesen Leib bewegen sich die sieben sichtbaren Wandelsterne (Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter, Saturn). Jeder einzelne Mensch ist ein Abbild dieses riesigen Urbildes, ein Mikrokosmos. Wie in dem Urbild wirken in ihm die Widderkräfte im Schädel, die Stierkräfte im Nacken, die Zwillingskräfte in Schultern und Armen, die Krebskräfte in der oberen Brust, die Löwenkräfte in der Herzregion usw. bis zu den Fischkräften in den Füßen. Diese Vision der Hierophanten lebt bis in unsere Tage in der Astrologie und im Kalendermann weiter.
Im Menschenleib wirken die sieben Planetenkräfte in den sieben Hauptorganen. Die Kräfte der Sterne und Planeten durchwirken eben die ganze Schöpfung. Daher suchte man die Heilkräuter für bestimmte Erkrankungen zu Zeiten, in denen sich der Planet, der die Pflanze wie das betroffene Organ beherrscht, in einem günstigen Zeichen, Haus und Aspekt befand. Stand der Planet ungünstig, dann vermochte die Medizin auch nicht viel zu helfen.
Irgendwie mussten diese Priesterärzte ihr Handwerk hervorragend beherrscht haben, denn wir erfahren, dass der Arzt, der einen Patienten fahrlässig tötete, des Mordes bezichtigt wurde. Wenn ein freier Mann durch Pfuscherei sein Augenlicht verlor, wurde dem Arzt zur Strafe die Hand abgeschlagen. Falls so etwas einem Sklaven widerfuhr, musste der Arzt lediglich eine Buße zahlen beziehungsweise den Sklaven ersetzen. Der dahinterliegende Gedanke ist, dass ein Arzt, der keine Heilung bewirken kann, den Segen der Götter verloren hat. Wenn er sich trotzdem an einen Patienten heranwagt, ist er ein Betrüger.
Die astrologisch ausgerichtete Heilkunde Mesopotamiens verbreitete sich in alle Himmelsrichtungen. Noch immer nehmen die ayurvedischen Mediziner Indiens – wie einst die Römer und die Ärzte der Renaissance – Bezug auf das Horoskop ihrer Patienten. Sogar die moderne Medizin kommt nicht ganz daran vorbei. Eine Operationsschwester aus Bremen beobachtete nahezu vier Jahrzehnte lang, dass die Blutungen auf dem Operationstisch viel schwieriger um den Vollmond als bei Neumond sind. Der tschechische Arzt Dr. Eugen Jonas konnte ermitteln, dass 98% der Kinder in der gleichen Mondphase gezeugt werden, in der die Mutter geboren wurde.6 Wenn eine Reihe von Planeten sich in Konjunktion mit der Sonne befindet, dann übt das einen gravitätischen Sog auf die Sonnenkorona aus, ähnlich wie der Voll- oder Neumond auf die Meeresoberfläche. Das Resultat erscheint uns als Sonnenflecken; diese wiederum korrelieren mit epidemischen Krankheiten, guten Weinjahren im Bordelais, Hungersnot in den Monsunländern, Erdbeben, Verschiebungen der Blütezeiten einiger Blumenarten und anderen Erscheinungen.7
Korrespondenz zwischen Organen und Himmelszeichen. (Entnommen aus: Martyrologium der Heiligen nach dem Kalender. Straßburg, 1484.)
Langjährige Anbauversuche der anthroposophischen Konstellationsforscherin Maria Thun zeigen, dass bei besonderen Mondkonstellationen bestimmte Unkrautsamen keimen und das Pflanzenwachstum unterschiedlich angeregt wird.8 Wer weiß, vielleicht wussten die alten Chaldäer und Babylonier mehr, als wir bereit sind, ihnen zuzugestehen.
Ägyptische Heilkunst
Jede Kultur legt sich ein medizinisch-anthropologisches Modell zurecht, das das gesammelte Wissen um Körper, Krankheit und Heilmittel ordnet und überschaubar verständlich organisiert. Seit René Descartes bedienen wir uns des Modells des Menschen als Maschine mit dem Hirn als informationsspeicherndem Steuerungsmechanismus. Die neueste Variante dieses Modells ist der Mensch als kybernetisches System. Das mesopotamische Modell war das des zwölfgeteilten himmlischen Makroanthropos, mit den Planeten als den sieben Hauptorganen. Das Modell der brahmanischen Medizin Indiens war durch den Wechsel der Jahreszeiten auf dem Subkontinent gegeben: Vayu – das kühle, feuchte Frühjahr; Pitta – die gereizte, heiß-trockene Vormonsunzeit; Kapha – die nasse, beklommene Regenzeit: Sie erscheinen im Menschen als die drei Humoren (Dosas, Dhatus), als Wind, Galle und Schleim.
In Ägypten war es die Nilüberschwemmung, die jährlich, wenn der Hundsstern am Horizont erschien, die Felder verschluckte, sie von Unrat und Ungeziefer säuberte und dann befruchtenden Schlamm hinterließ, die ein brauchbares Modell für das Funktionieren des menschlichen Leibes bot. Der Verdauungskanal, vom Mund bis zum Dickdarm, gleicht dem lebensbringenden Strom, der von den Sümpfen Nubiens hinab zum Delta fließt. Auch der innere Nil bringt Nahrung herunter und spült Unreinheiten aus dem Körper. Krankheit galt demzufolge als Blockierung oder Abänderung dieses Stromes. Daher bestand die ägyptische Arznei hauptsächlich aus Abführmitteln, Brechmitteln, Klistierspritzen und dem Schröpfen. Die Praxis des Aderlasses und Blutzapfens wurde später von dem römischen Superarzt Galenus als eines der wichtigsten therapeutischen Mittel propagiert und von der Medizin bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts beibehalten.
Wie anderswo standen auch hier die Kräuter an erster Stelle der Heilmittel. Die Tempel hatten ihre eigenen Kräutergärten. Wir wissen beispielsweise, was im Heilpflanzengarten des Tempelkomplexes zu Edfu in Oberägypten, 2400 Jahre vor unserer Zeitrechnung, angebaut wurde:
Wacholder(Juniperus communis), dessen harzige Beeren ein ausgezeichnetes harntreibendes Mittel sind, das bei Wassersucht – durch Herz- oder Nierenschwäche verursacht – angewendet wird; außerdem sind Wacholderbeeren appetitanregend und windtreibend.
Koloquinte(Citrullus colocynthis), eine bittere Verwandte der Gartengurke, die drastisch purgierend auf den Darm wirkt und zudem Wasser treibt.
Granatapfel(Punica granatum), ein Bäumchen, dessen rote Blüte und saure Früchte adstringierend (zusammenziehend) wirken. Wurzeln und Rinde beruhigen Durchfall und spülen Bandwürmer heraus.
Flachs(Linum usitatissimum) hat – ebenso wie der Flohsamenwegerich (Plantago afra), den die alten Ägypter ebenfalls kannten – Samen mit Schleimgehalt, die als mildes Abführmittel dem Bettlägerigen oder alten Menschen das Leben etwas leichter machen. Als Umschlag wirken die Samen erweichend bei Geschwüren und Furunkeln.
Fenchel(Foeniculum vulgare) fördert die Verdauung, wirkt wurmtreibend, harntreibend und krampflösend.
Ahorn(Acer spp.) gilt als kühlendes Mittel. Ein Blätterbrei wird auf die krankhaft erhitzten Stellen aufgelegt.
Kardarmom(Elettaria cardamomum) beseitigt Blähungen und Verdauungsstörungen.
Kümmel(Cuminum cyminum) wirkt ebenso wie Kardamomsamen, regt zudem die Drüsen an, reguliert die Menstruation und fördert bei stillenden Müttern die Milchsekretion.
Knoblauch(Allium sativum) ist ein tonisches Allheilmittel, das sich besonders zur Senkung des Blutdrucks und zur Stärkung des Immunsystems eignet.
Senna(Cassia angustifolia) ist ein darmschonendes, sicheres Abführmittel.
Madonnenlilie(Lilium candidum) ist ein Heiler der Frauenleiden. Die schleimhaltige Zwiebel eignet sich für erweichende Umschläge bei Tumoren, Entzündungen und Verbrennungen.
Wunderbaum(Ricinus communis), eine an sich hochgiftige Pflanze, aus deren Samen jedoch ein dünndarmwirksames Abführmittel – das Rizinusöl – gepresst wird.
Alraune(Mandragora officinarum oder Atropa mandragora) ist eine sagenumwobene Pflanze, deren Wurzeln aphrodisisch, abführend und purgierend, deren Blätter wundheilend und deren Saft schmerzstillend wirkt.
Schlafmohn(Papaver somniferum) ist ein bekanntes schmerzlinderndes, einschläferndes Mittel. Bei Ruhr und Diarrhöe wirkt es stopfend.
Viel Schlamm und Wasser ist den freundlichen Fluss heruntergeflossen, Dynastien kamen und gingen, und Götter lösten einander in der Herrschaft ab, seit ein unbekannter Schreiber vor nahezu fünftausend Jahren diese Pflanzenliste auf einen Papyrus (Papyrus Ebers) pinselte. Trotzdem bleiben die erwähnten Pflanzen unübertreffliche Heilmittel.
Im alten Ägypten ließ man die Kranken fasten, badete sie und legte sie im Tiefschlaf in den Tempeln unter das Bildnis der Göttin Isis. Die Große Mutter erschien ihnen im Traum und offenbarte ihnen beides, Heilweg und Heilmittel. Diese Methode des Tempelschlafs wurde später von den Griechen, den Schülern des wundertätigen Äskulap, übernommen.
Wie in allen alten Zivilisationen gehörte der Arzt zur Priesterkaste. Jeder Arzt war nur für jeweils eine bestimmte Krankheit zuständig. So kam es, dass der Pharao Dutzende von Ärzten um sich hatte – jeder zuständig für ein gewisses Organ. Da gab es farbige Titel wie »Königlicher Hüter von des Pharaos linkem Ohr« oder auch »Hirte des königlichen Sphinkters«.
Griechische und römische Medizinkunde
Wie alle indoeuropäischen Volksstämme kannten auch die frühen Griechen die Tradition der wurzelkundigen weisen Frauen. In Homers llias lesen wir von der gelbhaarigen Agamede, »die so viele Kräuter kannte, wie die weite Erde hervorbringt«.
Rhyzotomi – Wurzelschneider – durchstöberten die hellenischen Pinien- und Eichenwälder und Bergwiesen. Die Kräuter und Wurzeln, die sie gruben, galten als das Blut von Erddämonen, die mit Zaubersprüchen und Opfern beschwichtigt werden mussten.
Auch Äskulap scheint ein Erddämon gewesen zu sein. Irgendwann im 5. Jahrhundert v. Chr. errichteten die Griechen an heiligen Quellen und Grotten Tempel für diesen Heilgott. Hier wurden die Leidenden mit duftenden Kräutern massiert, gebadet und, nachdem ein Hahn geopfert war, in einen magischen dreitägigen Tiefschlaf versetzt. Hunde und Schlangen, die dem Gott geweiht waren, wurden im Tempelhof gefüttert und bewegten sich frei. Wie bei den Hindus, Mesoamerikanern, Ägyptern und Kretern galten Schlangen als heilkräftig. Hunde, die treuen Wächter, galten als dämonenabwehrend.
So erfolgreich scheinen die äskulapischen Heilpriester gewesen zu sein, dass – der Legende nach – Pluton, der Fürst des Totenreiches, sich wütend beim Götterkönig beschwerte, dass sich die Zahl der Schatten im Hades auf ein unerträgliches Maß verringere. Zeus tötete daraufhin Äskulap mit seinem Blitz. Das erzürnte wiederum den Sonnengott Apollon, dessen Pfeile den Menschen sowohl Krankheit als auch Heilung brachten, denn Apollon hatte mit einer Nymphe den großen Heiler gezeugt. Als Sohn des Sonnengottes und einer Waldnymphe erweist sich Äskulap als Kind zweier Welten, der himmlischen und der irdischen. (Sein indischer Gegenpart, der Heilgott Dhanvantari, weist ebensolche himmlischen und chthonischen Eigenschaften auf. Er ist Schüler des Sonnenadlers Garuda und Shivas, des Herrn der Schlangen, des Fiebers und der Zauberei.) Der heilkundige Pferdemensch, der Zentaur Cheiron, war der Lehrmeister, der dem Äskulap die Kräfte aller Kräuter verriet. Mit seiner Gattin zeugte der große Heiler zwei anmutige Töchter: Panazee, das Allheilmittel, und Hygieia, die Gesundheitspflege. Sein Zeichen ist der Äskulapstab (Caduceus), ein von zwei geifernden Schlangen umwundener Stab, der Gift und Gegengift versinnbildlicht. Dieser Stab wurde dem Götterboten Hermes/Merkur, dem Gott der Händler, Heiler und Gauner, als Zepter übertragen und gilt bis in unsere Tage als Symbol der Ärzte wie des Geldes (Dollarzeichen) (s. Abbildung).
Hippokrates (460–370 v. Chr.) stammt aus einer Familie äskulapischer Heiler, die auf Kos, einer Insel an der Küste Kleinasiens, lebte. Das östliche Ägäische Meer war damals wie heute Berührungspunkt verschiedener Kulturen – Kleinasiens, der Levante und des Abendlandes. In der Natur, an Orten, wo sich verschiedene Biotope überschneiden, kann man mit vielen schöpferischen Neuerungen rechnen. Wo sich Kulturkreise überschneiden, ist es ähnlich. Im Wirrwarr aufeinanderprallender, sich widersprechender Imaginationen und Bilder wählte Hippokrates einen nüchternen, praktischen Standpunkt, der uns heute noch modern erscheint. Es ist kein Wunder, dass die neuzeitliche medizinische Wissenschaft ihn zum Vater der Medizin erkoren hat.
Während seine Vorgänger Zauberei, den bösen Blick oder die Missgunst der Götter für Krankheiten verantwortlich machten, verzichtete dieser Arzt auf übersinnliche Manipulationen. Für ihn war die Krankheit vor allem ein Kampf zwischen den Kräften des Todes und den innewohnenden Fähigkeiten des Leibes, sich selber zu heilen. Der Arzt muss diesen Heilvorgang sachlich unterstützen, egal was die Ursache der Krankheit sein mag, auch wenn sie selbstverschuldet ist.
Seine therapeutischen Maßnahmen waren hauptsächlich von der Vernunft her bestimmt: Man greift der Natur unter die Arme mit frischer Luft, Sonne, Kräutertees, leichter, einfacher Kost, Reinigung des Körpers durch Brechmittel und Aderlass, Massage, Wasserkur und mit einfachen Mitteln wie Hydromel (Honigwasser), Gerstenwasser und Oxymel (Honig mit Essig). Er bevorzugte den schwarzen Nieswurz (Helleborus niger) als Abführmittel und den Weißen Germer (Veratrum album) als Brechmittel. Rund fünfhundert verschiedene Heilkräuter machten seine Apotheke aus. Seine Ethik – der Eid des Hippokrates – wird noch heute von promovierenden Medizinstudenten nachgeplappert, und es würde wohl nicht schaden, wenn unsere technologiebesessenen Mediziner sich seinen Inhalt öfter vor Augen hielten.
Im kaiserlichen Rom waren die meisten Ärzte griechischer Herkunft. Das schien Plinius dem Älteren zu missfallen, denn er nörgelt, dass die Römer sechshundert Jahre lang ohne Ärzte, aber mit Beschwörungsformeln, Riten und Kräutern gut ausgekommen seien. Zwei Hellenen treten besonders hervor und werden die Leuchten der medizinischen Wissenschaft in den kommenden Jahrhunderten. Der eine ist Dioskurides, ein Zeitgenosse des nörgelnden Plinius, der als Wundarzt bei den Heeren Neros und Vespasians seine Dienste leistete und dabei große Teile des Imperium Romanum kennenlernte. Zwischen Feldzügen und Schlachten hatte er Muße, sich mit Heilpflanzen abzugeben und das erste wirklich praktische Kräuterbuch des Abendlandes zu verfassen. In seinem Hauptwerk (Peri Hyles latrikes) beschreibt er nicht nur sechshundert Pflanzen, sondern auch ihren Nutzen, die richtige Zeit, sie zu sammeln, und wie man sie zubereitet.
Der andere große Arzt, ebenfalls ein Grieche aus Kleinasien, ist Claudius Galenus (131–201), Leibarzt des Kaisers Mark Aurel. Seine Lehre der Säfte und ihrer Mischung im Körper blieb die Leitidee der Ärztezunft bis ins 18. Jahrhundert. Die Urstoffe (Erde, Wasser, Luft, Feuer) erscheinen im Leib als vier Körpersäfte (Humores): schwarze Galle, Schleim, gelbe Galle und Blut. Stehen diese Körpersäfte in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander, dann ist der Mensch in »gutem Humor«; eine Unausgeglichenheit dagegen erzeugt »schlechten Humor«. Galenus ersann in seinen über vierhundert Schriften ein kompliziertes System von primären, sekundären und tertiären Qualitäten dieser Säfte. Da hat das Blut die Eigenschaften rot, heiß, feucht und süß und gibt dem Menschen ein sanguinisches Temperament, macht ihn lebhaft und heiter. Galle ist dagegen heiß, trocken, gelb, bitter im Geschmack und macht den Menschen cholerisch, das heißt jähzornig und aufbrausend. Schleim ist kalt, feucht, weißlich und salzig im Geschmack, und ein Überfluss davon gibt dem Menschen ein phlegmatisches Temperament, er wird schwerfällig und träge. Der vierte Saft, die schwarze Galle, ist kalt, trocken, bläulich, sauer und macht melancholisch, das heißt schwermütig oder traurig. Die Aufgabe der Arzneimittel ist es also, diese Körpersäfte in Harmonie zu bringen. Das wird durch Diät erlangt und durch Heilkräuter, die in ganz genau bestimmten Dosierungen eingenommen werden, unterstützt.
Die 4 Säfte
Den wohlhabenden und mächtigen römischen Patriziern verschrieb Galenus Rezepte mit über hundert verschiedenen Zutaten. Um die Klienten auch gehörig zu beeindrucken, verzierte er die Rezepte mit magischen ägyptischen Hieroglyphen, denn auf die alten Ägypter schauten die Römer ebenso ehrfurchtsvoll, wie wir auf das klassische Altertum schauen. Das Uzat-Auge, das Mond-Auge des Himmelsgottes Horus, war sein beliebtestes Motiv. Seth, der Gott des Todes und der Wüste, riss es einst dem Falkenköpfigen im Kampf aus dem Schädel. Da rief die All-Mutter Isis den ibisköpfigen Thot, den Gott der Weisheit, der Medizin und des Buchstabens an, dass er das Auge wiederherstelle. Er tat es auch, und seither wird das Uzat-Auge als Zeichen der regenerierenden Mondenkräfte, der Heilung und als Abwehr des bösen Blicks auf Amuletten getragen. Es hat sich bis in unsere Tage erhalten – als Symbol für die Rezeptur, die schriftliche Anweisung eines Arztes an den Apotheker: Rx.
Arzneimittelzusammenstellungen mit Dutzenden von Zutaten blieben bis zur Renaissance beliebt; bis sich Paracelsus darüber aufregte. Er hatte recht, denn die phantasievollen Mischungen aus allen möglichen Kräutern machten es unmöglich festzustellen, was welche Wirkung im Krankheitsverlauf hat. Die paracelsischen Ärzte gaben da lieber das »Simplum«, das einfache Heilkraut, damit sie dessen Wirkung genau beobachten konnten. Es ist deshalb ironisch, dass man im heutigen Sprachgebrauch gerade die einfachen Heilmittel, die Kräuter, »Galenika« nennt. Das kommt daher, dass Paracelsus, dem alles in der Natur als Heilmittel diente, auch nach arabischem Vorbild alchemistisch präparierte Mineralien erfolgreich anwandte. Seine weniger vorsichtigen Nachfolger, die »Paracelsisten«, machten immer ausgiebigeren Gebrauch von Präparaten aus Mineralien und Metallen. Schließlich verachteten sie die einfachen Kräuter als ebenso »galenistisch« wie die Phantasiemischungen des alten Griechen.
Kräutergärten in den Klöstern
Nachdem sich die wilden Germanenstämme durch das Weströmische Reich hindurchgeplündert und -gebrandschatzt hatten, blieb nicht viel von der klassischen Tradition des Galenus und des Dioskurides übrig. Die Priester und Mönche, die nach der Völkerwanderungszeit immer mehr davon besessen waren, ihre Herrschaft zu festigen, schielten mit unfreundlichen Augen auf die Knocheneinrichter und weisen Frauen, die mit Hilfe der »Teufel« ihre Heilungen verrichteten. Nein, lehrten die heiligen Väter, die Leiden der sündigen Menschen seien besser durch Buße und Gebet, mit Paternostern, gesegnetem Wasser, der heiligen Hostie oder durch Wallfahrten zu den Reliquienstätten zu beheben. Es ging sogar so weit, dass man den Bauern – wahrscheinlich um einem Rückfall ins Heidentum entgegenzuwirken – das Anpflanzen von Heilkräutern verbot. Kräuterkundige weise Frauen, Schamaninnen und Lachsner und Lachsnerinnen (Heiler) galten den Missionaren als Rivalen. Sie wurden bekämpft. Hatte nicht der Kirchenvater Tertullian verkündet, das Kräuterwissen der Frauen sei Luzifers Hurenlohn dafür, dass sie tugendhafte Männer verführten und sogar mit den Engeln Unzucht trieben (De Anima LVII)? Verschiedene Kirchensynoden, wie die Synode von Ancyra (314 n. Chr.) oder die Synode von Laodicae (506 n. Chr.) verboten „okkulte“ Heilmittel, darunter Kräuter.9
Das einfache Volk ließ sich jedoch nicht die bewährten Heilkräuter nehmen. Bei Krankheiten und gesundheitlichen Problemen ging man dennoch heimlich zu den kräuterkundigen Frauen. Die Kirche hatte keine Wahl, als die Heilpflanzen wieder in den kulturellen Kosmos aufzunehmen. Man weihte die Kräuter nun den Heiligen und vor allem der Muttergottes, Maria. Langsam fingen die Mönche und Klausner an, Kräuter bei ihren Einsiedeleien anzubauen, besonders diejenigen, die in der Bibel erwähnt werden, oder diejenigen aus dem Mittelmeergebiet, »wo einst die Apostel wandelten«.
Montecassino, das erste Kloster in Europa, das der heilige Benedikt um 527 n. Chr. gründete, war als eine selbstversorgende Mönchsgemeinschaft konzipiert. Hier konnten die Gottesversessenen ihr Leben dem Gebet und der Arbeit widmen. Zu dieser Arbeit gehörte nicht nur ein Gemüsegarten, sondern auch ein Küchen- und Heilkräutergarten, der bepflanzt und gepflegt werden musste. Montecassino wurde das Vorbild für andere mönchische Gemeinschaften, die sich, besonders durch die Unterstützung des Frankenkaisers Karls des Großen, im Abendland verbreiteten. Der Kaiser hatte sich wahrscheinlich ebenso Sorgen um die medizinische Betreuung seiner Untertanen gemacht wie um ihre Nahrungsmittelversorgung. Daher ließ er von seinen Schreibern und Gelehrten 812 n. Chr. das Capitulare de Villis lmperialibus aufstellen mit einer Liste aller Pflanzen, die er sich in seinen Gärten wünschte. Jeder Abt, der etwas auf sich hielt, war dann begierig, diese Kräuter auch in seinem Garten zu haben. Die einheimischen Kräuter wurden dabei oft verachtet. Man stelle sich die braven Mönche vor, die vielleicht ein Pflänzlein von Wald und Wiese mitbrachten; da sie es aber weder in der Bibel noch in irgendwelchen alten Schriften erwähnt fanden, mussten sie es als ludus daemonium, als Trick des Teufels, verwerfen.
Wie es in den Klostergärten zu karolingischen Zeiten ausgesehen hat, wissen wir ziemlich genau. Walafrid Strabo, der Abt im Kloster Reichenau (am Bodensee) gibt uns im Hortulus (847 n. Chr.) Aufschluss darüber. Die Anlage des Klosters hat sich nach dem Muster der alten römischen Villa entwickelt. Der Innenhof befand sich südlich des Kirchgebäudes. Ein Kreuzgang mit Säulen führte die andächtigen Mönche durch die mit bunten Blumen und duftenden Kräutern säuberlich bepflanzten Beete zu einem Brunnen, einer Statue oder einem Blumenkreis in der Mitte (wie einst das römische Atrium und Peristylum). Die Statuen waren natürlich nicht mehr die des Pan oder der Venus, sondern die eines Heiligen oder der heiligen Jungfrau.
Umhüllt von Blumenduft und Vogelgezwitscher konnten die Mönche ihre müden Geister erfrischen, ihren Meditationen nachgehen und einen gewissen Vorgeschmack der himmlischen Freuden genießen, denn – das wusste man – wo es lieblich duftet, da weilen die Engel, die guten Geister; der Teufel hingegen verrät seine Anwesenheit mit schwefeligem Gestank. Die offenen Stellen an der Seite der Kirche nannten die Mönche »Paradiesfelder«.
Aber wir wollen noch einen Blick hinter die Klostermauern werfen. Da sehen wir neben dem Klosterspital das »physiatrische« Gärtlein mit den Kräutern, die die Mönche für ihre kranken Brüder brauchen und auch für die Dörfler, die ab und zu um Hilfe bitten: Schminkbohnen, Bohnenkraut, Wasserkresse, Kümmel, Liebstöckl, Fenchel, Rainfarn, Salbei, Raute, gelbe Schwertlilie, Poleiminze und andere Minzarten, Bockshornklee, Rosmarin, Mugwurz, Andorn, Wermut und natürlich auch Lilie und Rose werden da vom Hortulanus und seinen Assistenten (famuli) gepflegt.11 Zu dem Hofgarten, dem Paradiesgärtlein und dem Kräutergarten kam dann noch der Gemüsegarten mit Feingemüsen und Gewürzen hinzu. Hier wuchsen Zwiebel, Knoblauch, Lauch, Schalotte, Sellerie, Petersilie, Möhre, Kerbel, Koriander, Dill, Pastinaken, Salat, Mohn, Bohnenkraut, Radieschen und Bete.
Ab und zu kamen wohl auch Brüder aus fernen Landen. In ihren Taschen war vielleicht eine Handvoll seltener Samen, Knollen oder Zwiebeln oder gar ein altes Manuskript, das sich mit Heilpflanzen befasste. Auf diese Weise haben die Benediktiner, und später die Zisterzienser, unbekannte Arten aus südlicheren Ländern in den neu bekehrten Norden mitgebracht und die wenigen Funken der klassischen Tradition gehütet und am Leben erhalten.
Im hohen Mittelalter verschmilzt die Tradition der Gottesmänner und -frauen immer mehr mit der Volksheilkunde der weisen Frauen. Mit Hildegard, der wurzelkundigen Äbtissin von Bingen, erscheint im 12. Jahrhundert eine wahrhaft weise Frau im Gewand einer Nonne. Sie kannte nicht nur die welschen Kräuter der Bibel und des Klostergartens, sondern ebenso die einheimischen Heilpflanzen. Hellsichtig nahm sie die Einheit der Schöpfung wahr, zu der die Engel, die Tiere, die Vegetation und das Gestein gehören.12
Auch der Mensch in seiner vollen Leiblichkeit, Sinnlichkeit und Geschlechtlichkeit gehört zur heilen Schöpfung Gottes. Da der Mensch, dieser Mikrokosmos, aber seinen Weg verloren hat, ist er schwach, hinfällig und für Krankheiten anfällig geworden. Aber der ganze Makrokosmos, die große Natur, besonders die grüne Lebensfrische (veriditas), dient dazu, ihn wieder zum Heil kommen zu lassen. Dieses Heil(mittel) liegt verborgen in der Natur:
...und so sind denn in allen Geschöpfen Gottes Wunderwerke eingeborgen: in den Tieren und Fischen und Vögeln, in den Kräutern und Blumen und Bäumen, verborgene Geheimnisse Gottes, die kein Mensch wissen kann, es sei ihm von Gott eingegeben.
Die ganze Natur spricht zu ihr von Gottes Liebe – da haben die einheimischen Kräuter genügend Platz! Hildegard, als »prophetissa teutonica« eine geehrte Ratgeberin Kaiser Barbarossas, war keine Akademikerin. Sie wusste noch nichts von der kunstfertigen arabischen Medizin, die die jungen Ärzte wie Fliegen zum Honig zu den Universitäten in Spanien und Süditalien zog. Sie las im Buche der Natur nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Verstand des Herzens.
Die Araber
Das arabische Wort al-kemi (Alchemie) bedeutet »schwarze Erde« und deutet auf den fruchtbaren schwarzen Humusboden des Nilschwemmlandes. Hier entstand schon in den frühsten pharaonischen Zeiten die geheimnisvolle Scheide- und Verwandlungskunst. Vor fünftausend Jahren schon wurden die aromatischen Öle und Harze den Kräutern, die Nektare und Düfte den Blüten entzogen, konzentriert, destilliert und gemischt – das war die Kunst der Priester des Thot, der in seiner griechischen Umbenennung als Hermes Trismegistos bis heute der Herr und Patron der Alchemisten ist. Da Thot, der Herr der Zeit, Herr des Mondes und Rechner der Jahre, ein Helfer der Toten ist, verwundert es nicht, dass die Heilelixiere, Pomaden, Parfüme und Salben, die die alten ägyptischen Alchemisten herstellten, nicht nur den Kranken zugedacht waren, sondern auch den Toten. Sie dienten zum Einbalsamieren der menschlichen Leichen und der Kadaver der heiligen Stiere, Affen, Krokodile und anderer Tiere, damit ihre Vitalseelen, ihr Ba und Ka, glücklich im Sarg weiterleben konnten. Herodot (5. Jahrhundert v. Chr.) schreibt, dass die Einbalsamierung der Mumien von Spezialisten vorgenommen wurde: Nachdem sie das Gehirn durch die Nasenlöcher mit einem Draht aus dem Schädel herausgezogen hatten, schnitten sie den Bauch auf, um die Eingeweide zu entfernen. Die Bauchhöhle wurde mit Palmwein und aromatischen Kräuterinfusionen ausgewaschen.
Dann stopften sie die Bauchhöhle mit reiner Myrrhe, zerriebener Kassiarinde (Cinnamomum cassia; chin. Zimtöl) und anderen Gewürzen, außer Weihrauchrinde, und nähten sie wieder zu. Nachdem dieses geschehen war, wurde der Körper für siebzig Tage in Natronlauge gelegt.13
Schließlich wurde die Leiche nochmals gewaschen, gesalbt und dann mit parfüm- und harzgetränkten Leinstreifen zur Mumie gewickelt. Das technische Wissen, das zur Herstellung von Ölen, Balsamen, Destillaten und Pulvern befähigte, wurde von den Alchemisten sorgsam weitergepflegt. Noch heutzutage werden Touristen von Straßenjungen in Kairo angeschwatzt und in Parfümerien gelockt, wo feine Essenzen, wie einst aus Blumen und Kräutern in Fayum hergestellt, feilgeboten werden. Über das maurische Spanien und auch über die Ärzteschule von Salerno drang die Kunst des Destillierens in die europäische Arzneikunde. Vorläufig blieben die alchemistischen Siedekünste das sorgfältig gehütete Geheimnis der Klöster. Mönche und Nonnen besaßen die Muße und die Mittel, mit Öfen, Kolben und Tiegeln zu experimentieren und arabische Schriftrollen zu übersetzen. So entstanden viele berühmte Liköre und Branntweine, Tinkturen und Essenzen, die ihre Hersteller berühmt und reich machten (zum Beispiel der Klostergeist der Karmeliternonnen). Im 16. Jahrhundert wurden diese alchemistischen Wundermittel immer häufiger von Ärzten, Apothekern, Wunderdoktoren, Badern, Scherern und anderen, die sich mit medizinischen Angelegenheiten befassten, benutzt. Hinzu kamen Frauen, die sich mit gebranntem Wasser und dem Sieden von Kräutersäften beschäftigten. Diesen Säftesiederinnen und Wasserbrennerinnen wurde das Recht zur Herstellung bestimmter Heilmittel verbürgt.