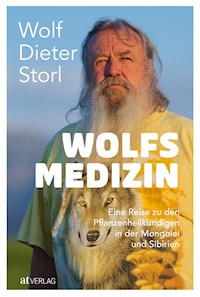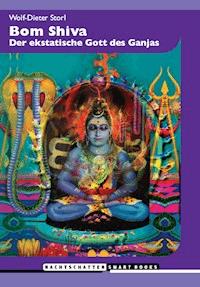25,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wo liegen unsere Wurzeln? Das Wissen um unseren Ursprung verblasst in der schnelllebigen modernen Zeit. Jetzt nimmt uns der renommierte Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl an die Hand und zeigt uns unseren Ursprung in der Natur. Denn hinter unserer scheinbar so starren Kultur liegen der natürliche Rhythmus des Jahreskreises und seine Pflanzen. Wolf-Dieter Storl hilft uns, die ursprüngliche Bedeutung unserer Rituale wiederzufinden, indem er sie auf die symbolische und tatsächliche Kraft unserer Pflanzen zurückführt. Lassen Sie sich von seinen spannenden Erzählungen in den Bann ziehen und erfahren Sie die Verbindung mit der Natur neu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Impressum
© eBook: 2024 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
© Printausgabe: 2024 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
GU ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, www.gu.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Projektleitung: Julia Herko
Lektorat: Dorothea Steinbacher
Korrektorat: Annette Baldszuhn
Bildredaktion: Dorothea Steinbacher, Natascha Klebl
Covergestaltung: ki 36 Editorial Design, Petra Schmidt, Bettina Stickel
eBook-Herstellung: Evelynn Ruckdäschel
ISBN 978-3-8338-9568-5
1. Auflage 2024
Bildnachweis
Coverabbildung: Stocksy/Hakan & Sophie
Fotos: AdobeStock; Alamy; Bernhard Haselbeck; Dorothea Steinbacher/ Archiv; GAP Photos/Robert Mabic; Gartenbildagentur Friedrich Strauss/ Linnhoff, Angelica /Staffler, Martin, /Strauss, Friedrich, /Wothe, Konrad; Getty Images; GU/Marina Jerkovic; Flora Press/Buiten-Beeld/ Michel Geven /Daniela Kunze:; Lisa Storl; Shutterstock; Wikicommons, /Dosseman Rogier van der Weyden, /Harry Rose; Wikipedia:/Martin, W.A.Parsons, /Moritz von Schwind
Syndication: Bildagentur Image Professionals GmbH, Tumblingerstr. 32, 80337 München, www.imageprofessionals.com
GuU 8-9568 11_2024_02
Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.
Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de
www.facebook.com/gu.verlag
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
wir wollen Ihnen mit diesem E-Book Informationen und Anregungen geben, um Ihnen das Leben zu erleichtern oder Sie zu inspirieren, Neues auszuprobieren. Wir achten bei der Erstellung unserer E-Books auf Aktualität und stellen höchste Ansprüche an Inhalt und Gestaltung. Alle Anleitungen und Rezepte werden von unseren Autoren, jeweils Experten auf ihren Gebieten, gewissenhaft erstellt und von unseren Redakteur*innen mit größter Sorgfalt ausgewählt und geprüft.
Haben wir Ihre Erwartungen erfüllt? Sind Sie mit diesem E-Book und seinen Inhalten zufrieden? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Titel weiterempfehlen, in ihrem Freundeskreis oder bei Ihrem Online-Kauf.
KONTAKT ZUM LESERSERVICE
GRÄFE UND UNZER VERLAG Grillparzerstraße 12 81675 München
Wichtiger Hinweis
Die Gedanken, Methoden und Anregungen in diesem Buch stellen die Meinung bzw. Erfahrung des Verfassers dar. Sie wurden vom Autor nach bestem Wissen erstellt und mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft. Sie bieten jedoch keinen Ersatz für persönlichen kompetenten medizinischen Rat. Jede Leserin, jeder Leser ist für das eigene Tun und Lassen auch weiterhin selbst verantwortlich. Weder Autor noch Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen praktischen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
MITTSOMMER Johanni und die Sommersonnenwende
Wer nicht von dreitausend Jahren sich weiß Rechenschaft zu geben, bleibt im Dunkel unerfahren, mag von Tag zu Tag leben.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
WEST-ÖSTLICHER DIVAN, 1819
Fest der Lebensfreude
Wohl ist alles in der Natur Wechsel, aber hinter dem Wechselnden ruht ein Ewiges.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
GESPRÄCHE MIT KANZLER FRIEDRICH VON MÜLLER, 15. MAI 1822
IM SOMMER – SO die Geistesschau Rudolf Steiners – träumt die Erde in den Kosmos hinein, so wie der Mensch, wenn er schläft; im Winter ist sie wach. Das Johannisfest ist ein freudiges, euphorisches Miterleben des »Mittsommertraums« von Mutter Natur.
Das Mittsommer-Sonnenfest ist ein Fest der Lebensfreude und Dankbarkeit dem Lebensquell Sonne gegenüber, ein Fest, das unsere europäischen Vorfahren mindestens seit der Jungsteinzeit feiern.
Heutzutage liest man oft, die Menschen hätten die Sonnwendfeuer entzündet, um Dämonen abzuwehren. Diese Umdeutung erfolgte aber erst im Mittelalter. Denn in dieser Zeit herrschte viel Angst. Die »kleine Eiszeit« war im Anmarsch; das Wetter wurde unbeständiger und es wurde kälter. Das bedeutete, dass die Anbauflächen sich verringerten und vielerorts Hungersnot drohte. Die immunologisch geschwächten Menschen waren anfälliger für Seuchenzüge und Pest.
Das Getreide, vor allem der Roggen für das tägliche Brot, war oft von dem schmarotzenden Mutterkornpilz (Claviceps purpurea) befallen, der die Menschen vergiftete. Nachdem man das verseuchte Brot gegessen hatte, fing der Körper an zu kribbeln, es fühlte sich an, als verbrenne man innerlich; wegen Durchblutungsstörungen wurden Finger und Zehen schwarz und starben ab; schlimme Halluzinationen – Mutterkorn enthält LSD8 – begleiteten den Schrecken der Brandseuche. Es schien, als hätten sich die Tore der Hölle geöffnet. Man rief den heiligen Antonius (251–356 n. u. Z.) an, der der Überlieferung nach in seiner Einsiedelei in Ägypten von ganzen Horden Höllendämonen angegriffen wurde, diese aber dank seines unerschütterlichen Glaubens abwehren konnte. Erst im 17. Jahrhundert entdeckte ein französischer Arzt die Ursache dieses Antoniusfeuers, dieses »heiligen Feuers« (Ignis sacer).9 Die Angst vor Hexen nahm zu, man brauchte ja Sündenböcke. Die Inquisition wütete. Trotz dieser schwierigen Zeiten bestanden die Grundherren (Adel und Klerus) weiterhin auf Abgaben – ein Zehntel der Ernte: Heu, Holz, Fleisch, Eier, Milch usw. – ihrer zunehmend verarmten, bäuerlichen Untertanen. Zusätzlich bedrängten ab dem 14. Jahrhundert die gefürchteten Osmanen immer wieder die christlichen Länder und eroberten weite Teile Osteuropas. Kein Wunder, dass die Angst vor Dämonen und Teufeln zunahm.
Eines der bekanntesten Medicine Wheels in Nordamerika, in den Bighorn Mountains, Wyoming.
DAS SONNWENDFEST IST URALT
Ursprünglich jedoch war das Sonnwendfeuer kein Ausdruck der Angst, sondern der Lebensfreude. Sein Entfachen diente dazu, mit der Sonne, dem Lebensquell, in Resonanz zu gehen und ihr auf ihrem Höhepunkt Beistand zu leisten. Wie angedeutet, kannten schon die Megalith-Menschen das Fest, denn viele vorkeltische Steinsetzungen, wie etwa die in Stonehenge (England), sind so aufgestellt, dass Licht und Schatten die Sonnenwenden wie auch die Tagundnachtgleichen genau anzeigen.10 Auch die fast 4000 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra erlaubt die Annahme, dass man in der frühbronzezeitlichen Aunjetitzer Kultur nicht nur die Sterne genau beobachtete, sondern auch in der Lage war, die Sonnenwenden präzise zu berechnen. So konnte die Scheibe, waagerecht gelegt und auf eine Erhöhung (Mittelberg) gerichtet, als Kalender zur Verfolgung des Sonnenjahrs genutzt werden.
Dann wäre noch das von keltischen Druiden benutzte »Belchen-System« zu nennen, bestehend aus Berghöhen im Schweizer Jura (Baselland), im Elsass und im Schwarzwald, von denen aus sich die Sonnenwenden und die Tagundnachtgleichen genau bestimmen lassen. Die Bezeichnung Belchen lässt sich auf den keltischen Sonnengott Belenos zurückführen. Sein Name bedeutet »der Leuchtende«, »der hell Glänzende«.
Andere Kulturen kannten Ähnliches. Wie die Megalith-Menschen in Europa errichteten auch die südamerikanischen Inka Steinsäulen, etwa bei Cusco, welche die Sonnenwenden anzeigen. In Nordamerika gibt es Hunderte von präkolumbianischen Steinkreisen mit astrologischer Ausrichtung. Eines der bekanntesten sogenannten Medicine Wheels befindet sich auf 3215 Meter Höhe im Bighorn-Gebirge in Wyoming. Das Steinrad hat einen Umfang von 24,3 Metern, besteht aus 28 Speichen und wurde (ähnlich wie die Scheibe von Nebra) astrologisch und als Kalender genutzt. Sonnenwenden und andere astronomische Daten können da abgelesen werden.
In Cahokia (Illinois) am Rande des Mississippi, nahe der größten Pyramide nördlich von Mexiko, entdeckten Prähistoriker 1961 zufällig einen tausend Jahre alten Kreis aus Holzpfosten mit einem Durchmesser von 70,5 Metern. Die Pfosten waren so aufgestellt, dass sich damit astronomische Daten wie etwa die Sonnenwenden exakt berechnen ließen. In Analogie zu Stonehenge (England), wurde der Kreis Woodhenge benannt. Die Baumstämme bestanden aus Virginischem Wacholder (Juniperus virginiana).
NOTFEUER
Mit dem Sommersonnwendfeuer wollten die alten Europäer der Sonnengottheit beistehen. Der Glaube, dass Menschen mit ihren Feiern und Ritualen die Sonne stärken und unterstützen können, war bei mehreren Völkern bekannt. Bei den Azteken war dieser Glaube besonders ausgeprägt: Die Sonne, sagten diese mittelamerikanischen Indigenen, verausgabt sich in ihrem nächtlichen Kampf gegen die Heerscharen der Sterne; die Menschen seien aufgerufen, ihr zu helfen. Aus diesem Grund opferten die Azteken auf ihren Pyramiden Gefangene, schnitten ihnen die noch schlagenden Herzen aus der Brust und hielten sie der Sonne – dem Sonnengott Huitzlipochtli oder Tonatiuh11 – entgegen.
Der Mittelpunkt des Sommersonnwendfestes ist das lodernde Freudenfeuer, das Johannisfeuer. Meistens sind es die jungen Burschen, die in den Tagen und Wochen davor das Holz zusammentragen und aufschichten. Manchmal holen sie es von den Dorfbewohnern und sprechen einen Bittvers dazu, wie etwa in Kärnten:
Heiliger Veit,
i bitt um a Scheit,
a kurzes und a langs
zan Sunnawendtanz.
Oder, um noch einen Heischereim aus dem Spessart zu erwähnen:
Sunnwendfeuer,
der Haber ist teuer.
Wer kein Holz zum Feuer git,
erreicht das ewige Leben nit.
Das Johannisfeuer muss immer ein Notfeuer sein. Das hat nichts mit Not oder Bedrängnis zu tun, sondern es ist ein »genötigtes« Feuer, althochdeutsch ein Hnotfiur, ein »Reibefeuer«. Nicht durch Feuerstein und Stahl, mit glimmender Kohle und schon gar nicht mithilfe von Streichhölzern wird es gezündet, sondern durch Reibung (Friktion) von Hölzern aufeinander, etwa mit einem auf ein Brett gestemmten Stab, der mit einem Seil umschlungen und rasch hin- und hergezogen und zum Glühen gebracht wird. Gerne wurde das Feuer auch durch das Drehen eines hölzernen Wagenrades erzeugt, das auf einer darunterliegenden Holzscheibe reibt. In vorgeschichtlichen Zeiten stellte man sich das Reiben als einen Geschlechtsakt vor, als eine Zeugung: Das unten liegende weichere Holz galt als weiblich, das härtere, oben liegende Holz als männlich. Durch die Reibung entsteht Hitze und das »Feuerkind«12 wird gezeugt.
Das Sonnwendfeuer soll am Abend entfacht werden – in dem Moment, wenn die Sonne unter den Horizont taucht. Die Dämmerung ist, wie der Sommersonnwendtag selbst, eine magische »Zwischenzeit«, eine Zeitspanne des »weder/noch«, weder Tag noch Nacht. Besonders die Kelten beachteten solche geheimnisvollen Zeitspannen, wo nichts fix und alles möglich ist.
Ehe das Feuerkind geboren wird, hat man traditionell alle Feuer in den Herden und Öfen der Häuser gelöscht. Nach Abschluss des Festes am frühen Morgen, bei Sonnenaufgang, wurde die neue Glut in die jeweiligen Heimstätten getragen. Das erneuerte Feuer symbolisierte einen Neuanfang für die Gemeinschaft.
Angesammelter Unrat und Unnützes wurden einem solchen Flammenstoß übergeben, etwa alte Totenbretter (Bretter, auf die Sterbende gebettet waren); Mütter warfen die Kleider kranker Kinder darauf. Mancherorts wurden Pferdeschädel oder, wie in Osteuropa, Strohpuppen vom Feuer vertilgt. Es war aber kein Abfall, wie wir ihn heute in unserer Konsumgesellschaft kennen, der da verbrannt wurde; Kunststoff, Büchsen, Glanzpapier und Ähnliches kannte man ja noch nicht; alle Gegenstände waren natürlichen Ursprungs. Auch alte Sündenlast und hartnäckiges Leiden wurden den lodernden Flammen übergeben; man verbrannte sie zusammen mit dem Beifußgürtel, den die Feiernden vielerorts trugen.
Von Paracelsus, dem großen Arzt, Naturphilosophen und Alchemisten, wird erzählt, dass er (am 24. Juni 1527) zum Entsetzen der medizinischen Fakultät der Universität ein klassisches Lehrbuch der scholastischen Medizin ins Baseler Johannisfeuer warf, während das Volk fröhlich das Feuer umtanzte. Dazu sagte er: »Ich hab die summa der bücher in sanct Johannis feuer geworfen, auf das alles unglück mit dem rauch in luft gang.«
Das Johannisfeuer galt immer als heilend. Es macht die Augen gesund, wenn man in die Flammen schaut. Wenn der Rauch über die Felder zieht, bringt er diesen Fruchtbarkeit und vertreibt Schädlinge. Die Kühe trieb man durch den Qualm oder während des Johannisfestes zwischen zwei Feuern hindurch. Und, ähnlich wie bei der indischen Feuerzeremonie (Agni Hotra), bringt die Asche, in kleinen Mengen in den Garten oder aufs Feld gestreut, Erntesegen und mindert Schädlingsbefall. Wir haben dabei mit uraltem Brauchtum zu tun: Schon im Indiculus superstitionum et paganiarum (8. Jh.) findet das Notfyr Erwähnung. Da heißt es, dass dieses Reibefeuer zur Heilung von Rindern und anderen Haustieren sowie bei Menschen gegen Krankheiten und Seuchen eingesetzt wurde. Bei dem Indiculus handelt es sich um ein »Kleines Verzeichnis des Aberglaubens und des Heidentums«, in dem die Kirche die Missionare der Sachsenmission anwies, was sie zu verbieten hatten und was sie bekämpfen sollten.
Der Anblick des hoch auflodernden Sonnwendfeuers soll Glück, Gesundheit und Segen bringen, so weit der Feuerschein zu sehen ist.
UMTANZEN UND ÜBERSPRINGEN DES FEUERS
Das Feuer brennt (brannte) die ganze Nacht. In der Johannisnacht soll man nicht schlafen, heißt es in Lettland, sonst würde man das ganze Jahr über müde sein. Der brennende Holzstoß wird im Reigen umtanzt. Einander an den Händen haltend, bewegte man sich sonnenläufig im Uhrzeigersinn, im Einklang mit der Bewegung der Sonne durch den Tierkreis. Meistens sind das zwei Schritte vorwärts und einen zurück oder auch fünf Schritte vor und drei zurück. Bekannt sind auch kreisende Tänze um das Feuer, die sich immer schneller drehen, bis die Tänzer taumelnd auseinanderfallen.
Nach altüberliefertem Brauch tanzte man nackt – bis auf einen Gürtel aus heiligen Kräutern. Das Abwerfen der Gewänder bedeutet, dass sich die Tänzer von den sozialen Konventionen des Alltags, symbolisiert durch die Kleidung, lösen und vorübergehend zum ursprünglichen (paradiesischen) Naturzustand zurückkehren. Man befand sich schließlich in der magischen Zwischenzeit, in welcher man dem Alltag entrückt ist und mit den Naturgeistern in Kontakt steht. Es ist sozusagen ein regressus ad originem, eine »Rückkehr zum Ursprung«, und in diesem Sinn ein Neuanfang.
Die Feiernden sprangen durch die Lohe oder über die glühenden Kohlen. Der Sprung galt als reinigend, denn all die kleinen Dämonen und Teufelchen, die sich über das Jahr in der Aura eingenistet hatten, können die Hitze nicht ertragen, sie müssen abspringen oder verglühen. Hier und da lief man sogar barfuß über die glimmende Kohle. Der Feuerlauf reinigt ebenfalls Leib und Seele und fördert die Gesundheit; den Zauderern bringt er jedoch manchmal schmerzende Brandblasen an den Sohlen oder zwischen den Zehen.
Uralt ist der Brauch, sich beim Tanzen und Springen mit einem Kranz aus geflochtenen Beifußstängeln (Artemisia vulgaris) zu umgürten. Gelegentlich wurden auch Eisenkraut (Verbena officinalis) oder Bärlapp (Lycopodium clavatum) mit in den Gürtel hineingeflochten.
Oft trugen die Feiernden einen Kranz aus Gundermann (Glechoma hederacea) auf dem Haupt. Der würzig-erdig duftende Gundermann, auch Gundelrebe genannt, kriecht über den Boden; im Gegensatz zu anderen Lippenblütlern richtet er sich kaum auf. An jedem Stängelknoten treibt er kleine Adventivwürzelchen, mit denen er den Boden abtastet und prüft, ob es sich lohnt, da zu wachsen. Mit anderen Worten: Er bleibt immer mit dem Erdboden verbunden. Fast könnte man meinen, dieses Kräutlein leide an Höhenangst. Somit ist die Symbolik klar: Ein Kranz aus Gundelreben hilft den Tänzern, auf der Erde zu bleiben, sodass ihre Seele in der Ekstase nicht abhebt und sich im Äther verliert. Dieser Gedanke mag uns heute eher seltsam vorkommen. Aber die Seele kann tatsächlich abheben und entrückt werden. Das aus dem Griechischen stammende Wort Ekstase besagt genau das – es bedeutet: »aus sich heraustreten«. Diesen Zustand kennen viele indigene Völker. Manchmal ist es ein fließendes Wasser, der Wind, ein vorbeifliegender Vogel oder ein »Geist«, der die Seele des Menschen mitnimmt, und wenn diese nicht zurückfindet, braucht es oft einen Schamanen, der ihr nachreist und sie wieder in die Gegenwart zurückführt. Meistens genügte ein Schlag mit einer Brennnesselrute, um die Seele wieder mit dem Körper zu verbinden. In der modernen technologischen Welt wäre eine solche Entrückung auch ansatzweise lebensgefährlich; beim Autofahren oder dem Bedienen einer Maschine könnte sie den Betroffenen etwa eines der Glieder oder gar das Leben kosten. Der Gundermann, dessen herb-würzig duftende ätherische Öle eine leicht psychedelische, subtile Wirkung auf das Gemüt haben, halten einen mit Mutter Erde verbunden.13
EXKURS
Janis oder Ligo – das baltische Sonnwendfest
Braue, Bruder, Gerstenbier,
gib Janis (Johannis) zu trinken.
Dieses Jahr wuchs die Gerste fett,
das Bier gärt schäumend.
LETTISCHES DAINA-LIED
Das Mittsommerfest (Ligo) ist vielleicht das wichtigste Fest der Letten. Einmal wurde ich dazu eingeladen. Sämtliche Zimmer im Haus hatte man mit frischen Birkenzweigen geschmückt, Roggenbrot, Kümmelkäse und gutes einheimisches Bier für den Schmaus bereitgestellt. Aber es wurde nicht drinnen gefeiert: Am Sonnwendabend ruderten wir mit anderen Feiernden in einer Flottille von Booten auf eine bewaldete Insel inmitten eines Sees. Frauen und Mädchen trugen ihre schönste Tracht und prachtvolle Kränze aus Wildblumen auf dem Haupt, die Männer waren mit Kränzen aus Eichenlaub gekrönt. Die Dainas-Gesänge14 erklangen, während wir über das Wasser glitten, und sie verstummten auch nicht, als uns die Insel mit ihren uralten hohen Birken, Eschen, Linden und Eichen in Empfang nahm. Die Gesänge erzählten von der Sonnengöttin Saule, die mit einem von goldglänzenden Pferden gezogenen Wagen über den Weltenberg fährt; von dem über Blitz und Donner gebietenden Eichengott Perkunas und von der Glücksgöttin Laima, der die Linden geweiht sind. Und alle – Männer, Frauen und Kinder – kannten die Lieder und sangen begeistert mit. Welch kultureller Reichtum! Die Insel schien von der Zivilisation unberührt; gezwieselte alte Birken und dunkle Eichen, die wahrscheinlich sechs, sieben Jahrhunderte oder noch älter waren, und viele große Findlinge gaben mir das Gefühl, auf einer heiligen Insel zu sein.
Die Eichenholzscheite für das Sonnwendfeuer waren sorgfältig aufgeschichtet, der Stoß mit Blumen und Kränzen geschmückt und von einer riesigen Eichenlaubgirlande umwunden, die einem grünen Drachen glich. Der Erdboden rundherum war mit Farnkraut und würzig duftenden Kalmusblättern ausgelegt. Ein Mann zündete den Holzstoß feierlich an, sodass er, von außen nicht sichtbar, von innen her zu brennen anfing und dann plötzlich aufloderte. Frauen, die das Ritual leiteten, räucherten mit Beifuß, sprengten Wasser auf die Teilnehmer und opferten dem Sonnenwendfeuer schließlich Wasser, Honig, Blumen und Bernstein. Traditionelle Speisen – dunkles kräftiges Roggenbrot, frische Erdbeeren, Kümmelkäse und Getränke – lagen als Opfergaben vor dem Feuer. Derweil erklangen, begleitet von Trommel und Dudelsack, die uralten sakralen, vierstrophigen Gesänge und man tanzte Hand in Hand Reigentänze um die feurige Mitte. Jeder Teilnehmer sammelte 27 Blumen – drei mal neun, eine magische Zahl –, die er dann einzeln jeweils für Verwandte, gute Freunde, das Heimatland und alle Letten in die Flammen warf. Irgendwann wurden auch die verdorrten Blumenkränze und Laubkronen vom vorhergehenden Jahr ins Feuer geopfert.
FUNKEN UND ROLLENDE FEUERRÄDER
Hier und da gibt es – ähnlich wie beim Funkensonntag – Läufe mit brennenden Besen und Fackeln, oder es werden, wie im alemannischen Raum, glimmende Feuerscheiben von den Höhen gestoßen. Bei diesem Scheibenschlagen wird die Scheibe auf eine ungefähr zwei Meter lange Haselgerte gesteckt, im Feuer brennend gemacht, unter Aufsagen eines Spruchs dreimal um den Kopf geschwungen und hochgeschleudert. Dass dabei Haselruten zum Einsatz kommen, ist nicht von ungefähr. Die Haselrute ermöglicht es, sich mit unsichtbaren, ätherischen Dimensionen zu verbinden (zur Hasel siehe >).
Seit vorchristlichen Zeiten beliebt ist es auch, brennende Räder von Hügeln und Büheln in die Täler hinabrollen zu lassen. Oft werden dazu Wagenräder mit Stroh umwickelt, mit Pech getränkt und angezündet. Wegen der erheblichen Brandgefahr hat man diesen Brauch vielerorts verboten. Im Jahr 831 n. u. Z. soll etwa das Kloster Fulda durch eine brennende Sonnenwendscheibe abgebrannt sein. War es ein »Sabotageakt« renitenter Heiden? Auch große Teile von Kloster Lorsch wurden 1090 n. u. Z. auf diese Weise ein Raub der Flammen.
In einigen Gegenden Frankreichs zieht man am Johannisabend, bei der Fête des Brandons, dem »Fest der Brandfackeln«, mit lodernden Fackeln umher und entzündet auf dem Dorfplatz oder an einer höhergelegenen Stelle große Johannisfeuer.
JOHANNISWUNDER
Das Fest, das seinen Höhepunkt zur astronomischen Sonnenwende oder am kurz darauffolgenden Johannistag hat, ist überall bekannt für sein ausgelassenes, ungezügeltes und übermütiges Treiben. Es heißt ja, dass an solchen Tagen des Übergangs zwischen zwei Zeiträumen der Schleier, der den Alltag von der Anderswelt trennt, dünner wird. Die Grenze zwischen den Menschen und den Geistern und Göttern wird aufgehoben. In Skandinavien heißt es, dass die Feen und Naturgeister – sogar die Mor Hulda, die Frau Holle oder gar Freya, in der Gestalt eines Mädchens mit langen Zöpfen – unerkannt mittanzen. Es ist nämlich so: Immer, wenn die Götter in solchen Zeitwenden über das Land ziehen und den Menschen nahekommen, dann verlieren diese ihren alltäglichen Verstand. Die numinose Gegenwart, die Lichtfülle und Wärme, berauscht die Menschenkinder – früher mehr als heute – und trägt sie fort. Aber auch kräftige Kräuterbiere und andere vergorene Säfte trugen dazu bei, und – wie einige Ethnobotaniker vermuten – möglicherweise auch das Essen von psychedelischen Pilzen führte zu Zuständen der Begeisterung und Hochstimmung.
Selbstverständlich mussten an diesen besonderen Tagen auch die allernotwendigsten Arbeiten getan werden, etwa das Melken der Kühe oder das Füttern der Hühner, aber dennoch verfielen die Menschen immer wieder in rauschhafte Zustände und erlebten wundersame Dinge, die als »Johanniswunder« bekannt und vielerorts belegt sind. Hier einige dieser überlieferten Wunder:
Die Sonne macht drei Sprünge.
Die Stalltiere, insbesondere die Pferde, können reden – ähnlich wie zu Mitternacht in der heiligen Weihnachtsnacht.
Seltsame Töne werden gehört. Musik tönt aus dem Berg oder aus dem Wald; man hört Feengesänge oder Glockengeläut von unter dem See.
Versunkene Städte oder Schlösser werden sichtbar.
Weiße Jungfrauen zeigen sich oder wollen erlöst werden.
Am Fluss- oder Seeufer werden Nixen sichtbar und Heinzelmännchen unter den Wurzeln alter Bäume.
Am Baum der Frau Holle, dem Holunder, feiern Zwerge ihre Hochzeit mit der Göttin (dem Schneewittchen).
Wer Glück hat, dem verraten die Gnome verborgene Schätze.
Die Ottern huldigen ihrem mit einem goldenen Krönlein gekrönten König.
Das Farnkraut blüht um Mitternacht und trägt sogleich Samen (siehe >).
Wer am Johannistag einen Kranz von neunerlei Kräutern unter das Kopfkissen legt, wird prophetische Träume haben und in die Zukunft blicken können.
Die Hexen treiben ihre Künste und sammeln Kräuter. Um sich in der Johannisnacht vor ihren Machenschaften zu schützen, soll man Sand vor die Tür streuen oder Wacholderzweige oder, wie in Osteuropa, Brennnesselzweige aufhängen, denn die Unholdinnen stehen unter neurotischem Zwang, alle Sandkörner oder die spitzen Nadeln des Wacholders oder der Brennnesseln zu zählen, und sie verzählen sich oft. Wenn dann die Sonne aufgeht, verlieren sie ihre Kraft.
Der Bilwis (Pilwis) reitet auf einem Bock über die reifenden Kornfelder und schneidet seltsame Muster in sie hinein (Kornkreise?). Um das zu verhindern, muss die Bäuerin einige Halme an allen vier Ecken des Feldes schneiden oder Johanniskräuter, insbesondere Arnika (Arnica montana), in die Felder stecken, um diese Getreidegeister abzuhalten (siehe >).
Zur Sonnenwende kann man zauber- und heilkräftige »Johanniskohle« finden. Sie schützt vor Würmern und Blitzeinschlag und macht sicher vor dem Biss tollwütiger Hunde. Man finde – so glaubte man – die magischen Kohlen unter einer Beifußstaude oder unter einem Knäuelkraut (Scleranthus perennis), und zwar in der kurzen Zeitspanne, während die Kirchturmglocken zwölf Uhr Mittag oder zwölf Uhr Mitternacht schlagen. Wenn das Geläute verstummt, verschwinden die Kohlen. Es braucht Mut und eine eher unschuldige Seele, die glühenden Kohlen zu sammeln, denn sie werden oft durch einen zähnefletschenden Zauberhund mit tellergroßen, rot glimmenden Augen bewacht. Jungfrauen und Kinder sind dabei am erfolgreichsten. Man hat es offensichtlich mit der Symbolik der Sommerhitze und des Feuers zu tun. Einige materialistisch denkende Volkskundler versuchten, die an den Wurzeln mancher Pflanzen befindlichen roten Lackschildläuse für das Phänomen verantwortlich zu machen. Aber das ist weit hergeholt, zumal diese Schildläuse in tropischen Ländern zu Hause sind und in Europa nicht vorkommen. Die Johanniskohlen gehören eben nicht der normalen Welt an, sondern den Zwischenwelten.
Wie auch die Johanniskohle, lässt sich zur magischen Sonnwendzeit auch die sogenannte Springwurzel oder das »Sprengkraut« holen, mit dem sich alle Schlösser sprengen lassen, auch die Keuschheitsgürtel der edlen Damen (siehe >).
Wer am Johannistag stillschweigend einen Kranz von neunerlei Kräutern bindet und unter das Kissen legt, wird in der Johanniszeit prophetische Träume haben und in die Zukunft blicken können.
Selbstverständlich kann man von einem Kind, das in der Johannisnacht geboren wird, nicht erwarten, dass es normal ist: Es wird entweder ein Hellseher oder ein Werwolf werden.
FARNKRAUTBLÜTE
Farnpflanzen (Polypodiopsida) haben keine echten Blüten; sie bringen, meistens unter den Blättern, nur unscheinbare Sporenkapseln hervor. Den Farn, diese Urpflanze, gab es schon im Erdaltertum vor 300 Millionen Jahren, als unsere biologischen Vorfahren noch als Lurche (Amphibien) durch die dampfenden Sümpfe krochen. Damals gab es überhaupt noch keine bunten Blüten, geschweige denn Bienen, Hummeln und Schmetterlinge, die sie hätten bestäuben können. Die Farnblüten, die für ein paar Sekunden in der Johannisnacht gelbrot, blutrot oder regenbogenfarbig aufblühen und sogleich versamen, gehören der Welt der Elfen und Einhörner an, dem Zwischenreich also.
Die winzigen schwarzen »Samen« haben magische Kräfte. Wer sie besitzt, hat Glück in der Liebe, beim Kegeln oder Kartenspiel; er kann die Sprache der Tiere verstehen und die Heilkraft der Pflanzen unmittelbar erkennen. Das einfache Volk glaubte, Paracelsus verdanke sein Wissen ebensolchen Samen. Auch werde man stich- und hiebfest, könne Reichtum erlangen, Schlösser öffnen, seine Speisekammer füllen und vieles mehr. Unters Schießpulver gemischt, macht er den Schuss unfehlbar und den Jäger zum Freischützen. Von jemandem, der Schweineglück hat oder zu plötzlichem Reichtum gekommen ist, sagen die Schwaben noch immer: »Der hät de Farnsame g’holt!« Auch könne man sich mithilfe des Samens unsichtbar machen. Dazu erzählte man die Geschichte von zwei Wanderern im Wald; einer wurde plötzlich unsichtbar, aber man hörte ihn noch reden. Erst als er seine Schuhe auszog – in die ein wenig Farnsamen gefallen war –, konnte sein Kumpan ihn wieder sehen.
Den Samen zu erlangen, ist jedoch alles andere als einfach. Gegen Mitternacht zu Johanni begibt sich der Farnsamensammler zu einem Farn, am besten einem, der auf einer Wegkreuzung oder -gabelung steht. Mit einem Haselstock – regional unterschiedlich kann es auch ein Ebereschen- oder Wacholderstock sein – muss er einen Schutzkreis ziehen und splitternackt in den Kreis eintreten. Nun muss er ein weißes Leintuch, in Schlesien die Haut einer einjährigen schwarzen Ziege, am besten aber das breite Blatt einer Königskerze unter die Farnpflanze legen, um die Samen aufzufangen. In katholischen Regionen nahm man gerne das heimlich entwendete, geweihte Tuch, mit dem der Abendmahlkelch bedeckt wird, um des Farnsamens habhaft zu werden, denn dieser sei so glühend heiß, dass er sich durch ein gewöhnliches Tuch hindurchfresse. Während der gefährlichen Handlung muss der Sammler absolut schweigen und den Blick ununterbrochen auf das Farnkraut richten. Sofort erscheint nämlich eine Schar Teufel oder wilder Waldgeister, manchmal auch Schlangen und Nattern. Diese versuchen den wagemutigen Glücksjäger oder die abgefeimte Zauberfrau abzulenken und zum Sprechen zu bringen. Wenn es ihnen gelingt, dann verliert er seine Seele an den Teufel. Oft donnert oder blitzt es, wenn Schlag Mitternacht die Blüte hervorbricht. Meistens soll der Samensammler dann bis Sonnenaufgang am nächsten Morgen in dem Zauberkreis verweilen und dabei Zauberlieder singen. Die magischen Samen können dann unter dem Hut, in einem Säckchen auf der Brust oder in der rechten Achselhöhle fortgetragen oder aufbewahrt werden.
Die politischen Autoritäten und deren gelehrte Ratgeber zweifelten nicht an der Macht des teuflischen Johannissamens, sie sahen darin eine Bedrohung ihrer Herrschaft. Was wäre, wenn Diebe, Einbrecher oder Meuchelmörder in Besitz dieser »pflanzlichen Tarnkappe« kämen, mit der sich zudem noch Schlösser aufsprengen ließen? Das musste strengstens unterbunden werden. Die Inquisition kannte kein Pardon: Wer so etwas tat, wurde hingerichtet. Der bayerische Herzog Maximilian (1573–1651) erließ 1611 ein »Landesgebot wider Aberglauben, Zauberei, Hexerei und andere Teufelskünste«, wonach das Holen von Farnsamen unter Strafe gestellt wurde. Im Jahr darauf verfügte die Kirchensynode von Ferrara ebenfalls ein strenges Verbot des Farnsamensammelns zu Johanni. Besonders gefährlich war es für den Sucher der magischen Samen, wenn das Ritual es erforderte, dass der Möchtegernzauberer sich eine Zeit lang weder wusch noch Fingernägel und Haare schnitt noch Weihwasser berührte. Dadurch wurde es für Tugendwächter und Denunzianten klar, dass da ein Hexer am Werk sein musste.
Bis in die Neuzeit hielten die Menschen den in der Johannisnacht gesammelten Farn»samen« für eines der stärksten Zaubermittel.
Trotz Acht und Bann, trotz des Gespötts aufgeklärter Zeitgenossen suchte man im ländlichen Raum, insbesondere in den slawischen Ländern, noch lange nach der mysteriösen Farnblüte in der Johannisnacht. Im Baltikum ist dieser Brauch, wenn auch auf spielerische Art, noch lebendig. Da wird zwar weniger der Zaubersame gesucht, sondern man versucht das Wunder des Aufblühens der Blume zu erleben. Die lettische Ethnologin Dr. Ieva Ančevska erklärt: »Selbstverständlich gibt es keine wirklichen Blüten beim Farn. Die Sonnenwende ist jedoch ein reales, kosmisch-terrestrisches Ereignis, das man auch in der eigenen Seele – besonders in der Stille der Nacht, in einsamer Natur – spüren kann. Die ›Blüte‹ ist eine seelisch-ätherische. Im Moment der Sonnenwende küsst der Himmel die Erde, und dann leuchtet die Blüte in der mystischen Schau auf.« (Storl 2020b:135) Im Baltikum gehen junge Paare oft gemeinsam in den Wald, um die Farnblüte zu suchen. Kinder, die zufällig neun Monate später geboren werden, nennt man »Johanniskinder«.
Auch sonst spielt der Farn im europäischen Volksbrauchtum zu Johanni noch immer eine Rolle: Die Slowenen streuen in der Johannisnacht Adlerfarnwedel auf den Boden, damit der Täufer darauf schlafen kann. In Frankreich wird der Farn vor Sonnenaufgang am Johannistag gesammelt; er schützt gegen Zauber – ein Brauch, der auf römisch-gallische Zeiten zurückgeht. Im Vogtland wird die Wurzel zu Mittag am Johannistag gegraben und dem Vieh gegen Behexung eingegeben.
DER BILWISSCHNITTER
Der Bilwisschnitter gilt als elbisches Wesen, das zu Mittsommer auf einem schwarzen Bock über das reifende Getreidefeld reitet und mit Sicheln an seinen Füßen merkwürdige Muster ins Korn schneidet. Wo er durchs Korn reitet, werden die Halme oder die Getreidekörner schwarz (Mutterkorn; Brandpilz?). Der Unhold selbst trägt Hörner, hat langes, wirres Haar und einen zotteligen Bart. Die Bezeichnung Bilwis soll auf eine abstruse, wenig bekannte germanische Mondgöttin oder ein slawisches Wort für Hexe zurückgehen. Dem ist aber nicht so. Wie der friesische Künstler Herman de Vries hervorhebt, entstammt das Wort Bilwis (angelsächsisch bilewit) sprachwissenschaftlich dem germanischen Begriff Bil, »die zur Sonne gehörende, gestaltende Bildekraft«. Bilidi bedeutet »die passende Form«, wie man etwa in Bayern von einem echten »Mannsbild« oder einem »Weibsbild« spricht. Die Nachsilbe wis oder wit bedeutet Wissen oder Weisheit. Das althochdeutsche billih bedeutet »wunderkräftig, bedeutsam, recht passend« und das altenglische bilewit heißt »wohlwollend«. In der heidnischen Kultur bezeichnete ein Bilwis einen »um die Wunder Wissenden«. Es handelte sich ursprünglich also nicht um getreideschädigende Dämonen, sondern um weise Priester des Brotkorns, die zur Mittsommersonnenwende Rituale durchführten, um die Ernte zu sichern und um den »Wachstumsgeist«15 – den Kornbock, den Kornwolf, den Kornbär, den Roggenbär, die Windsau, den Kiddlhund, die »Alte« oder die Kornmuhme – im Feld zu halten, damit die Fruchtbarkeit nicht entschwindet.16 Diese Priester oder Priesterinnen, heißt es, waren in lange, weiße Gewänder gekleidet, ihr Haar wurde nie geschnitten und war verfilzt – heute nennt man solche verzwirbelten Struwwelpeterhaare »Rastas« oder Rastalocken, volkstümlich aber sind es die Bilwislocken oder Wichtelzotteln.17 Die Assoziierung mit Hörnern deutet auf sehr alte Ursprünge hin: Hörner trugen die paläolithischen Götter, die männlichen Gefährten der Erdgöttin, wobei das Horn immer auf Wachstumskraft und Potenz hindeutet. In der Zeit der Missionierung wurde sogar der Heiland als Bilwit bezeichnet und der liebe Gott als bilenwit fader. Die monotheistische Religion konnte sich mit dem Begriff nicht anfreunden; allmählich wurden die Hüter des Kornfeldes zu Korndämonen gemacht; die Sommersonnwendgetreiderituale wurden kooptiert und christlich umgedeutet. Die Rituale sollten nun die zu Schaddämonen mutierten Bilwisschnitter vertreiben.18
DIE SPRINGWURZEL
Als Springwurzel oder Sprengkraut bezeichnete man die Pflanzenwurzel, mit der man Schlösser, Truhen, Türen und auch – im Mittelalter der Rittersleute – den Keuschheitsgürtel aufsprengen kann, jene berüchtigte eiserne Unterhose mit Schloss, die sicherstellen sollte, dass niemand mit der Frau Geschlechtsverkehr haben kann, während ihr Gatte nicht zu Hause ist. Man glaubte auch, dass diese Wurzel hieb- und stichfest mache oder Diebe ausfindig machen könne. Es ist nicht leicht zu beantworten, von welcher Pflanze die Zauberwurzel stammte: Es sei der blühende Farn, glaubte man. Es könnte aber auch die Wurzel der Schlüsselblume oder des Himmelsschlüssels (Primula veris) sein, die einst der Göttin Freya gehörte und mit der sie jedes Jahr das Tor zum Frühling aufschloss. Nach der Bekehrung zum Christentum wurde ihr diese Blume abgenommen und dem heiligen Petrus vermacht. Dieser schloss damit nicht das Frühlingstor auf, sondern, für fromme Seelen, das Himmelstor.
Das Sprengkraut könnte aber ebenso gut die im Juni blühende Weißwurz oder das Salomonssiegel (Polygonatum spp.) gewesen sein, mit dem vor allem von gelehrten »Pfaffen« (wie ein Kräuterkundiger des 16. Jahrhunderts spottete) und Alchemisten – nicht aber vom einfachen Volk – viel Zauber betrieben wurde. Im Winter sterben die oberirdischen Teile dieser Waldpflanze ab, wobei am Wurzelstock Narben entstehen, die einem Ringsiegel mit dem Davidstern gleichen sollen. Der Name dieses Spargelgewächses geht auf den weisen König Salomon zurück, der einen Siegelring getragen haben soll, dessen Abdruck der Narbe dieser Wurzel glich. Mit dem Ring ließen sich Felsen in Quader sprengen; mit den so erzeugten Gesteinsblöcken vermochte König Salomon seinen Tempel in Jerusalem zu errichten.
Mit etwas Fantasie erkennt man im Wurzelstock der Weißwurz ein Ringsiegel mit dem Davidstern.
Am Johannistag graben Wenden in Sachsen übrigens die Wurzel dieser Pflanze, die sie Heilige-Maria-Wurzel (swjatje Maryne koruschki) nennen, und schnitzen daraus glücksbringende Amulette.
Auch die Mistel, dieses Wesen der Zwischenwelt, das nie auf dem Erdboden, sondern nur auf den Ästen lebender Bäume wurzelt, wurde als Sprengkraut in Betracht gezogen. Viele Bauern glaubten jedoch, das Sprengkraut sei jenes zähe Kraut, an dem beim Mähen im Mittsommer die Sense zerbricht. Auf jeden Fall ist das magische Kraut schwer zu bestimmen und noch schwerer zu erlangen.
Es gab dennoch raffinierte Mittel, um an das begehrte Kraut heranzukommen. Die Rezepte dazu sind sehr alt. Schon der römische Gelehrte Plinius der Ältere, der während des Vesuvausbruchs im Jahr 79 n. u. Z. starb, wusste Rat: Man solle das Einflugloch einer Specht- oder Wiedehopfhöhle verstopfen. Der Vogel holt dann ein bestimmtes Kraut und sprengt damit den Pfropf oder den Lehm heraus. Wenn man ein Feuer unter dem Baum macht oder sich rot anzieht, dann lässt er vor Schreck die Wurzel fallen.
Der Dichter und Pflanzenfreund Rudolf Baumbach (1840–1905) schrieb dazu ein Gedicht:
Der Schwarzspecht ist ein Kräutermann,
kennt manches Zauberkraut im Tann,
das im Verborgnen sprießet.
Er hält ob einer Wurzel Wacht,
die alle Schlösser springen macht
und jede Tür erschließet.
Ein anderer Trick, die Zauberpflanze zu erlangen, sei es, kopulierende Frösche zu trennen und das Weibchen einzusperren. Das Männchen kommt dann bald mit der Springwurzel herangehüpft, um es zu befreien.
Der Specht passt besser für die heikle Aufgabe als die armen Frösche, denn dieser Vogel wird immer wieder mythologisch und symbolisch mit Blitz und Himmelsfeuer in Verbindung gebracht.
BLITZ UND DONNER
Wie bei dem im Jahresrad gegenübergesetzten Wintersonnwendfest wurde einst die Mittsommerzeit, die Sommersonnenwende, nicht nur an dem Tag des Solstitiums, dem 21. Juni, sondern ganze zwölf Tage lang gefeiert. In dieser Zeit kommt es häufig zu Gewittern. Deswegen war der mächtige Gewittergott immer ein Gast bei den Festlichkeiten. Die indoeuropäischen Donnergötter – egal, ob es sich um den germanischen Thor oder Donar, den keltischen Tanaris, den slawischen Perun, den baltischen Perkunas, den römischen Jupiter, den griechischen Zeus oder gar den indisch-vedischen