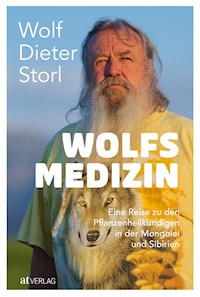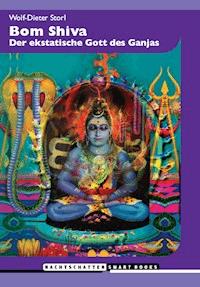Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Wir glauben, wir verstehen die Welt. Die Wissenschaft hat sie bis ins kleinste Detail vermessen, zergliedert und analysiert. Was aber wissen wir wirklich? Ist das Sein nicht viel weiter, viel magischer, als wir glauben? Wenn wir anhalten, uns Zeit nehmen und uns in eine Blume, ein Tier, eine Wolke, ein Geschehnis hineinversetzen, dann können uns Welten von unendlicher Tiefe aufgehen. In Wolf-Dieter Storls neuem Buch, dem Kondensat seines immensen Wissens, geht es in erster Linie um Pflanzen, um Schamanenpflanzen, um invasive Neophyten, Pyrrolizidin-Alkaloide und Hildegard von Bingens Löwenzahn. Storl vermittelt uns auch seine Sicht über Zeitfragen wie Klimawandel, Ökologie und Gesundheit. Das Wesen der Tiere, die Bedeutung der Märchen und das Gärtnern sind weitere Themen, wie auch seine magischen Reisen nach Indien, China, Mexiko, Südafrika und anderen Ländern. Ein Buch, gefüllt mit vielen klugen Gedanken und Weisheit und eine Orientierungshilfe in einer bewegten Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WOLFDIETERSTORL
EINSICHTENUNDWEITBLICKE
Das Wolf-Dieter-Storl-Lesebuch
INHALTSVERZEICHNIS
EINFÜHRUNG: Wie goldene Fische …
BIOGRAFISCHES
Lebensernte
Wie die grünen Kräuter uns den Weg in die Gesellschaft ebneten
Zauberfetisch: Schafgarbenkraut in einer Hirschblase
Angreifende Harpyien
PFLANZLICHES
Seidenpflanze und Schmetterlinge
Invasive Aliens – Die Sache mit den Neophyten
Industriewüsten: Paradiese für Neophyten
Pflanzenschätze Indiens
Pilze sind keine Pflanzen
Die stillen Meister des Lebens
Psychedelische Tomaten und andere Schatten der Nacht
Ackerschachtelhalm
Schafgarbe
Der Löwenzahn bei Hildegard von Bingen
Flachs
Sempervivum: Die Dachwurz
TIERISCHES
Von Pferden und Menschen
Treue Hunde
Regenzauber und die Kraft der Frösche
Wölfe und Karpfen in Sachsen
Riding Bronco
REISESCHUHE
Wyoming: Bighorn Mountains
Südafrika: Muthi-Medizin
Mexiko: Verschleimte Totenzähne
Sommersonnwende am östlichen Ufer der Ostsee
Pilgerreise zum Kailash
Schamanentreffen und Filmreise am Ganges
Manitus Grüne Krieger
Indian Summer, Rostgürtel und Alchimistenküche
Pflanzenfreunde und die letzten Wampanoag
Der chinesische Phönix
Mongolische Grassteppe und sibirische Taiga
Wo die kleinen Drachen wohnen
HEILKUNDLICHES
Meister Lugh und die ätherischen Öle
Pyrrolizidine und Borrelien
Brücke zwischen globaler und lokaler Medizin
Forever Young
Wort und Wurz
Kräutertees: Die Apotheke Gottes
Zwei Heilpflanzen, die unsere Aufmerksamkeit verdienen
JAHRESZEITLICHES
Ohne Spannung, ohne Strom: Ein Geschenk des Himmels
Die vier Speichen des Jahresrads
Gibt es den Weihnachtsmann?
Zauber der Wintersonnenwende
Lichtmessinspirationen
Winter, ade
Ungeduldige Gartenzwerge
Ostaras Segen
Nimm dir Zeit
Ein ungewöhnliches Sonnwendfest
Herbst
KUNTERBUNTES
Märchen: Nahrung der Seele
Auch die Stadt ist ein Naturlebensraum
Der Blutmond
Seniorenentsorgung und Gen-Farmen
An der Havel
Warum Rituale?
Die Erde ist keine Maschine
Ein wundersames Molekül
Revitalisierungsbewegungen
ANHANG
Nachwort: Pourquoi faire?
Stichwortverzeichnis
EINFÜHRUNG
Wer den Himmel im Wasser sieht,
sieht die Fische auf den Bäumen.
Chinesisches Sprichwort
WIE GOLDENE FISCHE ZIEHEN DIE GEDANKEN IM STROM DES BEWUSSTSEINS
Beim Gärtnern, egal ob beim Pflanzen, Säen, Hacken oder Jäten, kommt man leicht in einen meditativen Zustand. Besonders wenn es sich um einen großen Garten handelt, wie den biologisch-dynamischen Garten von Aigues Vertes an der Rhone südlich von Genf, wo ich einst fünf Jahre verbrachte. Auf zwei Hektar versorgten wir eine Gemeinschaft von rund hundertfünfzig Leuten das ganze Jahr über mit Gemüse und Obst aller Art.
Wenn man stundenlang mit der Pendelhacke die wachstumsfreudigen Begleitkräuter zwischen den Reihen hackt, dann geschehen manchmal merkwürdige Dinge mit dem Bewusstsein. Es ist dann, als ob man wie ein Angler am Ufer eines Flusses sitzt und die Gedanken wie Fische vor dem geistigen Auge vorbeischwimmen sieht. Normalerweise sind die Menschen unmittelbar mit ihren Gedanken verstrickt, sodass sie glauben, dass sie ihnen gehören oder dass sie sie selber hervorbringen. Beim Nachsinnen aber wird man gewahr, dass die Gedanken zu einem kommen; es ist, wie man einst sagte, »es dünkt mich«. So betrachtet man die Gedankengebilde, wie sie spontan auftauchen, vorbeischwimmen und dann wieder verschwinden. Das rhythmische Hacken gleicht dem beständigen Schlagen einer Schamanentrommel; jeder Schlag trägt die Seele einen Schritt weiter über das alltägliche Bewusstsein hinaus. Die Rosetten der Wildkräuter, die man heraushackt, gleichen in ihrer geometrischen Form oft einem Mandala und wirken zentrierend auf den Geist. Auch der Duft, der dabei der Erde entströmt, wirkt auf die Seelenverfassung des Gärtners ein.
Die Gedanken – tiefschürfende und oberflächliche, bunte und blasse, freundliche und unfreundliche, erschreckende und beruhigende – flitzen wie Fischlein vorbei. Meistens lässt man sie ziehen und engagiert sich nicht. Manchmal aber sind es goldene Gedanken; diese zieht man aus dem Strom heraus, hält sie fest und betrachtet oder bewundert sie, ehe man sie wieder freilässt. Einige aber landen sozusagen in der »Bratpfanne« und werden Teil eines Artikels oder eines Buches.
In diesem Buch wollen wir einige der »Fische«, die ich im Laufe der Zeit aus dem Fluss des Bewusstseinsstroms geangelt habe, näher anschauen. Auf Papier festgehalten und fixiert, will ich diese Eindrücke und Eingebungen hier zum Besten geben. Einige der kleinen Geschichten, Reisebeschreibungen und jahreszeitlichen Eindrücke sind in meinem Internet-Newsletter oder anderswo erschienen. Es sind sozusagen geräucherte, filetierte, gebratene, eingesäuerte, getrocknete oder gepökelte Gedankenfische, ein Smörgåsbord für die hungrigen Seelen unserer Zeitgenossen.
Eine wissenschaftliche Basis
Was ich da eben geschrieben habe, mag esoterisch klingen. Auch wenn ich mich gerne auf Streifzüge am Rande Midgards begebe oder anders gesagt, an die Grenzen der alltäglichen Wirklichkeit, käme es mir nie in den Sinn, die naturwissenschaftliche Erkenntnismethode zu verwerfen. Es gibt keine bessere Art und Weise, die Gesetze der materiellen Natur zu erkunden, als durch genaue Beobachtung und das Ziehen logischer Schlussfolgerungen. Das Ergebnis dieser Methode darf jedoch niemals endgültiges Dogma sein, sondern sollte immer wieder überprüft und eventuell widerlegt werden können – ein Vorgang, den der Philosoph Karl Popper als die Möglichkeit der Falsifikation (Widerlegung) bezeichnete. Auch sollte eine wissenschaftliche Erkenntnis nicht auf Konsens (Übereinstimmung) beruhen. Denn, wie es im tschechischen Sprichwort heißt: »Hundert Dummköpfe sind nicht klüger als einer.« In der echten Wissenschaft kann – wie es Einstein formulierte – eine neue Erkenntnis den Konsensus der Dogmatiker zunichtemachen.
Mir persönlich ist die wissenschaftliche Methode nicht fremd. Primatologie, hominide Evolution, Anatomie, physikalische Anthropologie, auch einige Semester Organische Chemie und Geologie gehörten mit zu meinem Grund- und Aufbaustudium. Als Universitätsdozent für physikalische und kulturelle Anthropologie war ich immer der empirischen Methode verpflichtet, lernte jedoch durch sogenannte »teilnehmende Beobachtung« (participant observation) bei meinen Feldforschungen unter nicht-westlichen, indigenen Völkern, dass es auch andere Wege der Erkenntnis gibt, die nicht zu verachten sind und die wahre Einsichten vermitteln: Es gibt eben – wie es Shakespeare in Hamlet so treffend sagt – »mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt«.
Das Problem, das den Esoterikern häufig ein Bein stellt, ist, dass sie die genaue Empirie und schlüssige Logik überspringen und unmittelbar ins Metaphysische gelangen wollen. Sie gleichen somit Bäumen ohne Wurzeln. Ihre Metaphysik besteht dann vor allem aus Fantasien, Wunschdenken, Übertragungen (Projektionen) und ist oft vom Ego getrieben, das sich mit Schlauheit und Raffinesse zu behaupten versucht. Auch auf diesen Fall trifft ein weiteres Zitat aus Shakespeares Hamlet zu: »Im Schwachen wirkt die Einbildung am stärksten.«
Bilder, die die Welt uns schenkt
Nicht allein die Natur – die Vegetation, die Tierwelt, der jahreszeitliche Rhythmus der Wiesen und Wälder –, wie sie sich den Sinnen offenbart, interessiert mich. Ebenso interessant ist es zu sehen, wie die verschiedenen menschlichen Kulturen in ihrer natürlichen Umwelt eingebettet sind, wie sie ihre Welt sehen und erleben.
Dazu gehören auch die Aspekte, die über unsere fünf Sinne hinausgehen und die wir lediglich mit unserem »inneren Auge«, im »Spiegel der Seele«, wahrnehmen. Es sind, wie die Kelten sagten, Erscheinungen der sogenannten Zwischenwelt. Sie tun sich an der Schnittstelle zwischen unserer Seele und den nicht-materiellen inneren Dimensionen der Natur kund. Als wahre Imaginationen werden sie von Dichtern, Sehern und Schamanen, aber auch von einfachen Menschen wie Hirten, Handwerkern oder Bauern am ehesten wahrgenommen und in die vorhandenen Gestaltungsmuster der tradierten Kultur eingepasst. Überall, in jeder Kultur, zeigen Pflanzengeister, lichtverbundene Devas, Naturgeister, Elfen, Zwerge und Götter ihr Gesicht. Sie tun das jeweils auf andere Art und Weise.
Die Moderne hat Schwierigkeiten, das zu verstehen. Psychologen und Philosophen fragen sich, worauf sich Imaginationen beziehen. Sind das nur, wie etwa Yuval Harari behauptet, Produkte der menschlichen Fantasie, die es in Wirklichkeit nicht gibt? Sind es »kulturelle Konstruktionen«, die erfunden, weitererzählt und geglaubt werden, um die Menschen zu unterhalten oder gar, um sie gefügig zu machen? Sind es mentale Projektionen auf eine an sich seelenlose Welt, eine, die durch Zufall entstanden ist und die vor allem aus Materie und Energie besteht?
Oder haben wir es mit echten Wahrnehmungen zu tun? Wahrnehmungen von Wesenheiten, die sich nicht auf wissenschaftliche analytische Daten reduzieren lassen, aber dennoch Teil des Seins sind, und die die Natur und unsere Welt beseelen, beeinflussen und tragen? Wesenheiten, die sich gelegentlich in der Tiefenmeditation, im Traum, in der Vision oder in der Ekstase offenbaren und die wir unserem Verstand zugänglich machen, indem wir ihnen eine kulturspezifische Gestalt geben?
Das sind fundamentale Fragen. Sie sind schicksalsträchtig und führen uns hinein in den Bereich der Religionen, Mythen und Weltbilder. Im gegenwärtigen, postfaktischen Zeitalter, in dem überlieferte Weltbilder zusammenbrechen und vieles durcheinandergewirbelt wird und die Menschen ihre Bodenhaftung und ihren Naturbezug verlieren, ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wir leben in einer Zeit, in der »alternative Fakten« miteinander konkurrieren und in der sich Grenzen auflösen: Erbgutlinien werden durch genetische Manipulation überwunden, Körperorgane werden hemmungslos transplantiert1, Genderrollen relativiert, und traditionelle Kulturen werden von einer globalisierten Wirtschaft, einer Unterhaltungsindustrie und auch durch Massenmigration aufgelöst.
Was mir bei meinen kulturanthropologischen Forschungen die Naturvölker – die Indianer, Inder, mongolische Hirten und die himalayischen Bergvölker wie auch traditionelle Bauern im Alpenraum – erzählt haben, hat mir manche Tür geöffnet. Die Beschäftigung mit unseren Ahnen, den alteuropäischen Waldvölkern, den Bauern und mit den Pflanzen selbst hat mir Dinge gezeigt, die man nicht einfach nach-googeln kann. Diese und andere Themen werden in diesem Buch angesprochen – mit vielen Geschichten, persönlichen Erfahrungen und einer Fülle an Hintergrundinformationen. Es sind kleine silberne, goldene oder regenbogenfarbige Gedankenfischlein, die wir aus dem nimmer endenden Bewusstseinsstrom herausfischen wollen.
1Siehe Storl, W.-D.: Das Herz und seine heilenden Pflanzen, Aarau und München: AT Verlag, 2009, Neuauflage 2020
BIOGRAFISCHES
Wir werden geformt und gestaltet
durch das, was wir lieben.
J. W. von Goethe
LEBENSERNTE2
Der Sturm hat einige alte Fichten umgehauen. Das ist Holz für den Herd. Da muss man sägen, spalten und aufstapeln. Rund drei Jahre lang muss es gelagert werden, damit es gut trocknet, ehe es die Stube wärmen und den Herd einheizen kann. Der Garten muss umgegraben, der Kompost umgesetzt und die Saaten gepflegt werden. Alles gute, harte Arbeit, die in der hellen Jahreszeit den Körper kräftigt, die Seele mit wahren Bildern nährt und schließlich Erdäpfel und Gemüse auf den Teller bringt.
Wer diese Arbeitsgänge schon oft gemacht hat, weiß, dass man nicht viel darüber nachdenken muss. Es fließt einfach, in einem natürlichen Rhythmus. Der Kopf kann sich dabei ausruhen, leer werden. Man kann sagen, es ist Meditation. Das arme Hirn hat es auch nötig, denn im Winter beim Schreiben läuft es auf Hochtouren, voller Gedanken und Formulierungen, die einen bis in den Schlaf hinein verfolgen und die Nerven anspannen.
Nun aber merke ich mit dem Überschreiten des siebten Lebensjahrzehnts, dass die körperliche Arbeit schwerer fällt. Hier und da zwickt und zwackt es, die Knochen meutern, die Zähne beißen nicht mehr die harte Brotkruste. Mögen amerikanische Wissenschaftler von der Ausschaltung eines sogenannten Altersgens träumen, die Ärzte eine Anti-Aging-Diät verschreiben oder Wissenschaftsgläubige gar ihre Hoffnung auf die Kryokonservierung des Leichnams in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius setzen, um von einer zukünftigen Wissenschaft zu neuem Leben erweckt zu werden – für mich ist das alles Wahnsinn. Unser Leben verläuft wie die Jahreszeiten der Natur. Herbst und Winter lassen sich ebenso wenig aufhalten wie das Erstarken der Sonne im Frühling. Geburt und Tod sind ein natürliches Geschehen. Götterkräfte sind da am Werk, unerbittliche, mit denen wir uns in Einklang bringen sollten.
Wie die Kräuter und die Blumen im Feld kommen wir ins Leben hinein, blühen dem Himmel entgegen, versamen im Herbst und verschwinden wieder. Der göttliche Geist, der uns durchweht, sich in uns verkörpert und unser eigentliches Selbst darstellt, ist Zeuge dieses Werdens und Vergehens in dieser Raum-Zeit-Dimension. Es ist seine wilde, ekstatische Fahrt auf der Achterbahn des Daseins. Unser Leben ist das Abenteuer des Göttlichen in uns, ein Wagnis und Berserkergang mit unvorhersehbarem Ausgang. Es ist der Tanz Shivas, dem Selbst aller Wesen, mit seiner verführerischen, bezaubernden, schrecklichen, betörend schönen, grausamen, lieblichen, sanften, täuschenden Maya.
Es ist der Tanz, der dem Ego Angst macht, vor dem es sich zu schützen sucht, vor dem es Rettung in der Religion oder als angepasster Gutmensch erhofft. Es ist der Tanz, den das Ego durch diese oder jene Ideologie auszublenden oder von dem es sich durch Alkohol, Sexsucht oder virtuelle Spielwelten abzulenken versucht. Aber, sorry, es gibt keine Rettung für das Ego! Und dennoch, ehe man das Ego verflucht oder ins Nirwana verdammt, sollte man wissen, dass auch es dazugehört, dass auch es Teil des Abenteuers ist: Es ist die Plattform, auf welcher der göttliche Tanz im Dasein stattfindet und sich manifestiert. Diese Sicht der Dinge – auch das ist ein Teil der Lebensernte – habe ich übrigens den indischen Sadhus, den wild aussehenden Wandermönchen, zu verdanken.
Die lebendige Erde unter unseren Füßen, die Materie (von lateinisch mater, »Mutter«), die uns unseren physischen Körper geliehen hat, bleibt uns treu. Der Himmel, der die Welt und auch unsere Seele mit seinem Licht erleuchtet, die Nacht, die uns Tiefe schenkt und mit den Sternen verbindet, die Pflanzen, die uns nähren, kleiden, behausen, heilen und uns sogar die Luft zum Atmen geben, die Tiere, die verkörperten Seelen, die unsere Gefährten sind und mit unserer Seele reden, damit wir nicht zu einsam werden, die Steine, die uns die Stille lehren – sie alle sind uns treu. Sie geben uns wahre Inspiration, sie reden mit unserem Wesen. Daher ehren wir sie, achten sie und lieben sie alle. Das habe ich von den Cheyenne-Indianern gelernt; auch das ist Teil der Lebensernte.
Viele Lehrer – nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Geistwesen – kamen des Weges und bereicherten mich. Sie alle aufzulisten, würde ein ganzes Buch füllen. Unter ihnen die Grundschullehrerin, Fräulein Caesar, die uns Kinder immer mit in die Natur nahm und uns zeigte, was vor unseren Augen liegt, damit wir es wirklich sehen. Auch der alte Hufschmied, unser Nachbar in Ohio, der mich in die Geheimnisse des Gärtnerns einweihte; die Bauern im Emmental, die mir das Melken von Hand, das Pflügen mit Rossen und vor allem das Dürrehebe (Durchhalten) beibrachten; die Indianer in Montana und der Bergbauer Arthur Hermes aus dem Waadtland, die mir die Natur als Erscheinung des göttlichen Mysteriums nahebrachten – sie alle haben mich bereichert.
Vor allem aber war mein Großvater mein Guru. Als ich noch in der Schweiz lebte, besuchte ich ihn jedes Jahr in der DDR, wo er wie ein Einsiedler in der Garderobe der vom Staat enteigneten Villa hauste, dort wo einst die Herrschaften ihre Mäntel, Spazierstöcke und Regenschirme ablegten. Der Raum war so klein, dass er ihn gut mit einem Elektrostrahler heizen konnte. Das ganze Jahr verbrachte er mehr oder weniger in Meditation, und dann, bei meinem Besuch, philosophierten wir.
»Alles Schwindel, was in den Zeitungen und Geschichtsbüchern steht«, sagte er. Er musste es wissen, er hatte Kaiserzeit, Kriege, Hitlerdiktatur und den sogenannten Arbeiter-und-Bauern-Staat durchgemacht. Ich dachte, das sei seine Lebensbilanz. Aber ich irrte. Im folgenden Jahr fragte er mich, ob ich wisse, wie alles entstanden sei, die Welt, die Natur, der Mensch. Da erklärte ich ihm die neuste wissenschaftliche Sicht der Dinge. Er schmauchte seine Pfeife und winkte ab: »Das sind lediglich Theorien, Einbildungen, alles imaginaire!«3
Ich versuchte es mit der christlichen Version der Schöpfung und mit der anthroposophischen Geisteswissenschaft.
Er schüttelte den Kopf: »Auch das ist erdacht, erdichtet, imaginaire!«
Nun kam ich mit der buddhistischen Sicht der Dinge. Er hörte gespannt zu und sann nach. »Ja«, sagte er schließlich, »da ist was dran, aber letzten Endes ist auch das Einbildung, auch das ist imaginaire. Was wissen wir wirklich? Das Leben ist ein Rätsel; unser Dasein besteht aus Rätsel über Rätsel.«
Gut, das war also seine Lebensbilanz, dachte ich. Als ich ihn im darauffolgenden Jahr besuchte, wurde mir klar, dass es noch nicht die endgültige Bilanz gewesen war.
»Das Leben und unser Dasein besteht aus Wunder über Wunder«, erklärte er mit leuchtenden Augen.
»Egal, ob du reich bist oder arm, gesellschaftlich angesehen oder unbedeutend – das alles hat keine Bedeutung, klammere dich nicht an solche Dinge; auch das ist lediglich imaginaire.« Das gab er mir als Rat mit. Ich habe mich daran gehalten.
Ich fragte ihn noch, wie ihm nach sechsundneunzig langen Jahren auf Erden das Leben vorkam.
»Wie ein Windhauch! Im Nu verfliegt unser Dasein«, gab er zur Antwort. Irgendwie begriff ich, dass man in diesem kurzen Dasein wahrhaftig und rechtschaffen leben sollte, um – wie die Inder sagen – nicht ein schlechtes Karma in die Ewigkeit mitzuschleppen.
Es sollte der letzte Besuch gewesen sein. Die Behörden entdeckten den allein lebenden Alten und steckten ihn in ein Altersheim. Da entschied er ganz bewusst, die Welt zu verlassen; er hörte auf zu essen und zu trinken, und nach wenigen Tagen war er tot. Sein Leben war bis zum Schluss selbstbestimmt.
WIE DIE GRÜNEN KRÄUTER UNS DEN WEG IN DIE GESELLSCHAFT EBNETEN
Wenn kurz vor Wintereinbruch der Garten abgeerntet ist und die Beete mit altem Stroh oder vergammeltem Heu zugedeckt sind, die Gemüse getrocknet oder im kühlen, feuchten Wurzelkeller untergebracht sind, das Holz gesägt und trocken verstaut ist, dann ist es für mich Zeit zum Schreiben. So war es damals, und so ist es noch heute.
Heute sitze ich beim Schreiben am PC. Damals, vor inzwischen mehr als dreißig Jahren, musste ich mich zuerst auf den langen Weg durch den Wald in die Stadt machen, um mir einen Vorrat an Farbbandspulen und Schreibmaschinenpapier zu holen. Mit einer kleinen Reiseschreibmaschine, einer »Hermes Baby«, die ich aus der Schweiz mitgebracht hatte, hämmerte ich die Buchstaben auf das Papier. Das Zimmer zum Schreiben konnte nicht beheizt werden. In der dunklen Jahreshälfte war es darin meistens so kalt, dass man den eigenen Atem sehen konnte. Also zog ich den langen Filzmantel an, den ich aus dem tibetanischen Ladakh mitgebracht hatte, und kochte mir einen Pott heißen Tee. Zusätzlich erhitzte ich auf dem Kochherd in der Küche eine Pfanne voller faustgroßer Steine und stellte mir den heiß abstrahlenden Behälter unter den weiten Filzmantel. Die aufsteigende angenehme Wärme hielt lange an. Wenn die Steine wieder kalt geworden waren und der Tee längst ausgetrunken, ging es mir wie den Insekten im Spätherbst: Die Finger wurden steif und ihre Bewegungen langsamer. Zeit, sich zu strecken, die Steine wieder aufzuheizen und frischen heißen Tee zu brauen.
Das Buch, an dem ich arbeitete, hatte mit der Ethnobotanik jener Blütenpflanzen zu tun, die der Arzt Edward Bach zur Herstellung seiner Blütenessenzen verwendet hatte. Wie kommt man auf ein solches Thema? Nun, kurz nachdem wir nach Deutschland4 gekommen waren, lud mich eine esoterische Seminarorganisation ein, im Schwarzwald ein Kräuterseminar zu veranstalten. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, da ich Seminare nur von der Universität her kannte. Dort liest jemand ein Themenpapier vor, worauf heftig diskutiert und gestritten wird, um anschließend mit dem Professor und den Assistenten in eine verrauchte Studentenkneipe zu gehen und das Ganze kräftig zu begießen. Dieses »Seminar« war anders. Ich wurde gebeten, auf einem erhöhten, mit Pfauenfedern geschmückten Bhagwan-Thron Platz zu nehmen; ein riesiger tibetanischer Gong kündete den Beginn an. Das war mir zu bunt, da ging ich lieber gleich mit der Gruppe hinaus ins Grüne, um mit ihnen in die Pflanzenwelt einzutauchen.
Eine Frau war dabei, die sich mir als Mechthild Scheffer vorstellte. Ich hatte keine Ahnung, wer sie war, wusste nicht, dass sie eine international bekannte Fachautorität für die Therapie mit Blütenessenzen war. Sie fragte mich, ob ich die Bach-Blütenessenzen kenne? Sie sei sozusagen zuständig für diese Heilmittel im deutschsprachigen Raum und würde gerne mehr über die Botanik und ethnobotanische Anwendung dieser Pflanzen wissen. Ob wir nicht diesbezüglich zusammenarbeiten könnten?
Nun ja, ich hatte von den Blütenessenzen gehört. Da wird eine Blüte in eine Schale mit Wasser gelegt und dann in die Sonne gestellt. Auf diese Weise soll die »Information« von der Blüte auf das Wasser übertragen werden. Das Blütenwasser wird dann homöopathisch verdünnt und tropfenweise vom Patienten eingenommen, um seelische Disharmonien, die zu körperlichen Krankheiten führen können, wieder ins Lot zu bringen. Ehrlich gesagt, ich hielt nicht viel davon, ich war schließlich als Naturwissenschaftler geschult worden, und das kam mir wie esoterische Spinnerei vor. Das sagte ich Mechthild aber nicht, sondern sagte zu. Ich nahm es als einen Fingerzeig der geistigen Führung, denn mir war noch nicht klar, was meine Aufgabe in Europa sein sollte.
Ohne weiteren Kontakt mit Mechthild Scheffer aufzunehmen, machte ich mich in diesem ersten Winter an die Arbeit. Eine Bibliothek stand mir nicht zur Verfügung, also zog ich vieles aus den Tiefen des Gedächtnisses und aus der Meditation. Wenn ich genaue Daten brauchte, nahm ich den mühsamen Weg den Berg hinunter auf mich und fuhr mit einem alten Drahtesel in die Stadtbücherei. Das war aufwendig und kostete Zeit. Hätte ich ein Auto gehabt, wäre es leichter gewesen, aber das hatten wir nicht.
Auf den Schreibtisch hatte ich mir ein Foto von Edward Bach gestellt, und ich hatte das Gefühl, als ob der verstorbene Arzt mir irgendwie Inspirationen zukommen ließ, als ob er sagte: »Beschreibe die Pflanzen in der Reihenfolge, in der ich sie gefunden habe, und du wirst den tieferen Sinn erfahren.« So war es auch. Es war, als ob Edward Bach seinen Lebens- und Initiationsweg in Form eines Blütenpfades beschrieben hätte. In den Sommermonaten suchte und fand ich die meisten der Blumen, die dieser ungewöhnliche Arzt für seine Elixiere verwendete. Ich vertiefte mich in die schönen Pflanzen, betrachtete sie sorgfältig und meditierte mit ihnen.
Nach anderthalb Jahren war das Manuskript »Die Seelenpflanzen des Edward Bach« fertig. Ich schickte es Mechthild Scheffer. Sie rief an und sagte, sie sei von dem Werk begeistert, und wir sollten es unbedingt in einem großen Verlag unterbringen. Dann fügte sie etwas verlegen hinzu: »Ich muss gestehen, Wolf, ich habe gar nicht damit gerechnet; ich hatte gedacht, du seist so ein abgehalfterter Junkie.« Das konnte ich gut verstehen, denn ich hatte damals, als wir einander begegneten, gerade eine schwere Gelbsucht hinter mir und war recht dünn und ausgemergelt, hatte lange Haare und, was die Kleidung betraf, nun ja, die war nicht gerade von modischer Eleganz.
Mechthild arrangierte ein Treffen in München mit dem Verlagsleiter eines der größten Verlage Deutschlands. Das stellte für mich ein Problem dar: Ich konnte mir kaum die Fahrkarte für den Zug in die bayrische Hauptstadt leisten. Mein Gegenvorschlag war, dass wir uns genauso gut in unserem Haus auf dem Berg treffen könnten. Das wurde vom Verleger wie auch von Mechthild gerne angenommen. Es bot ihr die Gelegenheit, einmal aus dem Büro herauszukommen und einen Ausflug zu machen.
Im Wohnzimmer stand eine lange Tafel, die der Fürst, der Besitzer des Hofes, da abgestellt hatte, und entlang der Wand befand sich eine Holzbank. Sitzmöglichkeiten waren also vorhanden. Blieb die Frage: Was sollten wir dem Besuch zu essen und zu trinken anbieten? Sie kamen ja über Mittag. Wir hatten kein richtiges Geschirr und Besteck, nur bunt zusammengewürfelte Teller vom Flohmarkt oder solche, die uns jemand geschenkt hatte. Auch Fleisch konnten wir uns nicht leisten. Wir borgten etwas Geld, um eine einfache Geschirrgarnitur zu kaufen. Dann überlegten wir, was wir kochen könnten. Ich hatte meine Bedenken, denn dieser Besuch war sicherlich feinste Küche gewohnt.
Es war gerade Frühling, draußen wuchsen saftige Wildkräuter. An dem Morgen sammelte meine Frau das frische Grünzeug. Als Appetitanreger kochte sie eine Bärlauchsuppe. Dazu gab es Wildkräutersalat aus zartem Giersch, Löwenzahn, Wasserkresse, Schafgarbenblättchen, Vogelmiere, Wegerich und allem, was man sonst zu der Jahreszeit so findet. Gänseblümchen, blaue Gundermannblüten und einige gelbe Himmelsschlüsselblüten garnierten den Salat. Als Hauptspeise folgten Brennnesselspinat mit Ei und Kartoffelpuffer. Dazu gab es einen würzigen Kräutertee. Die Gäste, der Verlagsleiter und seine Sekretärin sowie Mechthild, langten kräftig zu. An ihren Gesichtern konnte man ablesen, dass es ihnen außerordentlich gut schmeckte. Es bestand kein Zweifel, sie würden das Buch veröffentlichen und die mächtige Werbemaschinerie, die einem großen Verlag zur Verfügung steht, in Gang setzen. Sie löffelten das Buch förmlich in sich hinein.
Das Buch wurde dann auch zu einem Erfolg. Mechthild übernahm die Aufgabe, es mit hervorragendem Bildmaterial zu illustrieren. Als anerkannte Bestsellerautorin stellte sie ihren Namen als Ko-Autorin zur Verfügung, denn wenn es nur unter meinem, damals völlig unbekannten Namen erschienen wäre, wäre es bestimmt ein Flop geworden. Ich bin Mechthild für diese Chance, die sie mir gegeben hatte, sehr dankbar. Das Buch war für mich der Eintritt in den Club der Schriftsteller. Durch Mechthilds Anregung kam ich auch dem Wesen der Blüten näher; ich konnte erkennen, wie sich die Pflanzenseele am deutlichsten in der Blüte manifestiert und warum Blumen unsere menschliche Seele berühren und heilen können. Selbstverständlich bin ich auch den frischen grünen Frühlingskräutern dankbar, denn sie haben mir damals die Tür zu einem neuen Lebensabschnitt geöffnet.
ZAUBERFETISCH: SCHAFGARBENKRAUT IN EINER HIRSCHBLASE
Genau betrachtet, verändert jeder unserer Gedanken, jedes Wort und jede Tat unser Leben. Diese Veränderungen mögen minimal sein, aber so wird die eingeschlagene Richtung unseres Lebensschiffes auf der Reise über das Meer des Daseins auf Kurs gehalten und immer wieder von Neuem korrigiert. Manchmal jedoch kommt ein einschneidendes Erlebnis, das diesen Kurs völlig verändert und dem Leben eine ganz neue Richtung gibt. Es kann ein dramatischer Schicksalsschlag sein, der Blitz plötzlicher Einsicht, ein Satori, eine Offenbarung göttlicher Mächte (Darshan) oder auch eine stille Intuition. Letzteres widerfuhr dem großen Anthropologen Claude Lévi-Strauss (1908–2009). Als er in der Vorkriegszeit als Rekrut gelangweilt seinen Dienst an der Maginot-Linie schob, erweckte eine Pusteblume seine Aufmerksamkeit. Als er sich in das wunderschöne kristalline Gebilde des verblühten Löwenzahns vertiefte, erkannte er: Die Darwinisten liegen falsch; so etwas kann unmöglich durch blinden Zufall entstanden sein. Eine derart komplizierte harmonische Gliederung muss Ausdruck einer tief liegenden strukturellen Gesetzmäßigkeit sein, die der Natur und – wie er später folgerte – auch der menschlichen Kultur von Anfang an innewohnt. Diese Erkenntnis war der Anfang des »Strukturalismus«, der Schule der strukturellen Anthropologie, der er sein langes Leben widmete.
Mir ging es ähnlich, auch bei mir war es eine Pflanze, die Schafgarbe, die meinen Lebenslauf radikal veränderte. Genau genommen war es nicht das Kraut an sich, das mich in seinen Bann schlug, sondern eine mit Schafgarbe ausgestopfte Hirschblase, die am Dach eines Gartenhauses hing. Wie ich auf sie kam und welche Veränderung sie in meinem Leben bewirkte, will ich hier erzählen.
Es war in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre. Ich hatte eine feste Anstellung als Soziologie- und Anthropologiedozent an der Kent State University in Ohio. Der Campus glich derzeit einem Karneval. Hippies und Blumenkinder lagerten auf dem Rasen, rauchten »Dope« und zupften ihre Gitarren. Hare Krishnas chanteten das Krishna-Mantra, Mädchen mit Blumen, mit langen offenen Haaren und in fließende bunte Gewänder gehüllt, tanzten, junge Träumer träumten von der »Blumenkraft« (flower power) und einem Zeitalter des Wassermanns voller Liebe und Frieden. Ich selber gehörte zu einer neuen Generation von Dozenten, die sich lautstark für Toleranz und Öffnung gegenüber anderen Kulturen einsetzte und sich gegen Rassenvorurteile, Kolonialismus, soziale Ungerechtigkeiten und selbstverständlich gegen den Krieg in Vietnam engagierte. Ein Revolutionär war ich nicht; ich glaubte, dem Zeitgeist huldigend, an Love and Peace, an die wissenschaftliche Vernunft und die natürliche Güte des Menschen, glaubte, dass das Fahrzeug des American Way of Life lediglich eine Inspektion und etwas Wartung benötigte. Dann würde der amerikanische Traum auch für Minderheiten und Unterprivilegierte funktionieren.5
Die Vorlesungen, die ich hielt, machten mir Spaß. Den Studenten anscheinend auch, denn es schrieben sich so viele in meine Kurse ein, dass ein normales Unterrichtszimmer nicht ausreichte und ich meine Vorlesungen – es waren eher schamanische Performances – in der Aula abhalten musste. Die Fakultät war froh, mich als Kollegen zu haben, denn auf dem Campus brodelte und gärte es. Wenn wieder mal die Besetzung eines Gebäudes oder eine Studentendemo angekündigt war, schickten sie mich vor. Ich war jung und hip und kannte die Anliegen und die Umgangssprache der Studenten, sodass es mir jedes Mal gelang, den wilden Haufen zu beruhigen. Auf eine blutige Revolution hatte ich sowieso keinen Bock. Für mich war die Welt in Ordnung und der monatliche Gehaltsscheck auch.
Für die einfachen Bürger der Stadt jedoch, die sich von dem rapiden gesellschaftlichen Wandel bedroht fühlten, war ich alles andere als in Ordnung. »Was ist er, Soziologe? Wie heißt das, Sozio… was? Sozialist? Ist das nicht so was wie ein Kommunist, jemand wie in der Sowjetunion, der den Leuten ihr Haus und Privateigentum wegnehmen will, das sauer verdiente Geld wegsteuern und es den faulen Schwarzen und anderem Gesindel in den Rachen werfen will. Ja, und an Gott und die Bibel glaubt er auch nicht. Er erzählt den Studenten, dass der Mensch vom Affen abstammt!«
Im Sommer 1968 machte ich mit meiner damaligen Frau Faye eine dreimonatige Reise durch Europa. Besonders Wien hatte es ihr angetan. Wiener Charme, »Küss die Hand, gnädige Frau«, und Sachertorte – das gab es im Mittleren Westen nicht. »Ach, wie schön wäre es, mal in Wien zu leben!«, seufzte sie. Als wir wieder zurück waren, luden uns die Nachbarn auf eine Tasse Kaffee ein, ganz locker, wie man es in den Staaten eben so macht. Sie waren neugierig, zu erfahren, wie es denn »da drüben«, in Europa, so gewesen sei.
»Wunderbar«, sprudelte es aus Faye heraus, und sie erzählte, wie sehr es ihr gefallen habe. Das war natürlich die falsche Antwort. Sie hätte die schablonenartige Standardantwort geben sollen, dass es schon okay war, aber nichts über die good old USA gehe. Das Lächeln erstarrte in den Gesichtern unserer Gastgeber. Wir wurden nie wieder zum informellen Kaffee eingeladen, und kein freundliches Wort wurde mehr gewechselt.
Faye war ein geselliger Mensch. Gern lud sie Studenten ein und ließ sie bei uns übernachten, wenn sie gerade mal ein Dach über dem Kopf oder eine warme Mahlzeit brauchten. Manche lungerten tagelang bei uns herum, hörten sich die neusten Platten an – Steve Miller, Beatles, Doors, Stones, David Peel and the Lower East Side – rauchten, tranken und taten alles, was Studenten damals in den Zeiten des Flower Power so taten. Einmal war sogar ein schwarzer Student dabei, was den bigotten Nachbarn nicht entging. Es dauerte nicht lange, da kam das Gerücht auf, dass es sich bei uns um eine kommunistische Zelle handle, deren Aufgabe es sei, die Jugend mit Sex, Drogen und Ideologie zu verführen und ihren Patriotismus und ihre Sittlichkeit zu verderben. Die Lage spitzte sich zu. Schläger schlugen mich krankenhausreif. Eine bewaffnete »Bürgerwehr« (vigilantees) formierte sich, um uns auszuräuchern. Sogar Mitglieder der lokalen Polizei gehörten ihr an. Zur Abschreckung luden wir einen Studenten, einen ehemaligen Armee-Leutnant ein, mitsamt seinen halbautomatischen Waffen bei uns zu wohnen. Damit sie die Ausräucherungsaktion erst einmal gründlich überlegten, feuerte er als Erstes, noch ehe er sein Zimmer bezog, ein paar Schüsse in die Luft.
»Wir sollten abhauen«, sagte Faye, »ich kenne diesen Menschenschlag. Die werden dich umbringen!«
Ich war einverstanden. Es war sowieso an der Zeit, einen Doktorhut aufzusetzen, damit ich Anthropologieprofessor werden konnte und nicht dazu verdammt wäre, als Dozent mit nur einem Master-Abschluss für immer und ewig die unteren Semester zu unterrichten. Zudem wäre das year abroad, das für eine akademische Karriere so wichtige Auslandsjahr, die nächste wichtige Stufe auf der Karriereleiter. Also meldete ich mich zum Post-Graduate-Studium am Völkerkundeinstitut der Universität Wien an.
Wir verkauften oder verschenkten Möbel, Schallplattensammlung, das Auto und vieles mehr. Freunde übernahmen unsere Ersatzkinder, die Katzen und den Hund. In der Nacht vor der Abreise entdeckten wir, dass in den Wagen eingebrochen worden war und unsere Koffer fehlten. Also reisten wir ohne Gepäck ab.
Der Flug mit dem Propellerflugzeug der Islandic Air verlief nicht problemlos. Mitten über dem Atlantik platzte das Fenster des Cockpits heraus. Der Kabinenluftdruck sackte ab. Nur einige Meter über der Wasseroberfläche fliegend – man sah den Wellengang – ging es zurück nach New York. Der nächste Tag brachte einen Sturm mit Notlandung in Labrador. Am dritten Tag wurde in Shannon Airport aufgetankt – das Flugzeug mit Sprit, die Passagiere mit Guinness Stout. Erst am vierten Tag erreichten wir endlich den Zielflughafen in Luxemburg.
Im kalten, neblig feuchten Dezember zeigt Wien kaum mehr das charmante Gesicht, das Faye so verzaubert hatte. Da raunzen, schimpfen, schubsen und murren die Wiener eher. Eine auf Amerikaner spezialisierte Wohnungsagentur ließ uns kräftig zur Ader. Aber es dauerte nicht lange, da fühlten wir uns wohl in unserer neuen Umgebung. Ich mehr, Faye weniger. Die andersartige Mentalität machte ihr zu schaffen. Bald besuchte ich Vorlesungen, Seminare, gesellschaftliche Anlässe mit Studenten und Fakultät, besuchte Museen und hielt Referate zu Themen wie »Afrikanismen im amerikanischen Großstadtghetto« oder »Neue Entwicklungen in der amerikanischen Anthropologie«. Ich genoss den in Europa gepflegten akademischen Lebensstil und seine Privilegien. Der Morgen begann entspannt im Kaffeehaus mit einer Schale »Braunen« und der Lektüre der Herald Tribune, und der Tag endete abends in geselliger weinseliger Runde. Das Leben lief wieder rund. Am Institute for International Studies nahm ich einen Lehrauftrag an, der darin bestand, amerikanischen College-Studenten, die zwecks Horizonterweiterung ein Studienjahr in Wien verbrachten, die Scheu vor dem Kontakt mit der Lokalbevölkerung zu nehmen und sie in die Lokalsitten einzuführen. Das war auch nötig, denn meistens hielten sich die Kids im Innenhof des Palais auf, wo ohrenbetäubender Rock’n’Roll plärrte und es nach Hamburger und Pommes frites roch.
Die Sommerpause rollte an, eine gute Gelegenheit, sich nach einem Ort umzuschauen, an dem man eine lohnende ethnologische Feldforschung betreiben könnte. Meine Wahl fiel auf Ifny in Westafrika, eine ehemalige spanische Enklave, wo es sicherlich interessante Akkulturationsphänomene zu erforschen gäbe. Faye wollte eine Woche später nachreisen. Wir könnten uns dann in Tarifa, an der Südspitze Spaniens, treffen. Falls wir uns da verpassen sollten, würde sie auf jeden Fall eine Botschaft im American Express Office in Tanger hinterlassen.
Die Woche verging. Kein Zeichen von ihr. Noch eine Woche verflog und immer noch keine Nachricht. Besorgt rief ich in Wien an. Ja, sie sei abgereist. Auf, nach Tanger also, zum amerikanischen Konsulat. Eine junge blonde Frau vermisst, das sei äußerst beunruhigend! In letzter Zeit seien einige junge Frauen verschwunden, sagte der Konsul, wahrscheinlich als »weiße Sklavinnen« in irgendeinem arabischen Harem.
Die nächsten zwei Wochen lief ich den schier endlosen, windigen, menschenleeren Strand des Atlantiks ab. Bald fing ich an, mit den Wellen zu reden, und es fehlte nicht viel, da hätten sie mir geantwortet. Dann, eines Tages beim café con leche an der Plaza von Tarifa, sah ich zwei junge blonde Frauen die Straße entlang schlendern. Eine sagte zur anderen: »Könnte das nicht dein Mann sein, so wie du ihn beschrie ben hast?« Erst da erkannte ich sie und sie mich. Auf die Frage, wo sie so lange gewesen war, antwortete sie, sie hätte sich einfach Zeit genommen und einige Abenteuer erlebt.
Der Sommer war inzwischen vorangeschritten. Für Ifny war es zu spät. Also blieben wir in Tarifa. Da erreichte uns ein Brief meines Studienfreundes Gary. Er arbeite in einer Dorfgemeinschaft für geistig Behinderte in der Nähe von Genf. Ein ungewöhnliches Dorf sei es, von einer merkwürdigen Sekte geleitet, die geistig Behinderte betreue. Wir sollten auf dem Rückweg aus Spanien unbedingt dort vorbeikommen. Für einen Ethnologen wäre das sicherlich interessant. Ich schrieb zurück, gerne würden wir vorbeischauen, aber das ginge leider nicht. Unsere Zeit sei knapp bemessen. Wir würden von Madrid nach Zürich fliegen und gleich in den Nachtzug nach Wien umsteigen, da das neue Semester schon am nächsten Tag wieder beginne.
Noch ehe wir unser Gepäck im Zürcher Flughafen in Empfang nehmen konnten, sahen wir Gary hinter der Glaswand winken. Wie besessen redete er auf uns ein: »Ihr könnt nicht weiterfahren! Ihr müsst das sehen! Ich weiß nicht, was die treiben, in diesem Dorf. Irgendwelche Zauberei. Das kannst du dir als Anthropologe nicht entgehen lassen!« Er ließ unseren Einwand, dass morgen das Semester beginne, nicht gelten und lief, einen unserer Koffer in der Hand, Richtung Ausgang: »Ich bin mit dem Auto da. Es ist jetzt elf Uhr, wenn wir zügig durchfahren, sind wir am Morgen früh da. Da könnt ihr euch ein paar Stunden umsehen und dann von Genf aus den Schnellzug nach Wien nehmen.« Na gut. Ich war zwar nicht ganz einverstanden, dennoch freute ich mich, einige Stunden mit einem alten Sauf- und Raufkumpanen zu verbringen. Sein Fahrzeug war eine klapprige »Ente«, ein Deux Chevaux, die Koffer passten kaum hinein, eine lange holprige Fahrt erwartete uns. Allmählich wurde es hell. In Pastellfarben leuchtete die Landschaft auf, rechts der Jura mit satten grünen Wiesen und vergilbenden Laubwäldern, links Weinberge mit reifen Trauben. Wir umfuhren Genf Richtung Süden. Gerade als die Sonne aufging, hielten wir in einem Weiler am Rande der Rhone.
»Wir sind da«, sagte Gary, griff meinen Arm und zog mich Richtung Gemüsegarten. Beim Geräteschuppen hielt er an und zeigte auf die Dachrinne an der Südwestecke des Gebäudes. »Schau mal«, sagte er ganz aufgeregt, »das ist eine Hirschblase, ausgestopft mit irgendeinem Kraut. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Ist das ein Zauberfetisch? Du kennst dich doch mit solchen Sachen aus, du bist doch Ethnologe!«
Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was der mysteriöse Gegenstand für eine Bedeutung haben könnte.
»Da sind noch andere solche Sachen«, fügte Gary hinzu, »da unter der Traufe haben sie einen Schafsschädel mit irgendwas darin begraben. Meditieren tun die hier auch und führen irgendwelche Rituale auf, aber ich verstehe nichts, weil ich, verdammt noch mal, kein Französisch spreche. Die glauben an irgend so einen abgefahrenen Propheten namens Rudolf Steiner.«
Steiner? Rudolf Steiner. Den Namen hatte ich schon mal gehört. Ach ja, das war doch einer von denen, die an die wissenschaftlich längst widerlegte Atlantis-These glauben, diese Geschichte von jenem versunkenen Kontinent, auf dem einst eine hochentwickelte magische Zivilisation geherrscht haben soll. Über den war ich bei meiner Feldforschung bei den Spiritualisten6 gestolpert.
Er reichte mir einige Broschüren. »Schau mal her, was die hier schreiben! Wahnsinnig, oder?« Ich überflog sie, las von Ätherleibern, Elementar- und Astralwesen und dem kosmischen Christus. Ein Satz blieb mir im Gedächtnis: »Die Engel arbeiten nachts, während des Schlafs, am Ätherleib des Menschen.« Mit Ätherleibern und dergleichen konnte ich damals nichts anfangen. Und Engel existierten höchstens als Projektionen der menschlichen Psyche. Oder?
Das Dorf begann sich zu regen. Beim Frühstück, nach einer Zeremonie mit Kerzen und erhabenen Worten, fand ich mich umringt von neugierigen geistig Behinderten. Einen Augenblick lang kam ich mir vor wie ein Völkerkundler, der auf einer Kannibaleninsel gestrandet ist. Gary scherzte und lachte mit ihnen, und es dauerte nicht lange, bis wir uns entspannten.
Nach dem Frühstück traf ich den Gärtnermeister. Der ältere Herr war dünn, braungebrannt, trug nichts als eine Badehose und sah mit seiner Nickelbrille wie ein Klon von Mahatma Gandhi aus. Was es mit der Hirschblase auf sich habe? Nun, das sei Medizin für den Garten beziehungsweise den Kompost. Der Haufen sei schließlich ein Lebewesen, ein Organismus, und damit er gesund bleibe, gebe man ihm dieses Kräuterpräparat. »Die Schafgarbe ist eine starke Heilpflanze, und in der Blase, der Sonne und der Luft ausgesetzt, wird ihre Wirkung potenziert …« Ich hörte zu, verstand aber nur Bahnhof. Und dann war es höchste Zeit zu gehen. Den Zug nach Wien wollten wir nicht verpassen.
Als wir wieder in Wien waren, konnte ich die mit Schafgarbe gefüllte Hirschblase nicht vergessen, auch wenn ich sie nur kurz zu Gesicht bekommen hatte. Jeden Tag musste ich daran denken. Nachts träumte ich sogar von ihr. Meistens weiß man neue Phänomene einzuordnen. Für alles gibt es eine Schublade. Das ist ja sowieso die Begabung eines Dozenten: Er kann seinen Studenten die Welt erklären. Er kennt sich aus in der gesellschaftlich sanktionierten kulturellen Konstruktion der Wirklichkeit. Dieses Ding aber, diese schafgarbengefüllte Harnblase, konnte ich einfach nicht einordnen. Was hatte sie mitten in der technokratisch orientierten, wissenschaftlich aufgeklärten westlichen Welt des 20. Jahrhunderts zu suchen? Hätte ich so etwas bei den Indianern gesehen, etwa bei den Cheyenne oder den Quinault, mit denen ich flüchtigen Kontakt hatte, hätte ich kein Problem damit gehabt.
Kurz und gut, wir schrieben die Kommune an und erklärten, dass wir gerne dort mitarbeiten würden. Im Sinn hatte ich eigentlich eine Art Undercover-Datenerhebung, eine sogenannt »teilnehmende Beobachtung«. Ein lohnendes Forschungsprojekt. Ein Jahr später machten wir uns auf den Weg in die Siedlung an der Rhone. Ich half im Gemüsegarten, und Faye leitete das Batikatelier. Jeden Abend machte ich fleißig Notizen über das soziale Beziehungsnetzwerk, Glaubenssystem, Weltbild und den Wirtschaftskreislauf. Wie in einem Kibbuz leistete jedes Gemeindemitglied so viel an Arbeit, wie es konnte, nahm aber nur in Anspruch, was es brauchte. Einmal pro Woche fuhr ich nach Bern zum Ethnologischen Institut der Universität, wo ich auch schon meine Dissertation eingereicht hatte.
Allmählich wurden Garten und Landwirtschaft immer interessanter für mich, während der Reiz des Universitätsbetriebes zunehmend verblasste. Am Morgen half ich die Schweine füttern und Kühe melken und badete dabei meine ausgehungerte Seele in der riesigen, warmen Animalität dieser Tiere. Bis Sonnenuntergang nahm uns dann der Gemüsegarten in Anspruch. Über zwei Hektar erstreckte sich der Garten; jede Art von Gemüse gab es da, allein zwanzig Sorten Salat. Ich begann, barfuß zu laufen, erlebte, wie der sanfte, feuchte Humusboden mit den Füßen kommuniziert, und erkannte, wie uns Schuhe, Asphalt und Zement vom Herzschlag der Mutter Erde trennen. Das stundenlange Hacken glich einer Meditation. Die meisten unerwünschten Begleitpflanzen bilden Rosetten, die wie Mandalas aussehen. Auch wenn man sie weghackt, wirken sie dennoch zentrierend auf Geist und Seele. Man jätet nicht nur »Unkräuter«, sondern es scheint, als jäte man bei der Arbeit zugleich all die unnötigen Gedanken, Hirngespinste und den überflüssigen intellektuellen Kram, mit dem man sich über die Jahre vollgestopft hat.
Der Komposthaufen, der Tiermist, Küchenabfälle, Altpapier und Unrat schluckte und in gut riechenden dunkelbraunen Humus verwandelte, war ein stiller Lehrer. Ohne abstrakte Worte lehrte er einen, das Mysterium der Verwandlungen des Lebens und des Todes zu verstehen. Für »Gandhi«, den alten Gärtnermeister, war jeder seiner Komposte ein Lebewesen. Jedem Haufen pflanzte er, wie der liebe Gott selbst, mit einer weihevollen Geste verschiedene Kräuterpräparate ein – auch das Hirschblasen-Schafgarbenpräparat war dabei. Organanlagen seien das, die man diesen Proto-Lebewesen einpflanze, Organe, die mit den Planetenkräften in Resonanz stehen, erklärte er. So würde der Kompost vernünftig, würde die ordnenden Kräfte des Kosmos aufnehmen und schließlich den Pflanzenwurzeln vermitteln. Mir öffnete sich eine völlig neue faszinierende Denkweise.
Auch gegenüber der Natur öffnete ich mich, schaute den Krabbelkäfern zu, lauschte dem Vogelgesang, sog die Düfte und Aromen der frischen Erde und der Blüten ein und merkte dabei: Das ist nach jahrelangem Wandern durch Wüsten trockener, quantifizierter Daten und Fakten Nahrung und Stärkung für die Seele. Jeden Morgen schwebte ein Bussard, vom Wald jenseits der Rhone kommend, heran und drehte über dem Garten einige Kreise. Er schien uns Gärtner zu kennen. Es war wie der Gruß einer Gottheit.
Meine ethnografischen Notizen wurden immer spärlicher. Immer seltener erschien ich am Ethnologischen Seminar in Bern. Ich hatte eine tiefgründigere Welt entdeckt oder, genauer gesagt, wiederentdeckt. Auf einmal konnte ich wie einst in der Kindheit und Jugend die Natur wieder spüren und riechen, Tiere und Pflanzen wirklich sehen. Unmittelbar, ohne den Filter von Worten, Zahlen und theoretischen Modellen. Meine graue Welt wurde wieder bunt. Die Folie, in die ich eingeschweißt war, der Kokon, gesponnen aus Milliarden abstrakten Gedankenfäden, fiel ab. Die Seele konnte wieder atmen und fliegen.
Höchstens einmal im Monat fuhr ich nun nach Bern. Die theoretischen Auseinandersetzungen beflügelten mich nicht mehr so wie einst. Wenn ich dann am folgenden Morgen gegen drei oder vier Uhr früh wieder ins Dorf kam, brannte noch Licht in unserem Zimmer. Gerald, ein fahrender Künstler aus Irland, leistete meiner Frau Gesellschaft. Ganz harmlos, beteuerten sie. Sie würden nur gemeinsam Tolkiens »Herr der Ringe« lesen. Aber bald merkte ich, dass es nicht ganz so harmlos war. Eines Tages verschwand sie mit ihm.
Ich war erschüttert. Die Universität vergaß ich nun vollends. In die Stadt, ins Kino, Theater oder Restaurant ging ich gar nicht mehr. Ich war nur noch im Garten. Meine Sinne derweil wurden immer feiner, Haare und Bart immer länger. Als ich sie dennoch einmal schnitt, kam es mir vor, als schneide ich mir Antennen ab. Seither ließ ich sie wachsen. Immer mehr gelang es mir, mit den Tieren telepathisch zu kommunizieren. Sogar mit Fliegen. Konnte sie herabrufen, sich auf meine Hand zu setzen, oder konnte sie, wenn sie im Zimmer verirrt umherschwirrten, gedanklich zur Fensteröffnung lotsen. In den Gewitterstürmen, die gelegentlich über das Tal hinwegfegten, nahm ich Gottheiten wahr. Und manchmal am Abend, wenn man nach getaner Arbeit erschöpft, aber entspannt auf der Gartenbank saß und den Blick über Beete und Äcker schweifen ließ, sah ich – im Zwischenraum zwischen Wachen und Träumen, zwischen dieser und der »anderen« Welt – ätherische Naturgeister schwebend tanzen und Heinzelmännchen über die Erdkrume stapfen. Früher, in meinen Vorlesungen, hatte ich solche Zustände als Halluzinationen, als Ausdruck von gestörtem Hirnzellstoffwechsel, als Persönlichkeitsspaltung oder als psychische Projektionen bezeichnet. Nun wusste ich aber, dass das nicht zutrifft. Das sind keine Halluzinationen oder geistige Verwirrungen. Es sind Wahrnehmungen, die eher auf einer Erweiterung der Sinne und des Bewusstseins beruhen, auf dem Wegschmelzen kultureller Filter. Diese Erfahrung half mir später, andere nichtwestlich geprägte Kulturen besser zu verstehen – von innen her sozusagen. Für die Indianer oder Schamanen der Naturvölker etwa sind Götter und Naturgeister nicht etwas, woran man glaubt, sondern Erfahrungen der anderen Art. Auch die Pflanzen begannen mit mir zu »sprechen«.
Dieser Garten war mir zur Universität geworden. Ich war nun im Kolleg der Natur immatrikuliert. Meine Bibliothek waren Pflanzen, Tiere, der Erdboden, Wälder und Wiesen, Felder, Berge und Flüsse. Diese Universität befreite mich von dem zum Pessimismus neigenden Nihilismus, der – trotz seiner Hybris – der reduktionistisch-materialistischen Sichtweise innewohnt.
Zweieinhalb Jahre vergingen, und ich war immer noch im Garten in der Nähe von Genf. Da erschien eines Tages der Assistent des Ethnologischen Seminars. Der Professor, sagte er, wolle wissen, wo ich stecke. Er wolle unbedingt, dass ich die vor langer Zeit abgegebene Dissertation noch etwas ausfeile und endlich die Prüfung ablege. Er hätte ein Fulbright Stipendium (American Exchange Scholarship) für mich bereitliegen, wenn ich dazu bereit wäre. Ich war es. Es war also Zeit für einen neuen Lebensabschnitt. Zwar habe ich später noch an verschiedenen Universitäten und Colleges gelehrt, fand aber den akademischen Betrieb immer etwas einengend. Geblieben ist, was ich in der Universität der Natur gelernt habe; geblieben ist die Skepsis gegenüber all den allzu klugen intellektuellen Modellen, Computersimulationen und theoretischen Systemen. Die Wirklichkeit ist tiefer; sie kann nicht vom Verstand ausgelotet werden, eher vom Herzen.
»Was ist das? Ein Zauberfetisch?«, hatte mich mein Freund Gary gefragt. Für mich war es das bestimmt. Ein kurzer Blick auf die ausgestopfte Hirschblase hat mein Leben verwandelt. Allein die Symbolik ist stark. Sie berührt archaische Schichten der europäischen Seele. Die Kelten erlebten den Hirsch als Erscheinung des geweihtragenden Cernunnos. Diese Hirschgottheit galt als Sonne in der Tiefe der Erde, als die Kraft, die die Pflanzen nach oben wachsen lässt. Und die Schafgarbe, dieser heilkräftige aromatische Korbblütler, wurde – wie einst auch in China für das I Ging – als Orakelpflanze verwendet. Im germanischen Kulturkreis wurde das Kraut der holden Freya, der Göttin des Lebens und der Liebe, geweiht. Auch für mich stimmte die Symbolik: Dank dieses Fetischs, der da am Dach des Gartenhauses hing, konnte ich die Liebe zur Erde wiederfinden. Der Fetisch war der Schlüssel, der mich aus der Enge des Elfenbeinturms befreite.
ANGREIFENDE HARPYIEN
Verfluchungen und ungute Gedanken können einen einholen, das erfuhr ich in Marokko. Immer wieder mal fuhr ich nach Tanger, um im American-Express-Büro nachzuschauen, ob Faye mir eine Botschaft hinterlassen hatte (siehe Seite 25). Um den Hals trug ich eine Kette mit einem kleinen Kreuz, denn damals war Jesus in: Für die Hippies war klar, dass Jesus einer von ihnen war und dass er im Marihuana-Rausch mit dem himmlischen Vater kommunizierte; George Harrison hatte gerade My sweet Lord veröffentlicht; die Jesus People schickten Mädchen auf die Straße, um Sünder mit »freier Liebe« zu Gott zu bekehren, und sogar in den von Rucksacktouristen besuchten marokkanischen Bazaren hörte man aus den Boxen immer wieder den Hit Jesus, come to us in Marihuana. Ein Straßenjunge fragte mich, was es mit dem Kreuz auf sich habe. Als ich zu erklären versuchte, dass Gott in Jesus Mensch geworden war und sich geopfert habe, um uns von unseren Sünden zu erlösen, stürmte ein älterer, in ein Dschellaba-Gewand gekleideter Mann auf mich zu, schrie mich hasserfüllt an und fuchtelte mir mit dem Zeigefinger ins Gesicht. Die dunkle Schwiele auf seiner Stirn deutete an, dass er es mit dem fünfmal täglichen Niederwerfen zum Gebet ernst meinte. Anscheinend war ich für ihn ein verfluchter Ungläubiger, den er, wenn es erlaubt wäre, auf der Stelle umbringen würde. Nun, ich machte mir nichts weiter daraus und ging fort.
Als ich einige Wochen später in einem Straßencafé in Tarifa an der Südspitze Spaniens saß, kam Faye angeschlendert. Mit ihr war eine junge blonde Reisegefährtin, eine Studentin aus Amerika, die sich ihr angeschlossen hatte. Tarifa ist windig, das Meer unruhig, richtig Baden kann man nicht. Heute ist es ein Ziel für Windsurfer, aber damals war in der Stadt nicht viel los außer Tapas, Cerveza und ab und zu Flamenco. Wir entschieden uns, zu dritt einen Ausflug in das naheliegende exotische Land der Berber zu machen.
Auf der Fähre sprach uns ein Marokkaner mittleren Alters freundlich an und sagte in gebrochenem Spanisch, er würde uns gerne zu sich einladen, er habe ein Haus mit Gästezimmern. Nebenbei bemerkte er, die Hand über den Mund haltend, dass er etwas Alkohol als Schmuggelgut dabeihabe. Wir dachten uns nichts weiter und nahmen die Einladung an.
Im Hafen bestiegen wir einen Landbus. Während er redete, sah ich, wie eine ältere Frau, die hinter uns saß, mich mit ihrem Blick fixierte und heftig mit dem Kopf nickte. Als Ethnologe hätte ich verstehen sollen, dass die Geste bedeutete: »Macht das auf keinen Fall, dem ist nicht zu trauen!« Hätte sie keine Bedenken signalisieren wollen, dann hätte sie ihren Kopf leicht hin und her gewiegt und nicht so streng geblickt. Dieses Nicken war als Warnung gedacht. Leider habe ich sie nicht verstanden.
In einem staubigen Kaff, irgendwo im entlegenen Nirgendwo, stiegen wir aus dem Bus. Ein klappriger alter Wagen hielt und nahm uns mit. Wir fuhren eine Strecke durch eine wüstenhafte Landschaft, bis das Auto in einem trostlos aussehenden Dorf vor einem unspektakulären viereckigen, fensterlosen Gebäude hielt, dessen Wände mit braunem Lehm verputzt waren.
»Das ist mein Haus«, sagte unser Gastgeber. Ein jüngerer Mann öffnete die Tür von innen; er machte große, eher erschrockene Augen und ließ uns ein. Kaum waren wir in den düsteren Raum eingetreten, sprang der Junge hinaus und verschloss die Tür von außen mit einem Schlüssel. Das kam uns merkwürdig vor. Faye und ihre Freundin hatten ein mulmiges Gefühl.
»Nehmt Platz, da auf den Kissen«, sagte unser Gastgeber und verschwand in ein anderes Zimmer. Man hörte das Geräusch von Messerwetzen. »Der wetzt Messer!«, flüsterte die junge Amerikanerin beunruhigt. »Hoffentlich will er uns nicht abschlachten!«
Kurz darauf erschien er schon wieder mit einem großen Tablett, angehäuft mit Fleisch, Fladenbrot, Tomaten und Obst. Er hatte lediglich das Messer geschärft, um das Fleisch aufzuschneiden. Auch mehrere Flaschen Rum und Whisky hatte er dabei. Wir sollten essen und es uns gemütlich machen, sagte er breit lächelnd, während er große Saftgläser mit dem Fusel füllte. Er selbst becherte eifrig mit, wurde immer lauter und war bald angetrunken. Mit ungutem Gefühl merkte ich, wie sich bei ihm allmählich die Hemmungen lösten; immer ungenierter starrte er die blonde junge Frau an, versuchte ungeschickt mit ihr zu flirten und sie schließlich zu berühren. Wahrscheinlich waren wir für ihn die typischen »Hippies«, jene sittenverdorbenen jungen Europäer, die damals das Land überfluteten, sich mit allem, was »high« macht, berauschten und – dank der Pille und dem Dogma der »freien Liebe« – hemmungslos herumvögelten. Er hatte sich vermutlich eine tolle Vierernummer, eine geile Orgie vorgestellt.
Es dauerte nicht lange, da griff er nach der verängstigten jungen Frau und wollte sich auf sie legen. Ehe es so weit kam, packte ich ihn an den Schultern und versuchte ihm klar zu machen, dass das nicht gehe. Das Manöver artete in einen wilden Ringkampf aus. Keuchend und schweißtriefend rollten wir auf den Boden, wobei einige der spärlichen Möbel und Behälter in Brüche gingen. Er glich einem brunftigen Stier. Alle rationalen Funktionen seines Gehirns schienen ausgeschaltet. Nach einer Weile kam es zu einer Pause. Die Frauen reichten ihm randvoll gefüllte Gläser mit Rum und versuchten ihn betrunkener zu machen. Er trank sie hastig aus. Nachdem die Frauen ihm immer wieder Alkohol eingeflößt hatten, rollte er schließlich in eine Ecke und schlief schnarchend ein. Das war unsere Chance auszubrechen. Sein Kumpan hatte zwar den Raum von außen abgeschlossen, aber mit heftigen Tritten splitterte die Holztür auf.
Es war noch dunkel draußen, aber der Morgen schien nicht weit, denn hier und da krähten schon Hähne. Köter bellten und heulten ununterbrochen, Esel wieherten heiser, und irgendwelche andere Tiere – vielleicht waren es Kamele – machten unheimliche Geräusche. Hinter einigen Gebäuden zog eine seltsame Prozession mit Fackeln, Trommeln, schrillen Hörnern und lautem Geschrei vorbei. Vielleicht ein Hochzeitszug.
Was sollten wir machen, wohin sollten wir gehen? Da draußen war man noch unsicherer als drinnen. Also blieben wir in dem ziemlich verwüsteten Zimmer.
Bei Sonnenaufgang stand unser Gastgeber auf und verschwand in einem Raum, der wohl eine Art Badezimmer war. Auf jeden Fall kam er frisch rasiert, gewaschen und mit einem sauberen weißen Hemd, aber sichtlich verkatert, wieder zum Vorschein. Er sagte kein Wort und würdigte uns keines Blickes. Kurze Zeit später hielt das zerbeulte Auto, mit dem wir gekommen waren, vor dem Haus. Der ängstlich blickende Fahrer machte die Hintertür des Wagens auf; unser Gastgeber sagte in kaltem Tonfall: »Steigt ein.« Eine Staubwolke aufwirbelnd, fuhren wir auf holpriger Piste in eine nahegelegene Stadt.
Dort, vor einem Friseurladen, wo mehrere Männer Tee tranken und Wasserpfeife rauchten, hielt das Fahrzeug. Wir sollten aussteigen. Unser Gastgeber deutete an, dass wir in dem Laden, dessen Chef er offensichtlich war, mit ihm eine Tasse Tee trinken sollten. Wir tranken, wie es eben Brauch war, den Tee. Er sagte kein weiteres Wort, hatte wohl einen schrecklichen Brummschädel und verfluchte uns mit eiskaltem Blick. Nach dieser qualvollen Tasse Tee waren wir mehr als froh, uns schließlich wieder auf den Weg zurück nach Spanien zu machen.
Ein paar Jahre später – ich war schon Gärtner geworden, und das Schicksal hatte Faye und mich getrennt – lernte ich ein nettes Hippiemädchen kennen. Ich wollte ihr Marokko zeigen, jenes exotische Land, das von Europa aus am leichtesten zu erreichen ist und das man sich mit geringem Einkommen noch leisten konnte. Mit Autostopp ging es ohne Probleme durch Frankreich und Spanien. Als wir in Tanger landeten, kam ein in traditionelle Tracht gekleideter Wasserverkäufer auf uns zu. Als er mir den Krug reichte, war es plötzlich, als befinde ich mich in der twilight zone, jenem unheimlichen Raum jenseits des gewöhnlichen Alltags. Ich trank, und es kam mir vor, als trinke ich vom Kelch des Schicksals.
Wir waren junge Träumer auf den Pfaden von Flower Power, Love and Peace. Wir wollten ans Meer, an einen menschenleeren Strand, wo wir Sonne, Wellen und nachts den Sternenhimmel genießen konnten. Einen solchen Strand fanden wir auch in der Nähe von Larache, einem ehemaligen Seeräubernest mit schöner Altstadt. Auf dem Weg entlang des Meeresufers griff uns unvermittelt eine Schar krächzender, dunkel gefiederter Vögel an. Wie Harpyien, die geflügelten Rachegeister der griechischen Mythologie, stürzten sie im Sturzflug immer wieder auf uns herab, ehe sie unmittelbar über unseren Köpfen wieder abbogen und unerbittlich erneut Anlauf nahmen. Mit vorgestreckten Krallen und in der Luft hackenden Schnäbeln versuchten sie uns zu vertreiben. So etwas hatte weder meine Freundin noch ich je erlebt. Vielleicht haben sie ihre Nester hier und versuchen diese zu verteidigen, dachte ich.
Bei Sonnenuntergang fanden wir schließlich ein ruhiges Plätzchen in den Dünen, wo wir unsere Schlafsäcke ausrollten. Die aggressiven Vögel waren verschwunden. Der Strand war in das helle Licht des Vollmonds getaucht, und der Rhythmus der Wellen klang wie das Atmen eines riesigen Tieres. Nach einer Weile bemerkten wir einen Hirten, der uns von einem Hügel aus beobachtete.
»Mir ist nicht wohl bei dem Anblick«, sagte meine Freundin, »vielleicht sollten wir lieber gehen.«
»Ach was! Der sucht wohl nur eine verlorene Ziege«, antwortete ich.
Es dauerte nicht lange, da erschien eine Gruppe Männer, fünf, sechs, vielleicht sieben waren es – ich habe sie nicht gezählt. Sie trugen Knüppel und umringten uns, während wir dort lagen. Als spontane Friedensgeste reichte ich ihnen Brot. Das wollten sie nicht. Sie wollten die Frau. Sie standen über mir, die Knüppel schlagbereit über meinem Kopf, während einer nach dem anderen die junge Frau vergewaltigte. Ich saß wie gelähmt da. In solchen Situationen erwacht manchmal der Berserkergeist, und man wirft sich wie besessen auf die Gegner. Aber diesmal war das nicht der Fall. Sie hätten mich wahrscheinlich totgeprügelt.
Es war, als ob in diesem Moment die gebündelten Flüche, die mir folgten, ihr Ziel erreicht hätten. Wäre ich klarer im Geist gewesen, hätte ich die Sprache der Vögel verstanden, dann hätten wir nicht am Strand übernachtet. Vögel – das wusste man im Altertum und bei den meisten Naturvölkern – sind dem Himmel und den Göttern nahe, sie können Zukünftiges vermitteln. In Rom gab es sogar ein staatliches Priesteramt, die Auspicien, deren Aufgabe es war, den Flug der Vögel zu deuten.
Flüche wirken. Aber nur, wenn sie sich an etwas heften können. Seelen, die rein und geläutert sind, bilden keine Angriffsfläche für solche negativen Energien. Aber das war mir damals nicht bewusst.
Die Indianer, die ich kenne, meiden Orte, wo ihnen etwas Ungutes geschehen ist. Da gehen sie nicht wieder hin. Für viele ist Marokko ein aufregendes und wunderbares Reiseziel, aber für mich hat es seinen Reiz verloren.
2Eva Rosenfelder, Poetin, Autorin und Insidern als begabte Redakteurin des Schweizer Magazins Spuren bekannt, hat mich in einem Interview bezüglich meiner Lebensernte befragt (Spuren, Nr. 116, Sommer 2015).
3Aus einer Zeit kommend, in der französische Ausdrucksweisen als kultiviert galten, benutzte mein 1887 geborener Großvater gern solche Fremdworte.
4Nachdem ich als Elfjähriger mit meinen Eltern nach Amerika ausgewandert war, kehrte ich nun über Indien nach Deutschland zurück, wo ich seither nicht mehr gelebt hatte.
5Näheres dazu in: Storl, W.-D.: Mein amerikanischer Kulturschock, München: Kailash Verlag, 2017
6Die Sekte der Geisterbeschwörer, die sich als Spiritualisten (spiritualists) bezeichnete, ist nicht identisch mit Spiritisten.
PFLANZLICHES
In einem Kraut liegt mehr Tugend und Kraft
als in allen Folianten,
die auf den hohen Schulen gelesen werden
und denen auch keine lange Lebensdauer
beschieden ist.
Paracelsus
Der weise Tschuang-tse, der vor ungefähr 2400 Jahren in China lebte, sagte einmal in Bezug auf die Anmaßungen vieler Gelehrter: »Was weiß ein Frosch im Brunnen über das Meer? Was weiß die Libelle über Eis und Schnee?« Ebenso könnte man unverschämt fragen: »Was wissen die Botanik-Professoren über die Pflanzen?« Im Vergleich zu einigen indianischen Medizinleuten, begabten Kräuterfrauen oder oft analphabetischen Hirten wissen sie eigentlich recht wenig, denn sie sind an eine Methode der Erlangung von Wissen gebunden, die nur das materiell Messbare und Wägbare zulässt. Zu Recht nennt man diese Methode »reduktionistisch«. Genau wie der Mensch ist auch die Pflanze mehr als die Summe von Elementen, Wirkstoffen und messbaren physiologischen und chemischen Reaktionen. Das habe ich vor allem von den Medizinmännern der Cheyenne gelernt: Mit den alltäglichen Augen sehen wir nur die lebenden Körper der Pflanze; mit den Augen der Seele nehmen wir ihr Seelen-Geistwesen wahr. Diese Pflanzenwesen sind mächtig; sie können uns inspirieren, in unseren Träumen erscheinen und – da sie selber heil sind – uns heilen. In der indischen Tradition sind Pflanzen nicht nur von Göttern bewohnt, sie sind selbst Devas, göttliche, mit Licht verbundene Wesen. Das mag esoterisch klingen. Aber genau betrachtet, sind Pflanzen kosmisch offene Wesenheiten, verbunden mit Sonne, Mond und Sternen. Zugleich nehmen sie die Kraft der Erde auf. Sie geben uns den Sauerstoff, den wir atmen, und sie nähren Mensch, Tier und Pilz. Was sie als himmlische Lichtkräfte und Rhythmen aufnehmen, vermitteln sie anderen Geschöpfen als heilende und nährende Informationen.