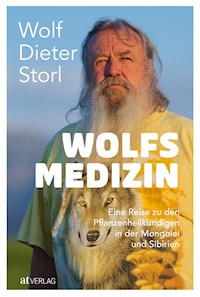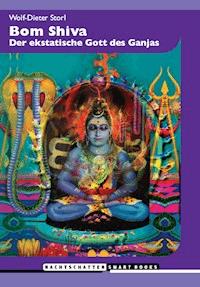Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AT Verlag AZ Fachverlage
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Pflanzen sind mächtiger, als wir allgemein glauben. Als makroskopische Wesen vermitteln sie die Lichtkräfte des Kosmos und verlebendigen die Erdmaterie. Alle Kulturen, ausser unserer gegenwärtigen, wissen um die geistig-seelischen Dimensionen der Pflanzen. Im Traum oder in der ekstatischen Vision des Schamanen erscheinen die Pflanzen als göttliche Wesenheiten, Devas oder Lichtengel, die aktiv und bewusst in das Erdgeschehen und in die Menschheitsgeschichte eingreifen. Das Buch soll ein Schritt sein, die unterbrochene Kommunikation zwischen Mensch und Pflanze wieder herzustellen. Ein Anhang mit praktischen Anleitungen zu Pflanzenmeditationen erleichtert die Kontaktnahme mit den Pflanzendevas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolf-Dieter Storl
Pflanzendevas
Die geistig-seelischen
Dimensionen der Pflanzen
Wolf-Dieter Storl
Pflanzendevas
Die geistig-seelischen Dimensionen der Pflanzen
Mit praktischen Anleitungen zu Pflanzenmeditationen
6. Auflage, 2014
© 1997
AT Verlag, Aarau, Schweiz
Umschlagbild: Frank Brunke, Buchenberg
Illustrationen Seite 48, 56, 86, 97, 99, 105, 110, 139, 183, 185:
Lambert Spix, Köln
Satz und Lithos: AT Verlag, Aarau
ISBN 978-3-03800-104-1
www.at-verlag.ch
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheimwww.brocom.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Die Wiederkehr des Andersweltlichen
Nahrung aus dem Kosmos
Devi: Göttin der Vegetation
Marias Kräuterwisch
Pflanzendevas – Devis Kinder
Die Ammen der Menschheit
Die heimlichen Herrscher
Persönliche Freundschaften
Der alte Medizinmann und das grüne Volk
Sich dem vegetativen Pol des Lebens anvertrauen
Engelwesen und Sphärenharmonien
Herz und Leber der Devas
Findhorn und der Erbsendeva
Roc und die Naturgeister
Die Geister der vier Elemente
Motsiiuifs heilige Pflanze
Die himmlischen Wölfe und die Mutter der Kräuter
Sammelrituale: Der richtige Ort, die richtige Zeit
Keltische Sammelzeiten und Planetenstunden
Sammelrituale: Orientierung und Opfer
Grabwerkzeuge: Bärenkrallen und Hirschgeweihe
Die Macht der Mantras
Pflanzenrituale für heute
Pflanzen, die menschliche Gestalt annehmen
Nachwort: Der schlimmste Krieg aller Zeiten
Anhang: Praktische Übungen
Bibliografie
Stichwortverzeichnis
VORWORT
«Überhaupt ist der Mythos weit mehr dem Zufall entzogen als die Geschichte – er bringt Ideen, die Geschichte nur Tatsachen.»
Ernst Jünger, Annäherungen
Vor allem darum geht es mir in diesem Buch: um fruchtbare, kunterbunte Ideen, die das Gewohnte in einem neuen Licht erscheinen lassen können, und weniger um «gesicherte» analytische Tatbestände. Keine wissenschaftliche oder parawissenschaftliche Botanik, keine eigentliche Ethnobotanik und schon gar nicht eine esoterische Phytosophie liegt dem Leser hier vor. Das Buch, gespeist aus den Sagen und Überlieferungen verschiedenster Völker, Traditionen und Zeitepochen, ist eher im Sinne eines Märchens für Erwachsene zu verstehen – ein Märchen im ursprünglichen Sinne des Wortes Mär, also eine «Kunde», eine «Nachricht». Es ist eine Nachricht aus dem Zauberreich der uns tragenden stillen, grünen, ewig wachsenden Mitgeschöpfe. Es erkundet den leuchtenden archetypischen Urgrund der Vegetation – der zugleich auch unser eigener Daseinsgrund ist.
Wolf-Dieter Storl
EINLEITUNG
Das Telefon riss mich aus meinen Gärtnerträumereien. Ich warf den Spaten beiseite und hastete ins Haus. Als ich den Hörer abnahm, überwältigte mich der Wortschwall irgendeines mir unbekannten Fernsehproduzenten:
«Sicherlich kennen Sie Das geheime Leben der Pflanzen, den einmaligen Bestseller von Peter Tompkins und Christopher Bird? Wissen Sie, dass seit der Erstveröffentlichung zwanzig Jahre vergangen sind?» – Die Stimme wurde nachdrücklicher: «Zwanzig Jahre! Es ist nun wirklich an der Zeit, dem Publikum die neueren Erkenntnisse und Fortschritte auf dem Gebiet der esoterischen Pflanzenforschung nahezubringen. Es geht darum, den Leutchen da draussen klarzumachen, dass es sich bei den Pflanzen nicht um leblose Gegenstände handelt, sondern um beseelte Lebewesen, die mit den Menschen eine emotionale Beziehung eingehen können. Vielleicht könnten Sie mir da einige Hinweise geben. Verstehen Sie mich recht, es geht mir um eine spirituelle Sicht der Dinge. Wir suchen nach einer Möglichkeit, die Pflanzendevas im Fernsehen selber zu Wort kommen zu lassen.»
Noch ganz ausser Atem, fragte ich: «Nun, ja, wie wollen Sie das denn anstellen? Pflanzenseelen und -geister sind ja schon vom Begriff her für unsere äusseren Sinne unerfahrbar. Sie sind unsichtbar! Was wollen Sie denn da eigentlich filmen?»
«Sicherlich kennen Sie die Kirlian-Hochfrequenzphotographie, mittels derer es gelungen ist, die Auras der Pflanzen abzulichten, sichtbar zu machen! Es ist Ihnen vielleicht nicht geläufig, welche technischen Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, verborgene Phänomene unseren Sinnen zugänglich zu machen. Sie kennen doch sicherlich den Backster-Effekt?»
Ich brauchte nicht lange zu überlegen. Backster-Effekt. Klar! Aus spielerischem Trieb heraus hatte der Kriminologe Cleve Backster eines Tages seinen Lügendetektor an den Drachenbaum angeschlossen, der da in einem Topf neben seinem Schreibtisch dahinvegetierte. Zu seiner Verblüffung musste er feststellen, dass der Polygraph schon beim blossen Gedanken, ein Blatt zu durchstechen oder es in den heissen Kaffee zu tauchen, ausschlug. Pflanzen können Gedanken lesen – um diesen Schluss kam Backster nicht herum.
Die Stimme am anderen Ende der Telefonleitung arbeitete sich inzwischen in einen regelrechten Eifer hinein: «Nun lassen sich die von den Pflanzengeweben ausgehenden elektrischen Impulse leicht amplifizieren und aufandere Medien übertragen. Zum Beispiel kann man sie als Ton oder als Farbe wiedergeben. Folgende Szene wäre doch ganz toll für eine Sendung: Da sitzt jemand vor seiner Salatschüssel. Elektroden sind an den Salatblättern angeschlossen. Im selben Moment, in dem er mit der Gabel zusticht, verändert sich die elektrische Spannung in dem betroffenen Blatt. Das genügt, um mittels Farb- und Tongeneratoren einen schrillen Schrei auszulösen und es blutrot auf dem Monitor aufleuchten zu lassen! Nicht wahr, das würde den Leuten endlich einmal vor Augen führen, dass sogar der Salat ein fühlendes, beseeltes Wesen ist! Da würden sie nicht mehr so gedankenlos Salate, Gurken, Äpfel oder sonstwas in sich hineinstopfen. Ich sehe das sozusagen als eine pädagogische Aufgabe!»
Ich brummelte etwas Dümmliches vor mich hin und sagte, dass ich ihm wohl nicht helfen könne. Zugleich musste ich an die alte Dame denken, der es schon eine Qual bereitet, ihr Gärtlein zu jäten. Das blutrote Aufleuchten und der schrille Todesschrei des Salatblättchens würde ihr jede Mahlzeit zur Gewissensqual machen. Wie könnte sie die Vorstellung verkraften, die armen Kartoffelwesen lebendigen Leibes im kochenden Wasser zu verbrühen. Oder die unschuldigen Radieschen zu zerstückeln und dann noch Salz in ihre Wunden zu streuen! Der Mensch als molochartiges Monster! Welche geistig hochentwickelte Seele – und dafür hielt sich die alte Dame – könnte damit leben? Sie müsste, wollte sie nicht als niederträchtige Heuchlerin dastehen, die letzte Konsequenz ziehen: Sie müsste ganz aufhören zu essen und sofort ins Geistige eingehen, so wie es die Heiligen der Jaina im alten Indien taten. Um kein weiteres böses Karma anzuhäufen, versagten sich die Jaina völlig den animalischen Trieben. Sie setzten sich einfach hin, hörten auf zu essen – und entschwebten nach vierzig bis sechzig Tagen dieser grausamen Welt.
Nein, mit solch billigem Mediensensationalismus, solchen elektronischen Gaukeleien lässt sich die Ehrfurcht vor dem Leben nicht neu entfachen! So etwas sollten Sie, Herr Fernsehproduzent, Ihren Zuschauern nicht zumuten! Ausserdem erzeugen die Pflanzen ihre Biomasse im Überfluss. Pflanzen gleichen stillenden Müttern mit prallen Brüsten, denen es Freude macht, die hungrigen Mäuler ihrer Kinder zu stopfen. Es ist genug da für Menschen und Tiere.
Nein, Sie befinden sich auf dem Holzweg. Die einfachen Naturgeister, geschweige denn die erhabenen Pflanzendevas, lassen sich nicht so leicht leimen. Kein elektronischer Sensor, kein noch so raffiniert ausgeklügeltes Instrument wird die Devas zum Sprechen bringen. Ganz im Gegenteil, auf Zwang und freche Neugierde lassen sie sich nicht ein, sie ziehen sich zurück. Wir brauchen keine anderen Instrumente als unseren Leib und unsere Seele – das hatte ja schon der alte Goethe gesagt! Liebe ist die einzige Sprache, die die Pflanzengeister verstehen. Liebe zieht sie an – und dann erst können sie in ihrer unbeschreiblichen Schönheit im Spiegel unserer Seele erscheinen. Wir müssen also an uns selbst arbeiten, den Spiegel reinigen – etwa mit Yoga und Meditationsübungen, nicht bloss im Äusseren kramen.
«Nein danke, Herr Produzent, ich habe kein Interesse, an Ihrem Programm mitzuwirken. Auf Wiederhören!»
DIE WIEDERKEHR DES ANDERSWELTLICHEN
Wer oder was sind nun diese Devas, Pflanzenseelen, Baumgeister oder Blütenelfen, die in zunehmendem Masse die Aufmerksamkeit der Menschen wieder auf sich ziehen? Klare Vorstellungen gibt es kaum! Alle möglichen Bilder tauchen auf, von winzigen kitschigen Disney-Figürchen, die sich in Blütenkelche nesteln, sich an Tau und Blütendüften laben und mit zierlichen Libellenflügeln durch die warme Sommerluft schwirren, bis hin zu den Baumgeistern, wie etwa dem Erlkönig, oder gar heimtückischen Monstergewächsen wie den amoklaufenden fleischfressenden Schlingpflanzen eines Hollywood-Horrorfilms. Bei Botanikern rufen solche Bilder ein Nasenrümpfen, bestenfalls ein Schmunzeln hervor. Pflanzenseelen und Baumgeister – so etwas gibt es nicht! Hatte nicht schon der grosse Zellularpathologe Rudolf Virchow gesagt, er habe bei den vielen Tausenden von Sektionen noch nie eine einzige Seele gefunden? Taxien, Tropismen, Nastien und andere quantifizierbare mechanische oder chemische Reizreaktionen können für alles herhalten, was an den Pflanzen so geheimnisvoll und seelenartig erscheint.
Psychoanalytiker geben sich da schon etwas grosszügiger: Ja, solche Wesenheiten gibt es …, aber nur als Projektionen subjektiver Wunschbilder und Phantasien auf die an sich «leere» Natur. Objektiv gesehen gibt es sie ebensowenig wie fliegende Untertassen mit kleinen grünen Männlein als Besatzung.
Nicht jeder ist jedoch von diesem mit erhobenem Zeigefinger vorgetragenen Dogma der Wissenschaft überzeugt. Es gibt immer wieder Menschen, denen fliegende Untertassen begegnet sind, die mit Engeln oder mit Pflanzenelfen gesprochen haben und die sich diese Erfahrungen nicht nehmen lassen wollen. Es wird berichtet von Bäumen, die im Traum mit Menschen reden; von Heilkräutern, die plötzlich im Gartenbeet erscheinen, als wüssten sie, dass jemand im Haus krank ist und ihrer Hilfe bedarf; von Topfgewächsen, die sich ganz auf ihren Besitzer einstellen. So erzählte mir neulich ein Kakteenzüchter von seiner geliebten Königin-der-Nacht (Selenicerus). Nur in einer einzigen, mondhellen Nacht im Jahr öffnet sie ihre prächtigen glockenförmigen, weissen Blüten. Jedes Jahr blieb er in dieser Nacht auf und übergoss sie, wie eine Geliebte, mit seiner Bewunderung. Einmal musste er jedoch während dieser Zeit verreisen. Obwohl ein Freund sie umsorgte, schien die Kaktee ihr Blühen hinauszuzögern, als warte sie auf ihren Liebhaber. Schliesslich fielen die wohlausgebildeten Knospen ungeöffnet ab. Erst ein Jahr später blühte sie erneut.
Dann gibt es Gärtner – und zwar diejenigen mit den allerschönsten Gärten –, die nach keinem Schema, keinem Gartenbuch arbeiten. Die Pflanzen selber sagen ihnen, wann sie Durst haben, wann sie ausgesät, ausgepflanzt oder gedüngt werden wollen. Einige Gärtner – wie Mrs. Wright aus dem bekannten Perelandra-Garten in Virginia – sind der Ansicht, dass es die mit den Pflanzen verbundenen Elementarwesen sind, die ihnen die Anweisungen geben. Andere glauben, dass sie mit ihren grünen Zöglingen in direktem telepathischem Kontakt stehen. Für sie steht ausser Zweifel, dass da etwas in jeder Pflanze steckt – eine «Seele», eine «Intelligenz», oder wie immer man es nennen will –, das klar und eindeutig Gedanken empfindet und auch ausstrahlt. Der oben erwähnte Cleve Backster gibt neuerdings Urlaubern den Rat, sie sollen einen Schnappschuss ihrer Lieblingspflanze mit auf die Reise nehmen und das Foto jeden Tag liebevoll betrachten, dann würden die Pflanzen gesünder bleiben.
Telepathische Erlebnisse mit Pflanzen werden immer häufiger und gelten immer weniger als absonderlich. Was einst nur im Rahmen geheimniskrämerischer theosophischer oder spiritistischer Séancen zur Sprache kam, ist für die Generation an der Schwelle zum «Wassermann-Zeitalter» kein Flüsterthema mehr. Die Mauern des materialistischen Weltbildes zeigen Risse. Es bröckelt und bröselt. Ein seltsames Heer «ätherischer» und «astraler» Geschöpfe schlüpft durch die Ritzen und besiedelt das Bewusstsein der Menschen.
Atlantis
Rudolf Steiner hatte es kommen sehen. Die Menschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, verkündete er, würden lockerer in ihrem physischen Leib inkarniert sein; sie würden zunehmend hellsichtiger werden. Und Edgar Cayce (1877–1945), der «schlafende Prophet» aus Tennessee, sagte für das Ende des Jahrhunderts das Wiederauftauchen von Atlantis voraus. Das Wiedererscheinen des versunkenen Kontinents muss nicht unbedingt als ein brachiales geophysikalisches Ereignis mit Erdbeben und Vulkanausbrüchen verstanden werden. Vielmehr könnte man es als die Wiederkehr eines längst versunkenen Bewusstseinszustandes interpretieren – eines Bewusstseinszustandes, in dem die feinstofflichen und «übersinnlichen» Wesenheiten, mit all ihrem Zauber und ihrer Magie, wieder «wirklich» werden.
Atlantis soll jene uralte Zeit gewesen sein, in der Zyklopen, Kentauren, Elfen, Nymphen und andere Sagengestalten die Welt so bevölkerten wie heutzutage Autos, Flugzeuge, Fernseher und Computer. Das Bewusstsein der Atlantier reichte, so heisst es, weit in die ätherischen und astralen Dimensionen hinein. So konnten sie mit Pflanzen- und Tierseelen Zwiesprache halten. Die Sprache, ja schon die Gedankenkraft der Atlantier war naturgewaltig: Sie konnte das Wachstum und die Gestalt der Gewächse beeinflussen. In Indien ist das Chanten bestimmter Mantras überliefert, welche das Wachsen und Blühen der Vegetation anzuregen vermögen – es sind die letzten Nachklänge altatlantischer Magie.
Es heisst, die Atlantier schwebten schwerelos, weil sie die Vrilkraft – jene Vitalenergie, welche die Pflanzen entgegen dem Sog der Schwerkraft nach oben wachsen lässt – handhaben konnten. Als dann Selbstsucht und der Missbrauch der Lebenskräfte die Seelen der Atlantier langsam vergifteten, verloren sie die Fähigkeit zu levitieren. Indem ihre Seelen immer tiefer hinab in die Materie sanken und sich zunehmend in einem Ego verpanzerten, verloren sie auch die Fähigkeit, die ätherischen Entitäten unmittelbar wahrzunehmen und mit ihnen umzugehen. Die Vegetation erschien vor den Augen der Menschheit allmählich immer mehr so, wie sie uns heute erscheint – als ein zwar hochorganisierter, im Grunde genommen aber unbeseelter Zustand der Materie. Mythen, Märchen und Sagen – Urerinnerungen an atlantische Bewusstseinszustände – gelten heute nur noch als Produkte der Phantasie oder eines überzogenen Intellekts.
Einige Esoteriker verlegen das mystische Atlantis in jene Zeit, als die Lebewesen noch im Wasser atmeten und der Menschenleib sich kaum von einer Qualle unterschied – eine Zeit, die dem Paläozoikum entspräche. Einem Kulturanthropologen liegt es näher, den Zeitraum, auf den der Atlantismythos hindeutet, in der alten Steinzeit anzusiedeln. Tief in Höhlen verborgene paläolithische Felsmalereien und die Jagd- und Sammelbräuche einiger Restvölker lassen vermuten, dass schon die Jägerstämme der Steinzeit mit den transphysischen «Gruppenseelen» der Tiergattungen kommunizierten, dass sie die «Tiermutter» oder den «Herrn der Tiere» anriefen. Diese übersinnlichen Hüter der Tiere erschienen den Schamanen in der Trance oder Vision und gaben den Jägern das Jagdwild als Beute frei. Das Gleiche galt für das Einsammeln von Heil- und Machtpflanzen. Wir werden noch sehen, wie sich traditionelle Kräuterrituale, die es dem Heiler und Pflanzenkundigen ermöglichen, sich mit den Geistern der Pflanzen zu verbinden, in solche zeitliche Tiefen zurückverfolgen lassen.
Aber schauen wir uns einmal bei den sogenannten «New Age»-Workshops und -Seminaren um. Da erwachen Hexen, Pflanzengeister, Elfen, Elementarwesen und andere «atlantische» Entitäten zu neuem Dasein. Es werden Rituale und magische Handlungen erprobt in der Hoffnung, mit ihnen wieder Kontakt aufnehmen zu können. Botschaften aus dem kollektiven Unterbewusstsein, aus der atlantischen Urerinnerung, aus den transphysischen Dimensionen werden angezapft, «gechannelt» und visualisiert: Sie erhalten erneut richtungweisende Bedeutung im Leben der Teilnehmer. All das beflügelt zunehmend die Massen und findet Niederschlag in künstlerischen Schöpfungen, Fantasy-Filmen und MTV-Musikproduktionen. Atlantis is rising! Wahrlich, der versunkene Kontinent erhebt sich wieder aus der Vergessenheit.
Inzwischen finden die Pflanzendevas wieder ihre Fürsprecher. Terence McKenna, Ethnobotaniker und Leiter der Stiftung Botanical Dimensions, ist einer von ihnen. In seinem botanischen Garten auf Hawaii versucht er die schamanistischen Heilpflanzen der schwindenden Tropenwälder zum Nutzen künftiger Generationen zu retten. Wir Menschen brauchen diese Pflanzen, um auf unserem Planeten zu überleben. Viele von ihnen sind psychoaktiv, sie bewirken den Aufbruch verhärteter, lebensfeindlicher Denkstrukturen. Das ist notwendig, denn unsere Technozivilisation gerät zunehmend in eine Sackgasse. Die Krise ist global. Für McKenna liegt die Antwort weniger in den Utopien eines New Age oder in den Institutionen der klassischen Zivilisationen als vielmehr in jenen drei bis vier Millionen Jahren, in denen der Mensch als das Erdengeschöpf, das er noch immer ist, geprägt wurde – nämlich in der globalen Urkultur der Jäger und Sammler der Steinzeit. In dieser Zeitspanne – die immerhin 97 Prozent des menschlichen Daseins auf diesem Planeten ausmacht – war das Verhältnis Mensch zu Mensch, Mensch zur Natur und Mensch zu den geistigen Wesenheiten offen, frei und unmittelbar. Es gab keine Behörden, Schulen, Geldinstitute, Versicherungen oder Konzerne, die sein Leben bestimmten. Der Frühmensch unterlag keinen institutionellen Zwängen, keiner Instrumentalisierung, keiner Entfremdung. Er war mit seiner Sippe, seinem Stamm in gegenseitiger Liebe verbunden und in der Spiritualität der Natur geborgen. Auch wenn wir nicht mehr als nomadisierende Wildbeuter leben können, spricht uns die hier zum Ausdruck gebrachte Gesinnung noch immer an. Sie entspricht unserer ureigensten Natur. Indianerromantik, der Traum von der einsamen Insel und die ungebrochene Faszination aller Formen des Schamanismus deuten dies an. Als archaic revival (Wiederbelebung der Urzeit) charakterisiert McKenna die aus übersinnlichen Dimensionen hereinbrandende Zeit der Heilung, Zeit der Re-ligio (der Wiederverbindung) und der Wiedererlangung unserer «atlantischen» Fähigkeiten (McKenna 1992).
Der Vorfrühling des archaic revival waren die sechziger Jahre. Plötzlich erschienen die Blumenkinder, die Botschafter der Devas. Junge Leute, ihre langen Locken mit Blumen geschmückt, empfingen Botschaften der Gewaltlosigkeit und Liebe. Sie tanzten, träumten, meditierten, pflanzten Gärten ohne Gift und Kunstdünger, verweigerten Kriegsdienst, praktizierten natürliche Geburt, heilten mit Kräutern – wahre Kinder der gütigen Wanengöttin, von der hier noch die Rede sein wird.
Vorboten einer neuen Zeit
An besonderen Orten, wie in Findhorn (Schottland) oder in Aigues Vertes (Schweiz), kamen die Botschaften des sich ankündigenden Zeitalters besonders stark zum Durchbruch (Storl 1992). Dort entstanden regelrechte Wundergärten, die selbst die kritischsten Beobachter in Staunen versetzten. Pflanzen von ausserordentlicher Vitalität, Riesengemüse und herrliche Blumen gediehen – und das an Orten, wo Boden und Klima denkbar ungünstig sind. Wer würde schon einen Garten in den von kalten Meereswinden gepeitschten, mageren Sanddünen an der nordschottischen Küste oder auf einem ausgewaschenen, steinigen Moränenboden im Rhonetal anlegen? Niemand mit normalem Menschenverstand und schon gar nicht jemand mit einem Diplom in Agrarwissenschaft! Aber es war eben kein Menschenverstand, der da am Werk war. In Findhorn hiess es, es seien die Pflanzendevas selbst, die die Anweisungen geben, und ein ganzes Heer kleiner Naturgeister helfe dabei.
In Aigues Vertes, einer therapeutischen Siedlung in der Nähe von Genf, stopften Gärtner zermahlene Bergkristalle und Rindermist in Kuhhörner, um den Heinzelmännchen Nahrung zu geben. Seltsame Präparate aus Brennesseln, Löwenzahn, Kamille und anderen in Tierorgane gehüllten Kräutern wurden dem Kompost eingeimpft, um die Kräfte der Planeten einzufangen. Fürwahr ein magischer Garten! Jeden Tag schwebte ein Bussard tief über die Äcker von Aigues Vertes hinweg, zog einige Kreise. Arthur, ein Gärtner aus Holland, der die Fähigkeit hatte, seinen Körper zu verlassen und mit dem Vogel zu schweben, sagte nur: «Eine Gottheit schaut uns zu!»
Ein begabter Gärtner bemalte die Innen- und Aussenwände des Gartenhauses mit bunten Bildern von Göttern, Göttinnen, Elfen und Zwergen, um den unsichtbaren Helfern sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Diese Gestalten, so glaubten die Mitarbeiter, stellen die realen Energien dar, die am Wandel der Jahreszeiten und am Wachstum der Vegetation beteiligt sind. Die Malereien waren derart animiert, dass es dem Christengemeinschaftspriester, der sich für das Seelenheil der Siedlung verantwortlich fühlte, recht unheimlich vorkam. Es war ihm alles zu heidnisch, zu luziferisch. Er vermisste das christliche Element! Er liess die Schweine als «unreine» Tiere vom Hof verbannen und veranlasste, dass die Gemälde weiss übertüncht wurden. Bald darauf jedoch schwand die Fruchtbarkeit, die Schnecken wurden zur Plage, und die Obstbäume und Beerensträucher wollten nicht mehr recht gedeihen. Der Garten verlor seine Ausstrahlung und warf auch keinen finanziellen Gewinn mehr ab.
Auch das Bild des heiligen Fiakrius, des Schutzpatrons der Gemüsebauer, ikonographisch korrekt als bärtiger, barfüssiger Mönch mit Buch und Spaten dargestellt, wurde von der Aussenwand entfernt. Bevor der Bildersturm ihn hinwegfegte, war es oft vorgekommen, dass die Gärtner beim Arbeiten Augen auf sich ruhen spürten. In der Annahme, es sei wieder einmal ein Kunde da, der biologisches Gemüse kaufen wollte, legten sie ihre Hacke oder ihren Rechen beiseite. Als sie aber aufschauten, mussten sie staunend zur Kenntnis nehmen: «Mon Dieu! Das ist ja wieder der Saint-Fiacre!»
Fiakrius war ein irisch-schottischer Mönch, der im 7. Jahrhundert in einem Waldstück nicht weit von Paris eine Einsiedelei errichtete. Die Legende berichtet, dass sich sein Garten von selbst bildete, als er die Erde mit seinem Stab berührte. So wurde er zu einem der vielen Gärtnerheiligen. Nach ihm wurden im 19. Jahrhundert die Fiaker (französisch fiacre), die Pferdedroschken, benannt, da sie vor der ihm geweihten Kirche zu St-Fiacre parkten. Sogar da noch, von diesem Parkplatz aus, strahlte der Heilige weiterhin seinen Segen auf die Gemüsegärtner aus. Die Pariser Marktgärtner holten sich nämlich den Pferdemist von den Droschkenständen und düngten damit ihre tief gelockerten Mischkulturbeete – daraus entstand die berühmte culture maraîchère, eine Intensivmethode, die im Vergleich die höchsten Erträge pro Flächeneinheit erzielt. Das zahlte sich aus, denn schliesslich waren die Grundstückpreise so nahe der Grossstadt extrem hoch.
Im heutigen Kalifornien erfreut sich die culture maraîchère, mit Steiners bio-dynamischer Anbauweise zur French Intensive Method verbunden, höchster Popularität und wird als Modell für überbevölkerte Drittweltländer empfohlen (Jeavons 1974).
Wir sehen also, längst verstorbene Heilige, Devas, Naturgeister, Elfen und andere ätherische Geschöpfe, die mit den Pflanzen in Beziehung stehen, machen von sich reden. In manchen Köpfen richten sie ein regelrechtes Chaos an. Wenige haben die Fähigkeit, in diesen Bereichen klar zu sehen. Dies ist auch zu erwarten, denn diese Wesen offenbaren sich vor allem im Spiegel der Seele. Und dieser Spiegel muss lauter sein, wenn man die «Übersinnlichen» sehen will.
In den folgenden Kapiteln werden wir versuchen, etwas mehr Klarheit zu schaffen. Dabei berufe ich mich auf die Aussagen der Sagen und Mythen, auf die Überlieferungen der Naturvölker, wie sie die Ethnographie aufzeichnet, auf die Angaben solcher Seher wie Rudolf Steiner oder Dorothy Maclean aus Findhorn und auf die eigenen Erfahrungen und Beobachtungen, die ich als Gärtner und als ethnologischer Feldforscher machte. Zuerst aber wollen wir uns einmal vor Augen führen, was die Pflanzenwelt für uns als Menschen bedeutet.
NAHRUNG AUS DEM KOSMOS
Photosynthese ist der Fachausdruck für den überaus komplizierten Vorgang, der es den Pflanzen ermöglicht, ein weites Spektrum der einströmenden kosmischen, elektromagnetischen Energie – das Licht der Sonne – zu nutzen. Das grüne Chlorophyll fängt Lichtquanten auf und erlangt dadurch einen derart energetisierten Zustand, dass Wassermoleküle gespalten werden. Dabei wird der Sauerstoff, der allen Lebewesen das Leben schenkt, an die Atmosphäre abgegeben. In einer zweiten Reaktion, ebenfalls im grünen Blatt, wird Kohlendioxid (CO2) zu Zucker und Stärke synthetisiert. Die Zuckerherstellung im Grün der Pflanze ist Grundlage aller Stoffsynthesen, die in den Lebewesen stattfinden. Durch Photosynthese werden jährlich 100 bis 200 Milliarden Tonnen organische Materie aufgebaut.
Was die Wissenschaftler nun als rein materielles Geschehen auffassen, als höchst komplizierte Interaktionen von Photonen (Lichteinheiten) und Molekülen (H2O, Chlorophyll, ATP, CO2), sahen die alten Inder – weniger auf der Grundlage des Experiments als jener der Meditation – als ein gewaltiges kosmisches Drama. Die verschiedenen Seinsformen galten ihnen als Stationen zur Aufnahme und Weitergabe von Kräften. Jedes Wesen existiert – so sagen es die Upanischaden –, um ernährt zu werden und um andere zu ernähren.1 Die Pflanzen «verspeisen» sozusagen kosmische und stellare Energien. Ihre grünen Blätter saugen die im einströmenden Licht verborgenen Lebenskräfte auf, speichern sie in ihren Geweben und geben sie, indem sie sich selber verspeisen lassen, an andere Geschöpfe weiter.
Pflanzen, so meinen die Inder, sind eigentlich Meditanten im tiefen Samadhi, in vollkommener Ekstase. Unbewegt, ganz dem Himmel hingegeben, meditieren sie den schöpferischen Urton – das Om –, den die Sonne ohne Unterlass hervorbringt und herabstrahlt.2
Pflanzen vermitteln uns das in Licht gehüllte Ur-Mantra des Universums und schenken uns somit das Leben. Nur sie vermögen auf diese Weise, das Jenseits mit dem Diesseits zu verbinden. In der heiligen Sprache der Veden werden Pflanzen als Osadhi (Ausadhi) bezeichnet. Das Wort ist zusammengesetzt aus Osa (= brennende Umwandlung) und Dhi (= Gefäss). In diesem Sinn gelten die Pflanzen als Gefässe zur Metamorphose des kosmischen Feuers. (Lad/Frawley 1988: 22) Dieses Feuer, diese Liebesstrahlung des Himmels, wird mittels der Alchemie des Blattgrüns in das diesseitige Leben umgewandelt. Wenn Tiere ihren Hunger an den Blättern, Stengeln, Samen oder Knollen stillen, dann werden – in einer weiteren alchemistischen Verwandlungsstufe – die kosmischen Licht- und Wärmequanten in Gefühle (innere Wärme) und in Bewusstseinsregungen (inneres Licht) umgewandelt. Auch wir Menschen erhalten unsere Wärme und geistiges Licht aus dieser Quelle. Unsere Gefühle, Gedanken und Träume sind es, die wiederum den Engeln und Ahnengeistern oder auch den Dämonen als «feinstoffliche» Nahrung dienen. Da wir ihre Nahrungsspender sind, behüten und beschützen uns diese Geistwesen, ebenso wie ein Hirte oder Bauer sein Vieh hegt. Wir können aber auch einen Schritt weiter gehen. Einen Schritt, der es uns erlaubt, nicht nur «dummes Vieh» für die Transsinnlichen zu sein, sondern ihre Partner. Wir können die durch uns fliessende Lichtenergie auf ein höheres spirituelles Niveau bringen, wir können uns des Bewusstseins bewusst werden und bewusst mit den geistigen Wesenheiten, auch den Pflanzendevas, verkehren.
Die im Obst, Korn und Gemüse gespeicherte kosmische Energie wird durch das Zerkauen und die Einwirkung der Verdauungssäfte wieder freigesetzt und die darin enthaltenen Sternenbotschaften vom Organismus entschlüsselt. Genau genommen handelt es sich dabei um einen Verbrennungsprozess – die Umkehrung der Lichtassimilation, die in jedem grünen Pflanzenteil stattfindet. Wie bei jedem Verbrennungsvorgang wird Hitze (Kalorien) erzeugt, während ein Teil als «Asche» (Kot) ausgeschieden wird. Die im Darm freigesetzte Energie durchstrahlt den Körper und befeuert sämtliche Lebensvorgänge. Dem Sexus steht eine beträchtliche Menge dieser frisch erschlossenen Energie zur Verfügung. Es ist kein Zufall, dass sich die Fortpflanzungsorgane unmittelbar neben den Verdauungsorganen befinden! (Scheffer/Storl 1994: 48) Ein weiteres Energiequantum überflutet das vitale Zentrum des Sonnengeflechts (Solarplexus), den Sitz des Willens und des Selbsterhaltungstriebes.
Der Grossteil der verfügbaren Energie verbraucht sich also in den vitalen, animalischen Funktionen, in den Tätigkeiten, die unser Überleben und unsere Fortpflanzung sichern. Bei den Tieren und den meisten Menschen ist diese Energie dann praktisch erschöpft. Bei geistig weiter fortgeschrittenen Individuen steigen grosse Mengen dieser Energie weiter nach oben und verwandeln sich schrittweise in seelische und geistige Fähigkeiten.
Die Schlangenkraft
In der indischen Yogalehre wird dieser Vorgang als der Aufstieg der Kundalini-Schlangenkraft beschrieben. Die Kundalini symbolisiert die Summe der Lebenskraft. Einer Schlingpflanze gleich windet sich die Schlange dem Rückgrat entlang empor, vom untersten Lebenszentrum (Sexualorgane und After) bis hinauf zum obersten (Hirn). Zuerst ist die Kundalini träge, dumpf, dunkel und massiv. Beim allmählichen Aufstieg wird sie jedoch immer leichter, heller und feiner. Wie Lotosblüten, wenn sie von der Morgensonne wachgeküsst werden, blühen die Chakras auf, wenn sie von diesem Energiestrom erfasst werden. So gesehen ist der Mensch in seiner Entwicklung auch eine Pflanze, aber eine stark verwandelte, nach innen gestülpte mikrokosmische Pflanze.
Chakras, der Weg der Kundalini
Steigt die vom Lebensgrün vermittelte Sonnenkraft über die niederen Lebenszentren hinaus, also über die Geschlechtsorgane und den Bauch, bis in die Herzregion, blühen Mitgefühl und wahre Imaginationskraft auf. Steigt sie noch höher, bis in die Kehlkopfregion, dann vernimmt der Mensch das Tönen der Sonne, das mystische Om. Erreicht die Schlange die Stirnchakra, wird der Mensch alle illusionären Gegensätze überwinden und zur Gotteswahrnehmung befähigt. Er erkennt, dass das Licht des Himmels, welches ihm – durch die Pflanzen – das Leben schenkt und seinen Geist befeuert, nichts anderes ist als die Liebe Gottes. Er erkennt das Selbst, das in allen Dingen west und das man als Gott, als Shiva, den Gütigen, den Gnädigen bezeichnet hat. Es ist dasselbe Wesen, welches in Indien auch als Ausadhishvara, «Herr der Pflanzen», angerufen wird. Man erkennt, dass es seine Energie, seine Shakti, ist, die das Universum als Licht, Leben und Liebe durchströmt. (Storl 1988: 176)
Erreicht und durchbricht nun die aufsteigende Schlangenkraft die Schädeldecke, dann wird eine Lichtaura aufleuchten, wie sie auf den Ikonen als der «Heiligenschein» der Engel und Heiligen angedeutet wird. Wenn das geschieht, schliesst sich der Kreis: Das Lebenslicht vereinigt sich wieder mit seinem Ursprung. Gott und das wahre Selbst werden als ein und dasselbe erfahren. «Erleuchtung» heisst das oder Nirvana, das «Auslöschen des Wahns».
Dieses «Explodieren» der Schädeldecke bedeutet das Ende unserer Ego-Besessenheit, es ist das Aufsprengen der Grabesgruft und die Auferstehung unseres geistigen Selbst. Dieser Vorgang gleicht dem Aufsprengen der Samenhülle, welches der Pflanze erlaubt, sich erneut mit dem nährenden kosmischen Licht zu verbinden, zu wachsen, zu blühen und vielfältig Frucht zu tragen.
Wir sehen, die Pflanzen erhalten nicht nur unseren Leib. Sie fördern und nähren auch unsere Seele und ermöglichen die Erleuchtung unseres Geistes. Ihr Dasein ist Darbringung, ist Opfer und selbstlose Liebe. Die Erde, auf der sie wachsen, ist selber Opferaltar – und wir, die wir ihren Segen empfangen, sind die Opferpriester. Durch Pflanzen wird das äussere Licht der Sonne und der Sterne zum inneren Licht, das uns aus unseren Seelengründen entgegenstrahlt. Dies ist der Grund, weshalb Pflanzen immer und überall als heilig, als göttlich galten.
1 Aus Speise entstehen die Geschöpfe, die auf der Erde wohnen; sie leben durch die Speise und gehen schliesslich in Speise ein.» Anandavalli Upanishad, zit. aus: Upanischaden: Die Geheimlehre der Inder. Eugen Diederichs. München. 1988. S. 133
2 Die Erkenntnis, dass die Sonne «tönt» und dass unser geistiges Ohr wunderbare Harmonien vom Sternenkosmos her vernehmen kann, ist uns heute weitgehend fremd geworden. Unsere geschäftige Welt mit ihrem ständigen Motorengesumm, Rundfunkgeschnatter und Fernsehgeplärre hat kein Ohr mehr dafür. Aber noch der Dichterfürst lässt seine Sonne «nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang» ertönen (Goethe, Faust, «Prolog im Himmel»). Die Weisen der Antike ebenso wie die Alchemisten und Rosenkreuzer sprachen wie selbstverständlich von hörbaren Harmonien der Sphären. Gemeint waren jene Sphären, die durch die Bahnen der Sonne, des Mondes und der Planeten umschrieben sind. Diese Sphären galten auch als «Wohnorte» der Geistseelen der einzelnen Pflanzenarten.
DEVI: GÖTTIN DER VEGETATION
Einst, lange bevor dieses dunkle Zeitalter anbrach, meditierten in den einsamen Bergwäldern des Himalaya die weisen Rishis. Vor ihrem seherischen Auge erschien die unerschöpfliche Kraft, die die Pflanzen aus dem Äther saugen und die die gesamte Natur ebenso wie den menschlichen Mikrokosmos durchpulst, im Bild einer grossen Göttin. Diese Erhabene, die sich ihnen in der Versenkung ihres Geistes offenbarte, überhäuften die Seher mit zahllosen Namen, denn unendlich sind ihre Erscheinungsformen, unbegrenzt ihre Wandlungsfähigkeit. Als Shakti (Energie), als Gauri (die Goldstrahlende), als Uma (Licht), als Jagamata (Mutter der Welt) oder als Parvati (Bergfrau) riefen sie sie an. In ihrer energetischen, furchterregenden Erscheinung ist sie die löwenreitende, dämonenvernichtende Durga (die Unnahbare), Chandi (die Wilde) oder auch Bhairavi (die Schreckliche). Meistens aber wird sie schlicht als Devi, «die strahlende Göttliche», verehrt.
Die lotosgeborene Devi
Devi ist die ewige Begleiterin Gottes. Sie ist Shivas weiblicher, schöpferischer Aspekt. Sie ist selber die Kundalini. In ihrer Urform erscheint sie dem unerschrockenen Seher als ein sich ständig verwandelndes, schillerndes, schreckeneinflössendes Reptil. Allmählich, indem sie sich den höheren Chakren nähert, metamorphosiert die Kundalini in eine hehre, strahlende Göttin, die sich schliesslich im Hierogamos mit Shiva vereint.
Die Seher beschreiben Devi als den Wirbelsturm der Elemente, Shiva als stilles Auge mitten im Sturm. Sie ist der Reigen der Sterne, er der unbewegte Nordstern. Sie ist die unversiegbare treibende Kraft der Vegetation, er die starre Kälte des Winters oder auch die Hitze und Dürre der Wüste, die dem Wachstum ein Ende setzen. Sie ist das Erwachen und Keimen der Samen in feuchter, dunkler Erde, das Sprossen und Spriessen, er das farbig auflodernde Blütenfeuer, das Verstäuben, Verwelken und Versamen der Vegetation. Sie ist Leben, er der Tod.
Shiva ist Stein, Phallus; Devi ist Pflanze, offene Blüte. Und so einfach als Stein und Blüte, als Fels und Baum wurden sie seit dem Paläolithikum verehrt. Hier und da werden sie noch immer in dieser Form angebetet. Oft sieht es der Tourist gar nicht: den Stein, auf den eine schöne Blüte gelegt wurde, oder den mit Wasser liebevoll übergossenen Findling unter einem alten Baumriesen. Höchstens der fachkundige Ethnologe wird da seine Kamera zücken, um ein weiteres Indiz für einen indigenen «Fruchtbarkeitskult» festzuhalten. Und da hat er gar nicht so unrecht, denn das Zusammenbringen von Devi und Shiva, von Energie und Bewusstsein, von Linga und Yoni, lässt alle Geschöpfe glücklich werden und gedeihen – davon sind die Inder überzeugt.
Shiva-Linga mit Blüte
Devi ist die Herrin der Devas, der «Leuchtenden», der Himmlischen. Sie ist folglich auch die Göttin der Pflanzendevas, jener Urbilder, die sich in den einzelnen Arten und Gattungen irdischer Gewächse offenbaren. In der alten Schrift Devi-Mahatmya gibt sie sich als Herrin der Vegetation zu erkennen: «Also, ihr Götter, werde ich das ganze Universum mit diesen Pflanzen erhalten, Pflanzen, die das Leben nähren und die während der Regenzeit meinem Leib entspriessen. Ich werde als Sakambhari (Ernährerin der Gewächse) herrlich sein auf Erden und werde in dieser Zeit den Asura (Dämon) der Trockenheit zerstören!» (Eliade 1963: 280)
Eine Geschichte aus der Kenopanishad führt uns die Macht Devis vor Augen. Einmal wieder hatten die Devas (Götter) die Asuras (Dämonen) geschlagen, und zwar so vernichtend, dass ihr Stolz ins Unermessliche wuchs. «Unsere Tüchtigkeit ist nicht zu übertreffen!» rühmten sie sich selber und hielten sich für die Herren der Schöpfung. Da erschien ein Yaksha, ein Naturgeist von der Art, wie sie alte Bäume, Wälder oder Seen bevölkern. Nur war dieser von einem derartigen Ausmass, dass man weder seinen Anfang noch sein Ende ausmachen konnte. Die erschrockenen Devas schickten Agni, den Feuergott, um herauszufinden, wer dieser Geist sei.
«Ich bin der weise Agni», versuchte er den Yaksha einzuschüchtern, «ich habe die Macht, die ganze Welt in einem Augenzwinkern zu Asche zu verbrennen!»
«Nun gut», antwortete der Yaksha, «hier ist ein dürrer Grashalm, versuche ihn niederzubrennen!»
Wie er sich auch anstrengte, sein feuriger Hauch konnte das Gräslein nicht einmal ansengen. Beschämt schlich sich der stolze Agni von dannen. Nun schickten die Götter den mächtigen Windgott Vayu.
«Und wer bist du?» fragte ihn das unbekannte Wesen.
«Ich bin der Windgott, der die Wolken treibt. Ich habe die Macht, die gesamte Schöpfung in einem Augenblick wie Spreu in der Worfel hinwegzublasen!»
«Gut, dann blase diesen Grashalm fort!»
Vayu blies und blies, bis ihn die Pausbacken schmerzten. Nicht einen Zoll vermochte er das Gräslein fortzubewegen.
Zuletzt kam Indra, der Götterkönig und Blitzkeilträger selbst. Aber da verschwand der Naturgeist, und Devi stand da an seiner Stelle.
«Weisst du nicht, lieber Donnerer», lachte sie, «es ist die Macht der göttlichen Mutter und nicht die der Götter selber, die euch Göttern den Sieg schenkte. Shakti allein ist die Quelle aller Macht im Universum!» (Sivananda 1984: 80)
Die Geschichte will besagen, dass das Feuer, die Luft und alle übrigen Elemente im Dienste der Göttin stehen, auch im Dienste der Vegetation, in der sie sich offenbart.
Devi zu Ehren werden – vor allem in Nordindien – noch heute zwei zehntägige Feste, die sogenannten «neun Nächte» (Navratri), gefeiert. Das eine ist ein Frühlingsfest, und das andere findet im Herbst statt, wenn die Sommerernte eingebracht ist. In jeder Festnacht wird ein anderer Aspekt der Göttin zelebriert. Oft wird sie in den ersten drei Nächten als Durga, die goldhäutige, löwenreitende Dämonentöterin verehrt; in den nächsten drei Nächten als Lakshmi, Spenderin des Glücks und des Wohlstandes, und in den letzten drei Nächten als die weisse Schwanenjungfrau Saraswati, die Muse aller Künstler, Gelehrten und Heiler. Am zehnten Tag dann nimmt die Göttin von den Menschen Abschied. Im feierlichen Festzug wird ihre kunstvoll gestaltete, mit Blumengirlanden überhäufte Statue, in der sie während des Festes anwesend ist, durch das Dorf getragen, um anschliessend im Fluss oder im See versenkt zu werden. Die buntbemalte Gipsfigur löst sich im Wasser auf, derweil die Göttin selber in den Himmel, ins Jenseits zurückkehrt. Dort wird sie sich – sichtbar nur den benedeiten Sehern – auf dem heiligen Berg Kailash in inniger Liebe mit Shiva vereinen.
Ein Teil des aufwendigen Festes ist das Ritual der «Neun Blätter» (Navapatrika). Es ist ein Frauenritual, bei dem ein Bündel von neun wichtigen Heilpflanzen der Göttin geweiht wird. Diese neun Kräuter repräsentieren Devi und die gesamte Pflanzenwelt. Hier wie überall in Eurasien gilt die Neun – dreimal die heilige Drei – als Zahl der Vollkommenheit, der Ganzheit.
Die Kräuter, welche die indischen Frauen für ihr Bündel wählen, sind je nach Region hier und da verschieden. Alle aber sind reich an symbolischer und mythologischer Bedeutung, alle sind heilkräftig und verleihen den Sorgen und Hoffnungen der Frauen adäquaten Ausdruck. Hier nun einige der wichtigsten dieser Pflanzen:
Haridra, die Gelbwurz (Curcuma longa), die wir als Hauptbestandteil des Curry-Gewürzes kennen, ist immer mit dabei. Das Ingwergewächs, dessen Wurzel so gelb ist wie Durgas Haut, ist ein gutes Wundheilmittel und Verdauungstonikum. Gelbwurz vermittelt die Energie der Göttin und mehrt den Wohlstand. Die ayurvedische Heilkunde verschreibt sie zur Reinigung der Chakras und der subtilen Energiebahnen im Körper.
Auch Jayanti (Abutilon indicum), ein gelbblühendes, schleimhaltiges Malvengewächs, welches als Sexualtonikum und bei Weissfluss der Frauen verwendet wird, sollte nicht fehlen, denn es verleiht den Sieg (Jaya) der Göttin.
Einige Blätter des Bel-Baumes (Aegle marmelos) gehören ebenfalls in das Büschel. Die Pflanze, ein Rautengewächs wie die Zitrone oder Apfelsine, hat manchen Reisenden von den Qualen des Durchfalls oder der Ruhr gerettet. Shiva liebt den Baum, denn das dreiteilige Blatt kühlt sein heisses Zeugungsorgan – deswegen legen es seine Verehrer liebevoll auf das Shiva-Linga. Die orangengrossen Früchte gelten als die Brüste der Glücksgöttin oder auch als die Hoden des grossen Gottes. Frauen, die diesen Baum verehren und seine Blätter in das Kräuterbündel nehmen, können gewiss sein, von ihren Ehemännern liebevoll und gut behandelt zu werden.
Ein Zweiglein des im Frühling feurig-orange aufblühenden Ashoka-Baumes (Saraca indica) darf ebenfalls nicht fehlen, denn er ist dem Liebesgott Kama geweiht und erfüllt den Kinderwunsch. Die Zweigrinde dient als Mittel bei übermässiger Monatsblutung und zur Entspannung der Gebärmutter. Als Sita – sie ist das Idealbild der indischen Frau – sich auf ihrer Flucht vor Verfolgern unter diesem schönen Baum ausruhte, blühte er zum ersten Mal. Nach buddhistischer Legende wurde der Erleuchtete (Buddha) unter einem blühenden Ashoka-Baum geboren.
Der Koriander (Dhanya, Coriandrum sativum), in Indien ein Küchengewürz des täglichen Gebrauchs – wie die Petersilie bei uns – gehört ebenfalls in das Bündel. Das Gartenkraut ist ein gutes Hausmittel bei Störungen der Verdauung und Harnorgane. Die Samen des Schirmblütlers gelten als Liebesmittel.
Schliesslich werden noch einige Getreidehalme – sie gelten als lebensspendend – und rotblühende Blumen mit in das Frauenbündel aufgenommen. Die roten Blüten gelten als glücksverheissend. Sie erinnern an die rothäutige Glücksgöttin Lakshmi oder auch die durch den Kampf mit den Dämonen blutrot gefärbten Zähne der Durga.
MARIAS KRÄUTERWISCH
Nun mögen uns die neun Nächte der Göttin im Frühling und im Herbst recht fremdartig vorkommen. Doch in einigen Ecken Europas, in denen der eiserne Besen der Inquisition, Reformation und Aufklärung nicht so sauber fegte, hat sich uraltes, wahrscheinlich bis ins Neolithikum zurückreichendes Brauchtum unter dem Deckmantel der Marienverehrung bis in die Neuzeit erhalten. Auch wir kannten einst die «Neun Kräuter», die «Grüne Neune», die Fruchtbarkeit und Gedeihen bringen und alles Übel fernhalten.
In den Alpenländern ist es nicht Devi, die im Herbst nach eingebrachter Ernte in den Himmel fährt, sondern Maria, die Gottesmutter und Gottesbraut. Zu Mariä Himmelfahrt im August sammeln meine Nachbarinnen, die Allgäuer Landfrauen, noch immer ihren «Kräuterwisch» und lassen ihn am Altar «Marias Tod» segnen. Der Kräuterwisch – anderswo Würzbüschel, Weihbüschel, Sang oder in der Schweiz August-Maien genannt – sollte aus neun, gelegentlich auch sieben oder gar 77 Heilpflanzen bestehen. Früh am Morgen, noch vor Sonnenaufgang und ohne Messer sollten sie von Hand gepflückt werden. Wie die Pflanzen ihrer indischen Schwestern sind auch die Kräuter der Allgäuerinnen höchst symbolträchtig. Jeder Kräuterwisch spricht mythologische Bände und legt eine archaische Weltsicht offen.
Meistens wird der Kräuterwisch um eine blühende Königskerze (Verbascum) in der Mitte gruppiert: Der stolze Rachenblütler gilt als Zepter der Mutter Gottes. Wunden und Geschwüre würden sofort heilen, heisst es, wenn man sie mit dem ährenartigen gelben Blütenstand berührt und dabei den Segensspruch spricht: «Unsere Liebe Frau geht über Land / Und hat den Himmelsbrand in ihrer Hand!»
Viele sogenannte Frauenheilkräuter gehören mit in das Büschel. Etwa die Schafgarbe (Achillea), die einst eine wichtige Rolle in der weiblichen Hygiene spielte und mit der Liebesorakel erstellt wurden. Mit dem richtigen Spruch unter das Kissen gelegt, lässt ein Schafgarbenstengel sogar den Liebsten im Traum erscheinen.3 Auch der Beifuss (Artemisia vulgaris), der einst der wilden Waldgöttin Artemis geweiht war, ist mit dabei: Er erwärmt den Unterleib, regt die Mensis an und beschleunigt das Austreiben der Nachgeburt. Auch einige aphrodisische Kräuter, wie etwa das Liebstöckel (Levisticum), gehören mit in den Strauss.
Die grösseren Kräuter in der Mitte des Bündels werden von einem Kranz bescheidenerer Blümchen umwunden: von der bei Müttern und Kindern allzeit beliebten Kamille, vom duftenden Thymian und vom zierlichen Labkraut. Das Labkraut (Galium), ein harntreibendes Heilmittel, wird auch «Marias Bettstroh» genannt, weil das Christkind angeblich darauf gebettet wurde und weil es noch immer ins Kräuterkissen der Wöchnerinnen kommt.
Zu Anfang der christlichen Missionierung war die Kirche dem «heidnischen» Pflanzenbrauchtum gar nicht wohl gesonnen, schliesslich waren die heidnischen Schamanen und weisen Frauen die ärgsten Widersacher des neuen Glaubens. Die um 745 n. Chr. unter dem Vorsitz des Bonifatius einberufene Synode von Liftinae erstellte eine Liste des zu bekämpfenden heidnischen Aberglaubens (Indiculus superstitionum et paganiarum) und legte die Strafen fest. Verboten wurde die Verehrung der Bäume – Bonifatius, der «Apostel der Deutschen», hatte selber die Donar-Eiche gefällt. Verboten wurde das Sammeln des «petendo, gemeinhin St. Marienbündel genannt». Was da als Sankt-Marien-Bündel erwähnt wird, ist entweder eine Verballhornung des Wortes «Maienbündel» – als Maien bezeichneten die germanischen Heiden die grüne Lebensrute –, oder es ist das aus bewusstseinsverändernden und heilkräftigen Pflanzen bestehende «Bündel der Freya».
Aber wie sich die Zeiten ändern! Der verpönte «Hexenbesen» der Liebesgattin Freya wurde alsbald – von verdächtigen Giftgewächsen gereinigt – unter die Obhut der Maria gestellt. Nun erteilt die Kirche selber den Segensspruch im Namen des Dominus sanctus, besprengt die blühenden Kräuter mit Weihwasser und lässt verkünden, sie stellten jene süssduftenden Blumen dar, welche die Jünger im Grabe Marias anstelle des Leichnams vorfanden. Auch den heiligen Bäumen, nun mit Marienbildnissen versehen, wird wieder geopfert: Blumen, Kerzen und Votivtafeln.
Dennoch muss der Dorfpfarrer bei der Würzweih gelegentlich ein Auge zudrücken, wenn ein Mütterlein ein recht unchristliches Kraut, etwa den Bilsen oder den Stechapfel, mitsegnen lässt oder wenn sich die Anwendung der Kräuter kaum vom krassesten Aberglauben unterscheiden lässt. Gegen Hexerei, Feuersbrunst und Hagelschlag kommt der Büschel unter den Dachfirst oder in den Stall. Einige Zweiglein, unter dem Bett versteckt, verhelfen den Eheleuten zum glücklichen Beischlaf. Dem Saatgetreide wird davon beigemischt, und auch den Toten wird etwas vom gesegneten Bündel mit in den Sarg gelegt. Im bayrisch-österreichischen Raum wird hier und da noch während der Rauhnächte mit den Marienkräutern geräuchert, um Krankheiten und Unholde zu vertreiben.
Das Maria-Himmelsfahrts-Fest ist der Auftakt zur wichtigsten Kräutersammelzeit des Jahres. Es ist die Zeit der Frauendreissiger, jener «dreissig» Tage zwischen der Himmelfahrt (15. August) und der Geburt (8. September) der Gottesmutter. Heilpflanzen, die während dieser Zeitspanne gesammelt werden, übertreffen alle anderen Kräuter an Kraft – mit Ausnahme der Johanniskräuter, die zur Sommersonnenwende gepflückt werden. Wer zum Beispiel das Immergrün (Vinca minor) während der Frauendreissiger pflückt, über den hat der Teufel keine Gewalt mehr.4
Vielerorts gilt der Tag nach Mariä Geburt als geeignet für die Aussaat des Winterkorns. Jedenfalls mischte der Bauer an diesem Tag gesegnete Saatkörner unter das Saatgut, auch wenn die Aussaat später vorgenommen wurde.
Palm und Maibaum
Wie in Indien stehen dem herbstlichen Kräuterfest Frühlingsvegetationsfeste gegenüber. Da ist zuerst der Tag der Verkündigung Marias (25. März), wenn die Jungfrau den Samen des Heiligen Geistes empfängt wie die Erdscholle die Weizensaat. Vielerorts werden an diesem Tag die Sämereien für Feld und Garten gesegnet und Kohl und Lein ausgesät. Da dann das Frühlingsäquinoktium überschritten ist und die Tage endlich länger werden als die Nächte, wandelt sie wie einst die Frühlingsgöttin Ostara als Lichtgöttin über das Land. Wo immer ihr Fuss den Boden berührt – so die Volksimagination –, da grünt das Gras, und die schönsten Blumen spriessen hervor. Auch in Indien erscheint die junge Göttin zu dieser Zeit in der Gestalt der weissgewandeten Schwanengöttin Sarasvati.
In der Karwoche, die in diese Zeit fällt, wird die Neunkräutersuppe oder die Gründonnerstagssuppe gekocht. In den Topf kommen Brennesseln, Sauerampfer, Bärlauch, Taubnesseln, Giersch, Pimpernelle, Gundermann und anderes frisches Grünzeug, je nach Gegend und Tradition. Auch dieser christliche Brauch hat alte heidnische Wurzeln. Die verschiedenen indoeuropäischen Stämme nahmen nach den langen trüben Wintertagen die ersten grünen Kräuter als Kultspeise zu sich. Die Göttin, die da über das Land zog, kehrte dadurch auch in den Leib der Menschen ein und liess sie an ihrer vitalisierenden Lebenskraft teilhaben. Aphrodisierende und berauschende Kräuter waren einst auch mit dabei. Von der Gründonnerstagssuppe, die das Ende der vitaminarmen Winterkost signalisiert, heisst es noch immer, sie «reinige das Blut», mache «negenstark» (neunmal stark) und verjünge den Organismus. Tatsächlich vertreiben die Frühjahrskräuter, als Salat oder Wildgemüse genossen, die Frühjahrsmüdigkeit und bringen die Anzeichen eines subklinischen Skorbuts zum Abklingen.
Bald folgt Ostern, das Fest des Sterbens und der Auferstehung des Mariensohnes. Auch wenn dies heute nicht mehr im Vordergrund steht, ist auch das noch immer ein Fest der Vegetation. Für die Palmsonntagsprozession, die an den Einzug des Heilands in Jerusalem erinnern soll, binden meine Allgäuer Nachbarn den Palm. Das Gebinde besteht ebenfalls aus neun verschiedenen Pflanzen. Zweiglein der Eibe, des Buchs, der Buche, Thuja, Fichte, Weisstanne und Weide werden auf einem Kreuz aus Holunderzweigen befestigt und dann auf einen Haselnussstock erhöht. Die Holunderzweige müssen geschält werden, es könnte sich ja eine Hexe zwischen Rinde und Holz verstecken. Der Holunder ist schliesslich der Baum der Frau Holle, der Hexengöttin.
Die Bäuerinnen glauben, jeder Zweig stehe für eine der christlichen Tugenden. So hat es ihnen der Pfarrer gesagt. Sie stellen den geweihten Palm in den Herrgottswinkel, um Haus und Stall mit Gesundheit und Wohlergehen zu segnen und um Blitzschlag abzuwehren.
Beim näheren Betrachten erkennen wir, dass es sich beim Palm vor allem um Friedhofsgewächse handelt. Jede einzelne ist eine altüberlieferte Sakralpflanze, die schon in vorchristlicher Zeit Trauer, Leid und das Mysterium von Tod und Wiedergeburt symbolisierte. In mediterranen, keltischen und germanischen Kulten waren sie der samen- und seelenhütenden Erdgöttin, der schwarzen Todesgöttin, geweiht. Die Zweige raunen von längst vergessenen neolithischen Ritualen. Sie erzählen von erschreckend grausamen Opferkulten der ersten sesshaften, ackerbauenden Stämme. Diese gaben der Erd- und Pflanzengöttin einen Gefährten und Begatter mit, indem sie periodisch ihren König, Jünglinge, Stiere oder andere potente männliche Tiere opferten. Das vergossene Blut, welches die Erdscholle gierig aufsog, galt zugleich als Entschädigung für die eingebrachte Ernte und Garant künftiger Fruchtbarkeit. (Der Glaube, dass der in der Karwoche bestellte Garten besonders fruchtbar und schädlingsfrei sei, geht auf diesen kultischen Ursprung zurück: Am Karfreitag tränkte und befruchtete das Gottesblut die Erde.) Eine weinende Göttin, eine Mater dolorosa oder Pieta gehörte schon damals zum sakralen Schauspiel.
Der Opfertod war nur ein Teil des alten Fruchtbarkeitsfestes. Tod und Zeugung, Leiden und Lust, Sterben und Wiedergeburt gehören als Gegensatzpaar zueinander. Sexuelle Ausgelassenheit, Orgien unter freiem Himmel, auf frisch gepflügten Äckern, unter den Ästen heiliger Bäume oder neben aufgestellten hölzernen Phallen und Vulven, waren überall – von Melanesien über das megalithische Europa bis nach Amerika – Teil des Rituals des Säens und Pflanzens. Alle Konventionen und sittlichen Normen wurden während dieser wilden Tage suspendiert. Das vergossene Blut war zwar Sühne, stellte aber zugleich das Blut der Jungfrau Erde dar, deren Jungfernhaut im heiligen Koitus des Hackens, Pflügens und Einsäens aufgerissen wird. Zugleich symbolisierte die gerötete, feuchte Scholle die Menstruation der Göttin – ein Zeichen ihrer Empfänglichkeit und Fruchtbarkeit.
Wir dürfen aber nicht glauben, dass es sich bei diesen archaischen Fruchtbarkeitsriten lediglich um bunte Symbolik handelt. Geschlechtsverkehr auf frisch gesäten Feldern und blutige Opfer haben eine ganz reale Wirkung auf das Wachstum der Pflanzen. Es werden subtile Bioenergien generiert, ätherische Kräfte freigesetzt – die Orgon-Energie Wilhelm Reichs oder die vis animalis der Alchemisten. Neuere Experimente bestätigen das. So etwa Cleve Backster, der führende Pionier auf diesem Gebiet: «In aktiven Schlafzimmern finden Sie niemals kranke Pflanzen. Auf Sex reagieren sie sehr stark, auf alle Fortpflanzungsaktivitäten stimmen sie sich besonders ein.» (Kerner/Kerner 1992: 59) Backster kam darauf, weil sich sein Labor zufällig neben einem Seemannsbordell befand. Zuerst dachte er, seine Pflanzen spielten verrückt, bis er dann merkte, dass die Polygraphen, an die die Pflanzen angeschlossen waren, häufig ausschlugen, wenn das Bordell besonders stark frequentiert wurde. Pierre Paul Sauvin, ein Elektronikexperte, konnte bestätigen, dass die Gewächse sowohl auf das Absterben lebendiger Zellen als auch auf sexuelle Aktivität heftig reagieren. Und dies sogar über weite Entfernungen. Auch wenn er sich mit seiner Freundin in einem 130 Kilometer entfernten Ferienhaus aufhielt, reagierten die mit ihm verbundenen Pflanzen, und zwar so stark, dass der Ton des Oszillators, an den die Pflanzen angeschlossen waren, im Augenblick des Orgasmus zu einem schrillen Kreischen anschwoll. (Es muss hier betont werden, dass es nicht blutige Orgien braucht, um die Pflanzen anzuregen, Meditation und tiefes Gebet bringen ähnliche Resultate hervor.)