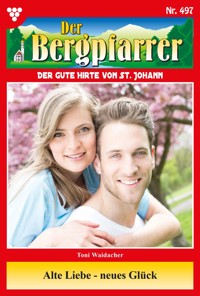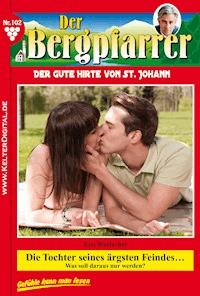
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Bergpfarrer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Mit dem Bergpfarrer hat der bekannte Heimatromanautor Toni Waidacher einen wahrhaft unverwechselbaren Charakter geschaffen. Die Romanserie läuft seit über 10 Jahren, hat sich in ihren Themen stets weiterentwickelt und ist interessant für Jun"Liebling, du ißt einfach zu wenig", schüttelte Gerti Rheimann tadelnd den Kopf. Sepp Reisinger begrüßte den jungen Mann mit einem breiten Lächeln. "Der Herr Winkler, nehm' ich an? Aus München?" Der Hotelgast nickte. "Herzlich willkommen im Löwen", fuhr der Gastwirt fort. "Ihre Suite ist vorbereitet." Sepp nahm den Schlüssel vom Brett und klingelte nach dem Hausburschen. "Das Gepäck des Herrn kommt auf die ›König-Ludwig-Suite‹", wies er an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Bergpfarrer –102–
Die Tochter seines ärgsten Feindes…
Was soll daraus nur werden?
Roman von Toni Waidacher
Sepp Reisinger begrüßte den jungen Mann mit einem breiten Lächeln.
»Der Herr Winkler, nehm’ ich an? Aus München?«
Der Hotelgast nickte.
»Herzlich willkommen im Löwen«, fuhr der Gastwirt fort. »Ihre Suite ist vorbereitet.«
Sepp nahm den Schlüssel vom Brett und klingelte nach dem Hausburschen.
»Das Gepäck des Herrn kommt auf die ›König-Ludwig-Suite‹«, wies er an.
Der Gast mit dem Namen Winkler folgte dem Angestellten die Treppe hinauf in den ersten Stock. Die Suite war großzügig und elegant eingerichtet. Sie besaß ein Wohnzimmer, einen Schlafraum und ein Bad. Fernsehgerät und Telefon waren in dieser Zimmerkategorie selbstverständlich.
Herr Winkler entlohnte den Hausburschen mit einem ordentlichen Trinkgeld und schloß die Tür hinter ihm. Dann öffnete er die Glastür und trat auf den Balkon hinaus. Von hier aus hatte er einen weiten Blick bis zum Zentrum des Dorfes und auf die Kirche mit ihrem hohen schlanken Zwiebelturm. In der Ferne sah er die Zwillingsgipfel ›Himmelsspitz‹ und ›Wintermaid‹, die ihm schon auf der Herfahrt aufgefallen waren.
Er atmete tief die würzige Luft ein, die nach Wildblumen und Kräutern schmeckte, und schloß für einen Moment die Augen.
Wie lange hatte er darauf gewartet!
Tage, Wochen, Monate – Jahre schließlich. Irgendwann hatte er aufgehört, über die Zeit nachzudenken und nur noch für seinen Plan gearbeitet, der darauf abzielte, eines Tages hierher zurückzukommen und den Mann zur Rechenschaft zu ziehen, der für sein und das Unglück seiner Familie verantwortlich war.
Der Mann, der gar nicht Winkler hieß, sondern Adrian Greininger, wandte sich um und ging ins Wohnzimmer zurück. Er hob den Hörer des Telefons ab, wählte eine Zahl und war mit dem Zimmerservice verbunden.
»Winkler hier«, sagte er. »Ich hätte gern ein Kännchen Kaffee.«
Er legte wieder auf, doch seine Hand blieb auf dem Hörer. Einem Impuls folgend, nahm er wieder ab, drückte die Null und wartete auf das Freizeichen. Dann tippte er die Zahlen der Telefonnummer ein, die ihm nur zu gut bekannt war.
Atemlos lauschte er, dann wurde am anderen Ende abgenommen.
»Reindl«, hörte er eine Frauenstimme und drückte rasch den Finger auf die Gabel.
Adrian atmete tief durch.
Sogar die Telefonnummer hatten sie übernommen.
Nun gut, dachte er, soweit ist alles klar. Jetzt galt es, die nächsten Schritte zu überlegen. Er mußte vorsichtig zu Werke gehen, damit die Überraschung auf seiner Seite war. Nicht zu früh agieren, damit seine Tarnung nicht aufflog, aber auch nicht zu abwartend. Stück für Stück wollte er sich vorarbeiten, um dann zum entscheidenden Schlag auszuholen.
Ein Klopfen an der Tür seiner Suite unterbrach seine Gedanken. Adrian öffnete und nahm das Tablett mit dem Kaffeegedeck entgegen. Er setzte sich in einen der Sessel und schenkte ein.
Das heiße Getränk tat gut, vor allem schmeckte er besser, als jeder andere Kaffee, den er in den letzten zehn Stunden zu sich genommen hatte.
Genauso wenig wie der Name, mit dem er sich hier im Hotel angemeldet hatte, stimmte die Angabe, er käme aus München. Nachts um drei war er aus Kiel losgefahren, hatte mehrere Pausen eingelegt und St. Johann am späten Nachmittag erreicht. Vielleicht wäre er noch eher dagewesen, wenn es auf der Autobahn Würzburg-München nicht einen schweren Unfall gegeben hätte, der einen stundenlangen Stau nach sich gezogen hatte.
Indes hatte er es auch nicht eilig gehabt, herzukommen. So lange wartete er schon auf diesen Tag; jetzt kam es auf ein paar Stunden mehr oder weniger auch nicht an.
Als er auf den Parkplatz fuhr, überkam ihn Furcht, Sepp Reisinger könne ihn erkennen. Doch eigentlich war das unmöglich, hatte er versucht, sich zu beruhigen. Der junge Bursche, der er einst war, als er aus der Heimat fortging, hatte sich verändert. Männlicher war er geworden, die harte Arbeit der letzten Jahre hatte ihre Spuren hinterlassen. Allerdings im positiven Sinne, das Gesicht war gebräunt. Es hatte einen markanten Schnitt, die hellen Augen darin konnten sanft oder zornig schauen, und das Kinn drückte Durchsetzungsvermögen und Entschlossenheit aus.
Beides hatte ihm gefehlt, damals. Sonst wäre wahrscheinlich alles anders gekommen. Die Arbeit auf der Bohrinsel vor der norwegischen Küste hatte seine Muskeln gestählt. In der rauhen Männergesellschaft, in der Adrian Greininger sich in den letzten Jahren aufgehalten hatte, bedeuteten Kraft und Selbstbewußtsein viel. Sie sicherten das Überleben.
Adrian war dennoch mit gemischten Gefühlen in das Hotel hineingegangen. Früher hätte er sich das nie getraut, ganz abgesehen davon, daß er einen Aufenthalt hier nie hätte bezahlen können. Damals war er nur einige Male auf den Tanzabend im Saal gegangen, der jeden Samstag dort stattfand. Indes, Sepp Reisinger erkannte den einstigen Bauernsohn nicht, und Adrian war sicher, daß auch die anderen sich seiner nicht erinnern würden.
Liebend gerne hätte er geschlafen. Doch da gab es noch etwas, das sich nicht länger hinausschieben ließ. Acht Jahre war es her, daß er fortgegangen war, und so lange hatte er das Grab der Eltern nicht mehr gesehen. Er hoffte, daß sich in all der Zeit eine barmherzige Seele darum gekümmert haben möge. Allerdings zweifelte er an der Barmherzigkeit seiner Mitmenschen.
Wie hätten sie sonst damals zulassen können, daß die Eltern von Haus und Hof vertrieben wurden und er in die Fremde gehen mußte?
Da war niemand, der einen Finger für die Familie Greininger rührte. Doch dafür würden sie bezahlen. Jetzt war er zurückgekommen, um die Schuld einzufordern.
›Denn mein ist die Rache, spricht der Herr!‹ Wie oft hatte er diesen Spruch aus dem Alten Testament vor sich hin geflüstert.
Er war es, der ihn die Strapazen durchstehen ließ, der ihn aufrichtete, wenn er unter der Last des Lebens zusammenzubrechen drohte, und der aus dem schmalbrüstigen Bauernsohn einen Mann gemacht hatte.
Mein ist die Rache, und nur für diesen Tag lebte Adrian Greininger!
*
Sebastian Trenker saß im Bischöflichen Ordinariat, in der Empfangshalle, und wartete darauf, daß sein Vorgesetzter ihn empfing. Es war schon eine Weile her, daß der Sekretär Bischof Meerbauers, Pater Antonius, ihn gebeten hatte, Platz zu nehmen. Seine Exzellenz habe noch einen telefonischen Termin wahrzunehmen.
Der gute Hirte von St. Johann faßte sich in Geduld. Jeder andere Geistliche würde sich wahrscheinlich angstvoll gefragt haben, warum er zu seinem Bischof zitiert wurde. Nicht so der Bergpfarrer. Zum einen war das Verhältnis zwischen ihm und Ottfried Meerbauer eher so wie zwischen Freunden und weniger wie zwischen Untergebenen und Vorgesetzten, und zum anderen wußte Sebastian ohnehin, was der Bischof von ihm wollte.
Es ging wieder einmal um ein leidiges Thema, das die Kirchenmänner nun schon geraume Zeit beschäftigte, und wenn der dritte Beteiligte nicht langsam Ruhe gab, dann würde es noch sehr lange dauern, bis man sich wirklich wichtigen Themen zuwenden konnte, die nach Sebastians Meinung sehr viel dringender waren als ein beschädigtes Altarkreuz.
Der Mann, der eine Einigung in dieser Angelegenheit verhinderte, war Blasius Eggensteiner, der Pfarrer an St. Anna in Engelsbach. In eben dieser Kirche war das Altarkreuz beschädigt worden, als es, nach Aussage der Haushälterin Hermine Wollschläger, von einem Landstreicher heruntergeworfen wurde.
Gesehen hatte niemand, daß Franz Mooser, so hieß der Mann, der Übeltäter war. Dennoch stand die Anklage gegen ihn im Raum, und die lautete: Kirchenschändung.
Als Pfarrer Eggensteiner hinzukam, stand seine Haushälterin in der Kirche, und das Kreuz, ein Kelch für den Wein, der beim Abendmahl gereicht wurde, und eine Vase lagen vor dem Altar am Boden.
Da der obdachlose Mooser-Franz kurz zuvor am Pfarrhaus geklingelt und um etwas zu essen gebeten hatte, wie Hermine Wollschläger berichtete, kam für den Geistlichen nur dieser Mann für die Tat in Frage. Eigentlich hatte Mooser sich noch im Dorf geirrt, wollte ursprünglich nach St. Johann, und Pfarrer Eggensteiner folgte ihm auf dem Fuße. Dort hatte Sebastian Trenker Franz Mooser kurzerhand bei sich einquartiert, und zum Ärger des Geistlichen von St. Anna, legte er auch noch schützend die Hand über seinen Gast.
Das war zuviel des Guten. Blasius Eggensteiner wurde mehrfach im Bischöflichen Ordinariat vorstellig, um sich über den früheren Studienkollegen zu beschweren, und irgendwann konnte Sebastian dieses Gespräch mit seinem Vorgesetzten nicht mehr weiter hinauszögern.
Allerdings hatte er das auch nicht getan, weil er sich davor fürchtete, vielmehr gab es Dinge im Leben des guten Hirten von St. Johann, die er für wichtiger ansah, als sich mit dem Amtsbruder darüber zu streiten, ob der Mooser-Franz nun ein Kirchenschänder war oder nicht.
Der Sekretär erschien und meldete, daß Seine Exzellenz nun bereit sei, den Besucher zu empfangen.
Ottfried Meerbauer kam Sebastian mit geöffneten Armen entgegen.
»Entschuldige, daß ich dich hab’ warten lassen«, begrüßte er den Bergpfarrer.
»Das macht nix«, erwiderte Sebastian. »Ich hab’ mir derweil die Porträts deiner Vorgänger angeschaut.«
Die Gemälde hingen in der Empfangshalle.
»Ach, die Bilder, ja…«, nickte der Bischof deprimiert. »Net mehr lang’, dann kann man da auch eins von mir bewundern.«
»Bist du etwa krank?« erkundigte sich Sebastian besorgt.
Seit einer gemeinsamen Bergtour, auf der er dem Bischof die Schönheiten seiner Heimat gezeigt hatte, duzten sich die beiden Männer.
»Nein, nein«, versicherte Ottfried Meerbauer. »Aber du weißt ja selbst, die Zeit bleibt net stehen, und irgendwann werd’ ich auch abtreten müssen.«
»Na, bis dahin wird’s ja wohl noch recht lang’ dauern«, meinte Sebastian Trenker. »Du bist doch gerad’ im besten Alter für deine Aufgaben hier.«
»Trotzdem muß man sich beizeiten nach einem geeigneten Kandidaten umsehen, der einmal meinen Platz einnehmen soll.«
Er schaute den Besucher prüfend an.
»Du kommst ja wohl net in Frage«, sagte er schließlich.
»Bloß das net«, schüttelte Sebastian entsetzt den Kopf. »Du weißt ja, wie ich darüber denk’.«
Ottfried Meerbauer deutete auf einen Sessel.
»Ja, ich weiß, du kümmerst dich lieber um deine Gemeinde, als in der Kirche Karriere zu machen. Aber das ist auch net der Grund, warum ich dich net vorschlagen könnt’, sondern vielmehr dein Dickschädel, mit dem du dich über meine Anweisungen hinwegsetzt.«
Den letzten Satz sprach der Bischof gerade aus, als der Sekretär hereinkam und ein Tablett mit Kaffee und Tassen auf das Beistelltischchen stellte. Sebastian entging nicht das Lächeln, das der Mann bei diesen Worten auf seinen Lippen hatte.
Ottfried Meerbauer schüttelte den Kopf, als der Sekretär einschenken wollte.
»Das mache ich selbst«, sagte er. »Und jetzt bitte keine Störungen mehr!«
Er reichte dem Bergpfarrer eine Kaffeetasse und sah ihn dabei über den Goldrand seiner Brille hinweg an.
»Was mach’ ich bloß mit dir?« fragte er halblaut, wobei zu merken war, daß er diese Frage mehr an sich als an seinen Besucher gerichtet hatte.
»Gibt mein Amtsbruder denn immer noch keine Ruhe?« erkundigte sich Sebastian.
»Nein. Es vergeht kaum ein Tag, an dem er net anruft oder sogar herkommt und nachfragt, ob etwas in dieser unleidlichen Angelegenheit unternommen worden ist.«
»Wahrscheinlich wär’s ihm am liebsten, wenn man mir die Ordination entzöge«, vermutete der gute Hirte von St. Johann, »und mich womöglich in ein Kloster verbannte.«
»Vermutlich ja«, seufzte der Bischof. »So langsam hab’ ich Zweifel, ob es wirklich eine gute Idee war, den Bruder Eggensteiner aus dem Urwald zurückzuholen und ihm St. Anna als Pfarrei zu geben. Dort drüben hat er gute Arbeit geleistet – aber hier? Nix als Scherereien!«
Sebastian hatte einen Schluck Kaffee getrunken.
»Es tut mir wirklich leid, was da vorgefallen ist«, sagte er. »Aber ich habe dir ja schon mehrfach am Telefon gesagt, daß der Mooser-Franz unschuldig ist. Er hat mit dem, was da in der Kirche vorgefallen ist, net das Geringste zu tun. Ich hab’ keine Ahnung, warum Blasius sich so darauf versteift, daß Franz es gewesen sein soll. Überhaupt halt ich den Vorwurf der Kirchenschändung für ausgemachten Blödsinn. Es gibt nix, was darauf hindeutet. Wenn jemand der Kirche wirklich hätte Schaden zufügen wollen, dann hätt’ er net nur die Sachen vom Altar heruntergeworfen, sondern noch ganz andere Dinge angerichtet.«
Ottfried Meerbauer nickte.
»Wahrscheinlich hast du recht«, meinte er.
»Ich vermute viel eher, daß das Kreuz, der Kelch und die Vase unabsichtlich heruntergeworfen worden sind. Vielleicht von einem unachtsamen Besucher, der sich dann net getraut hat, die Angelegenheit zu melden. Das ist ärgerlich, kommt aber nun mal vor.«
Der Bischof nickte wieder – und verzog für einen Moment das Gesicht, als habe er Schmerzen.
Sebastian entging es nicht, obwohl Ottfried Meerbauer sich rasch abwandte.
»Ist was?« fragte der Bergpfarrer besorgt.
»Nein, nein«, versicherte sein Vorgesetzter. »Alles in Ordnung.«
Pfarrer Trenker wußte nicht so recht, ob er das glauben konnte, zumal der Bischof sich mit der rechten Hand an die Seite faßte.
»Ist der Herr Mooser denn noch bei dir?« fragte er dabei schnell, bevor der Bergpfarrer seine Frage stellen konnte.
»Nein, nach vierzehn Tagen hat er sich verabschiedet, und ich hab’ ihn natürlich ziehen lassen.«
Die Tür wurde geöffnet, und der Sekretär trat ein.
»Verzeihen Sie, Exzellenz«, sagte er, »aber der Termin bei…«
»Ja, ich weiß schon«, antwortete Ottfried Meerbauer und sah Sebastian an. »Tut mir leid, aber…«
Der gute Hirte von St. Johann war schon aufgestanden und verabschiedete sich. Auf der Fahrt nach St. Johann fragte er sich, warum er den Eindruck gehabt hatte, daß Ottfried Meerbauer irgendwie froh gewesen zu sein schien, ihn losgeworden zu sein.
Diese Frage beschäftigte ihn auch noch, als er das Pfarrhaus betrat. Da ahnte er noch nicht, daß er schon bald eine Antwort darauf bekommen würde.
Eine, die ihm ganz und gar nicht gefiel…
*
Adrian Greininger war überrascht, daß sich in den sechs Jahren seiner Abwesenheit kaum etwas in St. Johann verändert hatte. Alles sah noch genauso aus wie damals, nur das kleine Einkaufszentrum war neu.
Er betrat die Passage und schaute sich die Geschäfte an. Ignaz Herrnbacher, der Kaufmann, hatte sich hier eingerichtet; es gab Modegeschäfte und Andenkenläden. Man konnte Tabakwaren und Zeitschriften kaufen und sich sogar zu einem Eisbecher niederlassen.
Der Heimkehrer, der unter falschem Namen im Hotel wohnte, betrat das Blumengeschäft. Früher mußte man bis zur Gärtnerei am Rande des Dorfes laufen, wenn man Blumen kaufen wollte.
Adrian kannte die junge Frau, die hinter dem Tresen stand und gerade ein Gesteck band, noch von damals. Sie begrüßte ihn mit einem Lächeln, schien sich aber nicht an ihn zu erinnern.
Er suchte einen kleinen Strauß aus, bezahlte und verließ den Laden wieder. Während er weiterschlenderte, achtete er auf die Gesichter der Leute, die ihm begegneten. Die meisten waren Touristen, wie er unschwer an den Fotoapparaten und Videokameras erkennen konnte. Einheimische sah er auch einige, doch die meisten kannte er nicht.
Adrian verließ die Passage, ging an der Bankfiliale vorüber und schritt weiter zur Straße. Auf der anderen Seite stand die Kirche, daneben lag der Friedhof.
Ob Pfarrer Trenker immer noch der Seelsorger der Gemeinde war?
Er erinnerte sich an die Stunden, die er als Messdiener in der Kirche zugebracht hatte, an den Kommunionsunterricht, die Freizeiten, die der Pfarrer mit den Jugendlichen unternommen hatte.