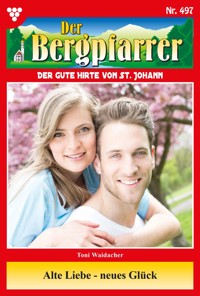Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Bergpfarrer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Mit dem Bergpfarrer Sebastian Trenker hat der bekannte Heimatromanautor Toni Waidacher einen wahrhaft unverwechselbaren Charakter geschaffen. Die Romanserie läuft seit gut 13 Jahren, hat sich in ihren Themen dynamisch weiterentwickelt und ist interessant für Jung und Alt! Unter anderem gingen auch bereits zwei Spielfilme im ZDF mit je etwa 6 Millionen Zuschauern daraus hervor. "Hast du auch alles?" erkundigte sich Carla Worthmann besorgt. "Deinen Führerschein, das Handy? Was ist mit dem Straßenatlas?" Maria Burgner lächelte. "Du machst dir viel zuviel Gedanken", erwiderte sie und klopfte auf ihre Handtasche. "Da steckt alles drin. Und den Weg nach St. Johann werde ich schon finden. Schließlich ist es ja meine Heimat, in die ich fahre." Die Freundin schaute besorgt drein. "Du kommst doch aber wieder zurück?" Carla Worthmann schüttelte den Kopf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Bergpfarrer –125–
Maria - eine erfolgreiche Frau
Roman von Toni Waidacher
»Hast du auch alles?« erkundigte sich Carla Worthmann besorgt. »Deinen Führerschein, das Handy? Was ist mit dem Straßenatlas?«
Maria Burgner lächelte.
»Du machst dir viel zuviel Gedanken«, erwiderte sie und klopfte auf ihre Handtasche. »Da steckt alles drin. Und den Weg nach St. Johann werde ich schon finden. Schließlich ist es ja meine Heimat, in die ich fahre.«
Die Freundin schaute besorgt drein.
»Du kommst doch aber wieder zurück?«
Carla Worthmann schüttelte den Kopf.
»Also, das mit diesem Testament gefällt mir überhaupt nicht«, setzte sie hinzu. »Wieso verlangt deine Tante, daß du in dieses Kaff zurück ziehen sollst?«
Jetzt war es Maria, die ihrerseits den Kopf schüttelte und zwar so sehr, daß die schulterlangen blonden Haare nur so flogen.
»Erstens ist es meine Großtante gewesen«, erklärte sie. »Und zweitens verlangt sie nicht, daß ich für immer in dem Haus wohne, sondern lediglich drei Monate im Jahr dort verbringe. Und das ist doch nicht zuviel verlangt, wenn man bedenkt, daß mit der Erbschaft recht viel Geld verbunden ist.«
»Trotzdem«, erwiderte die rotblonde Carla, eine hübsche junge Frau, die ihrer Meinung nach immer ein paar Kilo zuviel drauf hatte, »finde ich es unverschämt. Schließlich lebst du hier, in München, hast all deine Freunde hier und natürlich deine Arbeit.«
Sie musterte Maria mit einem forschenden Blick.
»Oder bist du in Nöten? Finanziell, meine ich…«
Maria Burgner lachte hell auf.
»Nein, wirklich nicht. Es ist nur so – wie soll ich sagen? Irgendwie habe ich gemerkt, daß mir die Heimat fehlt. Acht Jahre war ich nicht mehr in St. Johann, seit ich damals fortgegangen bin.«
Sie schaute auf die Uhr.
»So, jetzt muß ich aber los. Sonst wird’s zu spät.«
Sie umarmte die Freundin und stieg in das weiße Cabrio.
»Gute Fahrt«, rief Carla ihr noch hinterher.
Maria winkte zurück. Während sie durch die stillen Straßen des Münchener Vororts fuhr, dachte sie an die vielen Diskussionen zurück, die es in den letzten Wochen mit der Freundin gegeben hatte. Angefangen hatte es mit dem Schreiben eines Rechtsanwalts, der sie aufgefordert hatte, ihn in einer Erbschaftsangelegenheit in seiner Kanzlei aufzusuchen.
Bei ihr hatte sofort das schlechte Gewissen geschlagen, denn sie wußte, daß es sich nur um Tante Gerlinde handeln konnte, die Schwester ihrer Großmutter, die verstorben war. Und tatsächlich war es so. Der Anwalt öffnete nach der Begrüßung, und nachdem Maria sich ausgewiesen hatte, einen versiegelten Umschlag und verlas das Testament. In dem vermachte Gerlinde Hofacker ihrer Großnichte das Haus in St. Johann und einen Betrag von beinahe einhunderttausend Euro in Wertpapieren und Bargeld.
Maria wäre vor Schreck beinahe vom Stuhl gefallen. Sie hatte keine Ahnung gehabt, daß ihre Tante so vermögend gewesen war. Gleichzeitig wurde ihr deutlich, daß sie überhaupt nichts von ihr wußte. Als sie seinerzeit St. Johann verlassen hatte und nach München gezogen war, da hatte nur ein mehr oder weniger loser Kontakt bestanden, der gänzlich einschlief, als Maria anfing, beim Fernsehen zu arbeiten. Es gab da irgendeine alte Familiengeschichte, ein unsinniger Streit, der sich durch zwei Generationen zog und der der Grund war, warum alle Gerlinde Hofacker mieden wie die Pest. Nur die Großnichte hatte den Bannkreis, der um die Verwandte lag, durchbrochen und sie ab und zu besucht. Daher wußte Maria, daß die Großtante nie geheiratet und keine Kinder hatte.
Woher das Geld stammte, konnte sie nur mutmaßen, gesprochen hatte sie mit ihr nie darüber. Die Tante hatte ihren Lebensunterhalt früher als Angestellte bei einer Bank verdient. Möglicherweise hatte sie einen Teil ihres Gehalts gewinnbringend angelegt. Und wenn man den Gerüchten glauben durfte, die damals die Runde machten, dann lebte Gerlinde sehr sparsam, ja, man bezeichnete sie sogar als geizig. Wahrscheinlich hatte sie mehr gespart, als für sich ausgegeben. Selbst Miete mußte sie nicht zahlen, weil sie das Haus von den Eltern geerbt hatte und es schuldenfrei war.
Die Aussicht, dieses Erbe nun anzutreten, hatte Maria allerdings nicht nur überrascht, sondern auch vor ein Dilemma gestellt. Es gab nämlich eine Klausel im Testament, die besagte, daß Maria für mindestens drei Monate in dem Haus leben müsse. Würde sie sich weigern, sollte die gesamte Erbschaft der Gemeinde zugesprochen werden.
»Sie müssen sich net jetzt gleich entscheiden«, hatte der Anwalt gesagt. »Aber innerhalb einer Frist von sechs Wochen muß das Erbe angenommen oder ausgeschlagen werden.«
Er saß hinter seinem Schreibtisch und sah sie beinahe mitleidig an.
»Ich weiß, daß es keine leichte Entscheidung ist«, fuhr er fort. »Gerade in Ihrer exponierten Stellung, Frau Burgner. Aber seien Sie versichert, daß, wie immer Sie sich entscheiden werden, nix darüber an die Presse verlautbaren wird.«
Die junge Frau hatte genickt, sich für den servierten Kaffee bedankt und verabschiedet. Dann war sie schweren Herzens nach Hause gefahren, in die Villa in Grünwald, die sie vor drei Jahren gekauft hatte, als es endlich bergauf ging.
Tagelang grübelte sie über alles nach, und Carlas Einwendungen machten es ihr nicht gerade leichter, sich dazu durchzuringen, den Anwalt anzurufen. Dabei war es gar nicht mal der auferlegte Zwang, für drei Monate in dem Haus zu leben, der sie zurückhielt, sondern die Tatsache, daß sie Angst hatte.
Angst vor dem Wiedersehen mit Wolfgang…
*
Im Pfarrhaus von St. Johann war alles auf den großen Tag ausgerichtet. Sophie Tappert hatte das Bett im zweiten Gästezimmer hergerichtet und war emsig dabei, einzukaufen und vorzubereiten. Sebastian Trenker stand derweil ungeduldig am Fenster seines Arbeitszimmers und schaute hinaus.
Es war wirklich ein aufregendes Ereignis, denn es geschah nicht jeden Tag, daß ein Totgeglaubter nach über zwanzig Jahren ein Lebenszeichen von sich gab und in die Heimat zurückkehrte.
Die Haushälterin steckte ihren Kopf durch die Tür.
»Jetzt müßt’ er aber wohl bald da sein.«
Der Geistliche drehte sich um und nickte.
»Es kann net mehr lang’ dauern.«
»Hoffentlich schmeckt ihm meine bayerische Hausmannskost überhaupt noch«, sagte Sophie Tappert besorgt.
Sebastian lächelte.
»Keine Angst«, meinte er. »Es wird ihm net nur munden, sondern auch daran erinnern, daß er wieder daheim ist.«
Die Rede war von Andreas Trenker, Sebastians Cousin.
Der war vor langer Zeit von zu Hause fortgegangen, und man hatte nichts wieder von ihm gehört. Bis vor einiger Zeit eine Frau ins Wachnertal kam, die auf der Suche nach ihrem Vater war, von dem sie immer geglaubt hatte, daß er längst verstorben sei.
Es dauerte eine Weile, bis herauskam, daß es sich bei diesem Mann nur um den Verwandten des Bergpfarrers handeln konnte. Doch fehlte von ihm jede Spur.
Nachdem Kathrin Sonnenleitner den jungen Bauern, der jetzt den Hof ihres Großvaters bewirtschaftete, geheiratet hatte, war sie im Wachnertal ansässig geworden, der Heimat ihrer Mutter.
Natürlich ließ der gute Hirte von St. Johann nichts unversucht, um etwas über den Verbleib seines Cousins herauszufinden, und durch die Vermittlung eines Freundes, der wiederum Beziehungen zum kanadischen Konsulat hatte, gelang es ihm tatsächlich festzustellen, daß Andreas Trenker immer noch lebte und jetzt sogar seine Rückkehr nach St. Johann plane. Vor einer guten Woche hatte ihn ein Brief erreicht, in dem der Cousin seine Ankunft ankündigte. Gestern abend dann hatte es ein erstes Telefonat gegeben.
Der Geistliche war selbst an den Apparat gegangen.
»Grüß dich, Sebastian«, hörte er eine Stimme, die ihm fremd und vertraut zugleich war. »Ich bin’s, der Andreas.«
»Grüß dich, mein Lieber«, hatte er erwidert. »Schön, daß du dich meldest. Wie geht’s dir? Bist’ gut in Deutschland angekommen? Wann wirst’ in St. Johann eintreffen…?«
Der Bergpfarrer machte ein Pause und holte Luft, während sein Cousin lachte.
»Ach, ich hab’ so viele Fragen«, lachte nun auch Sebastian. »Ich kann’s gar net abwarten, bis du endlich hier bist.«
»Das wird schon morgen der Fall sein«, antwortete Andreas Trenker. »Deshalb rufe ich ja an.«
»Wie kommst du her? Soll ich dich irgendwo abholen?«
»Nein, nein. Ich fliege ganz früh hier in Hamburg ab, und in München steht ein Leihwagen für mich bereit. Ich freu’ mich schon darauf, selbst zu fahren und mir unterwegs alles anzuschau’n. Deshalb nehm’ ich auch net die Autobahn, sondern fahre über die Dörfer. Aber zum Mittag werd’ ich bei euch sein.«
Der Bergpfarrer schmunzelte. Auch wenn Andreas lange Zeit fort war, seinen heimatlichen Dialekt sprach er immer noch.
»Du, ich freu’ mich narrisch«, sagte er. »Dann wünsch’ ich dir für morgen alles Gute. Komm heil hier an; wir haben für deine Ankunft schon alles vorbereitet.«
Trotz der Ankündigung Andreas’, er würde gegen Mittag eintreffen, stand der gute Hirte von St. Johann schon seit geraumer Zeit am Fenster seines Arbeitszimmers und schaute hinaus. Endlich sah er unten an der Straße ein Auto halten und einen Mann aussteigen.
»Er ist da!« rief er, während er die Haustür öffnete und den Kiesweg hinuntereilte.
Andreas kam ihm entgegen.
Er sieht gut aus, ging es Sebastian durch den Kopf. Jedenfalls scheint er bei guter Gesundheit zu sein.
Zwar hatte es keine Anzeichen dafür gegeben, daß es seinem Cousin schlecht ginge, dennoch hatte den Geistliche die Ankündigung seiner Rückkehr überrascht, und er fragte sich, ob Andreas vielleicht Probleme hätte, die ihn dazu bewogen, in Kanada alles aufzugeben.
Drei Schritte von einander entfernt blieben sie stehen und schauten sich strahlend an. Beide breiteten ihre Arme aus und gingen aufeinander zu.
»Herzlich willkommen!« rief Sebastian sichtlich gerührt. »Ich freu’ mich ja so, daß du wieder da bist!«
Andreas holte tief Luft und nickte.
»Ich auch, Sebastian, ich auch«, antwortete er mit erstickter Stimme.
Es war unübersehbar, daß auch ihn die Rührung überwältigte. Sie standen minutenlang da und umarmten sich. Dann sah der Bergpfarrer seinen Cousin prüfend an und nickte.
»Du schaust prächtig aus.«
Andreas Trenker war so groß wie er selbst. Genauso schlank und sportlich. Das Gesicht war vielleicht ein klein wenig hagerer, aber die Augen lachten glücklich. Die Verwandtschaft mit dem Bergpfarrer war unübersehbar. Man hätte sie durchaus für Brüder halten können.
»Das kann man von dir aber auch sagen«, meinte der Ankömmling. »Wenn man’s net besser wüßt’, könnt’ man dich glatt für einen Schauspieler halten. Hast’ also deinen Traum wahrgemacht und bist Pfarrer geworden.«
Daß Sebastian seinerzeit das Priesterseminar besuchte, hatte er noch mitbekommen, bevor er fortgegangen war.
»Jetzt komm erstmal herein«, sagte der Geistliche. »Meine Haushälterin wartet schon mit dem Essen. Du kennst sie übrigens – Sophie Tappert.«
»Was? Die Sophie?«
Sebastian nickte. Seine Haushälterin war schon bei seinem Vorgänger in Diensten gewesen und hatte damals, als er und Andreas Meßbuben waren, ihnen immer etwas Leckeres zugesteckt.
Der Heimkehrer rieb sich den Bauch.
»Jetzt weiß ich, warum ich vorhin in München nix gegessen hab’, obwohl ich schon ein bissel Hunger hatte«, scherzte er.
»Darüber wird sie sich freuen«, lachte der Bergpfarrer.
*
Es gab, wie es sich für einen Festtag gehörte, einen prächtigen Schweinsbraten mit Kruste, der mit Bier geschmort worden war. Dazu Kraut und Knödeln.
»Herrlich!« rief Andreas, nachdem er sein Besteck aus der Hand gelegt hatte. »So was Gutes hab’ ich lang’ net mehr gegessen.«
»Ich hoff’, daß du noch net satt bist«, sagte Sebastian. »Es gibt noch einen Nachtisch.«
Andreas Trenker saß mit Behagen am Tisch der Pfarrküche.
»Gemütlich hast’ es hier«, meinte er. »Aber sag’ mal, wo steckt denn der Max?«
»Auf Hochzeitsreise.«
»Was? Ist der etwa schon erwachsen?« rief sein Cousin aus.
»Du wirst dich wundern«, schmunzelte der Geistliche. »Ein gestandener Mann ist aus ihm geworden. Er ist übrigens der Polizist hier im Ort.«
»Da staun’ ich wirklich. Himmel, wie die Zeit vergangen ist. In München hab’ ich mich kaum noch zurechtgefunden. Es gibt da soviel Neues. Nur hier scheint mir irgendwie die Zeit stehengelieben zu sein. Jedenfalls hat sich net viel verändert.«
»Das ist auch gut so. Wenn’s nach uns’rem Bürgermeister ginge, dann wären wir schon längst ein großer Kurort mit großen Hotels, Skipisten und was weiß ich.«
Andreas sah ihn lächelnd an.
»Ich vermute, daß du dafür verantwortlich bist, daß das alles verhindert wird«, meinte er.
Sebastian zuckte die Schultern.
»Aber net allein. Gott sei Dank gibt’s genug vernünftige Leut’, denen der Umweltschutz und die Pflege des Althergebrachten mehr am Herzen liegt als reines Profitdenken.«
Sophie Tappert hatte eine große Schüssel hereingebracht und forderte die Männer auf, sich zu bedienen. Auch wenn sie schon gut und reichlich gegessen hatten, so schmeckte ihnen der Grießflammerie mit den frischen Beeren aus dem Pfarrgarten doch auch noch.
Nach dem Essen zogen sich die beiden Cousins mit einer Kanne Kaffee auf die Terrasse zurück. Andreas streckte alle Viere von sich und atmete tief durch.
»Jetzt spann mich net länger auf die Folter«, sagte Sebastian. »Erzähl’, wie’s dir ergangen ist.«
Der Heimkehrer schaute versonnen vor sich hin, dann blickte er den Pfarrer an.
»Wo soll ich beginnen?« fragte er leise. »Es ist damals so viel geschehen.«
Er zuckte die Schultern und biß sich auf die Lippe.
»Du erinnerst dich vielleicht, daß ich damals etwas mit einem Madel angefangen hab’«, fuhr er fort.
Sebastian nickte.
»Leider stand uns’re Liebe unter keinem guten Stern«, sprach sein Cousin weiter. »Ediths Vater verbot ihr, sich mit mir einzulassen. Es war eine schreckliche Zeit für uns beide. Wir mußten uns heimlich treffen und immer in der Angst leben, daß man uns beobachten könne. Irgendwann wurde es Edith zuviel. Sie konnte das alles net mehr aushalten und machte Schluß mit mir. Ich war so traurig darüber, denn ich liebte sie von Herzen, daß ich es hier net mehr aushielt. Ich beschloß, fortzugehen und in der Fremde all das zu vergessen.
Der Entschluß war schnell gefaßt, und ich war mir bewußt, daß ich damit vielen Menschen wehtun würde, besonders meinen Eltern. Aber ich hatte keine andere Wahl. Immerhin hab’ ich ihnen später eine Karte geschrieben und ihnen versichert, daß es mir gutginge und sie sich keine Sorgen zu machen bräuchten.«
Er unterbrach sich und trank einen Schluck Kaffee.
»Von München aus bin ich nach Norddeutschland«, erzählte er dann weiter. »Kannst du dir das vorstellen, ein waschechter Bayer, der in Hamburg auf der Reeperbahn arbeitet?«
Er lachte in Erinnerung an die Zeit, die er auf Hamburgs weltberühmter Amüsiermeile verbracht hatte. Erst als Türsteher in einer Diskothek, später als Tellerwäscher in einem Lokal, das Blasmusik und bayerische Schmankerl servierte.
Nach einem Vierteljahr hatte Andreas Trenker die Nase voll von diesem Leben. Während seiner wenigen Freizeit hatte er sich immer öfter im Hafen umgesehen und den großen Schiffen nachgeschaut, wenn sie ablegten und in die weite Welt hinausfuhren.
Er heuerte als Hilfsmatrose auf einem Frachter an und lernte das schwere Seemannshandwerk von der Pike auf. Die erste Fahrt ging nach Südamerika. In Rio de Janeiro wechselte er auf ein Passagierschiff, das nach Nordamerika fuhr. Im Hafen von Corpus Christi musterte er ab und trieb sich einige Zeit in den Vereinigten Staaten herum, bis er schließlich für ein halbes Jahr in Detroit Arbeit in einer Automobilfabrik fand. Dabei gelang es ihm nie, das zu vergessen, was ihn aus der Heimat vertrieben hatte. Andreas liebte Edith Sonnenleitner immer noch, und in seinen Träumen sah er sich wieder mit ihr vereint. Allerdings sollten es nur Träume bleiben.