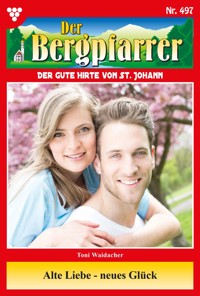Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Bergpfarrer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Mit dem Bergpfarrer hat der bekannte Heimatromanautor Toni Waidacher einen wahrhaft unverwechselbaren Charakter geschaffen. Die Romanserie läuft seit über 10 Jahren, hat sich in ihren Themen stets weiterentwickelt und ist interessant für Jung und Alt! Unter anderem gingen auch mehrere Spielfilme im ZDF mit Millionen Zuschauern daraus hervor. "Grüß Gott, herzlich willkommen in der Pension Stubler. Die Frau Behrens aus München, nehm' ich an?" Ria Stubler schaute die junge Frau lächelnd an. Sie trug Jeans, einen leichten Pulli und bequeme Schuhe. Das dunkle Haar war modisch frisiert. Eine große Reisetasche hatte die Urlauberin neben sich auf den Boden gestellt. "Ja." Sie nickte und reichte der Wirtin die Hand. "Ich bin Claudia Behrens."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Bergpfarrer –78–
Stille Tränen – neues Glück?
Claudias Herz sehnt sich nach Liebe
Roman von Toni Waidacher
»Grüß Gott, herzlich willkommen in der Pension Stubler. Die Frau Behrens aus München, nehm’ ich an?«
Ria Stubler schaute die junge Frau lächelnd an. Sie trug Jeans, einen leichten Pulli und bequeme Schuhe. Das dunkle Haar war modisch frisiert. Eine große Reisetasche hatte die Urlauberin neben sich auf den Boden gestellt.
»Ja.« Sie nickte und reichte der Wirtin die Hand. »Ich bin Claudia Behrens.«
»Schön, daß Sie da sind«, freute sich Ria und nahm den Zimmerschlüssel vom Brett. »Hatten S’ eine gute Fahrt?«
»Ganz wunderbar«, bestätigte Claudia. »Mit dem Zug ist’s ja ein Klacks, und in der Stadt stand auch gleich der Bus hierher am Bahnhof bereit. Auf der Herfahrt konnt’ ich schon ein bissel was von der Gegend sehn. Ich muß sagen – einfach herrlich!«
»Freut mich, daß es Ihnen gefällt. Sie soll’n mal sehn, wenn S’ erst einmal ein paar Tag’ hier sind, dann woll’ns gar net mehr wieder fort.«
Die beiden Frauen waren die Treppe hinaufgegangen, und Ria schloß die Zimmertür auf.
»So, da sind wir«, sagte sie. »Ich hoff’, daß Sie mit dem Zimmer zufrieden sind und daß S’ sich bei mir wohl fühlen werden.«
»Bestimmt«, versicherte Claudia. »Wo doch der Empfang schon so herzlich war.«
Sie schaute sich um. Das Zimmer war zwar einfach, aber doch gemütlich eingerichtet. Ein Bett, Schrank, Tisch und Stuhl, am Fenster ein kleiner Sessel.
»Das Bad ist gleich hier.« Ria Stubler deutete auf die Tür neben dem Kleiderschrank.
Früher hatte es in der Pension nur ein Etagenbad gegeben, das die Gäste sich teilen mußten. Vor ein paar Jahren hatte die Wirtin dann einiges Geld investiert, um die Zimmer zu modernisieren. Die immer größer werdende Nachfrage hatte dazu geführt. St. Johann war ein beliebter Urlaubsort geworden, und die Leute, die hierherkamen, verlangten schon einen gewissen Komfort.
»Es ist sehr schön«, sagte Claudia Behrens.
Ria nickte ihr zu.
»Packen S’ erst einmal in aller Ruh’ aus, und dann kommen S’ nachher zu mir herunter. Ich koch’ uns eine schöne Tasse Kaffee.«
Sie schloß die Tür hinter sich, und Claudia trat an das Fenster. Zum Greifen nahe schienen die Berge auf der anderen Seite des Dorfes, bis zu denen sie schauen konnte.
»Himmelspitz« und »Wintermaid« mußten das sein. Claudia hatte darüber in dem Prospekt gelesen, den sie aus dem Reisebüro mitgenommen hatte. Sie seufzte leise und ließ sich in den Sessel sinken. Das malerische Bild verschwamm vor ihren Augen und dafür sah sie das Gesicht, das sie in den letzten Tagen und Wochen immer wieder verfolgte. Das Gesicht des Mannes, der ihr alles bedeutet hatte, das Paradies auf Erden und die Hölle zugleich.
Ja, ihr Fortgang aus München war eine Flucht gewesen. Das mußte Claudia sich ganz klar eingestehen, auch wenn sie bis gestern abend noch der Meinung gewesen war, Tobias Sonninger bedeute ihr nichts mehr, und sie dies sogar gegenüber Klara, ihrer besten Freundin, geäußert hatte. Jetzt, als sie so mitterseelenallein in dem Pensionszimmer saß, da wünschte sie nichts mehr auf der Welt, als daß Tobias bei ihr wäre und sie in seine Arme nähme. In diese starken Arme, in denen sie immer so viel Liebe und Geborgenheit gefunden hatte.
Jetzt spürte sie die Traurigkeit zurückkehren, und Tränen stiegen in ihr auf. Ihr Körper straffte sich, und Claudia richtete sich auf.
Nein, dachte sie, ich will net mehr weinen. Zu viele Tränen waren schon geflossen. Sie hatte nicht diesen Schnitt gemacht, um Tobias hinterherzuweinen.
Der Urlaub sollte ein erster Schritt sein, die endgültige Trennung zu vollziehen. Er sollte ihr helfen, Abstand zu gewinnen und nicht immer wieder in den alten Fehler zu verfallen, doch wieder nachzugeben, wenn er vor ihr stand und sie mit seinen großen, traurigen Augen anschaute.
Allein dieser Blick war Lüge!
Und doch hatte sie ihm nie wiederstehen können, obwohl Claudia wußte, daß Tobias nur mit ihr spielte, daß all seine Liebesschwüre, ja, selbst seine Küsse falsch waren.
Und gleichzeitig wußte sie, daß sie ihn immer noch liebte, und wieder einmal mußte sie es zulassen, daß Tränen flossen.
Stille Tränen, die besser ungeweint blieben.
Endlich gab sich Claudia Behrens einen Ruck und stand auf. Sie öffnete die Reisetasche und ordnete ihre Kleidungsstücke in den alten, mit Bauernmalerei verzierten Schrank. Dann ging sie in das kleine Bad und ließ sich kaltes Wasser über das Gesicht laufen, bis sie glaubte, daß die Spuren ihrer Tränen verwischt wären. Nachdem sie das Haar geordnet hatte, nickte die junge Frau zufrieden und ging nach unten. Ria Stubler erwartete sie schon.
»Setzen S’ sich«, sagte die Pensionswirtin mit einem freundlichen Lächeln. »Sie schau’n g’rad’ so aus, als könnten S’ einen Kaffee gebrauchen.«
Da hatte sie nicht ganz unrecht, mußte Claudia zugeben. Im Zug hatte es leider keinen Speisewagen gegeben. Auf der relativ kurzen Strecke zwischen München und St. Johann lohnte der sich für die Bahn wohl auch nicht.
Und als sie in der Kreisstadt angekommen war, wartete bereits der Bus ins Alpendorf, so daß keine Zeit geblieben war, dort noch einen Kaffee zu trinken.
Mit einem dankbaren Nicken nahm die junge Frau das heiße Getränk entgegen, und schon der erste Schluck weckte ihre Lebensgeister.
»Stammen S’ aus München?« begann Ria Stubler das Gespräch.
Claudia bejahte. Sie war ein echtes Münchner Kindl, aufgewachsen in einem behüteten Elternhaus. Nach der Schule, das Abitur bestand sie mit einer guten Note, studierte sie Pharmazie. Nach dem Studium arbeitete sie für drei Jahre in einer Apotheke. Während dieser Zeit lernte sie Tobias Sonninger kennen, dessen Vater der Inhaber eines großen pharmazeutischen Unternehmens war.
Die beiden jungen Menschen verliebten sich ineinander, und es dauerte nicht einmal ein halbes Jahr, bis sie schon von Hochzeit sprachen. Allerdings wurde dieses Vorhaben nie realisiert.
Heute wußte Claudia nicht zu sagen, ob sie darüber traurig oder froh sein sollte.
Indes sprach sie jetzt nicht davon, sondern erzählte nur von den Eltern, die in einen kleinen Ort in der Nähe der bayerischen Landeshauptstadt gezogen waren und dort ihren Lebensabend verbrachten. Nur wenig erzählte Claudia von ihrem eigenen Leben, dem Beruf, den Träumen für die Zukunft, ob es eventuell jemanden gab, mit dem sie diese Zukunft teilen wollte.
Ria Stubler besaß allerdings die Gabe, zwischen den Zeilen lesen zu können. Ihr mütterlicher Instinkt sagte ihr, daß da eine junge Frau vor ihr saß, die nicht ganz so glücklich war, wie es auf den ersten Blick schien. Da war etwas in den schönen dunklen Augen, das die Wirtin aufmerksam werden ließ.
Doch vorerst sagte sie nichts weiter zu ihrer Vermutung. Claudia Behrens war ihr sympathisch, und wer über dieses Glück verfügte, der hatte es in der Pension Stubler besonders gut, kam er doch in den Genuß, mehr als nur ein umsorgter Feriengast zu sein. Schon öfter hatte Ria Menschen, für die sie eine besondere Sympathie empfand, zu sich in ihre Privaträume eingeladen, mit ihnen gegessen und geplaudert. Und meistens war es ihnen nicht schwergefallen, Ria ihr Herz auszuschütten. In diesem Punkt ähnelte die Wirtin Sebastian Trenker, der das gleiche Gespür für Menschen besaß, die in Not waren und der Hilfe bedurften. Der gute Hirte von St. Johann und Ria Stubler hatten sich da schon oft ergänzt, und immer war es ihnen gelungen, die Probleme zu lösen und zu einem guten Ende zu führen.
Noch war es allerdings nicht soweit, daß Claudia sich ihr voll und ganz anvertraut hätte. Aber sie war ja auch erst kurze Zeit hier, und Ria war sicher, daß aus der jungen Frau, nach dem Urlaub, ein anderer Mensch geworden war.
*
Die große Villa stand direkt am Ufer des Starnberger Sees. Eine hohe Mauer umgab den weitläufigen Park und versperrte Neugierigen den Blick. Am See lag, am Steg vertäut, ein Segelboot, der Strand war Privatbesitz und durch einen Zaun und Verbotsschilder davor gesichert, daß Unbefugte sich hier niederließen.
Das Haus selbst war riesig im Vergleich zu den Nachbarvillen. Das Dach mit glasierten Pfannen gedeckt, die Mauern weiß, zwei Stockwerke hoch. Überall sah man Bedienstete umhereilen. Ein alter Mann mit einer grünen Schürze bekleidet und einem Filzhut auf dem Kopf harkte den Rasen, zwei Mädchen mit weißen Schürzchen deckten den großen Tisch auf der Terrasse für den Nachmittagskaffee, und ein livrierter Diener beobachtete mit Argusaugen, ob Teller, Tassen und Löffel auch an ihrem richtigen Platz waren. Nachdem er noch einmal selbst Hand angelegt und getan hatte, als müsse er den Standort einer Kaffeetasse korrigieren, nickte er gnädig und wedelte die beiden Hausmädchen mit einer Handbwegung fort.
»Christel, Sie können jetzt den Kaffee und das Gebäck holen«, ordnete er noch an, bevor er sich auf den Weg machte, den Herrschaften zu melden, daß alles für das Kaffeetrinken bereit sei.
Richard Sonninger und seine Frau saßen im Wohnzimmer. Der braungebrannte Pharmaunternehmer hatte sich gerade einen Nachmittagswhisky gegönnt. Seine Frau blätterte derweil in einem Gesellschaftsmagazin, das über die Reichen und Schönen der Welt berichtete. Und es kam nicht selten vor, daß Margret Sonninger auch einen Bericht über die eigene Familie darin fand.
Genauer gesagt über Tobias, ihren einzigen Sohn und Erben, und nicht immer waren die Berichte und Artikel dazu angetan, die Stimmung im Hause Sonninger zu erhellen. Denn meistens waren es negative Schlagzeilen, die der Sohn machte, und immer häufiger gaben sie Anlaß zu Auseinandersetzungen zwischen den Eltern und Tobias.
So trügte denn auch die scheinbare Idylle dieses Sonntagnachmittags. Wenn man es genau nahm, dann war der Hausherr kurz davor zu explodieren.
»Dieser Nichtsnutz«, schimpfte er. »Ich hätt’ net übel Lust, ihn zu enterben!«
Margret Sonninger schaute von ihrer Lektüre auf. Sie zog die Stirn kraus.
»Richard, nicht so laut«, mahnte sie. »Was soll denn das Personal denken?«
Der Pharmaunternehmer kippte den irischen Whisky die Kehle hinunter und schüttelte den Kopf.
»Ach was«, widersprach er. »Die wissen doch ohnehin alles, was mit uns’rem Herrn Sohn los ist. Daß er ein fauler Hund ist, ein Playboy, der das Geld, das ich sauer verdiene, zum Fenster hinauswirft. Wo steckt er überhaupt, der feine Herr?«
Seine Stimme hatte sich vor lauter Erregung immer mehr gesteigert. Beinahe schrill hatte er die letzten Worte ausgestoßen. Seine Frau legte das Magazin beiseite und stand auf.
»Beruhig’ dich«, sagte sie und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Ich find’s ja auch net richtig, was der Junge so treibt. Aber er wird schon wieder zur Besinnung kommen.«
Richard Sonninger schnaubte.
»Der Junge ist ein gestandener Mann von beinahe siebenundzwanzig Jahren, und du nimmst ihn noch in Schutz, anstatt ihn dazu anzuhalten, zu seiner Verantwortung zu stehen. Einer Verantwortung, die er gegenüber uns und der Firma hat.«
Der Vorwurf in seiner Stimme war nicht zu überhören, und Margret Sonninger senkte auch schuldbewußt den Kopf.
Natürlich hatte ihr Mann recht mit dem, was er sagte. Tobias war ein Tunichtgut, der nur Flausen im Kopf hatte und nie schien erwachsen werden zu wollen. Seine Eskapaden waren nicht nur in München Stadtgespräch, und was ihren Mann jetzt so auf die Palme gebracht hatte, verärgerte auch sie über alle Maßen.
Es klopfte, und der Diener trat ein.
»Der Kaffee ist gerichtet«, sagte er.
»Danke, Ludwig.« Die Hausherrin nickte. »Wir kommen gleich. Sagen Sie doch bitte meinem Sohn Bescheid.«
»Sehr wohl«, antwortete Ludwig und deutete eine Verbeugung an.
»Falls er ihn überhaupt wachbekommt«, meinte Richard Sonninger mit einem Anflug von Sarkasmus, nachdem der Diener die Tür wieder hinter sich geschlossen hatte.
Seine Frau seufzte. Wahrscheinlich würde Ludwig tatsächlich Schwierigkeiten haben. Tobias war erst am Vormittag von einer Party am Vorabend nach Hause gekommen und in sein Bett gefallen. Vielleicht war es sogar besser, wenn er noch weiterschliefe…
*
Sie und ihr Mann saßen schon auf der Terrasse, als der Sohn dann endlich erschien. Zwar hatte er schnell geduscht und sich umgezogen, doch die Spuren der Nacht hatten sich in sein Gesicht eingegraben und ließen sich nicht so schnell verwischen.
»Setz dich«, forderte sein Vater ihn auf. »Ich hab’ mit dir zu reden.«
Tobias Sonninger zuckte unter der Stimme zusammen. Sie hatte einen Ton, den er so von seinem Vater nicht gewohnt war. Deshalb gehorchte er widerspruchslos und setzte sich ihm gegenüber.
Ludwig stand bereit, Kaffee einzuschenken. Den Kuchen, Mohnschnecken, Himbeertörtchen und Eclairs sah Tobias eher widerwillig an. Kaffee ja, aber Kuchen ganz bestimmt nicht. Auf der Zunge hatte er einen unangenehmen, pelzigen Geschmack. Am besten wäre jetzt eigentlich eine kräftige Brühe, die ihn wieder aufrichtete. Aber er wagte nicht, danach zu fragen. Nicht, nachdem sein Vater so barsch mit ihm gesprochen hatte.
Der Diener hatte sich entfernt, und die Familie war unter sich. Richard Sonninger fixierte seinen Sohn.
»Was ist das für eine Geschichte mit der Claudia?« fragte er.
Tobias zuckte zusammen. Er war ein attraktiver Mann, dem die Frauen nachliefen, daran änderte auch nichts sein Zustand nach der durchzechten Nacht. Mit einer schnellen Bewegung strich er sich eine Strähne aus der Stirn und griff dann zur Kaffeetasse, an der er sich festhielt.
»Was meinst du für eine Geschichte?« gab er sich unwissend.
»Lüg’ mich net an«, sagte sein Vater. »Ich bin ohnehin schon auf Hundertachtzig. Du hast mit ihr Schluß gemacht, stimmt’s?«
Natürlich hatte Tobias gleich gewußt, worauf die Frage seines Vaters abzielte. Es war ja auch eine zu blöde Angelegenheit!
»Das ist net ganz richtig«, erwiderte er schließlich lahm. »Claudia war’s, die die Beziehung beendet hat.«
»Woran du aber net ganz unschuldig bist«, polterte der Pharmaunternehmer los.
Er richtete sich in seinem Korbstuhl auf, der Zeigefinger seiner rechten Hand schnellte vor.
»Ich sag’ dir jetzt was und ich rat’ dir, gut zuzuhör’n. Du bringst das in Ordnung mit dem Madl. Du weißt, daß deine Mutter und ich die Claudia schätzen. Wir mögen sie, als wär’s unser eig’nes Kind. Von all deinen Freundinnen, die du uns im Laufe der Jahr ins Haus geschleppt hast, war sie die einzige, von der wir sagen können, daß sie eine Frau mit Format ist. Im Grunde ist sie viel zu schade für so einen wie dich.«
Tobias hatte einen Schluck getrunken. Die harten Worte seines Vaters trafen ihn sehr.
»Also, jetzt mach’ aber mal einen Punkt!« begehrte er auf.
Doch Richard Sonninger wischte seinen Einwand mit einer Handbewegung fort.
»Wenn hier jemand etwas zu fordern hat, dann sind wir das, deine Eltern. Du willst eines Tags die Leitung der Firma übernehmen. Kannst du mir vielleicht mal sagen, was du bisher dafür getan hast?«
»Bitte, Richard, werde jetzt nicht ungerecht«, mischte sich seine Frau ein. »Der Junge arbeitet hart genug.«
»Tja«, lachte Tobias’ Vater höhnisch auf. »Als Spesenritter. Was and’res macht er nämlich net, als Spesen, wenn er im Auftrag der Firma unterwegs ist. Doch halt, das hätt’ ich ja fast vergessen – natürlich ist er auch noch damit beschäftigt, jungen Apothekerinnen die Köpfe zu verdreh’n. Wahrlich, ein anstrengender Job, den unserer Herr Sohn da ausübt.«
Tobias hatte es die Sprache verschlagen. Wenn er allerdings geglaubt hatte, die Strafpredigt wäre damit zu Ende, so täuschte er sich. Sein Vater hatte nämlich noch etwas im petto, womit der Sohn überhaupt nicht rechnete.