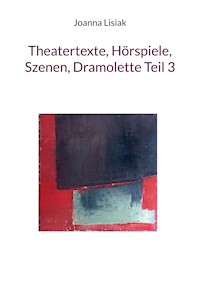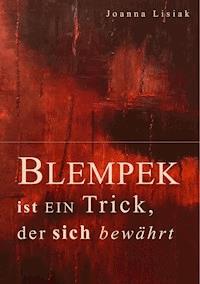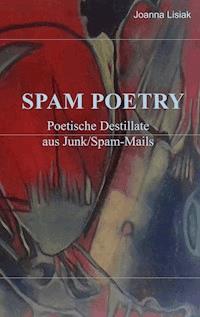Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warum fasziniert uns die menschliche Stimme, insbesondere wenn sie singt? Warum scheint uns eine reife Männerstimme vertrauenswürdig? Wieso räumen wir dem Lampenfieber so viel Raum ein, auch wenn wir selbst nicht betroffen sind? Wie geht man mit Vorbildern um? Wie fühlt es sich an, Kunstwerke zu erschaffen und eine Ausstellung zu planen? Diesen und anderen Themen, die allesamt um die Kreativität kreisen, geht die Autorin Joanna Lisiak in sieben Aufsätzen nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Die Stimme
Lampenfieber
Ein Strich
Des Künstlers Seele
Vorbilder
Der Faden im Kopf
Reife Männerstimmen
Die Stimme
Blicke auf Stimme
Worte für Stimme
Musik
Trocken gesagt eine Sprache eine Win-Win Sache und darüber rentabel: ein Mal komponiert spielbar mannigfach ohne Materialermüdung dazu universell.
Sie ist Freilauf des Gehirns. Auf Hörpromenaden klingende Skulpturen changierend in Form zwirbelnd wellend angelegte Variationen. Mit ihr kann man dem Materiellen das Andere entgegensetzen das größer ist.
Die Formel offen: Wo die Interpretation mehrdeutig wird wird mehrdeutig die Interpretation.
Was ist des Tons Chronologie? Wie lange dauert die Farbe eines Lauts? Wie schmeckt Dur wie Moll ist C vertrauter Freund?
In der Stille wird sie geschaffen. Aus der Stille tönt sie heraus. Die Stille ist in ihrem Klang zugegen.
Jeder hat sie. Sie ist täglich im Gebrauch. Übermittlerin, ein Medium von Sprache, Inhalt. Der, der spricht mit und mittels ihr, er benötigt die Stimme, um die Worte, die Sätze heranzutragen zu dem, der hört, zu dem, der verstehen will. Was gesagt wird, ist vordergründig wichtiger als wie es gesagt wird, wenngleich das Wie auch ungehört wahrgenommen wird. Die Stimme übertrage Emotionen heißt es. Die Stimme gelte als Fenster zur Seele, sagt man. Ist sich der Träger seiner Stimme bewusst - ob, um das Gesagte hervorzuheben oder ob um der Stimme an und für sich Ausdruck zu verleihen - gilt die Stimme als gesteigert. Besonders dann, wenn sich die Stimme mit dem Element Musik verbindet. Im Gefäß der Musik, die, egal welcher Art, in einem Korsett aus Regeln steckt – Rhythmus, Harmonien, Melodielinien, Begleitinstrumenten, der Struktur allgemein -, empfindet man die Stimme als überhöht. Eine Stimme, die in der Musik aufgehoben ist, betritt eine neue Sphäre und knüpft sich ab von der Stelle, die alltäglich, die allgemein gültig ist. Sie wird zu einer besonderen Stimme. Zu einer Stimme, die für alle sprechen kann, einer, die nicht diese Stimme sind und nicht sein können, erst gar nicht jetzt, wo sie doch ihren momentanen und einzigartigen Soloplatz mittig der Musik eingenommen hat. Dort entfaltet sie sich, für sich, für den Träger, den Zuhörer und für die Musik.
G.H., Berlin 2009, Aufnahmestudio, 17.20 Uhr: Erste Mikrophon-Probe. G.H.‘s Stimme wird mittig gesetzt, etwas vorne. Die Band ringsum. Der Hall kommt später hinzu. Vorläufiges Reiseziel erreicht. Das Setting ist da und der Rest beim künftigen Hörer. Er wird den Ort mit seiner Vorstellung anreichern, etwas von sich hineinlegen, wird das eine Ereignis vor Ort zu einem neuen Ereignis, seinem Ereignis machen.
Nicht immer muss die Transformation von Sprech- zur Gesangstimme etwas Göttliches darstellen, was es hierzulande oftmals ja tut. Da ist viel Kult um den Gesang, um den Sänger. Hier die langbeinige Bandfrontfrau mit Löwenmähne. Dort das ausdrucksstarke Starlet am Opern- oder Musicalhimmel. Wir verschwenden keine Zeit, das uns Beeindruckende auf den Sockel der Bewunderung zu heben.
In gewissen Ländern werden die Sprechstimmen und die Gesangstimmen nicht als in zwei verschiedenen Welten stattfindende Phänomene angesehen. Da geht die eine leicht in die andere hinüber. Da werden die Schritte zwischen einem nebenbei gesagten Wort und einer gesungenen Melodie ganz klein gehalten. Hierzulande jedoch, wo man Showbühnen kennt und pflegt, kennen wir das Phänomen nur allzu gut, wo die sprechende Stimme angesichts einer singenden in ihrer Wirkung nachsteht.
Freilich, wer singt, nimmt erstmals einen größeren, meistens auch lauteren, (Klang)Raum ein. Mitunter ist die Gesangsstimme effektvoller, weil die gesungenen Noten in der Regel länger dauern als die im Vergleich relativ kurzen, eher im kleineren Tonumfang stattfindenden Töne der gesprochenen Sätze. Man fällt dem Singenden auch nicht so leicht ins Wort –jedes singende Einklingen würde quasi zu einem Duett -, sondern man lässt den Singenden, was er zu singen hat zu Ende singen, wo demgegenüber das Ausredenlassen in der Praxis nicht immer so gut funktioniert. Und dies ironischerweise, obschon der Sprecher meistens von sich aus etwas sagt, etwas, das ihn direkt betrifft, wo hingegen der Sänger oftmals etwas interpretiert, das ein anderer komponiert, vertextet hat. Er stellt also etwas dar, was zwar aus ihm kommt, aber ihn nicht unbedingt auch darstellt. Der Sänger lebt etwas, das er sein könnte, sein möchte, aber möglicherweise gar nicht ist. Gerade das scheint besonders wertvoll und unantastbar zu sein.
T.T., Barcelona 1996, 20.40 Uhr:
T.T. singt sich ihren Raum frei und befreit bei ihrem Publikum einen gespiegelten. Aber es ist mehr. T.T. hat den Raum, den sie zur Verfügung hat geöffnet und die Zuschauer vor deren Raum in ihren herbeigeführt. Der abgeholte Zuhörer ist äußerst wach. Die Stimme hier, das Ohr dort. Verschiebung der Räume. Teilung der Zeit durch Sinne. Eine Welt entsteht neben der wirklichen, wodurch die wirkliche noch präziser, noch echter erscheint.
Was bei einem Gänsehaut hervorruft, bedeutet für einen anderen ein sanftes Anrühren, ein Innehalten, ein tiefer Atemzug, erzeugt durch etwas Äußeres, wenn auch nicht Fassbares. Es kann ein Aufwirbeln einer Sehnsucht sein, die etwas in ihm wachruft ohne merkliche äußere Anzeichen. Berührt im Innern, unsagbar in Worten, angeknüpft an etwas, das ihm vielleicht abhandengekommen ist. Im Hörerlebnis die Befreiung des Überlagerten und Verschütteten. Und wenn es nur Augenblicke der Illusion sind.
Man spricht von der Tragkraft der Stimme. Je nach Veranlagung, Training und Einsatz trägt die Stimme mal mehr, mal weniger. Wenn sie aber absolut trägt, ist sie in dem Moment imstande unter Umständen alles zu tragen. Und somit Fragen erst gar nicht entstehen zu lassen.
B.D., Los Angeles, 1952, 23.02 Uhr:
B.D.'s Stimme ist klein. Geringer Umfang, tendenziell wenig Durchsetzungskraft, eher unscheinbarer Natur, die einer sparsamen, sorgfältigen Begleitung bedarf. Umso größer der Charakter selbst, welcher sich weder in der Stimmfarbe, noch in artifiziell herbeigeführten Effekten zeigt. Er drückt sich vielmehr dadurch aus, dass B.D. eben mit der Stimme zu singen vermag, die ihr gegeben ist. Ohne jeglichen Zusatz, der kaschiert, beschönigt oder mehr sein will als vorhanden ist. Dies lässt B.D. umso authentischer, von äußeren Erwartungen unbeirrt, wirken. B.D. ist frei, was ihr Stil verleiht.
Der Personenkult um Sängerinnen und Sänger ist gelegentlich derart groß, dass man, abgelenkt durch Visuelles oder die Art, wie die Stimme zum Ausdruck kommt oder wie sie in Szene gesetzt wird, das eigentliche Hören vergisst. Angeregt durch eine immanente Präsenz von Gesangsstimmen und Gesangsmusik fühlt sich so mancher zum Experten berufen, darüber zu urteilen, welcher Sänger, welche Sängerin über eine gute Stimme verfügt und wer nicht. Wobei die Kriterien gelegentlich zu einem einzigen subjektiven Kriterium zusammenklumpen, ohne weitere Differenzierung. Innerhalb weniger Sekunden weiß der Beurteiler offenbar Bescheid: gute Stimme, guter Sänger, respektive umgekehrt.
Fürwahr ist es nicht einzig an den Experten oder an den Musikern über Musik zu urteilen. Denn gerade den Musikern fehlt mitunter jene Distanz, die das durch Musik leidenschaftlich Geweckte übersetzbar macht. Kann sich der Musiker in die Lage versetzen, die tatsächlich vorliegt, wenn Musiker während des Musizierens miteinander im Dialog sind, ist er gut beraten, weder allzu sehr in den Fachjargon zu greifen noch allzu allgemein zu werden. Eine Band, die „die Bude rockt“, ein Sänger, der „mit warmer Stimme das Publikum berührte“, führt zu einem austauschbaren Vokabular, das genauso wenig aussagt wie die Kritik darüber berauschend wirkt, nämlich, ob der vierte Takt zu hektisch in den fünften wechselte und dass die Triole im zweiten Satz zu kapriziös ausfiel. Eine präzise und zugleich leidenschaftliche Beschreibung, die an die Musik heranführt, neugierig macht oder gar bildet, ist eine rare Qualität.
R.K., San Francisco, 1982, 11.00 Uhr:
Überzeugt durch eine hervorragende Diktion. Man hängt an den Lippen dieser Sängerin, ist begeistert zudem von ihrer Leichtigkeit, zwischen den Noten spielerisch mit ihrem Pianisten zu flirten oder vielmehr mit ihm durch die Songs zu flirten, als würden sie gerade etwas tun, das leichter nicht sein kann. Wie ein unbeschwertes, vergnügliches Flanieren durch einen Park.
Musik, respektive die Wahrnehmung von Musik ist eine komplexe Angelegenheit, nicht einfach in Worte zu fassen, da sie auch abstrakt ist. Unzählige Bilder und Metaphern, die sich auftun, nachvollziehbare Analysen, die verlocken aufgezeigt, erläutert zu werden. Dann die Passion selbst, vor der sowohl der Laie als auch der Profi nicht Halt machen kann und die artikuliert werden möchte. Darüber hinaus hört, beziehungsweise fühlt sich dasselbe Musikstück an einem Tag ganz anders an als an einem anderen. Das Gehörte ist von einer zärtlichen Konstitution und daher vielleicht bloß mit Vorsicht in Worte zu zerlegen. Die zum Genuss offen liegenden Stellen können auf verschiedene Weisen entkernt werden. Egal, wie meisterlich am Ende eine Beschreibung präsentiert wird, stets ist sie auch von eigenen Ansprüchen und vom individuellen Geschmack geprägt.
F.M., Dublin, 1999, 11.08 Uhr:
F.M. hat sich entwickelt. Wurde von Auftritt zu Auftritt professioneller, selbstsicherer. Studioalbum nach Studioalbum. Der ehemals rohe Diamant wurde geschliffen und überschliffen. Denn obschon F.M. technisch besser wurde, mehr stimmliche Möglichkeiten demonstrieren konnte, ist etwas Unperfektes verloren gegangen, das in den früheren Aufnahmen charmant war und nun fehlt. Die Fragilität war einst eine Brücke von einer besonderen Qualität, über die der Zuhörer gerne ging.
Von einem selbst hängt es auch ab, ob man es lieber der Umgebung überlässt Einfluss auf einen zu nehmen oder ob man sich seine eigenen Vorstellungen selbst erarbeiten möchte. Wobei die Vorstellungen anfangs nur vage sein können. Geschmacksbildung ist ein Prozess, der allemal empfohlen ist. Nicht, um am vermeintlichen Ende einzig gut von schlecht unterscheiden zu können, sondern, um sich der musikalischen und sängerischen Vielfalt zu vergegenwärtigen. Es geht mehr um die Reise, denn als um das zu erreichende Ziel. Denn auf dem Weg zur Unterscheidung und zur angeblichen Übersicht, begegnen einem Unmengen an Darstellern und Interpreten. Wer sich am Anfang seiner Reise befindet, sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht, selbst wenn er sich nur auf die menschliche Stimme, ein bestimmtes Genre, eine kurze Zeitepoche oder ein Land konzentriert. Wer in die Tiefe geht, dem ist noch mehr Tiefe sicher.
C.R., Dallas, 1963, 19.00 Uhr:
Die kräftige Stimme ist das eine. Beeindruckend ist, dass C.R. bei jedem Song eine Geschichte erzählt als wäre es die eigens hautnah erlebte. Jeder Seufzer, jeder Glücksmoment sind somit Einladungen, mitzuleiden, sich mitzufreuen und mehr: man geht in die eigene Vita, erinnert sich, erlebt erneut, hofft. Man hört gebannt zu. Und jede Wiederholung, die Wort für Wort dasselbe aussagt, verweist auf die Nuancen und Facetten, die subtiler nicht vorgetragen werden können. Selbst zwischen den Noten oder innerhalb eines einzigen Wortes sind Abstufungen anzutreffen, die sanft elektrisieren. Nicht selten sind sie befreiend, da von selbstironischer Selbstreflexion. Wir folgen C.R.’s Spur, lösen uns in der Spur auf und kommen bei uns an.
Es gibt keinen diesen einen Wald, so wie es diesen einen Weg nicht geben kann. Wer aufbricht, weiß anfangs nicht, ob er sich im Zick Zack durch dornige Büsche irren wird, ob er von Lichtung zu Lichtung geführt wird oder ob er dem Waldrand entlang schleicht. Überall Irrwege, Umwege, Verwässerungen und Ablenkungen inmitten einer angenehmen Form von Einsamkeit.
K.E., Paris, 2001, 22.45 Uhr:
K.E. bietet viel. Die Band geht mit, das Publikum ist bestens eingebunden. Die Liebe für die Musik ist spürbar, gleichwohl ist etwas von K.E.'s Haltung ebenfalls deutlich wahrnehmbar, das viel Platz und Energie einnimmt und womöglich auf Kosten von etwas anderem geht: K.E. hört sich gut zu. Bisweilen hat es den Eindruck, sie suhle sich im eigenen Sound. K.E. liebt die eigene Stimme offensichtlich sehr. Erstaunlich ist, wie viel Raum diese Liebe einnimmt und wie K.E. es schafft diesen Raum Wort für Wort, Strophe für Strophe für sich herauszuschälen bis zur Hörbarkeit. Mit ihren Gesten entfacht K.E. ein Feuer, das nicht lodert. Es besteht aus Kohlestücken, die nach und nach verglühen.
Wo beginnen? Man beginnt chronologisch. Oder beim Bekanntheitsgrad. Man geht über die scharf Kritisierten oder die Verkannten. Man wählt die Literatur zum Einstieg. Oder man nimmt Querverweise. Man geht Anregungen und Nebenbemerkungen nach. Man fängt irgendwo mittig an, von wo die Wege in alle Richtungen möglich sind, auch in die falschen. Oder man nimmt sich die Nebenfiguren vor, um sich so an die Hauptfiguren heranzutasten.
Sich dabei vom eigenen Geschmack leiten zu lassen, ist nicht verkehrt. Doch inwiefern ist dieser Geschmack die Vorliebe unseres Umfelds, geprägt von der uns umgebenden Kultur? Sich dabei nicht in die Irre führen zu lassen, ist nicht minder schwierig, als sich die eigene Neugierde zu bewahren und ihr nachzugehen. Die Neugier ist eine Verwandte der Lust, und Lust ist auf der Erkundungsreise ein wichtiger Antrieb. Vor allem, wenn sich die geglaubten Neigungen als Irrungen herausstellen und Korrekturen bedürfen.
D.F., Malibu, 1995, 23.20 Uhr:
Keine schöne Stimme, vielleicht sogar eine hässliche Stimme: näselnd, manchmal sprechend, kratzend, knarrend, röchelnd und flach. Faszinierend geschmeidig jedoch bettet sich diese Stimme in die Musik. D.F. begleitet sich selbst, unterstreicht das Knarzende, bahnt sich den Weg durch die folgenden Akkorde. Das Timing der Pausen, die sich als leicht betonte Höhepunkte herausstellen, ist bemerkenswert unaufdringlich. Es ist das fließende Gesamtpaket, das einen einnimmt, vom ersten gesungenen und angespielten Ton an. D.F. knurrt wie ein Tier, trifft den einen oder anderen Ton wie zufällig. Stimmumfang klein, Stimmfarbe nicht unbedingt angenehm. Manchmal ist die Stimme fast sprechend, bricht ab. Schurke oder Meister? Das Lied ist jedenfalls da. Was anderes sollte D.F. also tun, als es zu singen? Und weil D.F. ist, der sich um nichts schert als um den Moment, darf das Stück entsprechend charakteristisch ausfallen.
Vielleicht zieht sich durch die Phase der Erkundung etwas durch wie ein ausgeleiertes T-Shirt, das uns begleitet und das wir nicht wegwerfen können, obschon alles darauf hindeutet, sich ihm zu entledigen, es endlich hinter uns zu lassen, darüber zu stehen, weiter zu ziehen. Oder aber wir ändern die Ansichten auf dieser Reise komplett und krempeln alles mehrfach um, so, als würden wir selber in einem Waschgang durchgeschleudert. Diese Exkursion mit und für sich zu tun, heißt, die einzelnen Hörerlebnisse zu Ereignissen werden zu lassen. Ereignisse, die sich an persönliche Erfahrungen anknüpfen lassen. Diese Ereignisse stehen zeitlich voneinander entfernt, sind in der jeweiligen Zeit und im jeweiligen Raum eingefangen und sind somit einmalig.
A.D., Athen 1973, 23.45 Uhr:
Die Töne nie wirklich rein, immer ein wenig kantig, von unten angeschlagen, just an der Grenze zu etwas, das erwartungsvoll macht. Der Hinweis zählt und die meisterliche Art auf diese Weise den Song zu einer Skulptur zu meißeln. Kokett ohne aufgesetztes Gebaren. Sexy durch den Mut daneben zu hauen oder sexy dadurch, diesen Mut zuzulassen.
Es gibt Vorlieben für bestimmte Stimmfrequenzen. Ob sie im Verhältnis zur eigenen Stimme stehen oder Erfahrungswerte sind, die von unserer Kindheit herrühren oder anders geprägt sind, bleibt Spekulation. Auf alle Fälle vermögen jene Stimmfrequenzen, die wir besonders mögen etwas in uns anzuschlagen, das uns glücklich macht. Diese Vorliebe hat etwas Hartnäckiges wie Faszinierendes. Vielleicht ist diese Vorliebe ein Ankerpunkt oder ein Kompass, der unsere Urteilskraft überhaupt in Bewegung setzen kann.
E.C., Mailand, 1970, 19.18 Uhr:
E.C. ist eine minimalistische Sängerin in dem Sinne, da sie die Stücke einzeln zu nehmen scheint und sie behutsam für den Zuhörer präsentiert, als wäre es das Kostbarste auf der Welt oder zumindest in dem Moment, wo E.C. singt. Sie hat ein beispielloses Gespür für besondere, aussagekräftige Stellen innerhalb eines Stückes und sie nähert sich ihnen behutsam und mit größter Sorgfalt an, aber auch mit Sicherheit. Sie präsentiert dem Zuhörer die Stellen mit Stolz, führt sie aber nicht vor, demonstriert nie, sondern schließt ihren Schatz und diesen offen gelegten Kern, den sie mit dem Zuhörer teilt, nach dem kurzen Moment der Offenbarung gleich wieder, weil er kostbar ist.
Die Unmengen an Hörerlebnissen zu bewerten, zu ordnen nach Merkmalen, nach vorgegebenen oder sich herauskristallisierenden Kriterien, benötigen logischerweise nicht wenig Zeitraum. Man wird der Musik nicht gerecht, wenn wir nur taktweise Schubert hören oder einzig Zeit für die Musik übrighaben, wenn wir dabei noch lesen oder andere Dinge verrichten.
Vielleicht kann sich jemand der Faszination für eine bestimmte Stimme von Anfang an nicht entziehen. Ein anderer kommt möglicherweise auf eine Stimme als Qualität zurück, wenn er fünfzig andere Stimmen gehört hat.
Die Musik in einen musikalischen Kontext zu stellen, ist eine einfache Methode, um geordnet vorzugehen. Auch die einzelnen Interpretationen desselben Stücks zu vergleichen, ist ergiebig. Wichtiger aber ist es, die Hörschule als spielerisches, persönliches Experiment zu betrachten, bei dem die Musik selbst niemals verlieren darf, in dem Sinne nicht, dass man ihrer nie überdrüssig werden sollte. Diese Experimentierräume können nächtliche einsame Stunden sein mit einem Glas Wein, Kopfhörer auf den Ohren, oder aber Live-Konzerte, die mit anderen geteilt werden. In thematische Radiosendungen reinzuhören, lohnt sich. Ebenso legitim ist es, beim Plattenverkäufer nach Lust und Laune quer durch die Empfehlungen des Verkäufers, oder durch eine intuitive Wahl der LP/CD Covers in die Alben reinzuhören. Es gibt keinen richtigen Weg, aber es ist gut, ihn zu suchen und zu gehen.
A.J., 2011, Genf, 22:43 Uhr:
Der Ansatz klar und frei von Pathos. A.J. singt äußerst werktreu. Jede Note ist am richtigen Ort. Man merkt ihr die Ernsthaftigkeit, die Überzeugung, mit welcher sie eine Linie ansetzt, an. Diese korrekte Art könnte zur These verleiten, dass A.J. brav klingt, doch stattdessen ist ihr Gesang innig. Die Nuancen, die sie individuell einflicht, sind derart klein, dass sie kaum hörbar, sondern nur zart fühlbar sind. So klingt jede Strophe just bloß wenig, nur subtil anders als die andere, und trotzdem bleibt man als Zuhörer mit Spannung dabei. A.J. singt wie ein japanischer Kalligraph zeichnet: akkurater Strich, schwarze Tusche auf handgeschöpftem Papier. Wenige Striche, keine unnötige Gefühlsregung und ein einziger Durchgang.
Jemand singt. Moduliert Schall, macht Töne, bringt sie zum Klingen und der, der zuhört, ist fasziniert. Zum einen die Person vor ihm, zum anderen die Verschiebung von Wirklichkeiten. Eben noch war die Person eine sprechende Gleichgesinnte; eine, zwei, drei Noten weiter und schon ist sie dabei davon zu fliegen. In eine Sphäre, die sie fortträgt und umso eine intensivere zu sein scheint als die, die soeben war. Doch ebenso richtig ist, dass diese Sphäre genauso da ist, im Jetzt, transformiert durch den Gesang. Sie erhebt sich im Klang über das Unmittelbare hinaus. Dazu das Verbindende. Oder vielmehr ein neuer Wunsch im Raum entfacht, verbunden zu werden. Man ist ganz Ohr, dem Klangraum zugetan. Man vergisst sich selbst. Diese Selbstvergessenheit fühlt sich gut an.
O.R., Turin, 1998, 15.20 Uhr:
Durch die Kopfhörer hindurch gelangt O.R. direkt in dein Wesen hinein. Takt für Takt schleicht sie sich durch die verschiedenen Kanäle, die nicht filtern können ob all der Nähe, ja ob all der hyperrealen Intimität.
Die angenehm rauchige Stimme ist wie ein Schlüssel, mit dem sie deinen Gehörgang öffnet, sich Räume in dir schafft bis zum Bauch, bis zu deinem Rücken, deinen Zehen und Haarspitzen. Angenehm nah singt die Stimme wie allerlei Geheimnisse ins Mikrofon, zuweilen fast geflüstert. Der Atemhauch, das Ansetzen einer neuen Linie spürbar wie ein leichter Wind. Brillante Aufnahme, die keine Fragen aufwirft. O.R. erreicht dich wie jemand, der es versteht, dich mit großer Eleganz zu ködern.
Der Weg der Geschmacksbildung vermag bestenfalls unentwegt zu verführen. Eine Ideologie jedoch, die über längere Zeit nicht aufrechterhalten werden kann. Der Anker wird sich gelegentlich vom Boden lösen, Wegweiser auf falsche Fährten führen. Eine Reise eben, die an einem Punkt beginnt und zu einem anderen Punkt führt. Bis all die Muster, die wiederkehrenden Merkmale, die ästhetischen Herausforderungen erkennbar werden, braucht es Zeit, mitunter, weil es Wege gibt, die nicht auf der Karte zu finden sind, ergo mögliche Umwege sind. Die Anzahl an Hörerlebnissen, die notwendig ist, um zu kategorisieren, auszusortieren, mit adäquatem Vokabular zu versehen, kurzum, um differenziert zu bewerten, ist nicht an einer Zahl festzumachen. Sie kann von Wenigen, Dutzenden bis zu Hunderten reichen oder einen das ganze Leben lang in unabgeschlossener Form begleiten.
L.L., Brügge 1948, 19.10 Uhr:
Wie nur schafft es L.L. sofort da zu sein. Ehe man das Glas auf den Tisch stellt, ist L.L. mittendrin, nach nur zwei Taktsekunden mittendrin. Und was in dieser Unmittelbarkeit auch möglich ist: sie nimmt dich mit. Ohne zu fragen, beziehungsweise, weil du da bist. L.L. ist im Stück, das sie singt zugegen. Sie besingt es nicht, sie beherrscht es. L.L. vertraut dabei auf ihr Können und auf ihre Präsenz. Wie aus dem Epizentrum der Komposition singt sie, was zu singen das Stück abverlangt, ohne je zu schreien, ohne sich hervorzutun und ohne die verführerischen Mittel des Sounds. Sie ist mittig positioniert, was L.L. erlaubt, ganz locker, ohne Attitüde ihr Ding zu machen. Sie ist hier, gerade jetzt, am einzigen richtigen Ort. Wie im Auge des Orkans steht und singt sie, während die Musik um sie kreist wie die Planeten um die Sonne kreisen.
Es gibt den Ratschlag nicht. Es gibt den einen, den möglichst gut asphaltierten Pfad, der effektiv zu sein vorgibt, nicht.
Streckenweise hilft jemand einen Wegweiser aufzustellen oder als Begleitung zur Verfügung stehen, weil er vermeintlich dieselben Interessen teilt. Vermeintlich deswegen, weil es keine genau gleichen Interessen geben kann. Sie werden nach und nach geweckt und sind an gewissen Punkten immer auch rein subjektiv geprägt. Wer erfahren will, muss daher wirklich erfahren. Mit dem, was er zur Verfügung hat, dem einen und einzigen Leben nämlich. Die Erfahrung findet innerlich statt. Auch wenn man sich gerne selbst darin täuscht und meint, - da man schließlich über diese Erfahrung mit Gleichgesinnten sprechen kann – dass diese Erfahrung im Miteinander geschieht. Es ist nicht schwer zu glauben, dass es das gemeinsame Eine gibt, wenn man schließlich gemeinsam Musik erleben kann. Die Sprache vermag nicht in Worte und somit nicht in andere Werte zu hüllen, was vorher andernorts erfahrbar war. Wir können nicht aus unserer Haut heraus, schaffen es nicht wirklich aus unserem Denken und Fühlen herauszutreten. Es ist folglich eine innere Reise, die man macht und die sich bezahlt machen kann, wenn man sich aufrichtig auf den Weg begibt.
J.N., Berlin, 1984, 14.35 Uhr:
Unprätentiös, schlicht, reichend bis zur Rohheit. Die Ästhetik des Lieblichen wird für das Pure geopfert. Wobei man nichts vermisst in dem Sinne, dass etwas fehlen könnte. Jegliche Eitelkeit wird im Dialog mit den Musikern erstickt. Der Dialog und die dort stattfindende Sprache ist das Wichtigste. Das Instrument ist dem anderen Instrument gleichgestellt, selbst die Komposition errichtet sich nicht wie ein Monument vor einem, sondern geht in diesem Dialog, der hin und hergeht, unter, verbindet sich zu den Bausteinen und Elementen, ohne, dass man als Zuhörer merkt wie nach und nach etwas erschaffen wird. Etwas, das man später nicht sehen wird, denn es ist nur, wenn J.N. mit den Mitmusikern kraft ihrer Gesangsstimme spricht.
Bis man weiß, welche Musik man für sich als eine musikalische Perle definiert hat oder meint zu ahnen, welche Muschel eine Perle beherbergt und welches vordergründig schimmernde Muschelgehäuse trotz Glanz für immer geschlossen bleibt, benötigt nicht nur der Auslesezeit. Das Ohr zu schulen, indem man sich einen Wortschatz aufbaut, der einen befähigt zu kategorisieren, was man hört, empfiehlt sich nicht nur deswegen, weil man fachkundig, urteilssicher Fakten benennen kann, sondern weil die Möglichkeit das Gehörte einzuteilen einem erlaubt systematisch vorzugehen. Ein System grenzt ein, macht die Unterscheidung deutlich. Es lässt die Lücken zwischen dem einen und dem anderen immer kleiner werden und somit die einzelnen Nuancierungen immer größer.
A.P., Casablanca, 1967, 22:30 Uhr:
A.P. singt viele Noten. Nicht nur die, die zu singen sind, sondern singt sie auch jene, die zu den notierten Tönen hinleiten und solche, die von ihnen wegfädeln. Nach einer halben Stunde Zuhören stellt man fest, es sind zu viele Töne. Sie sind richtig, aber nicht notwendig, da musikalisch nicht von einem Mehrwert. Später merkt man, A.P. beruft sich auf ein paar bewährte Tonfolgen, die, einst identifiziert, sie vorausschaubar beziehungsweise voraushörbar werden lassen. Viele Noten, viel Gesang und zu wenig Musik. Ein unentwegtes, nervös machendes Sprudeln und Schäumen lauwarmen Wassers, das nie zur Mündung gelangt.
Ob das Ohr von Anbeginn ganz leer ist und offen für alles oder ob in ihm bereits Vorlieben angelegt sind, nur schon dadurch wie wir denken, wo wir aufwachsen, in welchem Verhältnis wir zu unserer Umwelt stehen, in dem zur Stimme unserer Mutter, unseres Vaters, der Vorbilder, die wir uns aussuchen, ist unklar. Durch Lust, Wille, Geduld, Arbeit, Intelligenz und nicht zu vergessen – vielleicht am wichtigsten -, den Geschmack selbst, welcher wiederum an die oben genannten Attribute stark angeknüpft ist, kristallisiert sich nach und nach die eigene Hörschule.
S.P., Rom, 2000, 19.36 Uhr:
S.P. ist in die Stücke, die er singt, enorm vertieft. Er erobert mit jeder angesetzten Zeile um das Vielfache von vorher. S.P. erobert sich die Stücke, eines nach dem anderen. Temporäre Lieblingsstücke, die gefeiert werden, weil sie da sind. Wir dürfen S.P. dabei entzückt zusehen. S.P. ist ein Taucher. Er holt Muscheln, Korallen, Seesterne aus der Tiefe und macht nicht mehr, als die glänzenden Stücke ins Sonnenlicht zu halten.